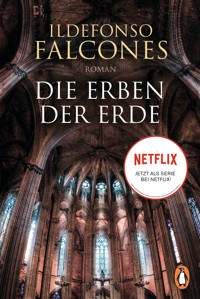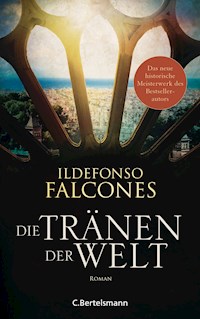
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. Bertelsmann Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein neues Zeitalter – eine Welt voller Möglichkeiten
Barcelona, 1901. Während soziale Unruhen die Stadt in Aufruhr versetzen, führt der ehrgeizige Maler Dalmau Sala ein Leben zwischen zwei Welten. Tagsüber gestaltet er Kacheln in einer Keramikfabrik und versucht in den elitären Kreisen seines Arbeitgebers seine Kunst zu verkaufen. Nach Feierabend kämpft Dalmau gemeinsam mit Emma, seiner großen Liebe, für die Rechte der Arbeiterklasse. Doch als ein tragisches Unglück geschieht, zerbricht ihre Beziehung. Jeder seiner Versuche, sie zurückzugewinnen, scheitert – bis Emma festgenommen wird. Als die Protestaktionen der Republikaner immer stärker ausarten, muss Dalmau um ihrer beider Leben fürchten und sich entscheiden: Wählt er die Flucht ins Ungewisse oder den Kampf für seine Ideale und für die Liebe?
Meisterhaft, packend und unterhaltsam porträtiert der Autor des Weltbestsellers »Die Kathedrale des Meeres« die aufstrebende Metropole Barcelona zu Beginn des 20. Jahrhunderts.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1000
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Ildefonso Falcones de Sierra lebt als Anwalt und Autor in Barcelona. Sein Debütroman Die Kathedrale des Meeres war ein überwältigender internationaler Erfolg. Mit weltweit mehr als zehn Millionen verkauften Büchern hat sich Falcones als der bestverkaufte spanische Autor historischer Romane verewigt. In seinem Roman Die Tränen der Welt widmet er sich erstmals dem zwanzigsten Jahrhundert und der Ankunft der Moderne in seiner Heimatstadt Barcelona.
Ildefonso Falcones’ Romane in der Presse:
»Falcones’ Erzählungen besitzen eine unwiderstehliche Anziehungskraft. Vergnügen und Geschichtsstunde zur gleichen Zeit. Der Roman entfaltet seine Faszination mit all seiner Macht.«
ABC Cultural España über Die Tränen der Welt
»So packend und detailreich, dass man nicht aufhören kann zu lesen.«
freundin über Die Erben der Erde
»Ein großer, mächtiger, gewaltiger historischer Roman! Leidenschaftlich erzählt, voll Leid, Wärme und Kraft.«
Bild am Sonntag über Die Kathedrale des Meeres
»Ein farbiges Historienpanorama.«
FAZ über Die Kathedrale des Meeres
ILDEFONSO
FALCONES
HISTORISCHERROMAN
AUSDEMSPANISCHEN
VONLAURAHABER
C. BERTELSMANN
Die Originalausgabe erschien 2019
unter dem Titel El pintor de almas
bei Grijalbo, Barcelona.
Die Übersetzung ins Deutsche wurde gefördert von
www.accioncultural.es
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten,so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung,da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglichauf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2019 by Ildefonso Falcones de Sierra
Copyright © 2021 der deutschsprachigen Ausgabe by C. Bertelsmann
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Umschlag: bürosüd GmbH
Umschlagmotiv: © mauritius images/age fotostock/Lucas Vallecillos;
© mauritius images/Zoonar GmbH/Alamy; © akg-images/arkiv
Redaktion: Anja Rüdiger
Satz: Leingärtner, Nabburg
ISBN 978-3-641-26636-3V002
www.cbertelsmann.de
ERSTER TEIL
1
Barcelona, Mai 1901
Die Rufe Hunderter Frauen und Kinder hallten in den Gassen der Altstadt wider. »Streik!« »Schließt die Tore!« »Haltet die Maschinen an!« Die Streikposten der Frauen, viele mit kleinen Kindern auf den Armen oder an der Hand, zogen durch die Straßen und forderten Arbeiter und Verkäufer, deren Werkstätten, Fabriken und Geschäfte noch geöffnet waren, dazu auf, umgehend ihre Tätigkeit einzustellen. Ihre erhobenen Stöcke und Stangen überzeugten die meisten, obwohl so manches Schaufenster zu Bruch ging und hier und dort heftige Worte gewechselt wurden.
»Das sind doch Frauen!«, rief ein alter Mann von seinem Balkon im ersten Stock herunter, genau über dem Kopf eines aufgebrachten Ladenbesitzers, der zwei von ihnen gegenüberstand.
»Anselmo, ich …« Der Ladenbesitzer sah nach oben.
Seine Entschuldigung wurde übertönt von den Beschimpfungen und Buhrufen etlicher Beobachter der Szene auf den weiteren Balkonen der alten, dicht zusammengedrängten Gebäude – Wohnhäuser von Arbeitern und einfachen Leuten, mit Rissen in der Fassade, Stellen, an denen der Putz bröckelte, und Feuchtigkeitsflecken. Der Mann kniff die Lippen zusammen und schloss kopfschüttelnd sein Geschäft ab, während ein paar zerlumpte, schmutzige Kinder den Sieg ausriefen und sich über ihn lustig machten. Einige Zuschauer grinsten ungeniert über die Späße der frühreifen Streikenden. Der Ladenbesitzer war nicht beliebt im Viertel. Er fertigte und verkaufte Espadrilles. Aber er ließ nicht anschreiben. Er lächelte nicht und grüßte auch nicht.
Die Kinder hielten mit ihren Spottrufen nicht inne, bis die Guardia Civil, die den Frauenstreikposten folgte, sie beinahe eingeholt hatte. Erst da rannten sie dem Menschenhaufen hinterher und marschierten weiter mit ihm durch Barcelonas mittelalterliche Gassen, ein ebenso gewundenes wie dunkles Straßengeflecht, in dem es kein Lichtstrahl der herrlichen Maisonne von den höchsten Stockwerken der sich übers Straßenpflaster erhebenden Gebäude nach unten schaffte. Die Anwohner auf den Balkonen verstummten, als die Polizisten vorbeizogen, einige zu Pferde, die Säbel in der Scheide, die meisten angespannt und mit verkrampften Gesichtern. Die einen wie die anderen waren sich des Konflikts dieser Männer bewusst: Ihre Pflicht verlangte es, die illegalen Streikposten aufzuhalten, aber sie waren nicht bereit, Frauen und Kinder anzugreifen.
In Barcelona war die Geschichte der Arbeiterrevolution eng mit den Frauen und ihren Kindern verknüpft. Oft mahnten sie ihre Männer, sich von den gewalttätigen Aktionen fernzuhalten. »Bei uns trauen sie sich nicht, und wir sind genug, um den Stillstand durchzusetzen«, argumentierten sie. Und so war es auch in diesem Mai des Jahres 1901, als die Arbeiter auf die Straße gingen, nachdem die Straßenbahngesellschaft ihre streikenden Arbeitskräfte entlassen und statt ihnen Streikbrecher eingestellt hatte.
Der Generalstreik, den die Arbeiterorganisationen zur Verteidigung der Straßenbahner anstrebten, ließ sich jedoch nicht durchsetzen, und trotz einiger Gewaltausbrüche schien die Guardia Civil die Situation in der Stadt unter Kontrolle zu haben.
Plötzlich brach ein Geschrei unter den Hunderten Frauen los. Die Nachricht von einer die Rambla entlangfahrenden Straßenbahn hatte sich verbreitet. Beleidigungen und Drohrufe wurden laut. »Streikbrecher!« »Hurensöhne!« »Auf sie!«
Die Streikenden hasteten, manche rannten beinahe, durch die Carrer de la Portaferrissa zur Rambla de les Flors, oberhalb der Markthalle La Boqueria. Die traditionellen Blumenstände, Konstruktionen aus verschweißten Eisenteilen, die beidseitig die Rambla de les Flors säumten, waren geschlossen, wenngleich die Blumenverkäuferinnen, viele herausfordernd mit in die Hüften gestemmten Armen, davorstanden, bereit, ihre Geschäfte zu verteidigen. In Barcelona wurden Blumen nur auf diesem Teil der Ramblas verkauft. Am Mercado de la Boqueria warteten unzählige aufgehaltene Fuhrwerke mit ihren Pferden nur wenige Schritte von den Straßenbahngleisen entfernt. Die Tiere reagierten nervös auf das Geschrei und die Menge an Frauen. Doch kaum eine schenkte dem Durcheinander sich aufbäumender Pferde und umhereilender Laufburschen und Standbetreiber ihre Aufmerksamkeit. Die Straßenbahn der Linie Barcelona-Gràcia, die an der Rambla de Santa Mónica, nahe dem Hafen, losfuhr, rollte heran.
Dalmau Sala war den Streikposten zusammen mit vielen anderen Männern schweigend hinter der Guardia Civil durch die Altstadt gefolgt. Jetzt hatte er im offeneren Bereich der Rambla eine bessere Sicht auf das Geschehen. Es herrschte völliges Chaos. Pferde, Fuhrwerke und Standbetreiber. Herbeieilende, schaulustige Stadtbewohner. Sich formierende Polizisten gegenüber den Frauen mit ihren Kindern, die sich verteilt und eine menschliche Schranke gebildet hatten, um all die anderen abzuschirmen, die als Block auf den Gleisen standen, um die Straßenbahn aufzuhalten.
Dalmau schauderte, als einige Frauen ihre kleinen Kinder hochhoben und der Guardia Civil entgegenstreckten. Andere, etwas ältere Kinder klammerten sich erschrocken an die Rockzipfel ihrer Mütter, während die Jugendlichen, angestachelt durch die Atmosphäre, die Polizisten reizten.
Es war nicht lange her, vier oder fünf Jahre, da hatte sich Dalmau gegenüber den Polizisten genauso unverschämt verhalten. Seine Mutter hatte hinter ihm nach Gerechtigkeit und sozialen Verbesserungen geschrien, ihn wie die meisten Mütter zum Kampf ermutigt.
Für einen Augenblick lösten die Rufe der Frauen ein ähnliches Rauschgefühl in Dalmau aus wie damals, als er sich selbst vor die Polizei gestellt hatte. Wie Götter hatten sie sich gefühlt. Sie kämpften für die Arbeiter! Manchmal war die Guardia Civil oder die Armee auf sie losgegangen, aber heute würde es nicht dazu kommen, sagte sich Dalmau mit Blick auf die Streikenden, die sich der Straßenbahn entgegenstellten. Nein. Dieser Tag war nicht dazu bestimmt, dass die Kräfte der öffentlichen Sicherheit die Frauen angriffen. Das ahnte, das wusste er.
Dalmau entdeckte sie schnell. In der vordersten Reihe, vor allen anderen, forderten sie mit dem Blick die heranrollende Straßenbahn nach Gràcia heraus. Dalmau lächelte. Montserrat und Emma, seine kleine Schwester und seine Freundin, waren unzertrennlich, vereint im Unglück, vereint im Arbeiterkampf. Die Straßenbahn näherte sich mit Glockengebimmel. Die Sonne, die zwischen den Baumkronen der Rambla hindurchschien, ließ die Räder und anderen Metallteile am Waggon aufblitzen. Manche Frauen wichen zurück, aber sehr wenige. Dalmau richtete sich auf. Er hatte keine Angst um sie, die Bahn würde anhalten. Die Mütter und die Polizisten verstummten gespannt. Viele Schaulustige hielten den Atem an. Die Frauengruppe auf den Gleisen schien über sich hinauszuwachsen, stramm, stur, bereit, überrollt zu werden.
Die Bahn stoppte.
Die Frauen brachen in Jubelgeschrei aus, während die wenigen Passagiere, die es gewagt hatten, die Straßenbahn zu benutzen, und auf dem offenen Deck des Waggons in der Sonne Platz genommen hatten, strauchelnd abstiegen, um hinter dem Fahrer und den Schaffnern das Weite zu suchen.
Dalmau beobachtete Emma und Montserrat. Beide reckten die geballte Faust zum Himmel, lachten und feierten mit ihren Kameradinnen überschwänglich den Sieg. Kaum eine Minute später begannen die Hunderten Frauen, sich gegen die Straßenbahn zu stemmen. »Los!« »Stoßt sie um!« Die Guardia Civil wollte eingreifen, doch die Kinder fielen über sie her. Etliche Hände drückten gegen die Seitenwand des Waggons. Viele weitere, die nicht bis dorthin reichten, drückten gegen die Rücken der vorderen Streikenden.
»Schiebt!«, schrien mehrere Frauen gleichzeitig.
»Fester!«
Die Straßenbahn auf ihren eisernen Rädern wankte.
»Fester! Fester, fester!«
Eins, zwei … Der Waggon wankte zunehmend im Rhythmus der gegenseitigen Anfeuerungen. Endlich nahm ein Brüllen aus den Hunderten Kehlen seinen Sturz vorweg. Der Lärm vermischte sich mit dem Splitterregen, den gegeneinanderschlagenden Metallteilen und einer Staubwolke, die Straßenbahn und Frauen einhüllte.
Ein Geheul brach die relative Stille nach dem Aufprall des Waggons auf der Erde.
»Gesundheit und Revolution!«
»Es lebe die Anarchie!«
»Generalstreik!«
»Tod den Mönchen!«
Mehr Arbeit und bessere Löhne. Kürzung der auszehrenden Arbeitszeiten. Abschaffung der Kinderarbeit. Schluss mit der Macht der Kirche. Mehr Sicherheit. Angemessene Wohnverhältnisse. Vertreibung der Geistlichen. Gesundheitsfürsorge. Weltliche Schulbildung. Bezahlbare Lebensmittel. Unzählige Forderungen ertönten auf der Rambla de les Flors von Barcelona, bestärkt von einer Menge einfacher Menschen, die immer zahlreicher zusammenströmten und den Arbeiterfrauen begeistert Beifall klatschten.
Verschwitzt, mit schmutzigen, dunkel verfärbten Gesichtern vom aufgewirbelten Staub, sprangen Emma und Montserrat aufgeregt auf der Seitenwand des Waggons herum, feuerten ihre Kameradinnen an und streckten die Arme zum Himmel.
Dalmau bekam eine Gänsehaut beim Anblick der beiden jungen Frauen. Mutig! Engagiert! Er erinnerte sich an die Gelegenheiten, als sie gemeinsam mit den Müttern und Ehefrauen der Arbeiter zur Verteidigung irgendeiner Sache auf die Straße gegangen waren. Dalmau war knapp zwei Jahre älter als die beiden Mädchen, und dennoch übertrafen sie ihn an Kühnheit, als ob der Umstand, eine Frau zu sein, sie dazu zwingen würde. Sie schrien und beschimpften die Guardia Civil und provozierten sie sogar. Und jetzt sprangen sie dort auf einem eigenhändig umgestoßenen Straßenbahnwaggon herum. Dalmau zitterte, dann hob er die Faust und stimmte erregt in die Rufe und Forderungen der Leute ein.
Die Aufregung und der Lärm hallten noch in Dalmau nach, wühlten ihn auf und betäubten ihn, während er den Paseo de Gràcia zur Keramikfabrik hinauflief, in der er arbeitete. Sie lag auf einer freien Fläche am Ufer des Trockenflusses Bargalló im Stadtteil Les Corts. Er hatte keine Gelegenheit mehr gehabt, mit den Mädchen zu reden, denn nach erreichtem Ziel hatte die Nervosität der Guardia Civil die Streikenden zur Auflösung gezwungen, und die Frauen und ihre Kinder hatten sich in alle Richtungen zerstreut. Vielleicht waren Montserrat und Emma aufgefallen, dachte Dalmau. Mit Sicherheit, sagte er sich lächelnd, so wie sie dort auf dem Waggon herumgesprungen waren. Aber sie hatten sich schnell unter die anderen im Mercado de la Boqueria oder auf den Ramblas gemischt: Frauen wie so viele andere, in knöchellangen Röcken, mit Schürze und Hemdbluse, deren Ärmel sie normalerweise hochkrempelten. Die älteren trugen üblicherweise ein meist schwarzes Kopftuch, die übrigen steckten sich, ohne Kopfbedeckung, das Haar zu einem Dutt hoch. Es waren vollkommen andere Frauen als die reichen, eleganten, die über den Paseo de Gràcia flanierten.
Wenn Dalmau auf dem Hin- und Rückweg diese große Verkehrsader Barcelonas passierte, amüsierte er sich tagtäglich bei der Betrachtung dieser Damen, wie sie zwischen den weiß gekleideten Kindermädchen mit ihren Sprösslingen, Pferden und Fahrzeugen stolzierten. Brüste, Bauch und Po – das waren angeblich die drei Merkmale, an denen die ideale Frau zu bemessen war. Die weibliche Mode hatte sich genauso wie die Architektur und andere Künste im Zuge des Modernisme weiterentwickelt. Die steifen mittelalterlichen Elemente, die im letzten Jahrzehnt des vergangenen Jahrhunderts angesagt gewesen waren, wurden allmählich durch lebendigere ersetzt, wobei die Korsetts in einer Art wunderbarer S-Linie die natürlichen Körperformen betonten: vorn die Brüste, flache, zusammengepresste Bäuche und hinten die angriffslustig abstehenden Pos. Wenn Dalmau Zeit hatte, setzte er sich auf eine der Promenadenbänke und skizzierte diese Frauen mit Zeichenkohle. Aber in seiner Vorstellung verzichtete er normalerweise auf Kleidung und zeichnete sie nackt. Er wollte sich nicht auf die bloßen Andeutungen ihrer Korsette und Kleidung beschränken. Die Füße, die Beine, die Knöchel, vor allem die zarten und schlanken Knöchel mit den gespannten Sehnen, Hände und Arme. Und die Hälse! Warum sollte er nur auf diese drei Merkmale achten: Brüste, Bauch und Po? Ihm gefiel der weibliche Akt, aber leider hatte er keine Gelegenheit, mit nackten Modellen zu arbeiten. Sein Meister, Don Manuel Bello, hatte es ihm verboten. Männliche Akte ja, weibliche nein. Verständlich bei so einer Gattin, sagte sich Dalmau grinsend hinter Don Manuels Rücken. Spießig, reaktionär, konservativ, eine bis ins Mark verbohrte Katholikin, alles Eigenschaften, die sie mit ihrem Gatten teilte, klammerte sich diese Frau an die alte, schon seit einigen Jahren überholte Mode und benutzte immer noch die Tournüre, eine Art Gestell, das an der Hüfte befestigt wurde, damit der Rock sich hinten wölbte.
»Wie eine Schnecke«, spottete Dalmau, als er es Montserrat und Emma erklärte. »Alles vorn, und aus dem Arsch wächst eine Art Panzer heraus, den sie überall mit sich herumschleppt. Wollt ihr mir glauben, dass ich sie mir nackt gar nicht vorstellen kann?«
Die beiden lachten.
»Hast du denn noch nie einer Schnecke ihr Haus abgenommen?«, fragte ihn seine Schwester. »Der setzt du dann einen Haarschopf anstelle der Fühler auf, und schon hast du deine nackte Bürgersfrau mit ihrem Sabbermaul.«
»Hör auf! Wie eklig!«, beschwerte sich Emma und versetzte Montserrat einen Stoß. »Aber warum musst du dir die Frauen überhaupt nackt vorstellen?«, wandte sie sich an Dalmau. »Ist dir denn nicht genug, was du zu Hause hast?«
Ihre letzten Worte sprach sie gedehnt, mit sanfter, schmeichlerischer Stimme. Dalmau zog sie zu sich heran und küsste sie auf die Lippen.
»Natürlich ist es mir genug«, wisperte er.
Abgesehen vom heimlichen Gebrauch erotischer Fotografien, auf denen er die weibliche Nacktheit studierte, die sein Meister ihm verbot, war Emma tatsächlich die Einzige, die ihm nackt Modell gestanden hatte. Als Montserrat davon erfuhr, bot sie sich ihm ebenfalls an.
»Ich kann doch nicht meine Schwester nackt zeichnen!«, sträubte er sich.
»Es ist doch Kunst, oder nicht?«, beharrte sie und wollte sich schon das Hemd ausziehen. Dalmau packte ihre Hand, um sie davon abzuhalten. »Ich finde deine Zeichnungen von Emma toll! Sie ist darauf so sinnlich! So weiblich! Wie eine Göttin! Niemand würde sie für eine Köchin halten. Ich möchte genauso aussehen, nicht wie die gewöhnliche Arbeiterin aus der Stoffdruckfabrik.«
Dalmau schloss für einen Moment die Augen, während seine Schwester an ihrem geblümten Rock zerrte, als wollte sie ihn loswerden.
»Ich hätte auch gern, dass du mich so zeichnest«, gab Montserrat ihm zu verstehen.
»Hätte Mutter es denn gern?«, wandte Dalmau ein.
Montserrat kräuselte die Oberlippe und schüttelte resigniert den Kopf.
»Es ist ja gar nicht nötig, dass ich dich nackt zeichne, damit du weißt, dass du genauso hübsch bist wie Emma«, versuchte Dalmau, sie zu trösten. »Du verdrehst doch allen Männern den Kopf! Sie sind verrückt nach dir, sie liegen dir zu Füßen.«
Nach der Aktion mit der Straßenbahn auf den Ramblas würde Dalmau schon reichlich spät zur Arbeit erscheinen, sodass er keine weitere Zeit damit verlieren durfte, sich mit der imaginären Nacktheit der Bürgerinnen aufzuhalten, die sich auf dem Paseo de Gràcia zur Schau stellten. Er hatte auch keine Zeit zu beobachten, wie die Bauarbeiten an den modernistischen Gebäuden im Eixample voranschritten, in Barcelonas Stadterweiterung, einem Gebiet außerhalb der Stadtmauer, in dem aus Gründen der militärischen Verteidigung jahrhundertelang ein Bauverbot gegolten hatte und das erst im neunzehnten Jahrhundert, nach dem Abriss der Stadtmauer, erschlossen worden war. Meister Bello verfluchte die modernistischen Bauten, obwohl sie seiner Keramikfabrik ein einträgliches Geschäft bescherten.
»Geschäft ist Geschäft, mein Sohn«, entschuldigte er sich, als Dalmau es einmal wagte, ihn auf diesen Widerspruch hinzuweisen. Fest stand, dass der Modernisme seit der Weltausstellung von 1888, genauso wie in der Mode, bedeutende Veränderungen bewirkt hatte, eine Abdrift, die manch konservativer Geist nur schwer hinnehmen konnte. Im letzten Jahrzehnt des neunzehnten Jahrhunderts hatten die Frauen, befreit von der Tournüre, immer noch strenge Kleider getragen, ähnlich denen des Mittelalters. Im selben Jahrzehnt hatten sich auch die Architekten vom Mittelalter inspirieren lassen und versucht, der Größe des damaligen Katalonien nachzueifern. Lluís Domènech i Montaner hatte Techniken mit heimischen Materialien wie den Backsteinbau wiederbelebt und damit das Café-Restaurant der Weltausstellung von 1888 errichtet, ein zinnenbewehrtes Schloss mit maurischen Einflüssen. Allerdings hatte er sich die Freiheit gewährt, nahezu fünfzig weiße Keramikwappen am Außenfries anzubringen. Darauf wurden die im Lokal zu verkostenden Produkte angepriesen: ein Gin trinkender Matrose, eine junge Frau mit Eis, eine Schokolade zubereitende Köchin …
Wenige Jahre später hatte Josep Puig i Cadafalch den Umbau der Casa Amatller am Paseo de Gràcia mit gotischen Elementen übernommen, dabei Symmetrien und Klassizismen durchbrochen und Barcelona seine erste koloristische Fassade geschenkt. Wie Domènech bei seinem Café-Restaurant für die Weltausstellung spielte Puig mit dekorativen Elementen und ließ in Anspielung auf die Vorlieben des Hausbesitzers eine Menge grotesker Tiere anbringen.
Diese beiden Bauwerke – unter vielen anderen, die bereits einen Wandel, ein neues Architekturkonzept forderten – waren Dalmaus Meister zufolge die Vorläufer der Casa Calvet in der Calle Casp, bei der Gaudí vom historistischen Ansatz, der das Werk seiner ersten Schaffensphase im letzten Jahrhundert inspiriert hatte, abzuweichen begann, um eine Architektur zu entwickeln, in der er danach strebte, die Materie in Bewegung zu versetzen. »Steine in Bewegung!«, rief Don Manuel Bello mit bestürztem Gesicht.
»Frauen und Gebäude sind dabei, sich von ihrer Klasse, von ihrer Haltung und Würde, von ihrer Geschichte loszusagen und sich zu prostituieren«, gestand er Dalmau einmal, »die einen, um sich in gewundene Schlangen, die anderen, um sich in unbeständige Materie zu verwandeln.« Dalmau verkniff es sich zu antworten, dass ihn die Schlangenfrauen eigentlich begeisterten und er diejenigen, die Schmiedeeisen, Stein und sogar Keramik in Bewegung versetzen wollten, bewunderte.
Als ein langer, mit Ton beladener Wagen, gezogen von vier starken Pferden mit mächtigen Köpfen, Hälsen und Kruppen und dicken haarigen Beinen, langsam und schwerfällig an ihm vorbeifuhr, sodass die Erde bebte, schreckte Dalmau aus seinen Gedanken. Er hob den Kopf und blickte auf die Rückseite des hochbeladenen Wagens, die sich vor den beiden darüber aufragenden Fabrikschloten abzeichnete. »Manuel Bello García. Fliesenfabrik.« So lautete die Ankündigung auf dem blau-weißen Keramikschild am Eingangstor. Dahinter lag ein weitläufiges Areal mit Wasserbassins und Trockenbecken neben Lagerhallen, Büros und Brennöfen. Es handelte sich um eine mittelgroße Fabrik mit Serienfertigung; sie produzierte aber auch Einzelstücke nach den Entwürfen und Vorstellungen von Architekten und Baumeistern, die für ihre Wohngebäude oder die zahlreichen kommerziellen Einrichtungen, Geschäfte und Apotheken auf die Keramik als eines der dekorativen Elemente par excellence zurückgriffen.
Und Dalmaus Arbeit bestand darin zu zeichnen. Er entwarf eigene Designs, die danach in Serie gefertigt und in den Firmenkatalog aufgenommen wurden. Außerdem setzte er die Designs um, die sich die Baumeister für ihre Gebäude oder Einrichtungen vorstellten und bloß skizzierten, und entwickelte sie weiter. Und zu guter Letzt realisierte er die Modelle, die ihnen die großen modernistischen Architekten bereits vollständig ausgearbeitet lieferten.
»Entschuldigen Sie, Don Manuel.« Dalmau betrat die Bürowerkstatt des Meisters neben den Verwaltungsräumen der Fabrik im ersten Stock des Gebäudekomplexes. »Aber die Lage in der Altstadt war sehr chaotisch. Demonstrationen, Polizeieinsätze«, übertrieb er, »und ich musste wegen meiner Mutter und meiner Schwester dableiben.«
»Wir müssen auf unsere Frauen aufpassen, mein Sohn.« Don Manuel, in strenges, nüchternes Schwarz gekleidet, wie es sich schickte, mit einer dunkelgrünen Krawatte mit riesigem Knoten, nickte hinter seinem Mahagonischreibtisch. Seine breiten, buschigen Koteletten gingen in einen ebenso dichten Schnauzer über und bildeten eine sauber gezogene Haardecke über dem bartlosen Hals und dem Kinn. »Sie brauchen uns. Du machst es richtig. Diese Anarchisten werden unser Land noch in den Abgrund stürzen! Hoffentlich hat die Guardia Civil sie tüchtig rangenommen. Mit harter Hand! Diese Undankbaren haben es verdient! Sorg dich nicht, mein Sohn. Mach dich an die Arbeit.«
Dalmaus Werkstatt lag direkt neben der seines Meisters. Auch er arbeitete nicht mit den übrigen Angestellten in den Gemeinschaftswerkstätten, sondern verfügte über einen Raum für sich allein, groß genug, um sich auf seine Arbeit – derzeit eine Fliesenserie mit ostasiatischen Motiven – zu konzentrieren: Lotusblüten, Seerosen, Chrysanthemen, Bambusrohr, Schmetterlinge, Libellen.
Um das Blumenzeichnen zur Genüge zu beherrschen, hatte er während seines Studiums an Barcelonas Kunstschule in der Llotja mehrere Kurse belegen müssen. Unter den Studieninhalten, die an der Llotja, in die Dalmau im Alter von zehn Jahren eingetreten war, vermittelt wurden, war einer der wichtigsten das Zeichnen im Bereich des Kunstgewerbes. Genau dafür war die Schule in der Llotja ins Leben gerufen worden: um den Arbeitern, die es benötigten, Kunst nahezubringen, was sie dann in der Industrie anwenden konnten.
Ab Mitte des neunzehnten Jahrhunderts war den schönen gegenüber den angewandten Künsten Vorrang gewährt worden, aber ohne Letzteren den Rücken zu kehren, die der Industrie dienen sollten und zu denen zweifellos das Blumenzeichnen gehörte. Botanische Elemente hatten in der gotischen Kunst als Ornament par excellence gegolten, und jetzt wurden damit im Zuge des architektonischen Modernisme Fliesen und Lambris, Mosaike, Schmiedeeisen, Möbel und Verglasungen sowie die unzähligen, die Gebäude zierenden Gipsskulpturen gestaltet.
Dalmau zog sich einen Kittel über seine knielange Bluse, und sobald er sich vor den vielen Skizzen, die über seinen Arbeitstisch verstreut lagen, niederließ und seine Bleistifte ordnete, traten Stimmen, Gelächter, Rufe sowie die Geräusche und der gelegentliche Lärm des Fabrikbetriebs in den Hintergrund. Dalmau verwandte alle seine Sinne auf die japanischen Zeichnungen und versuchte, sich diese fernöstliche Technik anzueignen. Das bedeutete, auf Realismus zu verzichten, zugunsten einer stilisierten Schönheit, ohne Schattierungen, so fern der westlichen Kriterien wie hochgeschätzt auf einem Markt, der sich auf die Suche nach dem Anderen, dem Exotischen, dem Modernen begeben hatte.
Genauso wie er, vertieft in seine Arbeit, zuvor alle Geräusche ausgeblendet hatte, umgab ihn die Stille der leeren Fabrik, als die Nacht über Barcelona hereinbrach. Das Mittagessen, das ihm heraufgebracht worden war, hatte er ohne großen Appetit gegessen, als wäre es eine Belästigung, und später hatte er nur mit einem Murmeln geantwortet, wenn jemand den Kopf zur Werkstatttür hereinsteckt hatte, um sich zu verabschieden. Don Manuel, einer der Letzten, war keine Ausnahme gewesen, und nach einem Schnalzen mit der Zunge hatte er Dalmau den Rücken gekehrt.
Wiederum ein paar Stunden später verglomm das Licht der Gasleuchten in der Werkstatt, bis Dalmau beinahe im Dunkeln saß.
»Wer hat das Licht ausgemacht? Wer ist da?«
»Ich bin es, Paco«, antwortete der Nachtwächter und drehte den Gashahn wieder auf, um die Werkstatt erneut in Licht zu tauchen.
Paco war ein scheuer alter Mann. Er war ein wunderbarer Mensch, aber er sollte nicht an diesem Ort sein. Der Meister hatte den Zutritt zu den Werkstätten und den dort befindlichen Skizzen und Projekten, halb fertigen Arbeiten, Material, das nur die vertrauenswürdigsten Angestellten sehen durften, untersagt.
»Was machst du hier?«, wunderte sich Dalmau.
»Don Manuel hat mir Befehl erteilt, dich hinauszuwerfen, falls du dich allzu sehr verspäten solltest.« Beim Lächeln entblößte der Mann seinen bereits zahnlosen Mund. »Die Lage in der Stadt ist schwierig, die Leute sind sehr beunruhigt, und deine Mutter wird sich Sorgen machen.«
Vielleicht hatte Paco recht. Jedenfalls verschaffte die Ablenkung Dalmaus Magen die Gelegenheit, vor Hunger zu protestieren, was es ihm, zusammen mit der Müdigkeit, die er plötzlich in seinen Augen spürte, ratsam erscheinen ließ, den Arbeitstag zu beenden.
»Mach das Licht aus«, bat er den Wächter und warf seinen Kittel auf den Garderobenständer in der Ecke, wo dieser notdürftig an einem Ärmel hängen blieb. »Was ist denn in der Stadt passiert?«, erkundigte er sich, während er seine Werkstatt abschloss.
»Die Lage hat sich zugespitzt. Die Streikposten, vor allem Frauen und Jugendliche, sind durch die Altstadt gezogen und haben Steine auf die Fabriken und Werkstätten geworfen, bis sie dichtgemacht haben. Am Vormittag haben sie offenbar eine Straßenbahn umgestoßen, und das hat sie angespornt.« Dalmau schnaubte heftig. »Ähnlich ist es mit den großen Fabriken in Sant Martí. Es hat Angriffe auf Polizeireviere gegeben. Die Kinder haben die Situation genutzt, um Unfug zu treiben, und Steuerbüros angezündet, wahrscheinlich nachdem sie dort geklaut hatten. Es ist alles ein ziemliches Durcheinander.«
Sie stiegen die Treppe zu den Lagern im Erdgeschoss hinunter. Bevor sie von dort auf das weitläufige Areal rund um die Gebäude hinaustraten, wo der Ton verarbeitet wurde, verabschiedete sich Dalmau von zwei höchstens zehnjährigen Jungen. Sie wohnten und schliefen in der Fabrik auf einer Decke auf dem Boden, im Winter in der Nähe der warmen Öfen und immer weiter weg, je milder die Temperaturen wurden. Sie waren nicht einmal Lehrlinge, sondern wurden für alles Mögliche eingesetzt: Putzen, Erledigungen, Wasserholen. Beide hatten eine Familie, wie sie sagten: Arbeiter, die im Bezirk Sant Martí, dem katalanischen Manchester, arbeiteten und zusammengepfercht mit anderen Familien in geteilten Wohnungen lebten. Nach Sant Martí war es weit, und der Meister hatte nichts dagegen, dass sie in der Fabrik wohnten und sich ein paar Céntimos verdienten. Er verlangte im Gegenzug nur, dass sie die Sonntagsmesse in der Kirchengemeinde Santa Maria del Remei de Les Corts besuchten. Die Familien der beiden schien es nicht zu kümmern, dass ihre Sprösslinge in der Fabrik lebten, nie war jemand gekommen, um nach ihnen zu fragen. Andere lebten unter noch schlechteren Bedingungen, dachte Dalmau, während er einem der beiden vor dem Hinausgehen mit der Hand durchs strohige Haar fuhr. Ein ganzes Heer von Kindern, schätzungsweise über zehntausend, trinxeraires genannt, war in den Straßen von Barcelona zu Hause, bettelte, stahl und schlief unter freiem Himmel in irgendeiner Ecke, in der sie es sich bequem machen konnten. Sie waren Waisen oder einfach sich selbst überlassen, wie diese beiden kleinen Handlanger, deren Familien sich weder um sie kümmern noch sie ernähren konnten.
»Gute Nacht, Meister«, verabschiedete sich einer der beiden. In seinem Tonfall lag nicht der geringste Spott: Sein Lob war ehrlich.
Dalmau drehte sich um, kramte in seiner Hosentasche und warf ihnen jeweils eine Zwei-Céntimo-Münze zu.
»Wie großzügig!« Diesmal war doch eine gewisse Scherzhaftigkeit herauszuhören.
»Hast du denn keine Ein-Céntimo-Stücke?«, rief der andere Junge. »Das sind die allerkleinsten.«
»Undankbare Strolche!«, schimpfte der Wächter.
»Lass sie«, bat ihn Dalmau mit einem Lächeln auf den Lippen. »Geht bloß sorgsam mit dem Geld um, nicht dass ihr euch den Magen mit zu viel Essen verderbt«, fiel er in ihr Scherzen ein.
»Einen ganzen Lammrücken werden wir mit diesen vier Céntimos verspeisen!«, hörte Dalmau sie noch hinter seinem Rücken.
»Und mit einem ordentlichen Schoppen Alella hinunterspülen!«
»Rotzlöffel«, murrte der Wächter.
»Nein, Paco, nein«, widersprach Dalmau. »Was kann man denn anderes von diesen zwei vernachlässigten Knirpsen erwarten, als dass sie sich über das Leben lustig machen?«
Der alte Mann schwieg, während Dalmau unter dem Keramikschild am Eingangstor von Don Manuel Bellos Fliesenfabrik hindurchging und sich seine Augen an das glänzende Mondlicht gewöhnten, das Freiflächen und Straßen erhellte, zu denen die öffentliche Beleuchtung noch nicht vorgedrungen war. Er atmete die frische Nachtluft ein. In der Stille lag eine Spannung, als hingen die Rufe der Streikenden, die tagsüber demonstriert hatten, noch in der Luft. Von dort, wo er stand, blickte Dalmau auf die sich zum Meer erstreckende Landschaft. Die Silhouetten Hunderter hoch aufragender Schlote zeichneten sich im Mondlicht ab. Barcelona war eine Industriestadt, voller Fabriken, Geschäfte und Werkstätten. Seit dem neunzehnten Jahrhundert wurde Dampfantrieb eingesetzt, wofür andernorts noch Menschenkraft verwendet wurde, was der Stadt, neben dem Einfluss von Nachbarländern wie Frankreich und einem ureigenen Geschäfts- und Unternehmergeist, dazu verholfen hatte, sich mit den fortschrittlichsten europäischen Städten messen zu können. Am wichtigsten war die Textilindustrie. Sie beschäftigte die Hälfte der gesamten Arbeiterschaft. Aber auch die Metall-, Chemie- und Lebensmittelindustrie leisteten einen bedeutenden Beitrag. Außerdem waren die Holz-, Leder- und Schuh- sowie Papierindustrie und die grafischen Künste vertreten, Dutzende Fabriken in einer Stadt, deren Bevölkerung auf eine halbe Million Einwohner angewachsen war. Doch während die reichen Industriellen und Bürger ihren Wohlstand genossen und damit protzten, war die Lebensrealität der einfachen Leute, der Arbeiter, eine gänzlich andere. Sie arbeiteten zwischen zehn und zwölf Stunden an sieben Tagen der Woche zu miserablen Löhnen. In den zurückliegenden dreißig Jahren waren die Verdienste um dreißig Prozent, die Lebensmittelpreise um siebzig Prozent gestiegen. Die Arbeitslosigkeit nahm zu. Die städtischen Herbergen waren jede Nacht voll belegt, und die Küchen der öffentlichen Wohlfahrt verteilten tagtäglich Tausende Mahlzeiten. Barcelona, und darüber schüttelte Dalmau den Kopf, war ausgesprochen grausam zu denen, die der Stadt zu ihrer Größe verhalfen, während sie ihr Leben und ihre Gesundheit, ihre Familien und ihre Kinder dafür aufopferten.
Montserrat war nicht zu Hause. Emma auch nicht. Sicherlich feierten sie zusammen den Erfolg ihres Protests, dachte Dalmau. Vielleicht bereiteten sie bei irgendeiner Versammlung die Aktionen für den Folgetag vor, freudestrahlend und unter gegenseitigen Beglückwünschungen. Dalmau hatte gezögert, ob er in die Gaststätte in der Nähe des Marktes von Sant Antoni gehen sollte, war aber zu dem Schluss gekommen, dass Emma, selbst wenn das Lokal trotz des Streiks geöffnet sein sollte, heute nicht dort arbeiten würde.
Dalmau wohnte mit seiner Mutter im zweiten Stock eines alten Gebäudes in der Calle Bertrellans. Diese schmale Gasse mitten in der Altstadt verband die Calle de la Canuda mit der Calle de Santa Anna, in der die gleichnamige Kirche lag, die gerade vergrößert wurde. Die Wohnung der Salas ähnelte all den anderen, die sich in der Altstadt, in Sants, Gràcia oder Sant Martí aneinanderdrängten: vier- bis fünfstöckige, feuchte und düstere Gebäude mit engem Treppenhaus, ohne Kanalisation, Gas oder Strom und mit fließendem Wasser aus einem Tank auf dem Dach, der sämtliche Bewohner versorgte. Von jedem Treppenabsatz mit jeweils einer Gemeinschaftslatrine gingen mehrere einander ähnelnde Wohnungen ab: Ein dunkler Flur führte in eine Essküche, oft mit Belüftung über einen Innenhof, gefolgt von einem Zimmer ohne sowie einem weiteren mit Fenster.
In diesem letzten Zimmer fand Dalmau seine Mutter wie immer an der Nähmaschine vor, inzwischen beim Schein einer traurigen Kerze, die die Dunkelheit eher zu vergrößern, als Licht zu spenden schien. Ein ums andere Mal betätigte sie das Pedal des guten Stücks aus dem Haus von Señor Escuder in der Calle Avinyó. Sie musste schon den ganzen Tag gearbeitet haben, wahrscheinlich über dreizehn Stunden.
»Wie geht es Ihnen, Mutter?« Dalmau küsste sie auf die Stirn.
»Hier sitze ich, mein Sohn.«
Dalmau beobachtete sie eine Zeit lang, dann stellte er sich hinter sie und streichelte ihre Unterarme. Er spürte das Surren, das sich von der Maschine auf die Arme und Schultern seiner Mutter übertrug, die sich im Takt der Nähnadel bewegte. Den Blick auf ihre Arbeit gerichtet, presste die Frau in der Andeutung eines Lächelns die Lippen aufeinander, sagte aber nichts, sondern fuhr mit der Arbeit fort, bediente die Pedale und führte den Stoff unter den Nadeln hindurch. Heute nähte sie abnehmbare weiße Krägen und Manschetten für Männerhemden. Das war, was der Zwischenhändler der großen Geschäfte, in denen sie verkauft wurden, ihr angeboten hatte. Abnehmbare weiße Krägen und Manschetten waren für eine Näherin die am schlechtesten bezahlte Arbeit; nach einem endlosen Arbeitstag erhielt sie etwa eine Peseta. Eine Stange Brot kostete vierzig Céntimos. Der Zwischenhändler hatte ihr einen Posten Hosen und sogar einen Posten Handschuhe versprochen, aber heute habe er nur Krägen und Manschetten für die weißen Hemden der Reichen. Josefa, so hieß Dalmaus Mutter, machte sich keine allzu großen Hoffnungen, dass der Mann sein Wort halten würde. Vielleicht, wenn sie ihm erlauben würde, sie zu befummeln und zu begrapschen. Nein, korrigierte sie sich, nicht einmal dann. Es gab Frauen, die vor ihm auf die Knie gingen und ihn masturbierten oder sich mit Rock und Schürze nach vorne neigten und ihm anboten, so viel er wollte. Und die waren jünger und hübscher als sie! Sie kannte sie. Manchmal hörte sie sie sogar streiten, im Flüsterton, müde: Wer war heute dran? Es konnte immer nur eine sein, denn der Mann war, was Sex anbelangte, nicht gerade ein Kraftprotz. Er ergoss sich augenblicklich und war noch schneller befriedigt. Josefa verurteilte diese Frauen nicht. Sie spürte keinerlei Groll. Sie hatten Kinder, und sie hatten Hunger.
Dalmaus Mutter seufzte. Er bemerkte es und drückte sanft auf ihre Unterarme. Josefa erhielt Unterstützung von ihrem Sohn. Die meisten Näherinnen und auch andere Frauen warfen ihr neidische Blicke zu und tuschelten, wenn sie an ihnen vorbeiging. Sie nahm es wahr, und es gefiel ihr nicht, denn sie hielt sich nicht für anders als die Übrigen: die arme Witwe eines anarchistischen Arbeiters, der zu Unrecht verurteilt worden und, wie man ihr mitgeteilt hatte, im Exil an den Folgen der Folter gestorben war; eine der vielen Näherinnen, die nach und nach ihre Sehkraft einbüßten und von der Bronchitis heimgesucht wurden, während sie, schlecht ernährt und immerzu erschöpft, stundenlang reglos vor ihren Maschinen saßen, die infektiöse Luft einatmeten, die aus dem Untergrund aufstieg, und unter der Feuchtigkeit litten, die ihnen bis ins Mark kroch. All das, um die Bürger mit weißen Manschetten und Krägen auszustatten. Dalmau hingegen genoss Ansehen und ein gutes Gehalt durch seine Arbeit für den »Frömmler mit den Fliesen«, wie ihn die Frauen des Haushalts einschließlich Emma nannten. »Lassen Sie doch das alles, Mutter«, bat er sie trotzdem oft. Aber Josefa wollte nicht auf Kosten ihres Sohnes leben. Dalmau würde heiraten, seine eigenen Bedürfnisse haben. Er half ihr, das schon, so sehr sogar, dass sie sich nicht der Wollust des Zwischenhändlers unterwerfen musste. Er half auch seiner Schwester und sogar dem Ältesten, Tomás, der Anarchist war wie sein toter Vater: ein Idealist, Libertärer, Utopist, Kanonenfutter wie sein Erzeuger.
»Und die Kleine?«, fragte Dalmau und bezeichnete damit liebevoll Montserrat. Er drückte seine Mutter ein letztes Mal, dann setzte er sich auf das Bett neben der Nähmaschine, das sich die beiden Frauen des Haushalts teilten.
»Was weiß ich! Vermutlich bei der Vorbereitung der Demonstrationen für morgen. Sie war da und hat mir erzählt, dass sie heute eine Straßenbahn umgestoßen haben.« Dalmau nickte. »Zu unserer Zeit waren mehrere Pferde vor die Straßenbahnen gespannt. Da war es schwierig, sie umzustoßen«, scherzte sie.
»Und wissen Sie etwas von Emma?«
»Ja.« Die lang gezogene, volltönende Bestätigung überraschte Dalmau. Ins Gesicht seiner Mutter trat ein sanfter Ausdruck. »Sie ist mit deiner Schwester gekommen und hat einen Topf mit Essen vorbeigebracht. Eine deiner Leibspeisen«, fügte sie augenzwinkernd hinzu. »Dann sind sie wieder gegangen, um weiterzukämpfen.«
Bacallà a la llauna. Tatsächlich handelte es sich um eines von Dalmaus Lieblingsgerichten, und Emma wusste, wie sie es für ihn zubereiten musste: Entsalzen, aber nicht zu stark, damit noch etwas vom Meeresgeschmack übrig blieb, wurde der Kabeljau in Mehl gewendet und gebraten. Sobald er gar war, wurde er in die llauna, ein hochrandiges Backblech, gelegt. Im restlichen Öl wurden mehrere, in Scheibchen geschnittene Knoblauchzehen angebräunt, dazu kamen rote Paprika und Wein, damit Erstere nicht anbrannten und bitter wurden. Nach einigen Minuten Köcheln wurde alles über den Fisch gegossen. Josefa wärmte das Gericht über der Glut des in die Wand eingemauerten Herdes auf und servierte es auf dem Esstisch mit Brot und einer Karaffe Rotwein.
Nicht einmal, als sie den Fisch gegessen hatten und aus den Straßen die Stimmen der Menschen heraufhallten, die aus ihren Elendswohnungen flüchteten, um sich an der frischen Luft zu unterhalten, spazieren zu gehen, eine Zigarette zu rauchen oder zusammen Wein zu trinken, schaffte es Dalmau, seine Mutter von der Arbeit abzuhalten.
»Ich habe noch viel vor mir«, entschuldigte sie sich.
Wann sie das denn nicht hatte, war Dalmau versucht, ihr zu antworten, aber das hätte bedeutet, von Neuem die endlose Diskussion zu beginnen: »So lassen Sie es doch, Mutter.« »Sie haben es doch gar nicht nötig.« »Ich werde Ihnen Geld geben.« »Es wird Ihnen an nichts fehlen.«
»Wir könnten in eine andere Wohnung ziehen«, hatte er ihr einmal sogar vorgeschlagen.
»Hier habe ich mit deinem Vater gelebt, und hier werde ich sterben.« Josefas Antwort war ungewöhnlich trocken ausgefallen. Danach hatte sie mit leicht belegter Stimme hinzugefügt: »Für dich oder deine Geschwister mag das ja ein finsteres Loch sein, aber an diesen Wänden haftet das Lachen und Weinen deines Vaters, auch das von euch natürlich. Weder Feuchtigkeit noch Gestank noch Dunkelheit können das Glück, das ich hier mit ihm, mit dir und deinen Geschwistern erlebt habe, aus meinem Gedächtnis löschen.«
Als seiner Mutter die Stimme brach und ihr Tränen über die Wangen rollten, kamen in Dalmau Zweifel auf. An diesem Abend schien sie ihm zerbrechlicher, hilfloser als sonst.
Später, in der Einsamkeit seines Zimmers, der fensterlosen Zelle, machte er sich im Schein einer Kerze daran, das Gesicht seiner Mutter zu zeichnen. Doch eine nach der anderen zerknüllte er die Skizzen. Sie war noch nicht so alt, dass ihr Leben nur noch aus Erinnerungen bestehen konnte! Aber sosehr er sich auch Mühe gab mit seinem Kohlestift und wieder und wieder versuchte, den Zeichnungen ein Lächeln, einen lebensfrohen Blick abzuringen, blieb der Eindruck immer derselbe: der einer traurigen Frau.
Am nächsten Morgen fand Dalmau auf dem Esstisch den Rest des bacallà a la llauna. Es war noch dunkel, aber die Stille wurde bereits von immer mehr Straßengeräuschen durchbrochen. Er wusch sich über einer Waschschüssel, und bevor er den Kabeljau aß, öffnete er einen Spaltbreit die Tür des zweiten Zimmers, in dem seine Schwester und seine Mutter noch zwischen den zerwühlten Laken schlummerten.
Draußen war es kühl. Über den höchsten Stockwerken der Häuser schimmerte das erste Tageslicht, als gäbe es dort oben eine saubere, gesunde Welt im Gegensatz zum Geschrei, dem Zwielicht, der Feuchtigkeit, dem Schmutz und Gestank, die die Bewohner der Altstadt von Barcelona einhüllten. Es war nicht etwa so, dass sich die Menschen über ihre Umgebung beklagten, im Gegenteil. Wie seine Mutter hingen die meisten an ihrem Herkunftsort, wo sie ihre Kindheit verbracht oder im reiferen Alter gearbeitet hatten. Nein, die Menschen beklagten sich nicht. Es war die Stadtverwaltung, die in ihren medizinischen Berichten versicherte, dass der Untergrund von Barcelona faulig sei. Die Kanalisation befinde sich in bedauernswertem Zustand, im gesamten Netz gebe es undichte Stellen. Typhus und viele weitere Infektionskrankheiten seien endemisch geworden und die Erkrankungsrate durch solcherlei Ursachen extrem erhöht.
Und seine Mutter wollte dort nicht weg! Dalmau hatte die Kirche Santa Anna passiert und war an der Plaza de Catalunya angelangt. Dabei handelte es sich um eine riesige Brache, die seit der Weltausstellung von 1888 städtebaulich erschlossen werden sollte und, obwohl der Platz noch gar nicht existierte, längst von allen Plaza de Catalunya genannt wurde. Dalmau versuchte, den Morast und die Abfallberge zu meiden und den Platz zu umrunden, so gut er konnte, bis er vor dem Eingang der Casa Pons stand, einem herrlichen, großen fünfstöckigen Gebäude im neogotischen Stil mit zwei Ecktürmen unter spitz zulaufenden konischen Dächern. Es war im letzten Jahrzehnt des vorigen Jahrhunderts erbaut worden und hatte von der Entwicklung des Kunstgewerbes profitiert, von Glas- und Schmiedekunst und Möbeltischlerei bis hin zur Keramik aus der Fabrik von Dalmaus Meister.
Dieses Gebäude des Architekten Enric Sagnier im ersten Häuserblock des Paseo de Gràcia markierte nicht nur den Beginn der modernistischen Prachtstraße von Barcelona, sondern auch eine so eindeutige, so verblüffende Grenze zwischen zwei entgegengesetzten Welten, dass Dalmau immer einen Moment davor stehen blieb und tief Luft holte. Er blickte zurück, dorthin, wo er herkam, wo sich seine Mutter und seine Schwester befanden, die inzwischen sicher aufgestanden waren, dann nach vorn auf den breiten, baumbestandenen Boulevard, den er entlanggehen musste, um zu seiner Arbeit zu gelangen.
Hier strahlte die Sonne. Bis auf den Boden, aufs Straßenpflaster! Und der Gestank war nicht so ekelerregend.
Zu dieser frühen Stunde zeigten sich noch keine jungen Bürgerinnen auf dem Boulevard. Stattdessen waren Bäcker zu sehen, die das Brot an die Wohnungstüren lieferten, Boten, Dienstmädchen, meistens schöner und kräftiger als ihre Herrinnen, mit Einkaufskörben am Arm, Arbeiter, die von hier nach dort gingen, viele Maurer, Verkäufer und Verkäuferinnen, die in den Geschäften arbeiteten, und die Heerscharen von Armen und Bedürftigen, die sich vor den Diensteingängen der großen Häuser anstellten, weil Almosentag war.
»Kriegszustand!« Der Ruf eines Zeitungsjungen riss ihn aus seinen Gedanken. »Kriegszustand in Barcelona!« Der Junge schrie mit der ganzen Kraft, die seine Lungen hergaben.
Dalmau ging zu ihm.
»Gib mir eine«, bat er, genauso wie einige andere, die sich um den Zeitungsverkäufer scharten.
Der Junge verteilte die Zeitungen und kassierte das Geld, während er weiterrief, um noch mehr Käufer anzulocken:
»Der Zivilgouverneur überträgt der Armee die Befehlsgewalt!«
Dalmau las begierig die Nachricht. »Da es dem Zivilgouverneur nicht gelingt, die Arbeiterkrawalle unter Kontrolle zu bringen, überlässt er der Armee die Befehlsgewalt über die Stadt! Der Generalkapitän erklärt den Kriegszustand! Die Garantien und Rechte der Bürger sind aufgehoben!«
Dalmau entfernte sich vom Tumult um die Morgenausgabe der Zeitung, und als wollten ihm die Tatsachen die unablässigen Rufe des Jungen bestätigen, fuhr eine Straßenbahn in Begleitung einer Eskorte von mehreren Kavalleriemitgliedern mit gezückten Säbeln den Paseo de Gràcia herauf.
Im Laufe des Tages kam es noch zu vereinzelten Auseinandersetzungen, aber angesichts der aus verschiedenen Teilen Kataloniens eintreffenden Verstärkungstruppen verlor der Streik an Durchschlagskraft. Der Kampfgeist sank, bis sich wieder Normalität einstellte, ohne dass deswegen der Kriegszustand aufgehoben wurde.
In der Fabrik vertiefte sich Dalmau in seine Skizzen für die Fliesen mit den japanischen Motiven. Als er zur Mittagszeit wieder einmal keine Antwort gab, wies der Meister einen der Lehrlinge an, den jungen Mann zu schütteln und ihm zu sagen, er werde im Hof in der Kutsche auf ihn warten, um nach Hause zum Essen zu fahren.
Don Manuel lud Dalmau öfter zu sich ein. Wie es sich für einen wohlhabenden Industriellen gehörte, wohnte er in einer riesigen Wohnung mit sehr hohen Decken am Paseo de Gràcia, um die Ecke zur Calle de València. Dalmau hätte zu Fuß gehen können, aber der Meister fuhr gern mit der Pferdekutsche. Er klopfte mit dem Silberknauf seines Spazierstocks gegen das Wagendach, und der Kutscher fuhr los.
Sie hatten das Fabrikgelände noch nicht verlassen, da zeigte Don Manuel auf Dalmaus Aufmachung und wedelte mit der Hand in der Luft.
Dalmau zuckte mit den Schultern.
»Ich bezahle dich gut, sehr gut sogar. Da könntest du dich schon deiner Position entsprechend kleiden.«
»Entschuldigen Sie, Don Manuel, aber ich habe mich immer so gekleidet. Sie wissen besser als jeder andere, dass ich aus einfachen Verhältnissen stamme. Ich sehe mich nicht als Lebemann.«
»Darum geht es ja nicht. Aber ein Paar gute Hosen, Hemd und Sakko und ein anständiger Hut anstelle dieser …« Er wedelte jetzt mit der Hand zur Mütze hin, die Dalmau in einer Hand zusammenpresste. »Anstelle dieser Schusterjungenmütze würden dir zum Beispiel dazu verhelfen, dass meine geliebte Gattin dich mit am Tisch sitzen lässt.«
Dalmau trug dieselbe Entschuldigung vor wie jedes Mal, wenn der Meister sich über die Dürftigkeit seiner Kleidung aufhielt und über die Möglichkeit, gemeinsam mit seiner Gattin und seinen beiden Töchtern zu essen – der kleine Sohn aß noch mit der Kinderfrau – sowie von Zeit zu Zeit mit Mosén Jacint, einem Mönch des Piaristenordens und Lehrer an der Escola Pia de Sant Antoni.
»Don Manuel, Sie wissen, dass ich Ihren Erwartungen nicht entsprechen könnte, und noch weniger denen von Doña Celia. Ich möchte sie ungern kränken. Meine Erziehung ist nicht die richtige«, sagte er zum wiederholten Mal.
»Ja, ja«, lenkte der Meister ein. »Aber diese Kleider! Du bist der zweite Zeichner der Fabrik! Der erste nach mir. Du solltest ein Beispiel geben.«
Das war eine weitere alte Leier von Don Manuel. Er sollte sich einen dieser Krägen umlegen? Vielleicht sogar einen, den seine Mutter vor Tagen genäht hatte, im schmutzigen Licht, das durch das Fenster von der Calle Bertrellans hereinfiel? Nein. Niemals würde er Krägen oder Manschetten tragen, noch Hemden, Sakkos oder Hosen, die das Leben seiner Mutter verbraucht hatten!
»Ich fühle mich nicht wohl damit«, wiederholte er in ebenso höflichem wie unerschütterlichem Tonfall. »In solcher Kleidung kann ich mich nicht auf meine Arbeit konzentrieren. Es tut mir leid.«
Ohne Don Manuel Zeit zu einer Antwort zu lassen, drehte Dalmau den Kopf zum Fenster und versank in der Betrachtung der Stadt. Zu dieser Tageszeit und noch dazu im Eixample, dem Reichenviertel, durch das sie fuhren, herrschte durch den vom Generalkapitän verhängten Kriegszustand absolute Ruhe. Er beobachtete einige Soldaten, die sorglos die Frühlingssonne und den Anblick der vorbeigehenden Frauen genossen. Dabei dachte er an Emma und Montserrat: Sie waren vermutlich an ihre Arbeitsplätze zurückgekehrt, die eine in die Gaststätte, die andere in die Fabrik. Beide wütend und enttäuscht über das Eingreifen der Armee, so wie die meisten Arbeiter, sagte sich Dalmau. Am Abend würde er sie treffen. Er lächelte, während das Klappern der Hufe des Pferdepaares verstummte und die Kutsche vor dem Eingang des Gebäudes am Paseo de Gràcia, in dem der Meister mit seiner Familie wohnte, zum Stehen kam.
Die Wertschätzung, die der Meister Dalmau entgegenbrachte, teilte seine Gattin Doña Celia keineswegs. Sie hatte ihre Geringschätzung der einfachen, wenn nicht revolutionären Herkunft Dalmaus nie zu verbergen versucht. Das Zeichentalent des Sohnes eines wegen Mordes verurteilten Anarchisten scherte sie wenig. »Es gibt sicher etliche genauso begabte Jungen wie ihn, auch wenn sie aus einfachen Familien stammen«, pflegte sie Don Manuel zu predigen. »Ich habe nichts gegen die Arbeiter, solange sie katholisch und nicht atheistisch sind wie dieser Junge.« Die Schärfe, mit der seine Frau Dalmau behandelte, kümmerte Don Manuel aber nicht, denn fest stand auch, dass die Essenseinladungen keinem anderen Zweck dienten als dem Interesse des Meisters an Dalmaus Meinung über seine Arbeit, die er nicht in der Fabrik ausführte, sondern im Atelier, das er in einem der Zimmer seiner Wohnung eingerichtet hatte. Gemälde. Werke, die nichts mit Keramik zu tun hatten. Meistens Landschaften, auch wenn er sich mitunter schon an ein religiöses Sujet bis hin zu einem Porträt herangewagt hatte. Don Manuel war ein ausgezeichneter Maler, der nicht nur im katalanischen Umfeld, sondern im ganzen Land Anerkennung erfuhr. Zu seinen vielfältigen kulturellen und sozialen Tätigkeiten gehörte die des Dozenten an der Llotja. Ebendort hatte er die herausragenden künstlerischen Fähigkeiten des jungen Dalmau voraus- und später bestätigt gesehen. Zum Zeitpunkt des Exils und Todes von Dalmaus Vater hatte er ihn sogar finanziell unterstützt. Dass Dalmaus Vater ein anarchistischer Revolutionär war, störte Don Manuel anscheinend nicht, vielmehr sah er darin die Gelegenheit, den Sohn eines Libertären dem Glauben und der christlichen Doktrin anzunähern.
Noch bevor Dalmau sein Studium an der Llotja beendet hatte, hatte ihn Don Manuel in seiner Fabrik als Lehrling angestellt. Das Ziel des jungen Mannes war es, so viel wie möglich über die Herstellung der Fliesen und vor allem über deren Verlegung am Bau zu erfahren. Die Fabrikanten konnten es nicht riskieren, dass unfähige Maurer eine gute Arbeit zunichtemachten und der Bauherr am Ende den Herstellern die Mängel zuschrieb. Deshalb boten alle bedeutenden Fabriken auch die Verlegung der Fliesen am Bau an. Dalmau lernte alles, was man über die Fliesen- und Mosaikverlegung wissen konnte, bis er mit neunzehn Jahren aus eigenem Verdienst zum ersten Gestalter und Zeichner nach seinem Meister befördert wurde. Natürlich gab es Neid und Streit in einer Fabrik, in der es vielen schwerfiel, einem jungen Mann zu gehorchen, der nicht einmal Sakko und Hut trug und bis vor Kurzem bei der Arbeit noch neben ihnen gekniet hatte. Aber Dalmau stellte sehr bald seine Fähigkeiten unter Beweis und brachte die Klagen zum Verstummen.
Doña Celia bedachte ihn mit einem finsteren Blick, als Dalmau das Wohnzimmer des Hauses durchquerte, um dem Meister in sein Atelier zu folgen.
»Guten Tag, Señora«, grüßte er sie hingegen. »Señoritas«, fügte er mit einem leichten Kopfnicken in Richtung der beiden Töchter des Meisters hinzu. Sie waren etwas jünger als er, ein Jahr vielleicht oder zwei, und saßen an den großen Fenstern, die auf den Paseo de Gràcia hinausgingen, stumpf die Zeit ab.
Der kleine Sohn des Meisters war vermutlich im Spielzimmer.
Auf dem Gesicht von Úrsula, der älteren der beiden Schwestern, erschien auf seinen Gruß hin ein rätselhaftes Lächeln, das Dalmau beunruhigte. Es war nicht das erste Mal: Dieses Lächeln mit halb geschlossenen Augenlidern, diese Sekunde der Unverfrorenheit, die sich das Mädchen erlaubte, wachsam, dass auch niemand sie beobachtete und dabei ertappte, verhießen Dalmau weit mehr als ein einfacher Gruß beim Durchqueren eines Wohnzimmers.
»Dalmau!«
Der Ruf des Meisters, der schon an der Tür zu seinem Atelier stand, verscheuchte diese Gedanken.
»Wie findest du es?«, fragte Don Manuel und zeigte mit ausholender Geste auf sein neuestes Gemälde. »Ich habe vor, es dem neuen Bischof als Willkommensgeschenk zu überreichen.«
Realistisch, zu realistisch. Dalmau unterdrückte seine Antwort. Stattdessen gab er schweigend vor, das Werk zu studieren. Er brauchte es nicht allzu ausgiebig zu tun. Es war gut, aber überholt, ähnlich wie die dunklen Gemälde in den Gotteshäusern. Zu sehen war eine Stadtlandschaft mit Kirche und zwei einfachen Frauen im Vordergrund, die das Gotteshaus gerade betraten. Aber es fehlte Licht, das Licht des Impressionismus, mit dem inzwischen sogar viele Freunde des Meisters in ihren Gemälden spielten. Dem neuen Bischof würde es vermutlich gefallen. Es hatte etwas Nostalgisches. Ansonsten vermittelte das Bild kaum weitere Empfindungen außer Frömmigkeit und Religionseifer. »Wie findest du es?« Es war jedes Mal das Gleiche: Sein Urteil würde Dalmau nur Probleme bereiten. Er war an den Meister gebunden. Dabei ging es nicht nur um seine Arbeit in der Keramikfabrik. Im Januar hatte in Barcelona das Losverfahren zur Einberufung der Wehrpflichtigen im Alter von neunzehn Jahren, Dalmaus Jahrgang, stattgefunden, um die Heeresreihen zu verstärken. Das Glück hatte nicht auf seiner Seite gestanden, sein Name war gezogen worden. Zwölf Jahre in den Fängen der Armee! Die ersten drei aktiv in irgendeiner Kaserne, danach drei in aktiver Reserve und die restlichen sechs in der zweiten Reserve. Der Ruin für jeden jungen Mann, der seine Ausbildung und sein Leben, seine oft unabdingbare Erwerbstätigkeit angesichts der kaum vorhandenen Ersparnisse einer Arbeiterfamilie wenigstens für die ersten drei aktiven Jahre unterbrach. Josefa, seine Mutter, erlitt einen leichten Schwindelanfall, als sie davon erfuhr. Montserrat und Emma wetterten gegen den Staat, die Armee, die Reichen und die Pfarrer, dann weinten sie, Emma untröstlich, als sie begriff, dass sie dadurch ihren Liebsten verlor. Don Manuel Bello dagegen beklagte sich, stieß eine zurückhaltende Verwünschung aus, wie es sich für einen guten Christen gehörte, schnaubte, und nachdem er einige Minuten nachgedacht hatte, bot er Dalmau an, ihm die nötige Summe für seinen Freikauf zu leihen, die Lösung, mit der sich die Reichen dem Wehrdienst entzogen und die weniger Reichen bis über den Hals verschuldeten: tausendfünfhundert Goldpesetas!
Dalmau besprach sich mit seiner Familie. Sie waren einverstanden, auch wenn sie den Meister für einen verbohrten Katholiken hielten, einen Bürger und wohlhabenden Industriellen, alles, wogegen sie bislang gekämpft hatten. Dalmaus Vater Tomás hatte zu Unrecht deswegen sein Leben gelassen. Don Manuel war geradezu die Verkörperung dieser Macht, die die Arbeiter unterdrückte, beraubte und ausbeutete und gegen die sich die Mädchen nun auflehnten.
»Und du, was meinst du, mein Sohn?« Josefas Frage brachte die Klagen der beiden anderen zum Verstummen.
»Ich will einfach nur zeichnen, malen und bei euch sein. Egal, ob mir dafür dieser, jener oder irgendein anderer tausendfünfhundert Goldpesetas leihen muss, damit ich mich vom Wehrdienst freikaufen kann.«
Sie unterzeichneten einen Darlehensvertrag, den Don Manuels Anwalt vorbereitet hatte. Der Anwalt überflog das Dokument und bestätigte nickend, was sein Assistent verfasst hatte. »Ganz normal. Das Übliche. Gut. Genau«, wiederholte er immer wieder.
»Du hast Glück, mein Junge, dass du einen so großzügigen Meister hast wie Don Manuel«, wandte sich der Anwalt an Dalmau und wies ihn mit dem Finger an, am Ende des Dokuments zu unterzeichnen.
Dalmau würde das Darlehen in Raten von hundert Pesetas pro Jahr plus Zinsen zurückzahlen, so viel hatte er in der Anwaltskanzlei mitbekommen. Den restlichen, mehrere Seiten langen Vertragsinhalt wollte er sich später trotzdem nicht durchlesen, und nachdem er seine Mutter hatte unterschreiben lassen, da er mit seinen neunzehn Jahren noch als minderjährig galt, steckte er eine Kopie in seine Dokumentenmappe und legte die seines Meisters bereit, um sie ihm am nächsten Tag zu übergeben. Was hatte es schon für eine Bedeutung, was darin stand? Er arbeitete für Don Manuel, der ihn gut bezahlte, und genau ihm, der ihn bezahlte, schuldete er das Geld.
Und jetzt sollte er das Bild kritisieren, das derjenige gemalt hatte, dem er es zu verdanken hatte, nicht in irgendeinem fernen Winkel Spaniens kaserniert zu sein. Das Gemälde gefiel ihm nicht. Er fand es dunkel und antiquiert, es löste nicht die geringste Empfindung in ihm aus. Aber wie konnte er Don Manuel seine wahre Meinung sagen? Er suchte nach einer Antwort, die keine glatte Lüge war.
»Man kann die Gebete aus dem Mund der beiden Kirchgängerinnen hören.« Er sprach ernst und leise, als wollte er die beiden Frauen nicht bei ihrer Andacht stören.
Auf Don Manuels Gesicht erschien ein seliges Lächeln, das nicht einmal seine Koteletten und sein buschiger Schnauzer verbergen konnten. Stolz richtete er sich auf.
Am Abend desselben Tages lief Dalmau zerstreut mit der Menschenmenge durch den Stadtteil Sant Antoni. Er hatte Paco gebeten, ihm vor Einbruch der Dunkelheit Bescheid zu geben, und der alte Wächter hatte sich einmal mehr den Spaß erlaubt, den Hahn der Gasleuchten in der Werkstatt zuzudrehen, während der junge Mann noch in seine Arbeit vertieft gewesen war.
»Was soll das?«, protestierte Dalmau, als er in seiner Arbeit unterbrochen wurde.
Dann erinnerte er sich, lächelte, warf seinen Kittel auf die Garderobe und machte sich auf den Weg zu der Gaststätte, in der Emma arbeitete, in der Calle Tamarit, in nächster Nähe zum Markt. Die Strecke von Don Manuels Fabrik im Stadtteil Les Corts ging er zu Fuß. Ohne sich zu beeilen, brauchte er etwa eine halbe Stunde, während er in fast gerader Linie immer aufs Meer zulief. Wenn die Sonne noch über Barcelona schien, machte er manchmal einen Umweg, folgte ein Stück der Avenida Diagonal und ging über den Paseo de Gràcia oder die Rambla de Catalunya in die Altstadt hinab, um sich die modernistischen Gebäude und die Reichen anzusehen, die durch diese Straßen spazierten. Aber wenn es schon spät war, so wie an diesem Tag, gefiel ihm die Atmosphäre der einfachen Viertel besser, das unablässige Treiben und der Lärm der Möbelfabriken und Schreinereien. Im Unterschied zum zentrumsferneren Les Corts war in Sant Antoni alles zu finden: Schneider, Sattler, Frisöre und Klempner zwischen Hutfabriken, Werkstätten zur Zurichtung von Hasenfellen, Herstellern von Likör oder Schnaps, Lampen und Eisenwaren.
Ständig betraten und verließen Menschen die Geschäfte, ruhig, als gäbe es keinen Kriegszustand, den einige lustlose, durch den Stadtteil schlendernde Soldaten kontrollierten. Straßenbahnen, Maultierwagen, Droschken, Pferde und Fahrräder kamen sich gefährlich in die Quere und wirbelten den Staub der ungepflasterten Straßen auf. Geschrei und Gelächter sowie der ein oder andere Streit schallten über die Straßen und vermischten sich mit den zahllosen Gerüchen in der Luft: Pökellake, Säuren, die das Atmen fast unmöglich machten, wie etwa Schwefel oder Salpeter, Lacke, Schnaps, Essig, Dünger, Fette und alle Arten von Tierleder. Dalmau stellte fest, dass sich seine Sinne für Licht, Farben, Menschen, Gerüche, Geräusche, Lärm und Freude schärften. Gern hätte er gemalt, gleich hier an Ort und Stelle, hätte all diese Eindrücke eingefangen und auf eine Leinwand übertragen, so durcheinander, wie er sie jetzt wahrnahm: Lebensblitze. Als er am Ca Bertrán, so hieß die Gaststätte, in der Emma arbeitete, ankam, befand er sich in einem merkwürdigen Zustand, den er weder als angenehm noch als beunruhigend zu definieren wagte.
Das Ca Bertrán war ein eingeschossiges Gebäude aus grobem Material, ein geräumiges Lokal voller Tische, die in drei Reihen unter einem Dach standen. Dieses wurde auf zwei Seiten durch Säulen abgestützt, um sich im Freien fortzusetzen, über der Fläche, die an die Mauer einer Seifenfabrik grenzte. Die Gaststätte war voll wie immer, schließlich gab es hier billiges Essen in einem einfachen Viertel. Für nur dreißig Céntimos kochten Bertráns Töchter den Gästen großzügige Kichererbsengerichte mit etwas Fleisch oder Kabeljau, Brot und Wein. Für ein paar Céntimos mehr wählten manche die gehaltvolle escudella mit ihrem carn d’olla, einen bunten Eintopf mit Topffleisch. Dalmau ließ den Blick durch das quirlige Lokal schweifen. Er konnte Emma nirgends entdecken, immerhin aber Bertrán, der ruhig in einer Ecke stand und aufmerksam alles überwachte. Entgegen dem verbreiteten Bild vom Bauchumfang eines Gastwirts war er ein schlanker Mann. Er grüßte Dalmau mit einem Lächeln und wies mit einer Kinnbewegung zur Küche. Dalmau erwiderte den Gruß und wandte sich in die angezeigte Richtung. In diesem Lokal genoss er gewisse Vorrechte, nicht nur, weil er Emmas Freund war, sondern auch wegen des Kohleporträts, das er einmal von Bertráns Gattin und dessen beiden Töchtern gezeichnet hatte und das, wie dieser ihm versicherte, im Esszimmer seines Hauses einen Ehrenplatz einnahm.
Dalmau betrat die Küche am Ende des Gastraums. Vor einiger Zeit hatte ihn Bertrán um ein weiteres Porträt gebeten, eins von ihm, und dieses hing nun hier über der Tür und beherrschte den Ort, an dem Likörgläser und Geld gezählt und aufbewahrt wurden. Auch unter den vier oder fünf Personen, die in der Küche hin- und herhasteten, konnte er Emma nicht entdecken. Die drei kohlebefeuerten Sparherde aus schwarzem Eisen waren anscheinend zu wenige, um die Menge an Gerichten zu kochen, die im Saal serviert wurden: Fast alle der jeweils vier konzentrischen Herdplatten waren mit gusseisernen Pfannen, Töpfen und Kasserollen belegt. In einer Ecke gab es noch eine Feuerstelle auf der Erde, und darüber hing an einer Kette mit Haken ein großer Topf, in dem es gerade brodelte.
»Sie ist draußen mit den Tellern«, sagte ihm eine von Bertráns Töchtern im Vorbeigehen. Die ganze Familie arbeitete hier.
»Steh nicht im Weg rum!«, schimpfte die zweite.
»Geh zu deiner Freundin, verdammt noch mal, und stör uns nicht«, gab ihm nun die Mutter im Befehlston zu verstehen.
Dalmau gehorchte und ging in den Hinterhof, in dem sich die Kohle und allerlei unbrauchbare Gerätschaften türmten, die Bertrán stur aufbewahrte. Es dämmerte. Die Sonne hinterließ einen roten Streifen am Himmel, der in dem jungen Mann die Gefühle wiederbelebte, mit denen er die Gaststätte betreten hatte. Er glaubte, Emma in einer Gestalt im Gegenlicht zu erkennen. Sie wandte ihm den Rücken zu und stand gebeugt über einem Haufen Sand, den sie zum Scheuern der schmutzigen Teller benutzte. Zwei Jungen, die an diesem Abend Reste essen würden, halfen ihr dabei. Dalmau ging leise zu ihr, schlang seine Arme um ihre Taille und drückte sein Glied kräftig gegen ihren Po.
»Hey!«, schrie Emma und richtete sich brüsk auf.
Dalmau ließ sie nicht los.
»Ich hatte schon Angst, du erschrickst gar nicht«, flüsterte er ihr ins Ohr und klammerte sich noch fester an sie.
»Das ist meine normale Reaktion, wenn ich von hinten überfallen werde«, spottete Emma. »Ihr beiden scheuert weiter!«, mahnte sie die beiden Jungen, die ihnen versonnen zusahen.
»Warum gehen wir nicht irgendwohin?«, schlug Dalmau vor und küsste sie auf den Hals.
»Weil ich zuerst mit den Tellern fertig werden muss«, entgegnete die junge Frau.
»Und warum übernehmen nicht die zwei da den Rest?«, schlug er vor.
»Weil sie, sobald ich ihnen den Rücken zuwende, mit den Tellern, dem Trog und sogar dem Sand abhauen. Warte, es ist nicht mehr viel, wenn du mich lässt. Siehst du?«
Dalmau hielt sie immer noch fest, lockerte aber seine Umarmung, als wäre er bereit, sie ihre Arbeit machen zu lassen.
»Du könntest ruhig mithelfen«, tadelte ihn Emma.
»Ich? Ein Künstler? Meine Hände!« Er scherzte.
»Soll ich dir sagen, was deine Hände heute Nacht zu fassen bekommen werden?«
Mit Dalmaus Hilfe waren sie bald fertig und verabschiedeten sich von den Bertráns, Vater, Frau und Töchtern. Eilig liefen sie zur Wohnung von Emmas Onkel, bei dem sie seit dem Tod ihrer Eltern lebte.
»Heute hat er Nachtschicht im Schlachthaus«, beruhigte sie Dalmau.
»Und deine Cousins?«
Emma zuckte die Achseln.
»Wenn sie auftauchen, werden sie es verstehen. Und wenn sie es nicht verstehen, werden sie es aushalten müssen.«
Es war eine Mietwohnung, eine von Tausenden, die die reichen Bürger im Eixample von Barcelona hatten bauen lassen, um sie an eine Arbeitermasse zu vermieten, die wegen der Immigranten stetig anwuchs. Die Gebäude aus Backstein – zuerst »Treppenhäuser« und später »Bauten im katalanischen Stil« genannt – gehorchten vor allem dem Prinzip der Sparsamkeit, und ihre schwächlichen Backsteinwände trugen bis zu sieben Stockwerke. Die Baumeister behaupteten, im Verhältnis zum auf ihnen lastenden Gewicht hätten sie die dünnsten tragenden Wände der Welt.
Es handelte sich um hierarchisierte Gebäude, in denen die Qualität der Wohnungen nach oben hin abnahm.
Die Wohnung von Emmas Onkel war eine der höher gelegenen, trotzdem war sie um einiges geräumiger und luftiger als die Wohnungen in der Altstadt.
Emma verriegelte die Tür eines der beiden Schlafzimmer, das sie mit ihrer Cousine teilte, zündete ein paar Kerzen an und versetzte Dalmau im Umdrehen einen so heftigen Stoß, dass er auf dem Bett zu sitzen kam. Sie stellte sich vor ihn, nahm seinen Kopf und drückte ihn gegen ihre Scham.
»Wo ist denn dein Feuer geblieben?«, fragte sie und rieb sich gleichzeitig an seinem Gesicht.