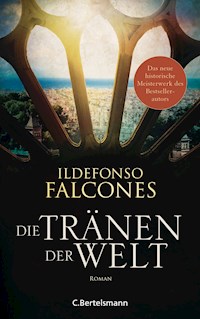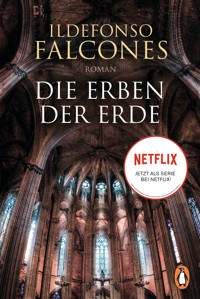
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. Bertelsmann Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Kathedrale-des-Meeres-Reihe
- Sprache: Deutsch
Die lange erwartete Fortsetzung des Weltbestsellers und der großen NETFLIX-Serie "Die Kathedrale des Meeres"
Millionen von Lesern waren fasziniert von Arnau Estanyols Geschichte, der beim Bau der Kirche Santa Maria mithalf. Nun erzählt Ildefonso Falcones in seinem neuen aufregenden Sittengemälde wieder von Loyalität und von Rache, aber auch von der Liebe und den Träumen der Menschen.
Wir schreiben das Jahr 1387. In Barcelona begegnen wir dem zwölfjährigen Hugo Llor, dem Sohn eines verstorbenen Seemanns. Aber wir begegnen auch Arnau Estanyol wieder, dem Werftbesitzer, der sich um den Jungen kümmert. Hugos Jugendträume werden mit der unbarmherzigen Realität konfrontiert. Und er wird sich in den Weinbergen neue Arbeit suchen - und so die schöne Nichte des jüdischen Weinbergsbesitzers kennen und lieben lernen. Doch er muss miterleben, wie unerbittlich der Hass auf Volksgruppen sein kann.
Ildefonso Falcones breitet wieder ein großes historisches Panorama aus, das auch eine Liebeserklärung an die Stadt Barcelona ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1457
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Ildefonso Falcones
DIE ERBEN DER ERDE
Roman
Aus dem Spanischen vonMichaela Meßner, Laura Haber und Carsten Regling
C. Bertelsmann
Die Originalausgabe erschien 2016 unter den Titel »Los Herederos de la Tierra« bei Penguin Random House Grupo Editorial, Barcelona.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2016 by Ildefonso Falcones de Sierra
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2018 beim C. Bertelsmann Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Cover: www.buerosued.de, München
Covermotiv: Arcangel/Trevor Payne
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-23004-3V005
www.penguin.de
Erster TeilZwischen Meer und Land
1
Barcelona, 4. Januar 1387
Die See war aufgewühlt, der Himmel grau und bleiern. Am Strand standen die Werftarbeiter, Hafenschiffer, Seemänner und Bastaixos in gespannter Erwartung. Einige rieben sich die Hände oder klopften sich warm, andere suchten sich vor dem eisigen Wind zu schützen. Kaum einer sprach. Stumme Blicke wurden gewechselt, dann sah man wieder auf die Wellen, die sich kraftvoll am Ufer brachen. Die mächtige königliche Galeere mit ihren dreißig Ruderbänken zu jeder Seite war rettungslos den Unbilden des Sturms ausgeliefert. In den vergangenen Tagen hatten sich die Mestres d’aixa, die Schiffsbaumeister der Werft, mit den Lehrburschen und Seemännern darangemacht, sämtliche Apparaturen und alles Zubehör vom Schiff abzumontieren: die Steuerruder und Kolderstöcke, die Ausrüstung, die Segel, Masten und Ruderbänke mitsamt den Rudern …
Was nicht niet- und nagelfest war, hatten die Hafenschiffer zum Strand geschafft und an die Bastaixos übergeben, die alles auf die Lager verteilten. Sie hatten drei Anker fest im Grund verhakt zurückgelassen, die nun an der Santa Marta zerrten, welche nur mehr ein riesiges schutzloses Gerippe war, gegen das die Wellen anbrandeten.
Hugo, ein zwölfjähriger Junge mit kastanienbraunem Haar, Hände und Gesicht so schmutzig wie das Hemd, das ihm bis auf die Knöchel fiel, hielt den Blick seiner wachen Augen starr auf die Galeere gerichtet. Seit er mit dem Genuesen in der Werft arbeitete, hatte er schon oft dabei geholfen, Schiffe an Land zu ziehen oder vom Stapel laufen zu lassen, aber das hier war gewaltig, und der Sturm gefährdete das Gelingen ihres Manövers. Ein paar Seemänner wurden an Bord der Santa Marta geschickt, um die Anker zu lichten, damit die Hafenschiffer das Schiff an Land bringen und die dort wartenden Arbeiter es zum Überwintern ins Innere der Werft ziehen konnten. Die Arbeit war mühevoll und außerordentlich anstrengend, es kamen Seilzüge und Spillen zum Einsatz, die helfen sollten, das Schiff, sobald es auf Sand gelaufen war, an Land zu ziehen. Neben Genua, Pisa und Venedig war Barcelona eine der größten Schiffsbaustätten, und doch hatte es keinen Hafen, gab es dort keine schützenden Buchten und Dämme, die die Arbeit hätten erleichtern können. Das Meeresufer vor der Stadt war ein einziger offener Strand.
»Anemmu, Hugo!«, befahl ihm der Genuese. Hugo sah den Mestre d’aixa verwundert an. »Aber …«, wagte er zaghaft einzuwenden.
»Tu, was ich dir sage«, fiel der Genuese ihm ins Wort, ehe er, mit dem Kinn auf eine Schar von Männern deutend, hinzusetzte: »Der Statthalter der Werft hat gerade einem angesehenen Mann aus der Gilde der Hafenschiffer die Hand gegeben. Sie sind sich also handelseinig geworden, welchen Preis der König ihnen zahlen soll. Bei dem Sturm ist das alles ein höchst gefährliches Manöver. Wir werden das Schiff aus dem Wasser ziehen! Anemmu«, sagte er erneut.
Hugo bückte sich und packte die Eisenkugel, die der Genuese am rechten Knöchel an einer Kette mit sich herumschleppte, wuchtete sie unter Aufbietung all seiner Kräfte hoch und hielt sie dann gegen den Bauch gepresst.
»Bist du bereit?«, fragte der Genuese.
»Ja.«
»Der Oberste Baumeister erwartet uns.«
Der Bursche folgte ihm über den Strand, und sie bahnten sich einen Weg durch die Menschenmenge, die schon von dem Handel erfahren hatte. Alle warteten nervös auf die Anweisungen des Obersten Baumeisters. Es gab auch einige Genuesen in der Menge, die ebenfalls auf See in Gefangenschaft geraten waren und nun mit Eisenkugeln an der Flucht gehindert wurden. Sie alle waren Zwangsarbeiter der katalanischen Werft, jeder mit einem Burschen an der Seite, der die Kugel im Arm hielt.
Domenico Blasio, so hieß der Genuese, dem Hugo Geleit gab, zählte zu den besten Mestres d’aixa des Mittelmeers, und man durfte behaupten, dass er sogar den Obersten Baumeister in den Schatten stellte. Blasio hatte Hugo als Lehrjungen eingestellt, nachdem Herr Arnau Estanyol und Juan der Navarrer, ein Mann mit gewaltigem Wanst und rundem Kahlkopf, ihn darum gebeten hatten. Zu Anfang hatte der Genuese ihn ein wenig zurückhaltend behandelt. Doch seit Pedro III., genannt der Prächtige, mit den Herrschern von Genua einen prekären Friedensvertrag unterzeichnet hatte, gaben sich alle gefangenen Werftarbeiter der Hoffnung hin, man werde zunächst die katalanischen Gefangenen in die Freiheit entlassen und dann ein Gleiches mit den Genuesen tun. Und so hatte der Meister sich auf Hugo gestürzt und begonnen, ihn in die Geheimnisse eines der Berufe einzuweisen, die im gesamten Mittelmeerraum am meisten geschätzt wurden: in die Geheimnisse des Schiffsbaus.
Als der Genuese sich dem Kreis der anderen hohen Persönlichkeiten und Mestres rund um den Obersten Baumeister zugesellt hatte, legte Hugo die Kugel im Sand ab. Er suchte den Strand mit den Augen ab. Die Spannung stieg. Unter den Gehilfen, die die Zugtiere vorbereiteten, gab es ein beständiges Hin und Her und viel Geschrei, man warf sich aufmunternde Rufe zu oder klopfte sich auf den Rücken. Es galt, dem Wind, der Kälte und dem nebelverhangenen Licht zu trotzen, das in einem Land, das die Sonne mit ihrem ewigen Strahlen beschenkte, so fremd war. Hugos Aufgabe bestand zwar bloß darin, die Eisenkugel des Genuesen zu tragen, doch er war stolz, diesem Trupp anzugehören. Es hatten sich viele Schaulustige am Meeresufer eingefunden. Sie applaudierten den Arbeitern und feuerten sie mit ihren Rufen an. Der Junge beobachtete die Seeleute, die Schaufeln trugen, um den Sand unter der Galeere auszugraben, dann die Männer, welche die Spillen, Seilrollen und Taue vorbereiteten. Andere schleppten die hölzernen Schienen herbei, die mit Fett eingestrichen und mit Gras bedeckt wurden, damit das Schiff gut darübergleiten konnte, oder trugen lange Stangen zum Strand, während die Bastaixos sich bereit machten, das Schiff an Land zu ziehen.
Hugo vergaß den Genuesen und lief zu der Schar von Bastaixos hinüber, die sich am Strand versammelt hatte. Er wurde herzlich begrüßt, hier und da mit einem freundschaftlichen Schlag ins Genick. »Wo hast du denn die Kugel gelassen?«, fragte einer und lockerte ein wenig den Ernst und die Anspannung der Versammelten. Sie kannten ihn alle, zumindest wussten sie, dass Herr Arnau Estanyol ihm große Zuneigung entgegenbrachte, der altehrwürdige Herr, der im Innern des Kreises stand und neben den kräftigen Zunftmeistern der Bastaixos von Barcelona recht schmächtig wirkte. Alle wussten, wer Arnau Estanyol war, und seine Geschichte flößte ihnen Bewunderung ein. Es gab immer noch etliche Zeitzeugen, die erzählen konnten, wie viele Dienste er der Zunft und ihren Mitgliedern schon erwiesen hatte. Hugo stellte sich still und leise neben ihn. Der alte Herr strich ihm übers Haar, ohne den Gesprächsfaden zu verlieren. Sie sprachen über die Gefahren, die den Bootsführern drohten, wenn sie die Galeere an Land zogen, und welche Gefahr sie selbst liefen, sollte das Schiff weit draußen auf einer Sandbank stranden und sie müssten hinüber, um es festzumachen. Der Wellengang war gewaltig, und die wenigsten Bastaixos konnten schwimmen.
»Hugo!«, hörte er eine laute Stimme.
»Hast du den Meister schon wieder allein gelassen?«, fragte Arnau.
»Er muss ja noch nicht arbeiten«, entschuldigte sich der Bursche.
»Geh zu ihm!«
»Aber …«
»Nun mach schon!«
Hugo lief zurück, nahm die Kugel in den Arm und folgte dem Genuesen über den Strand, während dieser dem einen oder anderen Arbeiter einen Befehl erteilte. Der Oberste Baumeister und die Handwerker respektierten Domenico. Niemand stellte sein großes Können als Mestre d’aixa infrage. In dem Moment, da es den Hafenschiffern gelang, zur Santa Marta zu kommen, die Seile zu packen, die Anker zu lichten und die Galeere langsam Richtung Ufer zu ziehen, brandete Begeisterung auf. Vier Boote zogen die Galeere, zwei zu jeder Seite. Einige beobachteten das Geschehen mit Entsetzen. In ihren Gesichtern und verkrampften Händen spiegelte sich die Angst. Aber die meisten ließen sich mitreißen, und ihre aufmunternden Zurufe steigerten sich zu einem entfesselten Kreischen.
»Lass dich nicht ablenken, Hugo«, ermahnte ihn der Genuese, doch der Junge starrte unverwandt zu dem Schauspiel hinüber, das auch die Menge in Bann geschlagen hatte: Ein Schiff drohte zu kentern, und ein paar Hafenschiffer waren ins Wasser gefallen. Würde es ihnen gelingen, wieder an Bord zu kommen?
»Meister?« Er stellte die Frage, ohne den Blick von den Hafenschiffern losreißen zu können, die sich vollkommen verausgabten, um das Leben ihrer Gefährten zu retten. Durch das Manöver des vierten Bootes bekam die Santa Marta Schlagseite.
Hugo zitterte. Die Szene erinnerte ihn an einen anderen Vorfall. Seeleute hatten ihm erzählt, dass sie mit eigenen Augen gesehen hatten, wie sein Vater vor einigen Jahren auf einer Reise nach Sizilien von den Wellen verschlungen worden war. Der Genuese verstand ihn, denn er kannte Hugos Geschichte, und auch ihn hatte das Drama, das sich vor ihren Augen abspielte, in seinen Bann geschlagen.
Einem der Schiffer war es gelungen, sich an Bord zu hieven, der andere kämpfte in den Wellen noch verzweifelt um sein Leben. Sie würden ihn nicht im Stich lassen. Das Schiff, das von der gleichen Seite an der Galeere zog wie das erste, machte die Leinen los und fuhr zu der Stelle, wo der Hafenschiffer mit einem verzweifelten Winken in den Fluten verschwunden war. Gleich darauf waren die wedelnden Arme noch einmal kurz zu sehen gewesen. Die Strömung trug den Mann aufs offene Meer hinaus. Nun machte auch das erste Schiff die Leinen los, und die beiden Schiffe von der anderen Seite schlossen sich ebenfalls an.
Hugo spürte, wie die Hände des Meisters aus Genua sich in seine Schultern krallten. Die Rettungsbemühungen gingen weiter, obwohl just in dem Moment die davontreibende Santa Marta bei der kleinen Mole von Sant Damià auf Grund lief. Ein paar wenige sahen kurz hinüber, doch gleich darauf richteten sie ihre Aufmerksamkeit erneut auf die Schiffe. Eines der Schiffe machte ein deutliches Zeichen, was einer für ein gutes Omen hielt und sogleich auf die Knie fiel, aber der Mehrheit schien es nicht zu genügen. Und wenn es doch ein Irrtum war? Noch mehr Zeichen, jetzt von allen Schiffen. Etliche Arme wurden in die Höhe gereckt, triumphierend, mit geballter Faust. Schon war kein Zweifel mehr: Sie kehrten zurück. Sie ruderten zum Strand, wo die Leute einander lachend in die Arme fielen oder in Tränen ausbrachen.
Hugo spürte, wie erleichtert der Meister war, aber er selbst zitterte noch immer. Niemand hatte damals etwas für seinen Vater tun können, das hatte man ihm versichert. Jetzt stellte er sich vor, wie er mit rudernden Armen um Hilfe gerufen hatte, ganz wie soeben der Schiffer in den Wellen.
Der Genuese strich ihm zärtlich von hinten übers Gesicht.
»Das Meer kann so grausam sein«, flüsterte er ihm zu. »Vielleicht hat heute dein Vater aus der Tiefe der Meeresfluten heraus diesem Mann geholfen.«
Unterdessen wurde die Santa Marta wieder und wieder von den Wellen gepackt, bis sie an den Felsen der Mole zerschellte.
»Das haben sie nun davon, dass sie es zulassen, dass die Schiffe jetzt auch außerhalb der Zeit zwischen April und Oktober fahren dürfen, auf die man früher die Schifffahrt beschränkte«, erklärte Arnau Hugo.
Die beiden waren am Tag nach dem Unglück der Santa Marta auf dem Weg ins Ribera-Viertel. Die Männer von der Werft sammelten das Treibholz, das von der Galeere an den Strand gespült wurde, sie versuchten, von der kleinen Mole von Sant Damià aus so viel wie möglich zu retten. Dort konnte der Genuese mit seiner Kugel am Bein nicht arbeiten, und so kamen sie in den Genuss eines freien Tages, der noch um einen weiteren Feiertag verlängert wurde: das Dreikönigsfest.
»Heute«, erläuterte Herr Arnau weiter, »bauen wir bessere Galeeren, die mehr Bänke und mehr Ruder haben, die aus besserem Holz und besserem Eisen gemacht sind und von Schiffsbaumeistern mit größeren Kenntnissen entworfen wurden. Unsere Erfahrungen im Schiffsbau haben uns vorangebracht, und jetzt gibt es sogar schon Schiffer, die sich im Winter aufs Wasser trauen. Sie vergessen, dass das Meer dem Waghalsigen nichts verzeiht.«
Sie gingen zur Pfarrei von Santa María del Mar, um in die Armenkasse der Kirche das Geld einzuzahlen, das sie beim Betteln von Haus zu Haus gesammelt hatten. Diese Wohlfahrtseinrichtung erfreute sich guter Einkünfte; sie besaß Weinberge, Häuser, Werkstätten und zog Pachtgelder ein. Doch Herr Arnau hatte großen Gefallen daran, die Menschen um milde Gaben zu ersuchen, wie es für die Verwalter der Armenkasse Pflicht war, und seit er Hugos Familie seine Hilfe zuteilwerden ließ, half ihm der Junge bei der Kollekte, die später allen Bedürftigen zugutekam. Hugo kannte die Geber, aber nie die Empfänger.
»Sagt mir nur, warum …«, hub der Junge an und verstummte. Mit einer zärtlichen Geste ermunterte Arnau ihn zum Weiterreden. »Warum verbringt ein Mann wie Ihr … seine Zeit mit Betteln?«
Arnau lächelte geduldig, ehe er antwortete.
»Für die Bedürftigen um Almosen zu bitten, ist ein Privileg, eine Gnade Gottes, nichts, wofür man verspottet werden könnte. Keiner von denen, bei denen wir vorsprechen, würde Menschen, von denen er nicht weiß, ob er ihnen vertrauen kann, auch nur ein einziges Geldstück geben. Die Treuhänder der Armenkasse von Santa María del Mar müssen angesehene Männer aus Barcelona sein und selbst für die Armen betteln gehen. Und weißt du, was? Wir Treuhänder sind nicht verpflichtet, Rechenschaft abzulegen, wofür wir das Geld aus der Armenkasse verwenden. Niemandem gegenüber, nicht einmal dem Erzdiakon von Santa María … ja, nicht einmal gegenüber dem Bischof!«
Früher hatte Hugo Meister Arnau bei dieser Aufgabe begleitet, bis er in der Werft bei dem Genuesen Arbeit fand, von dem er lernen sollte, wie man Schiffe baut, um später selbst ein Schiffsbaumeister zu werden. Bevor Hugo in der Werft zu arbeiten anfing, hatte Arnau bereits eine Anstellung für Hugos kleine Schwester Arsenda gefunden, die einer Nonne im Kloster María Jonqueres als Dienstmagd zur Hand ging. Die Nonne wollte das Mädchen ernähren und erziehen, wollte eine tüchtige Frau aus ihr machen und sie nach zehn Jahren mit einer Mitgift von zwanzig Pfund bedenken, auf dass sie sich einen Ehemann suchen konnte; das alles wurde in dem Vertrag niedergelegt, den Arnau mit der Nonne geschlossen hatte.
Die Begeisterung, mit der Hugo sich auf die Arbeit in der Werft stürzte, obwohl seine einzige Aufgabe vorläufig darin bestand, die Kugel des Genuesen zu tragen, war dennoch getrübt aufgrund der Folgen, die das für seine Mutter Antonina hatte.
»Ich soll in der Werft wohnen? Dort nächtigen?«, hatte er verängstigt gefragt, als sie mit ihm über seine neue Beschäftigung gesprochen hatte. »Wieso kann ich nicht arbeiten und dann nach Hause kommen, um bei Euch zu nächtigen, wie sonst auch?«
»Weil du dann nicht mehr hier wohnen kannst«, erwiderte Antonina mit sanfter Stimme.
Der Junge schüttelte den Kopf.
»Das ist unser Haus.«
»Ich kann es mir nicht leisten, Hugo«, gestand sie. »Arme Witwen, die noch dazu Kinder haben, sind wie nutzlose Greisinnen: Wir finden kein Auskommen in dieser Stadt. Das solltest du eigentlich wissen.«
»Aber Herr Arnau …«
Antonina unterbrach ihn wieder: »Der werte Herr Arnau hat eine Arbeit für mich gefunden, bei der ich Kleidung, Kost und Logis und vielleicht ein wenig Geld bekommen kann. Wenn deine Schwester im Kloster ist und du in der Werft bist, was soll ich dann hier allein?«
»Nein!«, schrie Hugo, sich an sie klammernd.
Barcelonas königliche Werft lag direkt am Meer. Sie bestand aus einem achtschiffigen, von Pfeilern gestützten und mit Satteldächern bedeckten Gebäude. Dahinter öffnete sich ein geräumiger Innenhof, der den Bau großer Galeeren ermöglichte. Hinter diesem gab es ein weiteres achtschiffiges Gebäude, ebenso hoch, ebenso nach den Seiten hin offen, ebenso geeignet, Schiffe zu bauen, zu reparieren oder zu beherbergen. Das Opus magnum, mit dessen Bau bereits zur Zeit von König Jaime begonnen worden war und für das später Peter III., der Prächtige, die Schirmherrschaft übernommen hatte, kulminierte in mächtigen Türmen an den Ecken des Gebäudekomplexes.
Neben den Hallen, Türmen und Wasserbecken zur Feuchthaltung des Holzes gab es Lagerräume, in denen alles Zeug und Zubehör für die Galeeren aufbewahrt wurde: Holz und Werkzeug, Ruder und Waffen, Armbrüste, Pfeile, Lanzen, Sensen, Handschwerter und Handbeile. Es gab Krüge mit ungelöschtem Kalk, die man den Feinden beim Angriff ins Gesicht kippte, damit sie erblindeten, wieder andere mit Seife, auf der die Seemänner ausrutschten, oder mit Pech, mit dem die gegnerischen Schiffe in Brand gesetzt wurden. Es gab mannshohe Schilde, die man entlang der Schiffsflanken aufstellte, um die Ruderer zu schützen, sobald der Kampf begonnen hatte; Leder, mit dem man den Rumpf schützte, damit der Feind ihn nicht in Brand setzen konnte; Kerzen, Bänder und Nägel, Ketten, Anker, Masten, Schiffslaternen sowie eine Unmenge an sonstigen Gerätschaften und Takelagezubehör.
Die Werft erhob sich am Stadtrand von Barcelona, auf der anderen Seite von Santa María del Mar, beim Kloster Framenors, doch während die Mönche sich durch die alten Stadtmauern geschützt wussten, wartete man in der Werft immer noch darauf, dass die Mauern, deren Bau Pedro III. angeordnet hatte, sie endlich umschließen würden.
Antonina hatte Hugo nicht begleitet.
»Du bist jetzt ein Mann, mein Sohn. Denk an deinen Vater.«
Arnau hatte das verstanden und Hugo sanft bei der Schulter gefasst.
»Ihr werdet euch auch weiterhin sehen«, hatte er ihm versichert, als der Junge sich im Fortgehen zu seiner Mutter umwandte.
Schon nach wenigen Tagen hatte Hugo sich an seine neue Umgebung gewöhnt. Einmal war er in die Stadt gegangen, um seine Mutter zu besuchen. Herr Arnau hatte ihm erzählt, sie arbeite jetzt als Dienstmädchen im Haus eines Handschuhmachers in der Calle Canals, beim Rec Comtal hinter der Kirche Santa María.
»Na, wenn das dein Sohn ist, dann schick ihn sofort weg!«, hatte die Gattin des Handschuhmachers derb auf Antoninas schüchterne Entschuldigung reagiert, mit der sie sich zu verteidigen suchte, als ihre Herrin sie dabei überrascht hatte, wie sie sich in der Tür umarmten. »Du bist zu nichts zu gebrauchen. Du kennst dich nur mit Fisch aus, das ist auch schon fast alles. Du hast nie in einem reichen Haushalt gearbeitet. Und du!« Sie hatte auf Hugo gedeutet. »Sieh zu, dass du verschwindest!«
Dann hatte sie wachsam beobachtet, wie Hugo bedrückt davongegangen war. Was es ihm jedoch nicht erspart hatte, die wütenden Beschimpfungen mit anhören zu müssen, die auf seine Mutter niedergingen, kaum dass sich hinter ihm die Tür geschlossen hatte.
Hugo ging seitdem immer wieder in die Calle Canals, in der Hoffnung, seine Mutter zu sehen. Das nächste Mal blieb er in einiger Entfernung stehen, ohne in dem engen Gässchen ein geeignetes Versteck zu finden. »Was machst du da, du Rotzlöffel!«, rief ihm eine Frau aus einem Fenster zu. »Bist wohl aufs Stehlen aus? Scher dich fort!« Bei dem Gedanken, ihr Geschrei könnte die Frau des Handschuhmachers anlocken und seiner Mutter weitere Schelte eintragen, ging er schnell weiter.
Von da an ging er nur noch durch die Calle Canals, als wollte er gerade woandershin oder käme zufällig vorbei, trödelte dann vor dem Haus des Handschuhmachers ein wenig herum und summte das Liedchen, das sein Vater immer gepfiffen hatte. Doch er bekam sie kein einziges Mal zu Gesicht.
Wenn er dann die Calle Canals hinter sich ließ und sich mit dem Gedanken tröstete, dass er sie am Sonntag bei der Messe sehen würde, ging Hugo ins Ribera-Viertel, um nach Herrn Arnau zu suchen, entweder in Santa María del Mar oder in seinem Haus, in dem noch andere Seeleute wohnten, oder vielleicht auch an seinem Schreibtisch, an dem er jedoch immer seltener saß und den er seinen Gesellen überantwortet hatte. Traf er ihn auch dort nicht an, suchte er ihn auf der Straße. Die Leute im Ribera-Viertel kannten Arnau Estanyol gut, und die meisten achteten ihn. Hugo musste nur nach ihm fragen, in der Bäckerei in der Calle Ample oder in der Metzgerei del Mar, in den beiden Fischläden oder beim Käser.
In dieser Zeit erfuhr er, dass Herr Arnau eine Frau hatte, die Mar genannt wurde. »Tochter eines Bastaix«, sagte der alte Mann stolz. Und auch, dass er einen Sohn hatte, Bernat, der etwas älter war als er selbst.
»Zwölf bist du?«, fragte Arnau, nachdem Hugo ihm noch einmal sein Alter genannt hatte. »Bernat ist gerade sechzehn geworden. Er ist jetzt im Konsulat in Alexandria, lernt dort Handel und Schifffahrt. Ich denke, er wird bald wieder nach Hause kommen. Ich will mich um keinen Handel mehr kümmern müssen. Ich bin zu alt!«
»Sagt doch so etwas nicht!«
»Keine Widerrede!«, fiel Arnau ihm ins Wort.
Hugo nickte ergeben, als Herr Arnau sich auf ihn stützte und sie weitergingen. Es gefiel ihm, dass Herr Arnau sich auf ihn stützte. Er kam sich dann wichtig vor, während die anderen Leute ihre Aufwartung machten, und es machte ihm sogar Spaß, ihre Grüße zu erwidern, manchmal so übertrieben, dass Hugo bei der Verbeugung fast das Gleichgewicht verlor.
»So tief sollte man sich vor niemandem verbeugen«, lautete der Rat, den Arnau ihm eines Tages gab. Hugo antwortete nicht. Arnau wartete ab – er wusste, dass Hugo antworten würde, er kannte ihn.
»Ihr könnt es wagen, euch nicht zu verneigen, Ihr seid ein allseits geachteter Bürger«, sagte der Junge schließlich, »ich dagegen …«
»Wenn du dich da nicht irrst«, erwiderte Arnau. »Dass ich ein geachteter Bürger wurde, verdanke ich vielleicht gerade der Tatsache, dass ich mich nie vor irgendjemandem verbeugt habe.«
Darauf erwiderte Hugo nichts. Doch Arnau hörte auch gar nicht mehr zu – in Gedanken war er zu dem Tag zurückgekehrt, an dem er auf Knien durch den Salon der Puigs gerutscht war, um die Füße von Margarida zu küssen. Die Puigs, Verwandte der Estanyols, die reich und arrogant geworden waren, hatten Arnau und dessen Vater Bernat erniedrigt und dafür gesorgt, dass Letzterer wie ein gewöhnlicher Verbrecher auf der Plaza del Blat gehenkt worden war. Margarida hasste ihn aus tiefster Seele. Obgleich seither schon so viel Zeit vergangen war, lief ihm immer noch ein Schauder über den Rücken, wenn er an sie dachte. Er hatte nie wieder etwas von ihnen gehört.
An jenem Tag im Januar 1387, als sie gerade auf dem Weg zur Kirche Santa María del Mar waren, erinnerte Hugo sich an den Rat, den Arnau ihm damals gegeben hatte, und lächelte. »Du darfst dich vor niemandem verneigen.« Was hatte er schon Ohrfeigen und Fußtritte erhalten, weil er diesem Rat gefolgt war! Aber Herr Arnau hatte recht behalten: Nach jedem Streit hatten die Burschen von der Werft größere Hochachtung vor ihm gehabt, auch wenn die Auseinandersetzungen mit den Älteren meist damit endeten, dass sie ihn kräftig durchprügelten.
Sie überquerten gerade den Pla d’en Llull hinter der Plaza del Born an der Kirche Santa María del Mar, als in der Ferne Glocken zu läuten begannen. Arnau blieb stehen, wie viele andere Bürger auch – dieses Geläut rief nicht zu den Waffen.
»Das ist das Totengeläut«, murmelte der alte Mann. »König Pedro ist gestorben.«
Er hatte noch nicht zu Ende gesprochen, als die Glocken von Santa María einfielen. Dann folgten die Glocken von Sant Just i Pastor und von Santa Clara und von Framenors … Innerhalb kurzer Zeit hatten sämtliche Glocken Barcelonas und der Umgebung das Trauergeläut angestimmt.
»Der König …!«, hallte es durch die Straßen. »Der König ist tot!«
Hugo glaubte Kummer in Herrn Arnaus Miene zu erkennen.
»Habt Ihr König Pedro sehr geschätzt?«
Arnau verzog nur den Mund und schüttelte den Kopf. Ich habe eine Schlange geheiratet, seine Ziehtochter, eine böse Frau, wie man sich keine schlimmere denken kann, hätte er antworten können.
»Und seinen Sohn?«, ließ der Junge nicht locker.
»Prinz Juan?« Der hat den Tod eines des besten Menschen auf dieser Welt verschuldet, hätte Arnau am liebsten geantwortet. Die Erinnerung an Hasdai, der auf dem Scheiterhaufen verbrannt war, bereitete ihm bis heute Qualen: der Mann, der ihm das Leben gerettet hatte, nachdem er das Gleiche mit seinen Kindern getan hatte, der Jude, der ihn bei sich aufgenommen und ihn reich gemacht hatte. Wie viele Jahre waren seitdem vergangen …!
»Er ist ein schlechter Mensch«, antwortete er stattdessen. Ein Mensch, der drei Menschen auf dem Gewissen hat, setzte er für sich hinzu, drei gute Menschen, die sich für ihre Lieben und für ihre Gemeinschaft geopfert hatten.
Arnau seufzte und stützte sich schwer auf Hugo.
»Lass uns nach Hause gehen«, murmelte er. »Ich fürchte, es kommen schwere Zeiten auf Barcelona zu.«
»Warum sagt Ihr das?«, fragte Hugo verwirrt.
»Königin Sibila ist schon vor Tagen mit ihren Angehörigen und ihrem Hofstaat aus dem Palast geflohen, sobald sie die Gewissheit hatte, dass ihr Gatte sterben würde …«, erwiderte Arnau.
»Sie hat den König im Stich gelassen?«, wunderte sich Hugo.
»Unterbrich mich nicht«, wies Arnau ihn scharf zurecht. »Sie ist geflohen, weil sie sich vor der Rache fürchtete, die Prinz Juan an ihr nehmen würde … Der neue König Juan«, korrigierte er sich. »Die Königin hat ihren Stiefsohn nie sonderlich geschätzt, und dieser hat ihr immer die Schuld an allem Schlechten gegeben, auch an der Abkehr seines Vaters und dem Zerwürfnis mit ihm. Im vergangenen Jahr sprach dieser ihm den Titel und die Ehren der Statthalterschaft des Königreichs ab. Das war für den Erben eine Erniedrigung. Es wird Rache geben, ganz gewiss, Repressalien werden nicht ausbleiben«, prophezeite Arnau.
Am Tag nach dem Tod von Pedro III. war alles in Trauer gehüllt. Hugo nahm neben seiner Mutter an der Sonntagsmesse teil. Das waren die einzigen Momente der Freiheit, die der Handschuhmacher aus der Calle Canals Antonina zugestand. In der Menge erblickte er Herrn Arnau. Demütig wie die einfachen Leute sah er zur Jungfrau hinauf. Meister Arnau sagte immer, sie lächle.
Aber Hugo lächelte die Jungfrau nie an. Trotzdem hörte er nicht auf, zu ihr zu beten und sie um ihre Hilfe anzuflehen, so auch an diesem Tag. Er betete für seine Mutter, sie möge den Handschuhmacher verlassen und wieder glücklich werden, sie möge wieder lachen und ihn wieder lieb haben wie früher. Damit sie alle zusammenleben könnten, mit Arsenda. Er betete für seinen Vater, für die Gesundheit von Herrn Arnau und für die Freiheit des Genuesen. »Die Freiheit …« Er zögerte. Wenn sie ihn freilassen, dann geht er nach Genua, und dann kann er mich nicht mehr lehren, wie man Mestre d’aixa wird, dachte er bei sich, und schon stach ihn das Gewissen. Doch. »Mach, dass er freikommt, Jungfrau Maria.«
Als die lange Zeremonie vorüber war, nutzten er und Antonina die wenige Zeit, die ihnen zur Verfügung stand, nicht dazu, um wie jeden Sonntag miteinander zu plaudern und sich zu zeigen, wie lieb sie einander hatten, vielmehr spitzten sie die Ohren, welche Gerüchte die Runde machten. Auf der Plaza de Santa María entdeckte Hugo erneut Herrn Arnau, konnte aber nicht zu ihm gehen: Er war umringt von Leuten, die nach Neuigkeiten gierten.
Hugo und seine Mutter und die vielen anderen, die lauschten, erfuhren, dass Königin Sibila, die sich auf das zwei Tagesreisen von Barcelona entfernte Schloss Sant Martí Sarroca geflüchtet hatte, darüber verhandelte, sich mit all ihren Verwandten dem Infanten Martín, dem Bruder von König Juan, auszuliefern. Sie erfuhren auch, dass der neue Monarch sich in Gerona aufhielt und sehr krank war. Allerdings habe er sich, sobald er vom Tod seines Vaters Nachricht erhalten hatte, auf den Weg nach Barcelona gemacht.
»Mein Sohn«, sagte Antonina schließlich, »ich muss jetzt gehen …«
Da umarmte sie Hugo und legte traurig den Kopf an ihre Brust.
Im Ribera-Viertel wussten viele, in welcher Lage Antonina sich befand, seit ihr Mann tot war. Doch nur wenige nahmen ihre Augenringe wahr, die Falten, die ihr Gesicht zerfurchten, und die Röte ihrer Hände. Sie war immer noch eine schöne, außerordentlich sinnliche Frau.
Antonina löste sich zart aus der Umarmung ihres Sohnes, ging vor ihm in die Hocke und legte sanft die Hände auf seine Wangen.
»Wir sehen uns nächsten Sonntag. Weine nicht«, versuchte sie ihn aufzumuntern, als sie sah, wie seine Unterlippe zu zittern begann. »Sei stark und arbeite fleißig.«
Hugo starrte lange in die Menschenmenge, in der seine Mutter verschwunden war, als könnte er sie jeden Augenblick wieder auftauchen sehen. Nach einer Weile verzog er den Mund und wandte seine Aufmerksamkeit wieder dem von der Menge umringten Herrn Arnau zu. Er spürte einen Kloß im Hals und beschloss zu gehen. Ich sehe ihn morgen, dachte er bei sich.
Aber so kam es nicht.
»Er ist nicht da, mein Junge«, versicherte ihm Juana, die Dienstmagd, als er sich bei Herrn Arnaus Haus einfand.
Niemand konnte ihm Auskunft geben.
»Er ist im Rat der Einhundert«, verkündete Arnaus Frau Mar ihm anderntags, als das Dienstmädchen sie auf Hugos Anwesenheit aufmerksam gemacht hatte. »Er ist bei den Ratsherren und Stadträten«, erklärte sie.
»Danke, Señora«, sagte Hugo stockend, »wenn er zurückkommt …«
»Mach dir keine Gedanken. Er weiß, dass du hier gewesen bist. Wir haben es ihm schon gesagt. Er hat mich gebeten, ihn bei dir zu entschuldigen. Er hat dich sehr gern, Hugo, aber es sind schwierige Zeiten.«
Das hörte Hugo auch in der Werft, wo die Arbeit immer schleppender voranging, weil die Meister und Gesellen fast nur noch damit beschäftigt waren, das Geschehen zu kommentieren.
»Er ist da, er ist in Barcelona!«, verkündete eines Nachmittags einer der Gesellen. Er sprach von König Juan.
»Aber er ist sehr krank!«, rief ein anderer.
»Man sagt, Königin Sibila hat ihn verhext. Deshalb ist er so krank.«
»Die Königin ist in Gefangenschaft.«
»Und ihr Hofstaat auch. Und alle, die König Pedro mit ihrem Rat zur Seite standen. Sie werden alle gefangen gehalten.«
»Man unterzieht sie der Folter«, vernahm man eine Stimme von der Kohlenglut, wo die Männer die Holzbohlen mit Wasserdampf anfeuchteten, um sie biegen zu können.
»Das ist unmöglich!«, rief einer aus. »Das verbietet das Gesetz. Als Erstes müssten sie verurteilt werden.«
Und doch stimmte es, wie etliche Meister ein paar Tage später einhellig bestätigten: König Juan und seine Minister hatten den Befehl erteilt, die Gefangenen zu foltern, obwohl die Richter und Stadträte sich dagegen ausgesprochen hatten. Niemand gab einen Kommentar dazu ab. In den riesigen Hallen der Werft hörte man wieder die Sägen, die Äxte und die Hämmer ertönen, aber es war nicht mehr das fröhliche Orchester, das sie alle gewohnt waren.
»Das dürfen wir nicht zulassen!«, ereiferte sich plötzlich einer und brach die Stille.
»Der König muss sich an die Gesetze halten«, schallte es aus einer anderen Ecke.
Doch letztlich wagte niemand, etwas zu unternehmen.
Königin Sibila wurde gefoltert, bis sie, mit ihren Kräften am Ende und völlig verängstigt, König Juan alle in ihrem Besitz befindlichen Ländereien, Schlösser und Güter überließ. Der Monarch verzieh der Gemahlin seines Vaters, deren Bruder, Bernardo de Fortia, sowie dem Grafen Pallars, verfügte jedoch die Weiterführung der Prozesse, die gegen die anderen Häftlinge geführt wurden.
Und als würde er die Ratsherren, die Stadträte, die Richter und die Bürgerschaft in noch größere Angst versetzen wollen, ordnete er noch dazu die öffentliche Enthauptung von Berenguer de Abella an, dem Minister seines Vaters, und von Bartolomé de Limes, einem der Edelleute, die mit der Königin geflohen waren.
Barcelona lehnte sich nicht gegen den königlichen Willen auf. Die Stadt wirkte eingeschüchtert, so empfand es Hugo auf dem Pla de Palau, der großen Esplanade, die sich zwischen dem Strand, der Auktionshalle und dem Pórtico del Forment erstreckte, wo sich Hunderte von Bürgern eingefunden hatten, um der Enthauptung der beiden Männer beizuwohnen, deren einziges Vergehen darin bestand, ihrem Monarchen die Treue gehalten zu haben. Der Junge hielt unter den Leuten, die sich um das Blutgerüst versammelt hatten, Ausschau nach Arnau. Es war ein einfaches, etwas erhöhtes und von König Juans Soldaten umringtes Holzpodium, auf dem der Hackklotz stand. Er konnte ihn nicht sehen, aber er wusste, dass er sich dort befand. Die Stadträte dagegen sah er wohl, ernst, in Schwarz gekleidet, genau wie die Mitglieder des Rats der Einhundert und die Zunftmeister, sowie die Geistlichen, Pfarrer und die Kirchenpröbste …
Hugo bahnte sich ohne Schwierigkeiten einen Weg durch die dort Versammelten, anders als bei sonstigen Gelegenheiten, wenn das bunt gemischte Volk sich schubste und drängte, um so nah wie möglich an das Blutgerüst heranzukommen. Diesmal wurden die Verurteilten auch nicht mit Geschrei und Beschimpfungen empfangen. Plötzlich fand der Junge sich in der ersten Reihe wieder. Als das Gefolge zum Hackklotz hinaufstieg, wich die Menge ein paar Schritte zurück. Eine Frau packte Hugo bei den Schultern und schob ihn wie einen Schutzschild vor sich her. Hugo befreite sich aus ihrem Griff, während ein Priester vor dem Gesicht eines Mannes das Zeichen des Kreuzes in die Luft schlug. Der Mann wahrte würdevoll Haltung, obwohl seine feinen Kleider schmutzig und zerrissen waren. Hinter den Angeklagten auf dem Blutgerüst, das Gesicht dem Publikum zugewandt, standen in einer Reihe die Soldaten und einige der neuen Minister des Königs.
Ein Herold des Lehnsherrn verlas die Anklageschrift vor einer Bürgerschaft, die immer verschüchterter und verängstigter wirkte, je länger die Liste der Lügen wurde, die sie sich anhören musste. Die Enthauptung wurde schnell und mit sicherer Hand ausgeführt. Der blutige Kopf von Berenguer de Abella fiel in einen Sack, während seine Beine noch ein paar Sekunden zuckten, was die Anwesenden mit schreckgeweiteten Augen verfolgten.
Da entdeckte Hugo den Gesuchten, der sich auf der anderen Seite befand.
»Herr Arnau!«
Hugo hatte die Worte ganz für sich gesprochen, aber in der entsetzten Stille hallten sie laut wider. Dem Jungen fuhr der Schreck in die Glieder, aber niemand achtete auf ihn.
Der Priester wandte sich nun dem zweiten Adligen zu, während Rumpf und Kopf von Berenguer de Abella fortgeschafft wurden. Um zu Arnau zu gelangen, musste Hugo den freien Raum zwischen der Menge und den Soldaten durchqueren. Als er schließlich bei dem Alten ankam und ihn ansprach, rührte der sich nicht und hielt den Blick starr auf einen Adligen geheftet, der bei den neuen Ministern auf einer Seite des Blutgerüsts stand.
»Herr Arnau …«
Er erhielt keine Antwort.
Der Herold las dem hohen Herrn Bartolomé de Limes gerade die ihm zur Last gelegten Vergehen vor. Hugo folgte dem Blick des alten Herrn. Was er sah, war Erklärung genug: eine gebrechliche Alte, die nach Luft schnappte, als sei sie am Ersticken, während sie sich vergeblich mühte, sich von der Sänfte zu erheben, welche ihre Diener trugen, die das Ganze besorgt verfolgten.
Ein Schauder lief Hugo über den Rücken, als er sah, wie viel Wut ihr verzerrtes Gesicht spiegelte. Er wich einen Schritt zurück und prallte mit Arnau zusammen, der stocksteif dastand.
Der Aufruhr, den die Dame in der Sänfte verursachte, verzögerte die Hinrichtung. Der Herold beendete die Verlesung der Anklagepunkte, jemand hielt das Ohr an die spröden, blau angelaufenen Lippen der Alten und folgte mit dem Blick ihrem abgemagerten Finger, der auf Arnau zeigte. Dieser Jemand ging zum Hackklotz und winkte den Minister zu sich, der der Hinrichtung vorstand, einen älteren Adligen, groß und kräftig, mit einem dichten schwarzen Bart, gekleidet in kostbare rote und goldene Seide.
»Was geht da vor sich, Herr Arnau?«, fragte Hugo, den Blick auf den Minister geheftet, der neben dem Hackklotz niederkniete.
Wieder keine Antwort.
Der Minister erhob sich. Nun starrte auch er zu Arnau hinüber. Dann befahl er, mit der Hinrichtung fortzufahren, und der edle Herr de Limes kniete mit dem gleichen Stolz vor dem Richtblock nieder wie sein Vorgänger. Die Menge, so auch Hugo, lenkte ihren Blick wieder zum Henker und auf die Axt, die dieser über dem Hals des Verurteilten erhoben hatte. Nur Arnau entging nicht, dass der Adlige unauffällig einen der Hauptmänner rief und ihm etwas mitteilte.
»Margarida Puig«, flüsterte der alte Mann in diesem Augenblick. Er sah den Hauptmann und einen Soldatentrupp näher kommen.
Der Kopf Herrn de Limes’ rollte in den Sack, während die Soldaten die Schaulustigen mit gezückten Schwertern auf Abstand hielten. Einige Frauen kreischten auf, doch niemand widersetzte sich.
»Geh nach Hause und sag meiner Frau, dass die Puigs wieder da sind und dass sie mich verhaften werden. Sie soll Hilfe holen«, sagte der Alte zu Hugo und schüttelte ihn, damit er seinen Blick vom Richtblock losriss.
»Was?«
»Und sie soll vorsichtig sein!«, rief er noch. Hugo schüttelte den Kopf, er verstand die Worte nicht. »Geh!«
Er konnte es nicht mehr wiederholen. Die Soldaten stürzten sich auf den wehrlosen Arnau und setzten ihn mit etlichen Fausthieben außer Gefecht, obwohl er sich seiner Verhaftung nicht im Geringsten widersetzte. Fassungslos musste Hugo mit ansehen, wie sie den betagten Mann fortschleppten. Die Menge teilte sich, um ihnen Platz zu machen. Niemand leistete Widerstand. Niemand eilte Herrn Arnau zu Hilfe. Als der Junge das begriffen hatte, stürzte er sich mit aller Kraft auf den Soldaten, der ihm am nächsten stand.
»Lasst ihn los!«, brüllte er.
»Nein!«, rief Arnau, der wollte, dass der Junge sich still verhielt. Der erste Soldat wurde von Hugos plötzlicher Attacke so überrascht, dass er stolperte und zu Boden fiel.
»Weshalb misshandelt ihr ihn?«, stieß Hugo wutschäumend hervor. »Wollt ihr das zulassen?«, schrie er den Umstehenden ins Gesicht, ehe er den zweiten Soldaten angriff.
»Hugo …«, versuchte Arnau ihn zu beschwichtigen.
»Junge, lass das sein …!«, rief einer aus der Menge.
Der grausame Hieb mit dem flachen Schwert, den Hugo auf den Rücken erhielt, schleuderte ihn zu Füßen eines anderen Soldaten, der ihm einen Fußtritt in den Bauch versetzte.
»Der ist doch noch ein Kind!«, protestierte eine der Frauen. »Sind das etwa die tapferen Helden aus König Juans Truppen?«
Einer der Soldaten wollte ihr schon entgegentreten, aber der Hauptmann hielt ihn zurück und machte ihnen ein Zeichen, sie sollten mit Arnau zum Richtblock zurückkehren. Dieser wandte den Kopf und sah, wie die Frau neben Hugo niederkniete, der schmerzverkrampft auf dem Boden lag.
»Arnau Estanyol!«, rief der Edelmann im rotgoldenen Gewand, als der Hauptmann den betagten Mann zum Richtblock stieß. »Königsverräter!«
Zwei Stadträte, die näher kamen, weil die Verhaftung einer so bekannten und beliebten Persönlichkeit Barcelonas ihr Interesse geweckt hatte, blieben wie angewurzelt stehen, als sie die Anklage vernahmen. Die Menge, die sich schon hatte zerstreuen wollen, blickte jetzt wieder gebannt auf das Schauspiel.
»Wer behauptet das?«, fragte indes mit lauter Stimme einer der Mitglieder des Rats der Hundert, ein schon älterer Färber, dessen Bauch so feist war wie sein Gehabe vorwitzig.
Die Stadträte, allesamt ehrenhafte Bürger und Kaufleute, rügten ihren Gefährten mit Blicken, weil er sich offenkundig im Ton vergriffen hatte. Man hatte soeben zwei von König Pedros Ministern enthauptet, einzig aus Rache. Königin Sibila war ohne Urteil gefoltert worden. Die übrigen Minister von König Pedro, dem Prächtigen, und der Hof seiner Witwe waren angeklagt worden, ihr Leben hing von der Laune eines kranken Königs ab, der sich in dem Glauben wähnte, man habe ihn verhext – und da erdreistete sich dieser Färber, mit den neuen Ministern über das Gesetz zu streiten.
Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten.
»König Juan behauptet das«, sagte der Edelmann vom Blutgerüst feierlich. »Und ich, Genís Puig, Graf von Navarcles, Oberbefehlshaber seines Heeres, spreche in seinem Namen.«
Der Färber senkte den massigen Kopf.
»Arnau Estanyol!«, wiederholte der Adlige. »Dieb und Wucherer! Häretiker! Geflohen vor der Heiligen Inquisition! Königsverräter! Verräter Kataloniens!«
Der Hass, mit dem er diese Anschuldigungen herausschrie, ließ die Bürger Barcelonas vom Schafott zurückweichen.
»Ich verurteile dich zum Tod durch Enthauptung. Dein gesamtes Hab und Gut wird beschlagnahmt.«
Ein Raunen der Entrüstung ging durch die Menge. Der Graf von Navarcles befahl den Soldaten, die das Blutgerüst schützten, die Schwerter zu ziehen.
»Du Hurensohn!« Hugo befand sich wieder in dem leeren Raum zwischen der Menschenmenge und den Soldaten. »Du räudiger Bastard!«
Hugos Geschrei wurde unverhofft von scharfen unverständlichen Schreien übertönt, ausgestoßen von einer Frau, die sich mit Fäusten einen Weg durch die Menge bahnte. Jemand war losgerannt und hatte Mar gewarnt.
»Ergreift sie!«, befahl der Hauptmann.
Erst jetzt, als er seine Frau aufkreischen hörte und sah, wie sie verzweifelt um sich schlug und sich mit Tritten aus den Armen der Soldaten zu befreien suchte, versuchte Arnau sich gegen seine Häscher zu wehren. Da versetzte ihm Genís Puig höchstpersönlich, mit einer Verachtung, als handelte es sich um ein Tier, eine Ohrfeige, die ihn zu Boden schleuderte.
Etliche Adlige lachten.
»Drecksgesindel!«, kreischte Hugo wieder los, jetzt in Richtung der Alten in ihrer Sänfte, die bei Arnaus Sturz auf die Holzbohlen ein zahnloses, geiferndes Grinsen gezeigt hatte.
»Wie kannst du es wagen?«
Ein junger Edelmann, noch keine zwanzig Jahre alt, blond, gut aussehend, bekleidet mit einem Mantel aus blauer Damaszenerseide und pelzbesetztem Kragen, einer Hose und Schuhen aus Glattleder mit Silberschnalle, ein Umschlagtuch quer über der Brust und ein Schwert im Gürtel, trat hervor. Auf ein kaum merkliches Zeichen von ihm stürzten sich sodann ein Diener und ein Soldat auf Hugo und prügelten ihn windelweich.
»Auf die Knie!«, forderte der junge Edelmann ihn anschließend auf.
Der Diener hieß den geschundenen Hugo niederknien und packte ihn beim Schopf, um seinen Kopf gerade zu halten. Blut lief ihm übers Gesicht.
»Entschuldige dich«, verlangte der Adlige.
Durch den bläulichen Schleier vor seinen Augen, die von den Schlägen halb zugeschwollen waren und ihm nur eine verschwommene Sicht gestatteten, glaubte Hugo, Arnau auf dem Schafott zu erkennen. Ermunterte er ihn, sich zu widersetzen? Er spie aus. Blut und Spucke.
Der junge Adelige fasste mit der Hand an sein Schwert.
»Genug!«
Mit diesem Befehl war Margarida Puig wieder zum Leben erwacht. Der Graf von Navarcles verstand die Gründe seiner Tante. Wieso sollte ein dreckiger Rotzlöffel ihnen die Rache verderben, die der Zufall ihnen beschert hatte? Und wenn die Leute am Ende wegen dieses Burschen einen Aufstand wagten? Arnau war ein geachteter Mann in der Stadt. Die Hinrichtung müsste sofort vollzogen werden. Sobald die Stadträte sich einschalteten, könnte alles zunichtegemacht werden, und er hatte Jahre auf diesen Moment gewartet. Was der König dazu sagen würde, kümmerte ihn nicht, es ließen sich gewiss überzeugende Argumente finden.
»Lasst ihn los!«, befahl der Graf. »Habt ihr mich nicht verstanden?«, wiederholte er, als sein Neffe sich erneut anschickte, das Schwert zu ziehen.
»Das nächste Mal wirst du nicht so viel Glück haben, darauf hast du das Wort von Roger Puig«, drohte dieser, öffnete die Hand, die das Schwert gepackt hielt, und spreizte theatralisch die Finger, um es in die Scheide zurückgleiten zu lassen.
Zwei Bastaixos stürzten herbei, um Hugo in Empfang zu nehmen, und während der Adlige wieder zu seinem Platz zurückkehrte, versuchten sie, ihn fortzuschleppen. Doch Hugo wehrte sich. »Arnau«, stammelte er.
Die Bastaixos verstanden und hielten ihn bei den Achseln gepackt, in der ersten Reihe stehend. Er konnte nichts sehen. Es gelang ihm nicht, die Augen zu öffnen oder sich das Blut abzuwischen, das ihm übers Gesicht lief, aber er hörte das Pfeifen der Axt und das knackende Geräusch. Und er spürte das Zittern der Bastaixos und hörte ihren stoßweisen Atem. Dann zerriss der Schrei von Mar die Luft, und ihn selbst packte ein Schwindel, der ihn ohnmächtig zu Boden sinken ließ.
2
Das Lächeln, das Hugo auf dem runden Gesicht von Juan dem Navarrer aufscheinen sah, konnte nicht den Schmerz besänftigen, der ihn am Morgen beim Erwachen überwältigte. Er bewegte den Arm und hörte sich selbst stöhnen, als käme dieser Klagelaut aus dem Mund eines anderen.
»Du darfst dich nicht rühren«, lautete der Rat von Juan dem Navarrer. »Dir stehen harte Tage bevor, auch wenn der Jude versichert, dass nichts gebrochen ist. Du hast Glück gehabt.«
Hugo wurde sich seiner Lage bewusst – ein Bein und einen Arm hatte man mit Verbänden fixiert, ein weiterer lief quer übers Gesicht und bedeckte ein Auge. Er erinnerte sich an das Blutgerüst und die Hinrichtung …
»Was ist mit Herrn …«
Seine trockene Kehle brannte so, dass er nicht weitersprechen konnte.
Der Navarrer führte ihm ein Glas Wasser an den Mund und versuchte ihn vorsichtig trinken zu lassen. Doch es misslang, so nervös wurde er schon beim Gedanken, ihm das Schicksal seines Freundes erklären zu müssen.
»Was ist mit Herrn Arnau?«, fragte Hugo beharrlich zwischen Hustenanfällen.
Der Mann wollte nicht antworten. Stattdessen strich er dem Jungen zärtlich übers schmutzige Haar, während dieser das Wasser fortstieß und die Lippen zusammenpresste, wenngleich sein zitterndes Kinn schon den Schmerz verraten hatte, der sich zur Qual seiner Wunden gesellte.
Hugo war erst ein Mal hier gewesen: an seinem ersten Arbeitstag in der Werft, als Arnau ihn begleitet und ihm Juan den Navarrer vorgestellt hatte. Hugo erkannte das Haus wieder. Es gehörte dem Statthalter, der die Pflicht hatte, darin zu wohnen, aber in Wirklichkeit bewohnte es sein Gehilfe, und er selbst lebte in einem schönen Haus unweit der Plaza de Sant Jaume. Die Werft war zwar groß, aber das Haus war klein: nur ein Stockwerk, wie die anderen Lager und Läden, mit zwei Schlafgemächern und einem Raum, der als Küche und Esszimmer genutzt wurde. Dort lebte der Navarrer mit seiner Gemahlin und zwei kleinen Töchtern sowie zwei Hunden, die die Familie in der Nacht frei laufen ließ, damit sie Wache halten konnten.
Hugo lag in der Ecke der Küche auf einem Strohsack auf einer Pritsche, die die Schreiner von der Werft für ihn getischlert hatten. In den Tagen, in denen er das Bett hüten musste, konnte er die beiden Töchter von Juan dem Navarrer beobachten, zwei hübsche Mädchen, die in der Stube herumtollten, sich aber nie seinem Lager näherten. Wenn er sie dabei ertappte, wie sie miteinander tuschelten und ihn beäugten, fragte er sich oft, ob man es ihnen wohl verboten hatte. Ihre Mutter, die Frau von Juan dem Navarrer, sah gelegentlich nach ihm, wenn ihr für einen Augenblick Zeit dazu blieb. Ansonsten machte Hugo nicht anderes, als den Hunden, die beständig um ihn waren, die Köpfe zu kraulen. Ließ er davon ab, wenn ihn wieder das Schuldgefühl stach und er die Lippen aufeinanderpressen musste, legte sogleich einer der beiden die Schnauze auf den Strohsack und fiepte, als wollte er den Schmerz mit ihm teilen. Warum nur habe ich vor dem Blutgerüst Herrn Arnau beim Namen genannt?, fragte er sich. Hätte ich das nicht getan, er wäre noch am Leben. Seine Qual wurde leichter, wenn der Hund ihm übers Gesicht leckte. Er kannte ihn gut. Wollte er tagsüber nach der Arbeit seine Mutter oder Herrn Arnau besuchen, hatte Hugo seine Angst besiegen und Freundschaft mit den Tieren schließen müssen. Nur so konnte er über die Hofmauer der Werft springen, wenn er an manchen Abenden durch Barcelona bis zum Kloster von Jonqueres gehen wollte, um seine Schwester zu besuchen. Er hatte einen Teil seiner Verpflegung dafür hergegeben und Brocken für Brocken um ihre Freundschaft gebuhlt, bis er schließlich das Fressen durch Streicheleien und Spiele ersetzen konnte. Sie hatten ihn noch nie verraten.
Einige der Jungen, die den Gefangenen aus Genua die Eisenkugeln trugen, hatten ihn besuchen wollen, denn sie waren alle beeindruckt von den Heldengeschichten, die man sich über seinen Auftritt vor dem Blutgerüst erzählte, aber die Gemahlin des Navarrers warf sie ohne Federlesen hinaus. Er durfte sich zwar nicht mit den Jungen die Zeit vertreiben, die darauf spekulierten, dass er ihnen die Geschichte von dem Kampf mit dem Adligen im blauen Gewand erzählte, doch es überraschte ihn, dass der Genuese ihn beständig besuchen kam. »Kein Junge trägt die Kugel so gut wie du«, sagte dieser mit seinem charakteristischen italienischen Akzent, um seinen ersten Besuch zu entschuldigen, als habe er kein Recht, hier zu sein. »Mit den anderen ist nicht so gut arbeiten.«
Der Meister bettete die Kugel auf den Boden, setzte sich daneben auf einen Stuhl, und nachdem er sich Hugos Wunden genau angesehen und ihn zu seiner Heilung beglückwünscht hatte, ohne ihn nach seiner eigenen Einschätzung zu fragen, fuhr er stur damit fort, ihm Lektionen zu erteilen.
»Wenn ich in meine Heimat zurückkehre, was sehr bald sein wird, da bin ich mir sicher, wirst du keine Gelegenheit mehr haben zu lernen, was ich dich zu lehren habe«, verkündete er. »Und zwischen einem Baumeister aus Genua und einem aus Katalonien gibt es keinen Vergleich!« Dann reckte er eine Hand mit geschlossenen Fingern in die Luft, ganz hoch hinauf, und schüttelte sie zornig. »Warum hält dein König uns hier zurück, was glaubst du?«
Bei diesen Sitzungen sprach der Genuese mit ihm über Holz: »Steineiche und Eiche sind hart, das beste Holz für jene Teile, die großer Spannung ausgesetzt sind, etwa für den Rumpf des Schiffes, den Kiel, die Ruder … Pappel und Pinie nimmt man für die Bohlen, die Takelage, die Rahen …«
Dann erläuterte er, woran man es erkennt, wie man es nutzt und bearbeitet, wie man es schneidet und, was vielleicht das Wichtigste war, wann man das alles tat.
»Das Holz muss geschnitten werden, wenn der Mond günstig steht. Das Holz von Laubbäumen wird beim letzten Mondviertel geschnitten, und das der Nadelbäume bei Neumond.«
In diesen Augenblicken vergaß Hugo nicht nur Arnau und seine eigenen Verletzungen, sondern gab sich dem Traum hin, ein großer Baumeister wie der Genuese zu sein, dem man Respekt zollte, obwohl er eine Eisenkugel mit sich herumschleppte. Und er träumte, in einem schönen Haus zu wohnen, eine Familie zu gründen und auf der Straße gegrüßt zu werden, Geld zu haben und seine Mutter unterstützen zu können. Und vor allem wollte er eines: ihr die Freiheit zurückgeben und das Lächeln, das der Handschuhmacher ihr gestohlen hatte. Wie sehr wünschte er sich, in dieses Haus in der Calle Canals zu gehen, die Tür einzutreten und seine Mutter einfach mitzunehmen, ohne sich um die Proteste des Handschuhmachers und seiner Frau zu scheren!
Und während er den Moment herbeisehnte, in dem er wieder aufstehen und sich an die Arbeit machen könnte, lauschte er dem Meister, der erzählte, bei jedem Schiffsbau sei immer auch ein Kobold mit am Werk, ein Duende.
»Ein klitzeklitzekleiner«, sagte der Genuese und hielt sich Mittelfinger und Daumen vor die Augen, als wollte er zwischen den Fingern ein Sandkorn betrachten.
»Ein Kobold?«, fragte Hugo interessiert und richtete sich auf seinem Sandsack auf.
»Ja, ein Schutzgeist, den keiner sehen kann. Ist der kleine Schutzgeist guter Laune und niemand ärgert ihn, wird das Schiff guten Wind haben. Wenn er wütend wird …«
»Und was macht ihn wütend?«
»Ich glaube Ungeschicklichkeit«, antwortete der Genuese mit leiser Stimme, als verrate er ein Geheimnis. »Aber ich bin mir sicher, was ihn am ärgsten in Wut versetzt, sind hochmütige Meister, die sich nicht an die Regeln der Kunst halten und den Gefahren des Meeres trotzen.«
In der Nacht, wenn die Hunde die Werft bewachten, wenn niemand bei ihm war und das heftige Geschnarche des Navarrers die Pfeiler, die in den Himmel ragten, zum Einsturz zu bringen drohte, kehrte Hugo in Gedanken zu Herrn Arnau zurück. Er fragte sich dann, wer wohl der Edelmann gewesen war, der ohne Urteilsspruch befohlen hatte, Herrn Arnau auf der Stelle zu enthaupten. Der ihn beschuldigt hatte, ein Verräter zu sein.
»Sie waren erbitterte Feinde«, erklärte der Navarrer ihm eines Tages.
Hugo wagte es nicht, nachzufragen, aber der Genuese, der aufmerksam gelauscht hatte, wagte es wohl.
»Der werte Herr Arnau hatte einen Feind?«
»Ja. Vor vielen Jahren hatte Arnau die Familie Puig in den Ruin getrieben. Dafür hassen sie ihn.«
»Er wird irgendeinen Grund dafür gehabt haben«, schaltete Hugo sich ein, um ihn zu entschuldigen.
»Ganz gewiss. Arnau war ein guter Mensch, ich kann mir nicht vorstellen …«
»Und wann soll das gewesen sein?«, wollte der Genuese wissen.
»Oh, das ist lange her! Genís Puig ist der Sohn eines Mannes aus der Familie der Puigs, die Arnau ruiniert hatte. Damals hatte er mit seiner Familie nach Navarcles zurückkehren und unter dem Schutz des Grundherrn, Bellera, ein armseliges Leben fristen müssen. Aber später hat er dessen Tochter geheiratet, und von da an …«
»Aber wie konnte dieser Puig Herrn Arnau ohne Urteilsspruch enthaupten lassen?«, fragte Hugo dazwischen.
»Man sagt, der König sei noch krank, und er sei einer Hexerei zum Opfer gefallen. Folglich habe er sich nicht um die Hinrichtung geschert und jedes Urteil, das sein Minister ihm vorlegte, bestätigt. Außerdem wurde Arnaus gesamtes Hab und Gut beschlagnahmt und der Schatzkammer zugesprochen, und das ist etwas, was jedem Monarchen gefällt.«
»Ist dieser Edelmann denn so bedeutend, dass er den Willen des Königs beeinflussen kann?«, fragte der Genuese weiter.
»So scheint es. Vor zwei Jahren hatte König Pedro den Grafen von Ampurias wegen eines Streits um die Ländereien einer Vizegrafschaft bestrafen wollen. Der Graf hatte sich dem Heer des Monarchen mit den eigenen Truppen entgegengestellt, zudem hatte er sich seine Sicherheit erkaufen wollen und sechzigtausend Florine an die Franzosen berappt, damit sie ihm zu Hilfe eilten. Prinz Juan hatte sich daraufhin den Franzosen entgegengestellt und sie aus Katalonien vertrieben. Niemand hatte gedacht, dass ihm das gelingen könnte, weil er einen so weichen und kleinmütigen Charakter hat. Und verantwortlich für diesen Sieg war kein anderer als Genís Puig, den Juan zum Grafen von Navarcles ernannte. Seither ist er sein Ratgeber, Freund und Minister. Wie man hört, würden weder der König noch die Königin jemals seine Entscheidungen infrage stellen, schon gar nicht in der Öffentlichkeit.«
»Und das gibt ihnen das Recht, einen Bürger von Barcelona hinzurichten?«, fragte verwundert der Mestre d’aixa.
»Ja, so ist es.« Der Navarrer seufzte. »Und gegen den Willen der Richter und der Stadträte haben sie noch dazu zwei Minister König Pedros hinrichten lassen. Sie haben Königin Sibila gefoltert und ihren gesamten Besitz gepfändet, und sie versichern, dass Juan die Schenkungen, die sein Vater zu Lebzeiten getan hatte, niemals gesetzlich anerkennen werde, was viele Leute mit Sorge erfüllt. Was schert sie da ein gebrechlicher Alter, der um Almosen für die Bedürftigen bettelt.«
Hugo und der Genuese fuhren erschrocken zusammen und sahen den Navarrer überrascht an.
»Ja, ein gebrechlicher Alter, der um Almosen bettelt. So nannten einige der ehrenwerten Bürger dieser Stadt Herrn Arnau. In Barcelona geht die Feigheit um, und jeder verfolgt nur noch die eigenen Interessen.«
»Und was ist mit Señora Mar?«, fragte der Junge in das drückende Schweigen hinein.
»Ihr ist nichts geblieben, sie durfte nur behalten, was sie am Leibe trug … mit Ausnahme ihrer Schuhe. Die Schufte haben sie gezwungen, barfuß fortzugehen.«
»Wohin ist sie gegangen? Wo ist sie jetzt?«
»Sie wurde von ein paar Bastaixos, Verwandten ihres Vaters, in deren Haus aufgenommen. Übrigens hat sich einer von ihnen im Namen der Witwe nach dir erkundigt.«
Es vergingen ein paar Tage, und der jüdische Medicus, den Juan der Navarrer hatte kommen lassen, erlaubte Hugo aufzustehen und wieder arbeiten zu gehen, aber »ohne sich anzustrengen«, wie er betonte. Hugo schlug den Rat in den Wind, und obwohl sein Arm ihn noch schmerzte, schleppte er wieder die Kugel des Genuesen und war mit Feuereifer bei der Sache. Man hatte ihm die Verbände abgenommen, doch die Narbe am Ohr trug er vor den anderen mit Stolz. Ihm gingen immer wieder die Worte durch den Kopf, die er während seiner Genesung oft gehört hatte: »Wenn du hart arbeitest, wirst du ein großer Mestre d’aixa werden.«
Eines Abends verspürte Hugo den Wunsch, seine Schwester zu besuchen. Arsenda dürfte sich Sorgen machen, er hatte ihr versprochen, er werde sie regelmäßig besuchen, aber das letzte Mal war schon eine Weile her. Er war lange der Werft ferngeblieben. Er war nicht einmal mehr in Santa María del Mar zur Messe gegangen. »Die Madonna wird es dir nicht verübeln«, beruhigte ihn der Navarrer. »Du hast gute Gründe.« Das war auch nicht der Grund, sagte er sich. Er hatte Angst vor dem, was er da draußen vorfinden würde … Vielleicht die Puigs, diese Hurensöhne. Und wenn er dem Edelmann im blauen Gewand auf der Straße begegnete? »Das nächste Mal wirst du nicht so viel Glück haben«, hatte er ihn gewarnt. Es drehte ihm den Magen um, wenn er daran zurückdachte. Sie würden ihn töten. Wenn sie schon mit Herrn Arnau leichtes Spiel gehabt hatten, wie einfach wäre das mit ihm. Es ging ihm gut da drin, bei den Schiffen, mit den Meistern und der ganzen Schar von Lehrjungen – auch mit den Älteren –, denn seit seiner Heldentat respektierten und beneideten sie ihn.
Wenn er seine Arbeit mit der Eisenkugel erledigt hatte, suchte er sich jemanden, der Hilfe gebrauchen konnte. »Solange es kein anderer Mestre d’aixa ist«, hatte die Bedingung des Genuesen gelautet. »Die werden dich sonst verderben«, hatte er im Scherz hinzugefügt.
Hugo ging zu den Schiffszimmerern und Sägern, zu den Ruderfabrikanten, vor allem jedoch zu den Kalfaterern, die die Schiffe mit Werg abdichteten, mit Teer aus der Destillation des Pinienholzes und mit Pech, dem wichtigsten Versiegelungsmaterial, einem Rückstand des Holzteers. »Du wirst noch als Kalfaterer enden statt als Mestre d’aixa«, neckten sie ihn manchmal, wenn sie ihn den großen Kessel mit dem Holzpech und dem Teer umrühren ließen, in den sie auch den Talg getan hatten. »Stell dir nur vor, was für ein Gesicht der Genuese dann machen wird!«
In jener Nacht wartete Hugo, bis das Atmen und Gehuste der Genuesen und ihrer Gehilfen sich beruhigt hatte, und erhob sich dann vorsichtig. Sie schliefen alle zusammengepfercht in einem Lager, vor dem offenen Hof zwischen den riesigen Schiffsrümpfen. Die Hunde wedelten mit dem Schwanz, während er über den weiten Platz lief. Er begrüßte sie und spielte ein Weilchen mit ihnen, dann kletterte er mühsam auf die Mauer und ließ sich auf der anderen Seite herunterfallen. Das Rauschen der Wellen, die träge das Ufer leckten, wurde nicht gestört durch das kaum hörbare Knarzen von Hugos Sandalen auf der Erde. Arnau kam ihm wieder ins Gedächtnis: Er hatte sie ihm selbst geschenkt. Sie hatten eine gute Ledersohle anstatt einer aus Espartogras oder Holz, wie die der anderen Jungen, die das Glück hatten, nicht barfuß gehen zu müssen. »Sie haben meinem Sohn gehört. Jetzt braucht er sie nicht mehr«, hatte er gesagt und sie ihm geschenkt. Mit einem Kratzen im Hals lauschte Hugo der Stille und versuchte nicht mehr an Herrn Arnau zu denken. Hinter ihm lag das Meer, zu seiner Linken die bebauten Felder, die sich bis zu den Ausläufern des Monjuïc erstreckten, und vor ihm das Raval-Viertel, das neu gewonnene Gebiet, das man mit einer Stadtmauer versehen wollte und das noch nahezu unbewohnt war. Zu seiner Rechten, hinter der alten Stadtmauer, lag das Kloster Framenors, und in einiger Entfernung von der Wohnstatt der Mönche das eigentliche Barcelona, der einzige Ort, an dem man den schwachen Widerschein von Lichtern erkennen konnte.