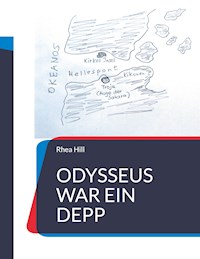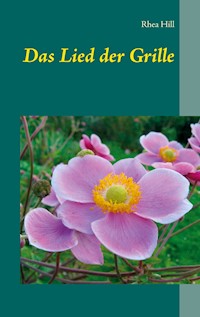
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Im Jahr 2044 wird der größte Teil Europas von den Moslems beherrscht. Sonja, eine junge Frau, die mit einem Araber verheiratet ist, stößt zufällig auf ein Zeitreisegerät und besucht damit einen ihrer Vorfahren im Jahr 1889. Was nur als kurzer Ausflug in die Vergangenheit geplant war, wird zu einem Aufenthalt von fünf Jahren. Sonja verliebt sich in ihren Urahnen. Die beiden heiraten und bekommen eine Tochter. Dann wird Sonja plötzlich krank. Notgedrungen muss sie zurück ins Jahr 2044.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 255
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 1
Es ist erst sechs Jahre her, dass sich die Welt veränderte. Damals war ich dreizehn und begriff von den politischen Dingen nichts. Das einzige, was mich bestürzte, war, dass meine Eltern Hals über Kopf ihre Sachen packten und verschwanden. Sie erklärten mir nichts. Aber das wunderte mich nicht. Für Erklärungen war schon immer meine Großmutter Henriette zuständig; denn meine Eltern arbeiteten den ganzen Tag, ich bekam sie kaum zu sehen. Sie hatten eine Firma aufgebaut, die Software entwickelte, komplizierte Programme für Industrieanwendungen und auch für militärische Zwecke. Mama und Papa lebten nur für ihre Arbeit. Ihr Laden hatte mehr als hundert Angestellte. Sie waren wohl beide workoholics. Morgens waren sie oft schon aus dem Haus, bevor ich zur Schule musste, und abends kamen sie selten vor acht Uhr zurück. Von klein auf hatte mich Oma betreut. Meine Eltern hatten ihr in einem Flügel unserer riesigen Vorstadtvilla eine Wohnung eingerichtet. Von ihrem Mann hatte sie sich schon bald nach der Geburt meines Vaters scheiden lassen. Danach ging es ihr ein paar Jahre lang gar nicht gut. Zumindest finanziell. Es war die Zeit, als die Regierung die Arbeit künstlich verknappte, um die Löhne zu drücken. Oma musste mit ihrem Kind von der mickrigen Sozialhilfe leben. Eine bezahlte Arbeit zu finden war für eine alleinstehende Mutter mit Kleinkind schlichtweg unmöglich. Als Papa sieben Jahre alt war, wagte Henriette einen verzweifelten Schritt. Sie gründete eine Reiseagentur. Wenn Papa vormittags in der Schule war, fuhr sie mit dem Fahrrad in der Umgebung herum und fragte eine Familie nach der anderen, ob sie nicht Zimmer an Touristen vermieten wollten. Später kaufte sie sich ein gebrauchtes, ziemlich klappriges Auto. Unsere Landschaft ist wunderschön, war aber damals touristisch überhaupt nicht erschlossen. Henriette zog nicht nur eine Menge Ferienunterkünfte an Land, sondern sprach auch mit den Bürgermeistern der Ortschaften und bewegte sie dazu, zum Beispiel die Öffnungszeiten für Freibäder zu verlängern. Sie schlug den Besitzern von Reitställen vor, Angebote für Feriengäste zu machen. Sie überredete Autoverleiher und Fahrradhändler, ihre Fahrzeuge zu Sonderpreisen an Feriengäste zu verleihen. Ich glaube, sie suchte auch jedes einzelne Gasthaus auf und brachte die Wirte dazu, heimische Spezialitäten zu erfinden und auf ihre Speisekarten zu setzen. Ihr Ideenvorrat war unerschöpflich. Da sie ja immer noch kein Geld hatte, bot sie ihre Ferienunterkünfte anfangs nur im Internet an. Ferien auf dem Bauernhof und botanische Exkursionen unter sachkundiger Führung wurden ihre ersten Renner. Es dauerte keine drei Jahre und ihr Geschäft fing an zu brummen. Anfangs wurde jeder einzelne Gast von Henriette persönlich betreut. Später, als ihr Unternehmen sich ausweitete, ging das natürlich nicht mehr. Sie musste Mitarbeiter einstellen, wobei sie darauf achtete, dass diese genau so drauf waren wie sie selbst. Und Oma ist von einer fröhlichen Herzlichkeit und hat einen umwerfenden Charme. Wenn ein Mitarbeiter unfreundlich zu den Kunden war, warf sie ihn hinaus. Dafür zahlte sie ihren Angestellten aber auch überdurchschnittliche Gehälter. Und ihre Firmenpolitik machte sich bezahlt.
Oma war schon immer gerne verreist. Als sie sicher war, dass sie ihre Mitarbeiter ein paar Wochen mit der Firma allein lassen konnte, fuhr sie in den Sommerferien ins Ausland. Ihr Kind nahm sie mit. Sie suchte sich unbekannte Gegenden aus, wo sie wieder von Haus zu Haus ging und Ferienunterkünfte fand. Mit zwölf Jahren kam Papa in ein Internat. Er fühlte sich überhaupt nicht abgeschoben, sondern fand es ausgesprochen aufregend. Oft schwärmte er regelrecht von seiner Internatszeit. In den Sommerferien fuhr er dann wieder mit seiner Mutter durch die Welt. Ich glaube, die beiden hatten eine Menge Spaß. Weil Oma nun unabhängig war und genug Geld hatte, baute sie im Laufe von knapp zehn Jahren ihre Reiseagentur zu einem weithin bekannten Unternehmen aus, das überwiegend Spezialreisen in exotische Gegenden anbot, Abenteuerurlaub, aber auch Reisen mit Rundumbetreuung für Alte und Behinderte. Das Geschäft florierte und Oma schwamm im Geld. Sie kaufte ein großes altes Fachwerkhaus und ließ es von Grund auf restaurieren. Darin brachte sie ihre Firma unter. Sie selbst wohnte im wunderschön ausgebauten Dachgeschoss mit Balken und Schrägen, großen Atelierfenstern und Fußböden aus dicken Buchendielen. Oma mag kein Parkett. Ich weiß nicht, ob Oma schon immer ein Faible für Malerei hatte oder ob das Licht, das durch die großen Fenster fiel, sie dazu animierte. Jedenfalls fing sie eines Tages an, Ölbilder zu malen. Ihre Firma lief reibungslos. Nicht zuletzt deshalb, weil sie ihre Angestellten am Gewinn beteiligte.
Georg, mein Vater, bestand sein Abi mit Bravour und studierte dann Informatik. Danach machte er sich mit Omas Geld selbstständig und gründete eine Softwarefirma. Während die Zustände in Deutschland immer schlimmer wurden – die Zahl der Arbeitslosen lag bei zwölf Millionen, die Lohnnebenkosten waren höher als die Nettolöhne, die Regierung war nicht nur pleite, sondern hoch verschuldet – hatte Papa Erfolg mit seiner Firma. Nach kürzester Zeit war die Firma auf fünfzig Mitarbeiter angewachsen und er konnte Omas Darlehen zurückzahlen. Geld kommt zu Geld, der Spruch ist schon wahr. Ohne Omas Geld hätte Papa nie eine Chance gehabt. In Deutschland nagten zwölf Millionen Menschen am Hungertuch und wurden zu allem Überfluss auch noch von der Bürokratie schikaniert, bespitzelt, zu unbezahlter Arbeit zwangsverpflichtet, aber Oma und Papa lebten wie die Maden im Speck.
Oma hatte sich mit Fantasie, Mut und unermüdlichem Schaffen hochgearbeitet, wovon Papa profitierte und einen leichten Start hatte. Als Omas Geschäft lief, fing sie an, mit Aktien zu spekulieren. Viel Ahnung hatte sie davon nicht. Sie fing mit einem Betrag an, den sie verschmerzen konnte, wenn es schief ging. Aber so, wie sie ihre Reiseagentur mit Geschick und Ausdauer zum Erfolg gebracht hatte, schien sie auch ein gutes Gespür für den Aktienmarkt zu haben. Im Laufe der Zeit entwickelte sie sich zu einer risikofreudigen Spekulantin und machte große Gewinne. Die wenigen Fehlschläge konnte sie gut wegstecken. Aber die allgemeine Stimmung im Lande entsprach den Zuständen. Nichts funktionierte mehr. Die Steuern wurden erhöht, die Löhne gekürzt, die Arbeitszeiten verlängert. Einige wenige Großkonzerne wie die Stromgiganten, Gift- und Medikamentenhersteller und Banken hatten praktisch die Regierung übernommen. Die Dummies, die unser „demokratisches“ Land regierten, waren nichts weiter als Befehlsempfänger der Konzerne. Korruption, Bestechlichkeit und Machtmissbrauch waren an der Tagesordnung. Die Medien wurden nur noch zur Gehirnwäsche für das Volk missbraucht. Den Dummen konnte man alles einreden.
Um die Jahrtausendwende propagierten die jeweiligen Machthaber – egal, ob diese sich als „sozialdemokratisch“ oder als „christlich-demokratisch“ etikettierten - ausgerechnet die Ärmsten im Lande, nämlich die Arbeitslosen, als Staatsfeinde Nummer 1, die ganz allein die Schuld an der finanziellen Misere haben sollten. Längst wurden die Arbeitslosen auch in Industrie und Landwirtschaft eingesetzt. Dafür erhielten sie zusätzlich zum Arbeitslosengeld eine Aufwandsentschädigung von einem Euro pro Stunde. Das Arbeitslosengeld belief sich auf weniger als die Hälfte des offiziellen Existenzminimums. Für einen Euro konnte man gerade mal ein halbes Kilo des billigsten Fabrikbrotes kaufen. Kurz vor der Machtübernahme durch die Araber gab es kaum noch Lohnarbeiter, die von ihrem Einkommen anständig leben konnten. Die Unternehmer hatten ihre mit hohen Sozialabgaben belegten Mitarbeiter entlassen und Billigkräfte eingestellt. So subventionierte der Staat die Unternehmen praktisch direkt durch das Arbeitslosengeld, ohne dafür einen Gegenwert zu erhalten. Denn Großunternehmen hatten tausend legale Möglichkeiten, das Finanzamt auszutricksen. Dieser Schwachsinn führte dazu, dass die Staatseinnahmen, die vorher hauptsächlich von den Löhnen und Gehältern herrührten, wegbrachen.
Auf der Uni hatte Papa Marietta kennengelernt, eine dunkelhaarige Schönheit mit strahlenden blauen Augen. Aus einem losen Techtelmechtel war im Laufe der Zeit eine immer festere Verbindung entstanden. Als Papas Firma lief, kündigte Marietta ihren Job und fing in seiner Firma an. Bald darauf heirateten sie und drei Jahre später wurde ich, Sonja, an einem kalten Februartag des Jahres 2025 geboren. Ich glaube, ich war eher ein Unfall; denn ich passte überhaupt nicht ins Konzept meiner Eltern, die von ihrer Arbeit fasziniert waren und nichts anderes im Kopf hatten. Oma verliebte sich, wie sie mir erzählte, auf den ersten Blick in mich. Sie verkaufte ihre Firma und legte einen großen Teil ihres Geldes in Aktien, Wertpapieren, Immobilien und einer erheblichen Menge Gold an. Das Haus blieb ihr Eigentum und sie malte dort weiterhin ihre Bilder. Meine Eltern überließen ihr einen Seitenflügel der Villa, und ihr Baby, also mich, überließen sie ihr auch. Oma zog mich auf und verwöhnte mich mit all ihrer Liebe, während meine Eltern Geld scheffelten. Ich verbrachte die meiste Zeit in Omas Wohnung, wo sie auf mich aufpasste und nebenbei ihre exotischen Landschaften pinselte. Als ich alt genug war, um einen Pinsel zu halten, stellte sie für mich eine eigene Staffelei auf und ich durfte nach Herzenslust mit ihren bunten Farben malen. Ich war ein glückliches Kind und vermisste meine Eltern nicht im geringsten.
Kapitel 2
Und dann – im glorreichen Jahr 2038 - geschah das Unglaubliche, das niemand vorausgesehen hatte und das doch so offensichtlich gewesen war. Die reichen arabischen Staaten, die mit dem Verkauf ihrer Ölvorräte Billiarden verdient hatten, waren – wie sich später herausstellte – niemals wirklich uneinig gewesen. Im Gegenteil. Jahrzehntelang hatten sie nach gemeinsamen Absprachen ihre Gelder gezielt investiert und über die Banken Geld an die hoch verschuldeten europäischen Regierungen verliehen. Damit hatten sie praktisch alle Länder und die wichtigsten Konzerne in ihre Hände bekommen. Alle europäischen Länder hatten schon seit je her eine großzügige Asylpolitik betrieben. Jeder politisch Verfolgte aus Krisengebieten musste aufgenommen werden. Manche Länder hatten sich diese Forderung sogar ins Grundgesetz geschrieben. Die deutsche Obrigkeit hatte eine panische Angst davor, als „Nazis“ abgestempelt zu werden. Und so schwafelten die Politiker selbst dann noch von Willkommenskultur, um das Volk einzulullen, als die Anzahl der Asylsuchenden von einigen Tausend pro Jahr urplötzlich auf Millionen anstieg.
Kein Politiker hinterfragte diese unfassbare Invasion von Flüchtlingsmassen, die von Süden her alle Grenzen durchbrachen und nicht zu stoppen waren. Keiner wunderte sich darüber, dass die meisten Flüchtlinge junge Männer waren, gut gekleidet und mit den modernsten Kommunikationsmitteln ausgerüstet. Sie wurden alle aufgenommen, untergebracht und versorgt. Manch ein Arbeitsloser oder schlecht bezahlter Lohnarbeiter fragte sich, woher plötzlich die Milliarden kamen, die für die Flüchtlinge aufgewendet wurden, wo doch angeblich kein Geld vorhanden war, um anständige Stundenlöhne zu bezahlen oder die Arbeitslosen mit dem Notwendigsten zu versorgen. Es brodelte in der Bevölkerung. Der Hass auf die Regierungen wuchs. Seit Jahrzehnten wurden alle Einwohner Europas ausspioniert, sämtliche E-Mails und Telefonate gespeichert, angeblich zum Zwecke der Terrorbekämpfung. Und terrorverdächtig waren seit Osama bin Laden selbstverständlich immer die Moslems. Und dann ließen die europäischen Regierungen unbesehen Millionen von potenziellen Terroristen ihre Länder überfluten, ohne sich auch nur die geringsten Gedanken über Hintergründe oder mögliche Folgen einer solchen Invasion zu machen.
Aus heutiger Sicht kann ich nur sagen: Zum Glück für uns; denn so sind wir unsere unfähigen und korrupten Regierungen auf elegante Weise losgeworden. Laut Gesetz durften die Flüchtlinge ihre Wohnorte nicht verlassen. Natürlich hielten sie sich nicht daran. Eine Kontrolle war unmöglich. Die jungen Männer konnten sich in aller Ruhe in den Ländern umsehen, feststellen, welche Schaltstellen der Macht am Tag X zu besetzen, welche Straßen zu sperren, welche Kommunikationswege lahmzulegen waren. Als sie dann zum letzten Schlag ausholten, war es eine Sache von wenigen Wochen und Europa war umorganisiert. Vom Balkan bis Dänemark hatten die Araber alle Staaten „aufgekauft“. Sie bezeichneten ihr neugewonnenes Reich als die „Vereinten arabischen Staaten Europas“, in Deutschland als VASE abgekürzt. Alle mächtigen Firmen waren fest in arabischer Hand, die Regierungen wurden abgesetzt und von den neuen Herren übernommen. Das Ganze ohne Gewalt und Militär. Es gab keinen Krieg, nur einen Machtwechsel. Nach einem anfänglichen Schreck war es den Bürgern relativ egal. Schlimmer, als es in den vergangenen Jahrzehnten ohnehin schon war, konnte es eh nicht mehr kommen, dachten die meisten vermutlich.
Alle Aktiengesellschaften, Banken und Großkonzerne wurden von den Arabern kontrolliert. Kleinere Firmen wie die von Papa konnten weitermachen wie bisher, wurden aber aufs Gründlichste überprüft. In Papas Firma wurde nicht nur Software für industrielle Anwendungen programmiert, sondern auch für militärische Projekte und hin und wieder auch mal blutrünstige Ballerspiele für Computerfreaks. Papa stand voll auf Ego-Shooter. Er sagte immer, dabei könne er sich am besten entspannen. Den Arabern gefielen Papas militärische Projekte nicht und die Ballerspiele noch viel weniger. Sie brachten eine neue Denkweise ins Land. Es sollte nichts mehr produziert werden, was schädlich, unnütz oder überflüssig ist. Es dauerte zwar ein paar Jahre, aber dann gab es keine unverrottbaren Verpackungen mehr, die Atommeiler wurden abgeschaltet, Giftstoffe wurden kaum noch hergestellt, die gesamte Landwirtschaft musste biologisch betrieben werden, alle Produkte mussten für lange Haltbarkeit und Wiederverwertbarkeit konzipiert werden. Manche Produzenten mussten ihre Firmen schließen. Dafür entstanden massenhaft Arbeitsplätze. Einige Verlierer murrten, aber durch das gesamte Volk ging ein Aufatmen. Endlich regierte die Vernunft. Als dann auch noch die ganze unsinnige Bürokratie auf ein erträgliches Maß zurechtgestutzt und die Arbeitszeit stufenweise gekürzt wurde, fingen die Bürger an, ihre neuen Herren zu lieben. Selbstverständlich wurde auch die unbezahlte Zwangsarbeit abgeschafft.
Ein besonders willkommener Nebeneffekt war das Sinken der Energiepreise, da das Öl direkt von den Ölfeldern nach Europa verkauft wurde, ohne zwischengeschaltete Börsenspekulationen und Preistreibereien. Die Araber wandten keine Repressalien an, sondern versuchten es mit Überzeugungsarbeit. Jeder durfte straflos seinen Glauben behalten. Niemand musste mehr Zwangsarbeit verrichten. Allerdings wurden nun in den Schulen Jungen und Mädchen in getrennten Klassen unterrichtet. Das fand ich richtig gut; denn die Jungs in meiner Klasse hatte ich schon immer als großmäulige Bremsklötze empfunden. Ich besuchte eine Privatschule, in der es – im Gegensatz zu den öffentlichen Schulen – relativ zivilisiert zuging. Aber auch hier waren die Jungs vorlaut und unausstehlich. Nun konnten wir Mädchen endlich mal so richtig loslegen.
Wie sich später herausstellte, waren die Mädchen den Jungen in ihrem Wissensstand bald weit voraus. Männer waren ja schon immer Spätzünder. Sie hatten nur deshalb die besseren Jobs bekommen, weil in einer Männergesellschaft die Männer zusammenhalten und sich gegenseitig unterstützen. So konnten auch die größten Deppen Macht erlangen. Das war nun auch vorbei. Schöne neue Welt.
Meine Eltern empfanden das wohl nicht ganz so wie ich. Sie wollten ihre Firma nicht kontrollieren lassen, redeten von fehlender Freiheit und konnten sich mit der neuen Herrschaft nicht abfinden. Kurz entschlossen verkauften sie Haus und Anwesen und wanderten mit Sack und Pack nach Tasmanien aus. Wahrscheinlich wollten sie so weit wie möglich entfernt sein von der neuen Ordnung, die sie nicht verstanden. Ich hatte die Wahl, mitzukommen oder bei Oma zu bleiben. Also blieb ich bei Oma.
Von der Intelligenz und Tatkraft meiner Vorfahren hatte ich offensichtlich wenig geerbt. Ich schaffte noch nicht mal das Abitur. Mit 17 ging ich von der Schule ab. Ich brauchte ja nicht zu arbeiten, weil Oma genug Geld hatte. Meine Eltern hatten in Tasmanien eine neue Softwarefirma aufgebaut. Oma und ich malten weiter unsere Bilder, fast nur Landschaften, nichts Abstraktes. Wir hatten schon so viele Gemälde, dass wir bald nicht mehr wussten wohin damit.
Dann kam Oma auf die glorreiche Idee, eine Ausstellung zu machen. Unsere Bilder waren richtig gut. Oma malte all die Landschaften, die sie auf ihren Reisen gesehen hatte und ich pinselte unsere heimische Landschaft auf die Leinwand. Wir verkauften viele Bilder. Oma meinte, um Platz zu schaffen, könnten wir doch eine Galerie eröffnen, um unsere Bilder und auch die von anderen Malern zu verkaufen.
Es ergab sich, dass der Reiseagentur die Räumlichkeiten in Omas Haus zu klein geworden waren. Sie zogen aus, wir ließen das Erdgeschoss umbauen und richteten unsere Galerie ein, der wir den etwas albernen Namen „Die Ölquelle“ gaben. Schließlich war das Öl, wenn auch Erdöl, der Grund dafür, dass jetzt in Europa ein völlig anderer Wind wehte und die Menschen glücklich und zufrieden waren. Die meiste Zeit betreute ich die Galerie, während Oma im Dachgeschoss malte.
Kapitel 3
Eines Tages kam ein ausgesprochen gut aussehender Araber in unseren Laden. Ich verliebte mich Hals über Kopf in ihn und da ich – wie Oma meinte – die Schönheit meiner Mutter geerbt hatte, war es kein Kunststück für mich, ihn zu erobern. Es stellte sich heraus, dass er der Besitzer der Firma war, die jetzt auf unserem ehemaligen Anwesen residierte. Auch unsere Villa gehörte jetzt ihm. Ich war gerade 18 geworden, als wir heirateten.
Osama, mein Ehemann, war schon 32, was Oma zu ein paar Warnungen veranlasste, die ich aber ignorierte. Vor unserer Eheschließung musste ich zum Islam übertreten, denn Osama war strenggläubiger Moslem. Ich entsprach freudig seinem Wunsch, denn ich liebe die Araber und ihre Lebensart, die auf Toleranz und Großzügigkeit basiert; ganz anders, als die Medien den europäischen Völkern jahrzehntelang einzubläuen versucht hatten. Als Ehefrau eines geachteten und erfolgreichen Geschäftsmannes musste ich in der Öffentlichkeit schickliche Kleidung tragen, aber das störte mich nicht im geringsten. Es gefiel mir, in knöchellangen Wallegewändern und mit versteckten Haaren aufzutreten. Gesichtsschleier sind erlaubt, aber nicht vorgeschrieben. Schließlich wohnen wir hier nicht in der Wüste, wo Sand und Staub herumfliegen.
Nur das züchtige Verdecken von Armen, Beinen und Haaren ist erwünscht. Weitfallende Hosen sind auch in Ordnung, im Gegensatz zu hautengen Jeans oder gar diesen unsäglichen Wurstepelle-Leggins. Geschäftsfrauen in „männlichen“ Hosenanzügen fanden wir bald nur noch lächerlich. Unisex ist mega out. Und der „Ölquelle“, in der ich nach wie vor ein paar Stunden am Tag arbeitete, gab mein Outfit den ganz besonderen Touch.
Meine schwarzen Haare, die mir bis zur Taille reichten, ließ ich flammend-rot färben, mit hellroten und dunkelroten Strähnen. Osama war begeistert. Die Araber lieben rote Haare.
Da ich nun nicht mehr den ganzen Tag in der Galerie arbeiten konnte, stellten Oma und ich eine junge Frau ein. Auch sie kam in arabischen Gewändern zur Arbeit und so wurde unser Laden bei den wohlhabenden Moslems sehr beliebt. Leider geschah es immer wieder, dass uns die jungen Damen nach kürzester Zeit weggeheiratet wurden. So stellten wir schließlich einen Mann ein.
Ich wohnte jetzt mit meinem Mann in der großen Villa. Osama hatte einen Swimmingpool bauen lassen, der genau wie das Grundstück ringsum von einer dichten Hecke gegen unerwünschten Einblick geschützt ist. Wir haben eine Menge Dienstboten, die in dem Seitenflügel wohnen, der einst das Refugium meiner Oma war.
Ich lebte wie eine Prinzessin. Osama trug mich auf Händen, ich konnte jederzeit zu Oma gehen und malen oder in der Galerie arbeiten. Das einzige Haar in der Suppe war, dass mein Mann genau so ein Arbeitstier war wie mein Vater. Ich kriegte ihn kaum zu sehen. So hatte ich mir das nicht vorgestellt. Oft brachte er sich auch noch Arbeit mit nach Hause und vergrub sich in seinen Arbeitsräumen in die diversen Projekte. Ich fing an, mich in meinem goldenen Käfig zu langweilen, auch wenn wir häufig große Parties gaben.
Ich war schon immer sehr neugierig gewesen. Und so spitzte ich bei solchen gesellschaftlichen Anlässen die Ohren und schnappte allerhand auf. Um die Jahreswende von 2043 zu 2044 häuften sich die Partys in unserem Hause und es wurde viel Geheimniskrämerei veranstaltet. Es ging vermutlich um Zeitreisen, wie ich mir aus zufälligen Gesprächsfetzen zusammenreimte.
Kapitel 4
Osama verschloss neuerdings oft Sachen, die er aus der Firma mitbrachte, in dem großen Safe, der in seinem Arbeitszimmer stand. Früher hatte er immer alles offen auf seinem Schreibtisch liegen lassen, wohl in der Annahme, dass ich von dem ganzen Computerkram sowieso nichts verstehe.
Ich fing an, während seiner Abwesenheit in seinem Büro herumzuschnüffeln. Zeitreisen, das war doch mal etwas Aufregendes. Ich stöberte in Osamas Computer und studierte alle Aufzeichnungen, die ich fand. Die Gefahr, dass er mich erwischte, bestand kaum; denn vom Arbeitszimmer hatte ich direkten Blick auf unsere lange Auffahrt. Ich konnte ihn schon von Weitem kommen sehen und hatte dann genug Zeit zu verschwinden. Ich ging sogar so weit, mir eine kleine Spionkamera zu besorgen wie sie in jedem Computerladen für wenig Geld erhältlich sind. Die installierte ich so, dass sie das Öffnen des Safes aufzeichnen konnte. Als ich die Kombination hatte, entfernte ich die Kamera wieder.
Kaum hatte Osama das Haus verlassen, war ich schon am Safe. Tatsächlich lag etwas Interessantes darin. Es sah aus wie ein Gürtel, aber nicht aus Leder, sondern aus einem schimmernden Metall, das in ganz zarten Ringen ineinander verflochten war. Das, was ich für die Gürtelschließe hielt, war aus dem gleichen Metall, recht massiv und groß für eine Gürtelschließe, fast so groß wie meine Hand, rechteckig mit abgerundeten Ecken. Ich nahm das Ding staunend in die Hand. War Osama unter die Modedesigner gegangen? Wider Erwarten war der Gürtel federleicht.
Eine Dokumentenmappe lag auch im Safe. Ich blätterte den Stapel Papier durch und stieß auf eine Seite mit der Überschrift „Gebrauch des TGap“. So, Tgap hieß das Gerät also. Offensichtlich eine der bei Technikern beliebten Abkürzungen. Wofür? Timegap – Zeitlücke? Great Arab Patent? Tückischer Geheimapparat? Time goes antipasti? Ach egal, das war nicht weiter wichtig. Ich las weiter. „Der Tgap ist ein Gerät, mit dem Sie durch die Zeit reisen können.“
Mir wurde ein bisschen mulmig. Da war ich wohl auf ein größeres Geheimnis gestoßen als ich erwartet hatte. Aber dennoch konnte ich die Finger nicht davon lassen. Die Gebrauchsanweisung war leicht verständlich abgefasst und relativ kurz. Ich nahm sie mir vor und lernte, wie sich die Zeitmaschine bedienen lässt. „Legen sie den am TGap befestigten Hohlringgürtel auf die nackte Haut um die Taille und schieben Sie das lose Ende des Gürtels in den Schlitz am TGap. Der Gürtel wird sich automatisch an ihren Körper anpassen.“
Okay, kein Problem. „Öffnen Sie den Verschluss, indem Sie gleichzeitig auf beide Schmalseiten drücken“. Ich fasste die Gürtelschnalle mit beiden Händen und versuchte es. Sie sprang auf, indem die Vorderseite nach vorn wegklappte und in einem solchen Winkel stehenblieb, dass ich auf die Innenseite blicken konnte. Dort sah ich ein kleines Display, Tasten mit den Ziffern 0 bis 9, einen schmalen rechteckigen Knopf und zwei runde Knöpfe, davon einer rot und einer grün.
Die Gebrauchsanweisung erklärte, was ich einzustellen hatte. Datum und Uhrzeit des Ziels mussten minutengenau eingegeben werden, keine Sekunden. Der rote Knopf startete den Sprung, der rechteckige löschte alle Eingaben. Mit dem grünen Knopf konnte man automatisch zur Ausgangszeit plus fünf Minuten zurückspringen. Das sollte laut Anleitung verhindern, dass man sich selbst am Ausgangspunkt begegnet.
Außerdem wurde darauf hingewiesen, dass man nicht zu einem anderen Ort springen kann, sondern nur in der Zeit versetzt wird. Und auch: „Sie können kein zweites Mal in eine Zeit in der Vergangenheit springen, in der sie sich schon aufgehalten haben. Der TGap verhindert einen solchen Versuch automatisch, indem er eine derartige Programmierung mit einer Fehlermeldung zurückweist.“
Zu meiner Beruhigung wurde auch beschrieben, dass die Erdrotation ebenso wie der Flug unseres Planeten durch das Weltall keinen Einfluss darauf haben, wo man landet. Und eine Landung in zehn Metern Höhe, wo vorher ein Gebäude gestanden hatte oder im Inneren von fester Materie sei ebenfalls ausgeschlossen. Wie das funktionierte wurde nicht erklärt. „Nach dem Drücken der roten Taste schließt sich der Deckel des TGap automatisch.“ Na, wunderbar, alles vollautomatisch. „Der TGap ist mit einer RG100-Batterie ausgerüstet.“ Alles klar, eine selbstregenerierende Batterie mit hundert Jahren Lebensdauer. Am Ende der Bedienungsanleitung stand die Überschrift „Warnungen und Hinweise“ und darunter eine Anmerkung, dass diese noch von den Ingenieuren zusammen mit den Anwälten der Firma ausgetüftelt werden mussten. Ich war so aufgeregt, dass mir die Hände zitterten. Ich legte alles wieder in den Safe und verließ das Zimmer, als sei ich nie darin gewesen.
In den nächsten Tagen ließ mich der Gedanke an eine mögliche Zeitreise nicht los. Welche Zeit würde ich gerne sehen? Mir fiel der Urgroßvater meiner Oma ein. Es gab da ein dunkles Geheimnis in der Familie, über das ungern gesprochen wurde. Irgendwann hatte ich bei Oma ein Foto meines Urururgroßvaters Wilhelm entdeckt. Ein gut aussehender junger Mann, der sich stolz mit seinem Fahrrad ablichten ließ. Ich bekam große Lust, diesen Urahnen zu besuchen.
Er war in Nieste, einem kleinen Dorf in Hessen, aufgewachsen. Ich musste also eine Entfernung von etwas über hundert Kilometern zurücklegen. Das wäre in einer Stunde zu schaffen. Ich könnte das Firmenfahrzeug der Galerie nehmen und sagen, ich wolle mich in Kassel nach Bildern umsehen. Dann könnte ich den ganzen Tag abwesend sein, ohne dass es auffiel. Für die Fahrt nach Nieste eine Stunde, fünf Minuten nach Beginn meiner Zeitreise wäre ich wieder zurück in der Jetztzeit, eine Stunde für die Rückfahrt. Vor der Rückfahrt könnte ich mich in Kassel nach Bildern umsehen, so dass ich nicht mit leeren Händen nach Hause kam. Perfekt!
Nun blieb nur noch zu überlegen, an welchem Tag ich meinen Urururgroßvater besuchen wollte. Auf jeden Fall im Sommer. Ich hatte keine Lust, im Winter in der Vergangenheit anzukommen und in dunklen Räumen mit rußenden Öfen zu sitzen. Warum nicht zum 18. Geburtstag meines Vorfahren? Wilhelm war 1871 geboren, am 8. August. Mein Ziel sollte also der 8. August 1889 sein. Den Zeitsprung musste ich nachts machen, um unbeobachtet zu bleiben.
Nun kam es nur noch darauf an, ob Osama den Zeitgürtel im Safe ließ oder wieder mit in die Firma nahm. Ob er ihn schon ausprobiert hatte? Vielleicht war deshalb jede Störung strengstens verboten, wenn er abends in seinem Arbeitszimmer war. Nun, wenn es ihm gelungen war, ungefährdet durch die Zeit zu springen, dann konnte ich das auch.
Am Samstag teilte mir Osama mit, dass er am Dienstag eine dreitägige Geschäftsreise nach Riad unternehmen würde, und fragte mich, ob ich Lust habe, ihn zum Flughafen zu begleiten. Sein Flug ging erst am Abend, so konnten wir vorher noch durch die Stadt bummeln, schick essen gehen, und ich konnte mir die neueste Mode ansehen. Bei uns in der Provinz war es schwierig, ausgefallene Sachen zu finden.
Ich informierte mich im Internet über die Mode um 1889, um die passende Kleidung für meinen Ausflug zu kaufen. Kurz entschlossen kaufte ich eine Nano-Kamera; denn ich wollte unbedingt Fotos und Filme aus der Vergangenheit mitbringen. Die Kamera, mit der ich die Tresorkombination ausspioniert habe, war nicht größer als eine Erbse. Die neuen Nano-Kameras sind so klein, dass man sie mit den Fingern gar nicht anfassen kann. Darum werden sie oft in Schmuckstücke, Handys (die wie eine Uhr am Arm getragen werden) oder Sonnenbrillen eingebaut. Seit Fehlsichtigkeit mit einer Laser-Operation schnell behoben werden kann, sind Sonnenbrillen groß in Mode. Und wer will schon ständig Kontaktlinsen tragen, um die Augen vor UV-Strahlung zu schützen. Ich brauchte etwas Unauffälliges und fand schließlich eine altmodisch aussehende Brosche mit eingebauter Kamera. Damit kann man zwar keine Stereofilme und –fotos machen, denn dafür sind zwei Objektive nötig, aber darauf konnte ich verzichten. Ich brauchte nur mit dem Finger die Brosche zu berühren, und schon filmte sie alles. Der Speicher war groß genug für acht Stunden Film oder für 200.000 Einzelbilder.
Montag früh waren der Zeitgürtel und sämtliche Dokumente aus dem Safe verschwunden. „Oh nein“, dachte ich, „er will ihn mitnehmen nach Riad. Warum habe ich nur so lange gewartet?“ Ich war total geknickt. Aus der Traum vom Besuch bei Urahn Wilhelm. Am Dienstag hatte ich keine Gelegenheit, im Safe nachzuschauen, weil Osama im Haus blieb. Kurz nach Mittag fuhren wir los nach Hannover. Im besten Sushi-Restaurant der Stadt nahmen wir eine leichte Mahlzeit ein. Dann kauften wir bei einem Haschischhändler einen Vorrat guter Ware ein.
Die Moslemregierung hat Alkohol zwar nicht verboten, aber hochprozentige Alkoholika mit immensen Steuern belegt. Auch Bier und Wein sind doppelt so teuer wie früher. Dadurch wurde der Massenkonsum berauschender Getränke wirksam eingedämmt. Darüber hinaus müssen sich alle Betreiber von Gaststätten mit Alkoholausschank verpflichten, jedem Gast nur eine begrenzte Menge Alkohol zu verkaufen. Jeder Gast, der mehr als 0,5 Promille hat, was mit dem Alkometer geprüft wird, muss seine Fahrzeugschlüssel abgeben. Ein Gastwirt, der gegen diese strikten Auflagen verstößt, verliert für alle Zeiten seine Lizenz.
Betrunkene Schlägereien und Alkohol am Steuer kommen kaum noch vor. Die Anzahl der Ehefrauen, die von ihren betrunkenen Männern verprügelt wurden, sank rapide. Die Gaststätten entwickelten sich zu Treffpunkten friedlicher Leute. Hin und wieder kreist ein Joint oder die Wasserpfeife. Selbstverständlich müssen auch die Haschischraucher ihre Fahrzeugschlüssel beim Wirt hinterlegen.
Ich genoss den Einkaufsbummel mit meinem Mann, den ich selten so lange für mich hatte. Osama kaufte noch Geschenke für seine Geschäftspartner und Freunde. Dann war ich an der Reihe. Wir suchten einige Modehäuser auf und ich probierte die neuesten Kreationen an. Osama gehört nicht zu den Männern, die sich dabei langweilen. Er schien es regelrecht zu genießen, wenn ich in den teuren Fummeln an ihm vorbei schwebte. Nachdem wir einige moderne orientalische Stücke ausgesucht hatten, fand ich einen dunkelbraunen langen Rock aus rustikalem Stoff, der mir für das Jahr 1889 geeignet schien. Dazu eine beigefarbene langärmelige Bluse mit Knöpfen und Rüschen. Erst als ich in einem Hosenanzug aus Baumwolle erschien, verzog mein Mann missbilligend das Gesicht. Hosen waren für Frauen verpönt. Einige wenige Frauen trugen sie aus Protest, aber den meisten gefiel die bequeme arabische Mode aus bunten Seidenstoffen viel besser. Ich kaufte den Hosenanzug trotzdem.
Nun brauchte ich noch handfeste Schuhe. Im Schuhgeschäft probierte ich Unmengen eleganter Schuhe an, kaufte ein paar entzückende Modelle und griff dann wie zufällig nach einem Paar stabiler Wanderschuhe. Osama fragte mich auch gleich: „Was hast du vor? Willst du einen Berg besteigen?“ „Nein, ganz bestimmt nicht. Aber sieh doch nur wie hübsch sie sind“, entgegnete ich. „Hübsch? Naja“, murmelte Osama. In der Tat sahen sie nicht gerade elegant aus zu meinem türkisfarbenen Kleid. Ich bat die Verkäuferin, alles einzupacken, auch die Wanderschuhe, und lenkte Osama ab: „Jetzt habe ich richtig Hunger. Wohin gehen wir essen?“
Vom Flughafen fuhr ich direkt nach Hause. Unser Butler schaffte die Einkäufe ins Haus. Als die Luft rein war, stürzte ich zum Safe. Mein Herz machte einen Sprung: Da lag der Zeitgürtel. Ich konnte starten. Aber nicht sofort. Für heute war ich zu müde.
Kapitel 5
Am nächsten Tag schaute ich kurz in der Galerie nach dem Rechten und besuchte anschließend Oma. Sie hatte gerade ein neues Bild angefangen, eine exotische Landschaft auf den Fidschi-Inseln. Oma schien ein fotografisches Gedächtnis zu haben. Nie malte sie nach den Fotos, die sie auf ihren vielen Reisen gemacht hatte, sondern immer aus dem Gedächtnis. Aber wenn sie ein neues Bild begonnen hatte, wollte sie nicht gestört werden.