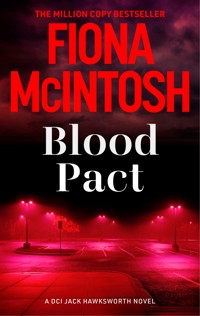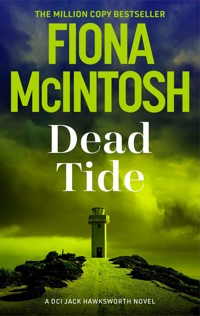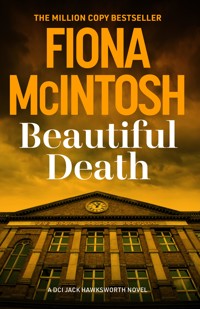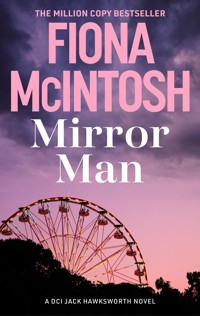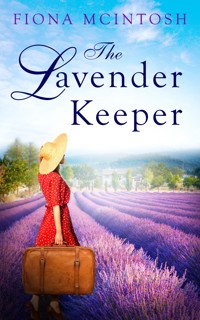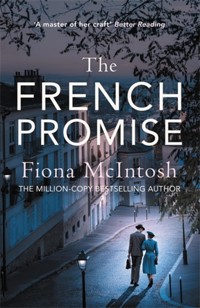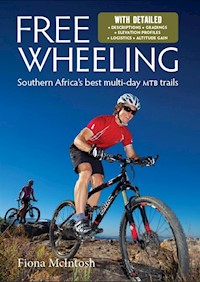9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die mitreißendste Liebesgeschichte seit »Der Englische Patient«!
England, Herbst 1918. Ein junger Mann erwacht in einem Sanatorium ohne jede Erinnerung an sein früheres Leben. Er weiß nur, dass er während des Ersten Weltkriegs in Flandern gekämpft und dort Schreckliches erlebt hat. Als er an einem Tag im November im Garten der hübschen Schneiderin Eden Valentine begegnet, die einen Botengang für ihren Vater erledigt, überredet er sie, ihm zur Flucht zu verhelfen. Tom und Edie verlieben sich, doch können sie nicht ahnen, dass eine junge Frau verzweifelt auf der Suche nach Tom ist und ihn im Sanatorium nur knapp verpasst hat. Bald schon wird die Vergangenheit das glückliche Paar mit aller Macht einholen und ihre Liebe auf eine harte Probe stellen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 654
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Buch
Ein englischer Soldat, genannt Jones, erwacht in einem Hospital ohne jede Erinnerung an sein früheres Leben. Es ist der Herbst 1918, der Erste Weltkrieg ist vorüber, doch die Spanische Grippe wütet in Europa und fordert weitere Todesopfer. Als sie schließlich auch das Sanatorium erreicht, überredet Jones eine hübsche junge Frau, der er im Garten begegnet, ihm zur Flucht zu verhelfen. Eden Valentine ist die Tochter eines angesehenen Londoner Schneiders und träumt davon, eines Tages selbst ein eigenes Atelier zu eröffnen. Obwohl sie verlobt ist, fühlt sie sich sofort zu dem attraktiven Soldaten hingezogen. Sie tauft ihn kurzerhand Tom, und da er niemanden hat, quartiert sie ihn – den Bedenken ihres Vaters zum Trotz – in ihrem Elternhaus ein. Was die beiden nicht wissen: Eine junge Frau ist verzweifelt auf der Suche nach Tom und hat ihn im Hospital nur knapp verpasst … Edie und Tom verlieben sich, heiraten, und bald schon erwartet das glückliche Paar ein Kind. Doch dann holt die Vergangenheit sie mit aller Macht ein und reißt die beiden von einem Tag auf den anderen auseinander. Wird ihre Liebe den Hindernissen, die das Schicksal noch für sie bereithält, trotzen?
Autorin
Fiona McIntosh stammt aus Brighton in England, zog jedoch schon als Teenager nach Australien. Gemeinsam mit ihrem Mann baute sie sich dort eine erfolgreiche Karriere in der Tourismusbranche auf, bevor sie sich dem Schreiben zuwandte. Die Autorin lebt mit ihrer Familie – bestehend aus ihrem Mann, ihren beiden Söhnen, zwei frechen Hunden und zwei verrückten Vögeln – im Süden Australiens.
Von Fiona McIntosh bereits erschienen
Herzen aus Gold · Der Duft der verlorenen Träume · Wenn der Lavendel wieder blüht
Besuchen Sie uns auch auf
www.facebook.com/blanvalet und
www.twitter.com/BlanvaletVerlag
FIONA MCINTOSH
Das Mädchenim roten Kleid
Roman
Deutsch von Theda Krohm-Linke
Für Jack McIntosh … der davon träumt, sich seine Anzüge in der Savile Row schneidern zu lassen.
1
November 1918
Der Mann schreckte aus dem Schlaf auf. Er starrte auf die vertraute Deckenfarbe, die Blasen warf, aber je mehr er versuchte, die Erinnerungen aus seinem Traum festzuhalten, desto schneller trieben sie davon, wie spinnwebfeine Seidenfäden im Wind. Doch die nächtlichen Schrecken hinterließen eine beißende Bitterkeit in seinem Mund, den metallischen Geschmack von Blut, den üblen Gestank von fauligem Fleisch und menschlichen Ausscheidungen, den durchdringenden Schießpulvergeruch und den von kaltem Tabak, Schweiß … aber vor allem den eisigen, scharfen Geschmack von Angst. Diejenigen, die ihn pflegten, versicherten ihm, er würde lediglich die Zeit in den Schützengräben noch einmal durchleben – Das kommt häufig vor; machen Sie sich keine Sorgen, es wird vergehen, und andere freundliche Beschwichtigungen –, aber nichts vermochte den wiederkehrenden Albtraum zu verscheuchen.
Er fröstelte unter der Decke des Krankenhausbettes. In einer Ecke war der Name seines gegenwärtigen Heims blau eingestickt. Edmonton-Militärhospital. Die Decke war grob und viel zu klein, aber immerhin stand sein schmales Eisenbett neben der Heizung. Der uralte, pfeifende Heizkörper tröstete ihn, und er fragte sich, wie viele andere Männer wohl in diesem Bett gelegen hatten und warum. Ein flüchtiger Beobachter hätte ihn für gesund halten können. Die Wunden waren so gut wie verheilt, und mittlerweile zeugte nur noch ein leichtes Humpeln von der Verletzung, die er sich an der Front zugezogen hatte. Wesentlich schlimmer war die unsichtbare Narbe, die er im Inneren mit sich trug.
Er konnte sich nicht daran erinnern, wie er verletzt worden war, und weil er als »unbekannter Soldat« eingeliefert worden war, konnten ihm die Ärzte und Schwestern auch nichts dazu sagen. Sie waren einhellig der Meinung gewesen, dass er dem Zustand seiner Wunden und dem besonderen Kreuz-und-quer-Stil seines Verbands nach zu urteilen eine Zeitlang in einem Feldlazarett gelegen haben musste, wahrscheinlich in Flandern. Und deshalb dachte er, er habe möglicherweise in Ypern gekämpft.
Vor einigen Monaten war er nach Hause geschickt worden, und man hatte ihn hierher nach London gebracht. Die meiste Zeit war er aufgrund einer schweren Gehirnerschütterung bewusstlos gewesen, zwischendurch hatte er Fieberanfälle durch die Infektionen gehabt und vor Schüttelfrost mit den Zähnen geklappert.
Abgesehen von den lebhaften Traumbildern, die ihm sofort entglitten, wenn er aufwachte, konnte er sich an nichts erinnern, was vor dem Juni 1918 passiert war. Seine erste klare Erinnerung war, dass er auf einem Schiff aufwachte, das den Kanal nach England überquerte. Um ihn herum sangen, rauchten, redeten Männer leise in den Ecken, während andere vor Schmerzen stöhnten. Allen war heiß, und die meisten wären wohl lieber an Deck gewesen, aber niemand beklagte sich. Sie alle waren in der Hölle gewesen und hatten überlebt. Mit ausdruckslosem Gesicht hatte er die Szene um sich herum betrachtet. Er fühlte nur Verwirrung – er konnte sich einfach nicht an das erinnern, was sie alle zu vergessen versuchten.
»Morgen, Jonesy.« Eine helle Stimme durchschnitt seine Erschöpfung und brachte ihn in die Gegenwart zurück. »Brrr … heute ist es aber kalt.«
»Guten Morgen, Nancy«, sagte er und rang sich für die Krankenschwester, die niemals ihre gute Laune zu verlieren schien, ein Lächeln ab.
»Wie geht es uns?« Sie fühlte ihm den Puls.
»Uns geht es gut«, sagte er. Das strahlende Weiß ihrer gestärkten Schürze, das einen starken Kontrast zu ihrer blauschwarzen Schwesterntracht bildete, beeindruckte ihn sehr. Beides trat jedoch in den Hintergrund vor ihren leuchtend roten Haaren. Nancy hatte die Krankenschwesternhaube so weit wie möglich zurückgeschoben, wodurch goldrote Löckchen hervorquollen. Sie war nicht unbedingt ein Hingucker, aber er fand sie trotzdem äußerst attraktiv. Ihre kecke Art war verführerisch, und sie war sogar jetzt zu spüren, während sie konzentriert zählte und auf ihre Taschenuhr blickte.
»Sie sehen auch gut aus«, sagte sie schließlich. »Und, wenn ich das sagen darf, auch sehr attraktiv trotz dieses Bartes.«
Er rieb sich über das Kinn. Noch weigerte er sich, den wilden schwarzen Bartwuchs abzurasieren.
»Vielleicht würde Sie ja jemand erkennen, wenn Sie sich rasierten«, sagte Nancy schelmisch und schüttelte ihm die Kissen auf. »Wollen Sie sich anziehen?«
»Hat das einen Sinn?«, sagte er, wobei er ihren fröhlichen Tonfall nachahmte.
Sie versetzte ihm einen leichten Klaps. »Ja, Mr Jones. Ich würde schrecklich gerne Ihren richtigen Namen erfahren. Sie klingen überhaupt nicht so, als würden Sie hierher gehören.«
»Wohin gehöre ich denn?«, fragte er und stand auf, damit sie seine Bettdecke und das Laken richten konnte. Er trat ans Fenster, wobei er zu verbergen versuchte, dass der Pantoffel an seinem linken Fuß wie ein leiser Seufzer über das Linoleum glitt.
»Oh, vermutlich an irgendeinen eleganten Ort im Süden«, antwortete sie.
Er überlegte. »Vielleicht bin ich ein berühmter Schauspieler.«
»Dann hätte ich Sie erkannt.« Stirnrunzelnd schüttelte sie den Kopf. »Ich glaube, Sie waren eher Anwalt oder Bankier«, sagte sie. »Dann würde ich definitiv mit Ihnen ausgehen.«
»Habe ich Sie darum gebeten?«, fragte er und wandte sich verlegen zu ihr um. Unwillkürlich zog er seinen Morgenmantel fester um sich.
»Nein, aber ich warte auf eine Einladung, jetzt, wo Sie wieder laufen können und wir endlich Frieden haben.« Sie warf ihm einen wissenden Blick zu.
Frieden. Das hatte für ihn keine Bedeutung. »Was haben wir heute für ein Datum, Nan?«
»Den neunzehnten November. Sie sind bestimmt nicht der Erste, der das heute fragt. Ich glaube, das ganze Land hat immer noch so eine Art Kater.« Lachend schüttelte sie den Kopf. »Ich muss mich ja selbst immer wieder kneifen. Vier Jahre …« Seufzend schnippte sie mit den Fingern. »Einfach so vorbei. Worum ist es eigentlich gegangen?«
Da fragte sie den Falschen. Er drehte sich erneut um und blickte aus dem Fenster in den gepflegten Krankenhauspark. Früher einmal, so hatte man ihm erzählt, hatten prächtige Blumenbeete den Vordereingang geschmückt, aber in den letzten Jahren war dort Gemüse angepflanzt worden. Im nächsten Frühjahr würde erneut ein Blütenmeer das Feld der Geschichte überdecken. Er befand sich in dem Flügel, den sie das Sanatorium nannten. Er lag ein wenig abseits vom Krankenhaus, und es war angenehm gewesen, als sie noch zu viert waren, aber seine drei Zimmergenossen waren mittlerweile wieder nach Hause zu ihren Familien zurückgekehrt, und jetzt verstärkte die Lage des Sanatoriums nur seine Isolation.
Ein weiterer kleiner Garten draußen war umgeben von kahlen, dornigen Rosenbüschen. Reif bedeckte den Rasen, und er sah ein Rotkehlchen in einem fast laublosen Strauch. Es hockte zwischen den orangefarbenen Hagebutten und zwitscherte melodiös. Der U-Form der olivbraunen Stirn nach zu urteilen, war es ein Männchen. Woher weiß ich das?, dachte er. Das Rotkehlchen sah so einsam aus, wie er sich fühlte, und sein Gesang klang so kläglich wie seine Stimmung. Er verstand es, weil er wusste, dass dieser Vogel die Ruhe so sehr mochte wie er.
»So, Jonesy. Ich komme gleich wieder. Haben Sie sich bis dahin geduscht?«
»Ja, bestimmt. Ich hasse es, Sie zu enttäuschen.«
Sie drückte seinen Arm. »Wenn nur alle Patienten so einfach wären wie Sie. Meinetwegen können Sie für immer hierbleiben.«
Bei ihren Worten lief es ihm eiskalt über den Rücken. Er wusste, dass sie es nur lieb gemeint hatte, aber ihm drehte sich der Magen um.
»Sie gehören zu den Glücklichen«, fügte sie hinzu. »Sehen Sie diese hübsche Frau da?« Sie wies mit dem Kinn zum Fenster, und er sah eine dunkelhaarige Frau in einem dunkelblauen Kostüm und braunen Handschuhen, die den Weg entlangging, der an seinem Flügel vorbeiführte. »Ich habe heute gehört, dass sie ihren Bruder verloren hat. Er muss in Ihrem Alter gewesen sein; sie sagte, er sei dreiunddreißig gewesen. Sie klang so niedergeschlagen … als ob es erst gestern passiert wäre.«
»Vermisst?«
»Nein, gefallen, aber es gibt keine genauen Informationen darüber – seine Leiche wurde neben anderen namenlosen Soldaten 1915 beerdigt. In Ypern, meine ich, hätte sie gesagt.«
Er blinzelte. »Wo ich war?«
»Wir nehmen an, dass Sie von dort gekommen sind«, sagte sie und hob warnend den Finger.
Die Frau war hinter der Hecke verschwunden. »Wen besucht sie?«
»Niemanden. Dort, wo Sie an den meisten Tagen mürrisch draußen sitzen, befindet sich auch der Lieferanteneingang.« Nancy zuckte mit den Schultern. »Sie hat dem Krankenhausdirektor etwas gebracht. Anscheinend hat sie in der Cafeteria auf ihn gewartet. Dort habe ich gehört, wie sie über ihren Bruder geredet hat.« Nancys Tonfall wurde wieder sachlich. »So, und jetzt ab in die Dusche. Danach gehen Sie in den Frühstücksraum …«
»Oh, Nancy, ich würde lieber …«
»Ja, Mr Jones, ich weiß, was Sie lieber würden, aber … Krankenhausordnung.«
»Was ist mit der Spanischen Grippe?«
Sie blinzelte und war sofort abgelenkt. »Wir haben in der Nacht zwei weitere Patienten verloren. Und zwei Krankenschwestern – mittlerweile sind vier von uns gestorben.«
»Nan, das tut mir so leid«, sagte er, beschämt, weil er ihr die gute Laune verdorben hatte.
»Es ist eine schreckliche Krankheit, und sie trifft jeden. Beth Churcher war eine großartige Krankenschwester – wir haben sie alle geliebt. Sie ist innerhalb von zwei Tagen gestorben. Länger hat es nicht gedauert. In der einen Sekunde war sie noch gesund, und in der nächsten hatte sie auf einmal diese schreckliche blaue Hautfärbung, die ihr das Todesurteil verkündete.« Er schüttelte voller Bedauern den Kopf. Zwar kannte er Beth nicht, aber er sah Nan an, wie nahe es ihr ging. »Und der junge Joey Nesbitt. Er wollte in einer Woche nach Hause gehen. Den anderen Patienten und auch die andere Krankenschwester kannte ich nicht, aber es wurde uns heute früh in der Morgenbesprechung mitgeteilt. Und das werden nicht die letzten Opfer sein«, sagte sie traurig.
»Umso mehr ein Grund für mich hierzubleiben«, sagte er.
Erstaunlicherweise stimmte Nan ihm zu. »Dieser Teil des Krankenhauses ist ziemlich verlassen. Wahrscheinlich sind Sie hier geschützt, und ich habe nicht auf denselben Stationen gearbeitet wie Betty, wo Joey und der andere Mann gestorben sind.« Sie lächelte wieder. »Na gut. Bleiben Sie hier. Ich bringe Ihnen gleich etwas zu essen. Aber vergessen Sie nicht, morgen ist die Friedensfeier. Ich habe Ihr gutes Hemd in die Wäscherei gegeben. Alle ziehen ihre besten Sachen an. Ich bringe Ihnen auch ein Rasiermesser.« Sie zwinkerte ihm zu, als sie ging.
Er konnte sich nicht vorstellen, dass eine Feier angesichts der Grippeepidemie, die die gesamte Nation überrollte, besonders klug war. Erst letzte Woche hatte er im Garten gesessen, als auf der anderen Seite der Hecke eine Familie vorbeiging. Ein kleines Mädchen sang einen Kinderreim, in dem es um einen kleinen Vogel namens Enza ging, der die Influenza ins Zimmer brachte. Er bezweifelte, dass das Kind den makabren Sinn hinter den Worten verstand.
Die Spanische Grippe, wie sie auch genannt wurde, tötete alles, was ihr über den Weg lief. Es war ihr völlig gleichgültig, dass Europa schon eine ganze Generation junger Männer verloren hatte. Jetzt brachte sie auch noch die Eltern, die Großeltern, die Geschwister, die Tanten und Onkel, Vettern und Cousinen … und alle ihre Freunde um.
Manche sagten, diese Krankheit sei schlimmer als der Schwarze Tod und sie raffe die Menschen schneller dahin, als jeder Krieg es vermochte. Er hatte gelesen, sie habe in den Schützengräben begonnen. Soldaten, die nicht auf dem Schlachtfeld gestorben waren, hatten die Krankheit mit nach Hause gebracht – manche glaubten, sie sei in Schottland ausgebrochen und habe sich auf einen mörderischen Weg nach Süden begeben und Tausende getötet. Er hatte auch gelesen, dass im Oktober schon mehr als eine Viertelmillion Briten, die meisten von ihnen gesund, an der Spanischen Grippe gestorben waren.
Und jetzt starben sie schon hier im Krankenhaus.
Er wandte seine Aufmerksamkeit wieder dem Weg zu, den die trauernde junge Frau eingeschlagen hatte. Das Geräusch ihrer Absätze auf dem Pflaster hallte dumpf in seinem Kopf nach, und er beneidete sie um die Freiheit, diesen Ort wieder verlassen zu können.
Die Träume waren jetzt schlimmer, erfüllt von gelblich grünem Totendunst und Männern, die blind umherstolperten, erstickten und sich auf erniedrigende Weise entleerten, wenn ihre Körper knietief im Schlamm versanken. Niemand hatte einen Namen, die Uniformen sagten ihm nichts, und seine Gefährten hatten keine Gesichter – manche waren weggeschossen worden, andere nicht zu erkennen.
Heute erwachte er traurig. Er hasste das Gefühl, niemand zu sein. Auch er hatte doch bestimmt mal zu jemandem gehört!
Er duschte sich rasch, insgeheim erfreut darüber, dass er sich endlich wieder alleine waschen konnte. Er befeuchtete die Seife, die Nan ihm zusammen mit dem Rasiermesser dagelassen hatte. Sie hatte es bereits zusammengeschraubt und mit einer neuen Klinge versehen, wie sein erfahrener Daumen ihm mitteilte. Woher er diese Erfahrung allerdings hatte, ließ sich nur vermuten. Die Seife war trocken und rissig, weil sie nicht gebraucht worden war. Doch das Wasser glättete die Risse, und als er seinen Bart einseifte, erfüllte der scharfe, medizinische Duft nach Kohlenteer das kleine Badezimmer. Eine flüchtige Sekunde lang weckte der beißende Geruch eine Erinnerung in ihm. Er sah sich als Kind in einer Badewanne sitzen, und eine ältere Frau in Dienstbotentracht hüllte ihn lächelnd in ein großes weißes Handtuch. Aber dann war das Bild wieder weg; ihr Gesicht hatte sich ihm nicht eingeprägt, doch die großen Hände mit den unberingten Wurstfingern waren schmerzlich vertraut, die ferne Stimme geliebt. Aber dann plötzlich fand er diese Erinnerung nicht wieder, konnte ihr leises Murmeln nicht mehr hören – ganz gleich, wie tief er den starken, öligen Geruch einatmete.
Jones nahm sich ein Handtuch und wischte den Dampf vom Spiegel. Das alte Glas war fleckig, in den Ecken war das Silber abgeplatzt, vor allem dort, wo die Löcher für die Schrauben waren. Kleine metallische Punkte zogen sich über eine Seite seines Spiegelbilds, das er mürrisch betrachtete. Dass sie fast sein halbes Gesicht seltsam undeutlich machten, schien ihn zu verspotten. Er war nur ein halber Mann; die andere Hälfte – die sich kannte und wusste, wer er war, wo er herkam – wanderte wie ein Geist über die Schlachtfelder von Ypern … wenn er da überhaupt gewesen war.
Warum konnte er nicht erkennen, wer ihn im Spiegel anschaute, mit diesen glänzenden, fast schwarzen Haaren und diesen erschreckten Augen? Sie haben die gleiche Farbe wie dein Schulblazer, hörte er in Gedanken, aber wer hatte diese Worte gesagt? Auf welcher Schule war er gewesen, wo die Schüler dunkelblaue Blazer trugen? Plötzlich bebten die Rohre im Badezimmer laut, und er warf das Rasiermesser ins Waschbecken. Das Metall klapperte auf der Emaille und zerfiel in seine Einzelteile. Genau so fühlte er sich innerlich. Kaputt. Demontiert.
Statt sich zu rasieren, wusch er sich die Seife wieder ab und rieb sich in seiner Frustration grob das Gesicht mit dem Handtuch ab. Der Petroleumgeruch der Seife hing immer noch in seinem Bart. Nancy würde nicht erfreut sein. Gehorsam zog er das frisch gewaschene und gebügelte Hemd an, das sie mitgebracht hatte. Sein einziger Anzug – eine milde Gabe von Gott weiß wem – war alt, abgetragen an den Knien und fadenscheinig an den Ellbogen, an zwei Knopflöchern ausgefranst. Bis zu einem gewissen Grad störte es ihn, aber eigentlich erfüllte er seinen Zweck und passte leidlich. Er hatte nicht wirklich Grund, sich zu beklagen. Die meisten verletzt heimgekehrten Soldaten waren sofort zu erkennen an einem sächsischblauen Anzug mit weißem Revers und einer hellroten Krawatte dazu. Nan, die großes Interesse an ihm hatte, hatte ihm diesen Anzug von zu Hause mitgebracht. Der Freund ihrer Cousine brauchte ihn nicht mehr. Jones hatte nicht nach dem Grund gefragt, aber bei dem schwachen Kohleduft hatte er die Nase gerümpft.
»Tragen Sie ihn häufiger und lassen Sie ihn auslüften«, hatte Nancy vorgeschlagen und ihm einen leichten Stups versetzt. Er wusste, dass sie ihn gerne spielerisch berührte. »Dann verschwindet der Geruch nach Mottenkugeln.«
Vielleicht vermag das Naphthalin ja den Erreger der Spanischen Grippe zu vertreiben, dachte er grimmig, während er am Jackett zupfte.
Er eilte sofort in den kleinen Garten vor seiner Station. In der frischen Luft würde sich seine Laune heben, und die leichte Brise würde den Geruch nach Kohlenteer vertreiben. Heute war es milder, vielleicht würde es sogar Regen geben. Dunkle Wolken ballten sich zusammen wie eine düstere Versammlung, aber er ging trotzdem nach draußen, ohne seinen Übermantel, der auf dem Haken neben der Tür hing, eines Blickes zu würdigen. Er hasste diesen Mantel. Er war zwar gereinigt worden, stank aber immer noch nach Tod. Stattdessen trug er einen Wollpullover unter seinem Jackett, den eine der freiwilligen Helferinnen für ihn gestrickt hatte. Ihm gefiel die moosgrüne Farbe, und er hoffte, sie würde ihn darin sehen.
Er winkte einer der Schwestern zu, die gerade durch den Garten eilte – sie war schon älter, aber sie pflegten hier einen zwanglosen Umgang.
»Wie geht es Ihnen, Mr Jones?«
»Oh, gut, gut«, gab er ihr die übliche Antwort. »Sieht nach Regen aus«, fügte er im Konversationston hinzu.
Sie blickte zum Himmel. »Sie bleiben besser nicht zu lange hier draußen.«
»Nein, das mache ich nicht. Alle scheinen beschäftigt zu sein«, ergänzte er, erfreut darüber, dass er einen neuen Baustein zur Unterhaltung beitragen konnte.
»Das ist wegen der Friedensfeier – endlich haben wir es geschafft. Wir können uns auf das glücklichste Weihnachtsfest freuen.«
»Ja, dieses Jahr gibt es viel zu feiern«, stimmte er ihr zu, bedauerte seine Bemerkung jedoch sofort, weil so viele um teure Angehörige trauerten.
»Ja, das stimmt«, erwiderte Schwester Bolton und hob zum Abschied grüßend die Hand. »Wir sehen uns dann auf der Feier. Von unseren amerikanischen Freunden ist ein neues Paket Tuxedo-Tabak gekommen. Ach übrigens, es wäre schön, wenn Sie sich rasierten.«
Er nickte und erwiderte ihren Gruß; er brauchte dringend neuen Tabak. Die Erinnerungen mochten einen ja verlassen, die Süchte jedoch seltsamerweise nicht. Die Erwähnung des Tabak-Pakets hatte in ihm den Wunsch nach einer Zigarette ausgelöst. Er zündete eine der letzten Selbstgedrehten an, inhalierte tief und spürte das Nikotin hinten im Rachen. Der erdige Geschmack erinnerte ihn – einen kurzen Moment lang – daran, im Grab zu liegen. Aber es hatte keinen Zweck, dieser Fährte nachzugehen; er hatte gelernt, dass es zwecklos war, ein Gefühl heraufbeschwören zu wollen. Stattdessen zwang er sich, dem Rat der Ärzte zu vertrauen, die erklärten, sein Gedächtnis würde zurückkehren, wenn es wieder gesund sei.
»Es ist genau wie bei Ihrer Beinverletzung, Jones. Es braucht Zeit.« Ein Schlaumeier – das musste wohl Nancy gewesen sein – hatte sogar gemeint, dass vielleicht ein weiterer Schlag auf den Kopf sein Erinnerungsvermögen zurückbringen würde. Seufzend dachte er, wie einfach das klang. Vielleicht sollte er Nancy vorschlagen, dass sie demnächst einen Hockeyschläger mitbrachte, um zu sehen, ob ihre Theorie funktionierte.
Der Aufenthalt an der frischen Luft tat ihm unweigerlich gut. Wenigstens regte er sich nicht mehr auf. Die Ärzte hatten ihm versichert, dass Gedächtnisverlust bei Soldaten, die an einem sogenannten »Schützengrabentrauma« litten, häufig vorkam. Ein Teil seiner Behandlung hatte aus Gesprächen mit einem Psychiater bestanden, und Dr. Vaughan hatte gemeint, dass sein extremer Gedächtnisverlust zwar ungewöhnlich, aber trotzdem nicht überraschend war, wenn man bedachte, was die alliierten Soldaten an der Front erlebt hatten.
Warum also kam er sich trotzdem vor wie ein Simulant? Wenn er sich erinnern könnte, dann würde er es tun, verdammt noch mal! Er wollte kein Mitleid; er hatte den Gedächtnisverlust ganz bestimmt nicht benutzt, um aus dem Höllenloch herauszukommen, aus dem sie ihn geholt hatten. Nun, er würde keinen Tag länger an diesem Ort bleiben und darauf warten, dass jemand ihn erkannte – ihn fand und wie ein verlorenes Gepäckstück zurückholte. Es war Zeit, eine Entscheidung zu treffen.
Als diese Erkenntnis sich bei ihm festsetzte, begann ein Rotkehlchen – vielleicht war es wieder dasselbe – melodisch zu zwitschern, und genau in diesem Moment tauchte die hübsche Frau von gestern überraschend hinter den Sträuchern auf. Gewohnheitsmäßig griff er nach seiner Taschenuhr, die es jedoch nicht mehr gab, aber dann dachte er, dass es wohl ungefähr die gleiche Uhrzeit sein müsse wie gestern. Heute war sie in Grau gekleidet, aber die dunkle Farbe wirkte bei ihr alles andere als trist; ihr maßgeschneidertes Kostüm schmiegte sich perfekt an ihren Körper. Sie trug nicht die bauschige Kriegskrinoline, wie sie die meisten Frauen bevorzugten, die keine Tracht oder Uniform trugen. Bei ihrem Rock herrschten klare Linien vor. Er war lang genug, um als züchtig zu gelten, mit Falten, die weite Schritte erlaubten, aber der Fantasie genug Raum ließen, um von der Krümmung ihrer Beine zu träumen, die weder lang noch kurz waren. Er war sich nicht sicher, warum er ihre Kleidung so genau betrachtete. Gestern hatte er sie offensichtlich aufmerksam genug angesehen, um sich an ihr marineblaues Ensemble zu erinnern. Vielleicht hatte er vor dem Krieg etwas mit Kleidung oder Stoffen zu tun gehabt? Vor dem Abgrund, wie er mittlerweile immer häufiger dachte – dort, wo alle seine Erinnerungen hinuntergestürzt und mit den übrigen Toten begraben lagen.
Ohne zu zögern, rief er: »Äh … Entschuldigung, Miss?« Sie blieb stehen und drehte sich zu ihm um. Jetzt hatte er es getan. »Entschuldigen Sie, dass ich Sie aufhalte.«
»Ja?«, fragte sie. Ihre Stimme gefiel ihm. Sie war leicht heiser.
»Äh, haben Sie Feuer?«, sagte er, froh darüber, dass seine Zigarette ausgegangen war.
Sie schüttelte den Kopf. »Nein, leider nicht.« Nein, ihre Stimme war nicht heiser. Sie war rauchig. Aber das gefiel ihm sogar noch besser, weil er jetzt ihren Mund sehen konnte. Sie hatte einen vollen Mund mit klar definierten Lippen, so präzise wie der Schnitt ihres Kostüms.
Er zuckte mit den Schultern. »Schenken Sie mir dann eine Minute Zeit?« Der Mund, den er bewunderte, verzog sich zu einem kleinen Lächeln. »Ich verspreche, ich beiße auch nicht«, fügte er hinzu.
»Wie kann ich Ihnen helfen?«
»Setzen Sie sich einen Augenblick zu mir?«
Sie legte den Kopf schräg, als ob sie seine Bitte abwägen würde, dann blickte sie sich um, um zu sehen, ob jemand in der Nähe war. Wahrscheinlich fragte sie sich, ob er nett oder einfach nur seltsam war. Nett gewann offensichtlich die Oberhand, denn sie kam näher. Vielleicht empfand sie aber auch nur Mitleid mit ihm.
»Ich kann einen Moment lang bei Ihnen stehen bleiben«, bot sie an. »Es ist hübsch hier zwischen den Rosenbüschen.«
»Noch vor wenigen Monaten hat es hier geduftet«, gestand er. »Aber ich bin sowieso ein Wintertyp, die kahlen Rosenbüsche passen zu mir.« Er streckte die Hand aus. »Ich bin Jones«, sagte er. Einen seltenen Moment lang war er angesichts ihrer strahlenden Schönheit dankbar dafür, am Leben zu sein.
Ihre dunklen Augen, die im trüben Licht fast schwarz wirkten, funkelten amüsiert. Sie schüttelte ihm die Hand. »Nur Jones?«
Ihr klarer Teint war weder blass noch bräunlich – sondern irgendwas dazwischen –, und ihre Wangen waren aufgrund der Kälte rosig angehaucht. Ihre Haare, so dunkel wie eine mondlose Nacht in Flandern, hatte sie im Nacken zusammengesteckt, und ein Hut mit einer gestreiften Feder saß keck auf ihrem Kopf.
»Leider ja«, antwortete er. Er hätte ihre Hand am liebsten nicht losgelassen, musste es aber. »Ich muss sagen, Ihre verwegene Feder gefällt mir.«
Sie grinste, und er hatte das Gefühl, aus der Kälte heraus vor einen warmen Ofen zu treten. »Haben Sie Ihren Namen vergessen?«, fragte sie leicht ungläubig.
»Und mein Gedächtnis dazu«, sagte er, wünschte sich aber sofort, er hätte geschwiegen. Es sollte fröhlich und tapfer wirken, klang aber nur hilflos.
»Oh.« Sie warf ihm einen verlegenen Blick zu. »Es tut mir leid. Ich wollte nicht …«
»Bitte entschuldigen Sie sich nicht.« Er wand sich. »Ich bin es müde, Mitleid zu erregen. Ich habe allen Grund, dankbar zu sein«, log er. Im selben Moment allerdings beschloss er, dass er sie nicht anlügen wollte. »Nein, das stimmt nicht ganz. Ich empfinde keineswegs Dankbarkeit, aber jetzt gerade bin ich froh, überlebt zu haben.«
Sie nickte, als ob sie sein Dilemma verstünde, und setzte sich in züchtigem Abstand zu ihm auf die Bank. Das gefiel ihm. »Mein Bruder hat leider nicht überlebt.«
»Das habe ich gehört.«
»Wie bitte?«
Er schnipste die Asche von seiner Zigarette und steckte mit einer Geste, die ihm wieder seltsam bekannt vorkam, die kaum gerauchte Zigarette in seine Tasche, um sie sich für später aufzuheben. »Eine der Schwestern hat gehört, wie Sie in der Cafeteria über Ihren Bruder gesprochen haben.«
Sie blinzelte. »Er hieß Daniel.«
»Es tut mir leid.«
»Mir auch. Ich vermisse ihn schrecklich, und vor allem meinem Vater fehlt sein Sohn sehr. Ich bin mir nicht sicher, ob ich ihm genug bin.«
»Oh, das kann ich mir nicht vorstellen. Für mich wären Sie es.«
Sie warf ihm einen verwirrten Blick zu.
»Ich muss mich schon wieder entschuldigen. Ich weiß nicht, warum ich das gesagt habe. Ich war offensichtlich lange nicht mehr in der Gesellschaft schöner junger Frauen. Vielleicht haben meine Verletzungen auch meine Filter getrübt …«
Sein Geständnis brachte sie wieder zum Lächeln, und er sah, wie ihr Blick wärmer wurde. Ihre Augen waren wie dunkle Schokolade, stellte er fest, keineswegs schwarz, wie er ursprünglich gedacht hatte. »Und was machen wir da mit Ihnen?«, fragte sie.
Er zuckte mit den Schultern. »Wer weiß? Ich habe nur einen Spitznamen und keine Ahnung, woher ich komme, in welchem Regiment ich gekämpft habe, noch nicht einmal, wo ich gekämpft habe. Als man mich gefunden hat, hatte ich wahrscheinlich keine Uniformjacke mehr an, sonst wüsste man es ja. Ich hoffe nur, dass eines Tages meine Familie hier erscheint und überglücklich darüber ist, dass sie mich gefunden hat.«
»Und Sie haben nicht den kleinsten Hinweis?«
Er schüttelte den Kopf. »Ich weiß nicht, wer ich war. Ich weiß noch nicht einmal, wie alt ich bin. Allerdings kann ich mich an einen Hund erinnern, einen Foxterrier, glaube ich.«
»Nun, das ist doch schon einmal ein Anfang«, sagte sie. Ihre Miene hellte sich auf.
»Man hat mir gesagt, das sei wahrscheinlich der Zigarettenhund in den Schützengräben gewesen, oder vielleicht sogar die Ratten, für die wir alle anscheinend so dankbar waren, deshalb ist es nicht wirklich ein Hinweis für mich.«
»Ach du liebe Güte«, sagte sie, und aus irgendeinem Grund – wahrscheinlich weil sie beide verlegen waren – mussten sie beide kichern. »Gibt es noch andere Optionen?«
»Ich warte nicht wirklich auf jemanden, der nach mir sucht«, sagte er mit spöttischem Grinsen. Sie wartete. »Darf ich Sie um einen Gefallen bitten?«, fügte er hinzu, bevor er den Mut verlor.
»Das hängt davon ab, worum es sich handelt.«
»Würden Sie mir helfen, hier herauszukommen?«
Jetzt war ihr Gesichtsausdruck wieder alarmiert. Besorgt musterte sie ihn. »Sie sollten sicher besser …«
»Sie wissen ja gar nicht mehr, was sie mit mir machen sollen. Ich bin jetzt seit fast fünf Monaten hier, und niemand hat auch nur die kleinste Verbindung für mich gefunden.«
»Es ist ja noch früh. Der Krieg ist doch erst …«
Er schüttelte den Kopf. »Ich glaube, ich werde verrückt, wenn ich noch eine einzige Nacht hierbleiben muss. Ich habe beschlossen zu gehen. Heute gehe ich fort, egal was kommt. Aber ich habe keine Ahnung, wohin ich gehen soll. Ich glaube, ich weiß noch nicht einmal, wie man einen Bus oder einen Zug nimmt. Und ich habe auch überhaupt kein Geld.«
»Und was kann ich da tun?«
»Zeigen Sie mir einfach nur die richtige Richtung. Wenn Sie mich auch nur ein paar Meilen von hier wegbringen, dann komme ich schon zurecht. Ich muss einfach nur weg aus dem Krankenhaus, damit sie mich hier vergessen können – einfach nur ein weiterer Kriegsverlust.«
»Es tut mir leid, Mr Jones, ich glaube wirklich nicht …«
»Bitte.« Es war peinlich, so betteln zu müssen. »Ich bezweifle, dass sich mir eine bessere Chance als heute bietet.«
Er sah in ihren Augen, dass sie ins Wanken geriet. Vielleicht dachte sie an Daniel.
»Ich bin ein erwachsener Mann, falls Sie das noch nicht bemerkt haben«, fügte er hinzu. Das durchbrach die Anspannung. Sie blickte auf ihre behandschuhten Hände, aber er sah ihr Lächeln, als sie den Kopf senkte. »Ich bin mir sicher, dass ich vor dem Krieg perfekt in der Lage war, für mich selbst zu sorgen, deshalb werde ich einfach lernen, es wieder zu tun. Ich weiß, dass ich nicht hilflos bin. Aber hier im Krankenhaus fühle ich mich so.«
Wieder musterte sie ihn, und er sah kein Mitleid in ihren Augen. Stattdessen spürte er ihren Ehrgeiz und ihre Stärke, und vielleicht fand sie es ja richtig, ihm seine Unabhängigkeit wiederzugeben.
»Na gut. Es ist wohl kaum ein Verbrechen, einem Kriegsveteranen zu helfen.«
»Wirklich?«
Sie nickte. »Und wie sollen wir es anstellen?«
»Heute ist ja die Friedensfeier. Alle werden abgelenkt sein, wenn erst einmal die Feierlichkeiten beginnen. Sie ergreifen einfach meinen Arm und gehen mit mir vom Gelände. Wenn wir draußen sind, werde ich Sie nicht mehr behelligen. Aber ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir sagen könnten, in welche Richtung ich mich wenden soll.« Ein goldenes Glitzern zwischen den Rosenbüschen erregte seine Aufmerksamkeit. Wind war aufgekommen und hatte ein paar Blätter weggeweht. »Warten Sie mal«, sagte er. Er erhob sich und humpelte über den Rasen. Eine Münze war an einen kahlen, dornigen Rosenbusch gerollt.
»Aha!«, sagte er triumphierend. »Ein halber Sovereign. Jetzt bin ich nicht mehr mittellos. Das sollte so sein!« Er trat wieder an die Bank. »Wahrscheinlich wird jemand das Geld vermissen, aber wie heißt es so schön: ›Was du anderen Gutes tust, kommt irgendwann zu dir zurück.‹«
Sie warf ihm einen ironischen Blick zu.
»Und in diesem Sinn werde auch ich Ihnen eines Tages Ihre Freundlichkeit vergelten. Wenn Sie meine Träume wahr machen, dann werde ich das Gleiche eines Tages für Sie tun … das verspreche ich.«
Sie schüttelte amüsiert den Kopf, streckte aber die Hand aus. »Abgemacht. Ich bin Eden. Eden Valentine.«
Selbst ihr Name war reizend. »Danke, Miss Valentine«, murmelte er und küsste das weiche Wildleder ihres Handschuhs.
2
Edie Valentine empfand amüsierte Verwirrung darüber, dass ein Fremder – ohne Gedächtnis, ohne Namen – gerade ihren Arm ergriffen hatte und sie den Weg entlang zu einem Seitentor des Krankenhauses begleitete.
»Wir sollten uns wahrscheinlich unterhalten«, murmelte er. »Es lenkt die Leute ab und vermittelt ihnen, dass wir zusammengehören und hier entlanggehen dürfen.«
»Worüber sollen wir denn reden?«, stieß sie verwirrt hervor.
»Nun«, sagte er fröhlich, »wie wäre es zum Beispiel damit, dass Sie mir erzählen, was Sie im Krankenhaus wollen? Das bringt uns bestimmt bis an die Hecke, und dann sind Sie mich bald wieder los.« Er lächelte ermutigend, tätschelte ihr sogar die Hand, als wären sie sehr gute Freunde.
»Na gut«, sagte Edie. »Heute war ich hier, um Geld abzuholen, und gestern habe ich dem Direktor des Krankenhauses etwas gebracht.«
»Und was haben Sie ihm gebracht?« Er bedeutete ihr höflich, sie solle auf dem schmalen Weg vorangehen.
Edie entspannte sich ein wenig, angetan von seinen guten Manieren. »Es war ein Anzug. Der Direktor ist … nun, mein Vater ist Schneider, und Mr Donegal gefallen die Anzüge, die mein Vater für ihn näht.« Sie räusperte sich und fügte hinzu: »Mr Donegal war zu beschäftigt, um … äh … jetzt ist es nicht mehr weit.«
Plötzlich ging ein Grammofon an, und Musik ertönte. Das war sicherlich das Zeichen dafür, dass das fröhliche Treiben jetzt begann. Der Wind trug Stimmen und das Gelächter einer Frau zu ihnen herüber.
»Sie klingt wie ein Huhn, das gerade ein Ei gelegt hat«, bemerkte er.
Edie kicherte, als weiteres glucksendes Lachen folgte, und sie sah im Geiste den Hühnerhof des Krankenhauses vor sich. »Es ist so schön, fröhliche Stimmen zu hören«, sagte sie mit leiser Wehmut.
»Sie machen das sehr gut, Miss Valentine«, versicherte er ihr so sanft, dass sie ihn zärtlich anlächelte.
»Ich bin an Intrigen nicht gewöhnt. Sie scheinen sich ganz wohl damit zu fühlen.«
»Na ja, vielleicht war ich ja während des Krieges Spion«, sagte er augenzwinkernd.
»Oh. Glauben Sie wirklich?«
Er schüttelte den Kopf. »Nein. Wie heißt Ihr Vater?«
»Abraham. Abe.«
»Hat er ein Geschäft?«
»Ja. Es heißt Valentine & Sohn. Oh, sehen Sie mal!« Edie freute sich darüber, dass der graue Himmel über London auf einmal voller bunter Kugeln war, die über dem Dach des Krankenhauses aufstiegen. Nach und nach trennten sich einzelne Ballons von der Menge, um sich vom Wind in alle Richtungen treiben zu lassen. Er hatte den Kopf gehoben, um ihrem Blick zu folgen, ihn aber rasch wieder gesenkt, als jemand, der ein Fahrrad schob, um die Hecke bog.
Sofort überfielen sie Schuldgefühle, und ihr Magen krampfte sich zusammen. Wenn jetzt ein Zulieferer – ein Lebensmittelhändler – sie als Fluchthelferin identifizieren würde? Aber dann rief Edie sich ins Gedächtnis, dass Mr Jones kein Krimineller war. Sie erwiderte den bewundernden Blick des jungen Mannes mit einem freundlichen Gruß. »Sehen Sie nur die Ballons da oben«, sagte sie und lenkte seine Blicke von sich ab gen Himmel. Vielleicht konnte er sich ja dann später nicht mehr an den Mann an ihrer Seite erinnern. »Das ist alles wegen der Feierlichkeiten. Es gibt auch Kuchen.« Sie grinste.
Der junge Mann hob höflich die Finger an seine Kappe.
»Und Sohn?«, fragte Mr Jones im Konversationston.
Sie blinzelte und konzentrierte sich wieder auf das Thema, über das sie geredet hatten. Edie nickte und zuckte mit den Schultern.
»Oh, verzeihen Sie. Ich wollte nicht …«
»Nein, ist schon in Ordnung. Daniel war schon seit seiner Kindheit auf das Geschäft vorbereitet worden. Mein Vater wollte immer, dass er es fortführte.«
»Natürlich. Und Sie? Haben Sie auch etwas damit zu tun?«
Sie seufzte leise. »Ja, ich bin Näherin.«
»Können Sie einen Anzug für einen Mann zuschneiden und nähen?«
»Natürlich«, erwiderte sie.
Er blieb stehen und ließ sie zuerst durch die schmale Öffnung in der Hecke treten, die die Welt draußen vom Krankenhausgelände trennte. Sofort umgaben sie Verkehrsgeräusche, aber der Jubel von der Party war immer noch lauter.
»Dann ist ja die Zukunft des Geschäfts gerettet, oder?« Stirnrunzelnd folgte er ihr.
Edie zuckte mit den Schultern. Es war müßig, darüber zu reden. »Wir sind da, Mr Jones«, sagte sie, als sie beide durch den kleinen Torbogen, der halb von der hohen Ligusterhecke verdeckt wurde, auf das Pflaster des Bürgersteigs getreten waren.
Sie beobachtete, wie er sich verwundert umblickte. Nach der langen Zeit im Krankenhaus musste es ihm vorkommen wie eine ganz neue Welt.
»Ja, das stimmt«, bestätigte er, und Edie stellte verlegen fest, dass sie ihren Gedanken laut ausgesprochen hatte.
Durch die dichte Hecke drang die fröhliche Tanzmusik nur noch von ferne zu ihnen, aber Edie überkam auf einmal der Wunsch, Mr Jones hätte sie gebeten, mit ihm zu tanzen. Sie hatte gehört, dass überall in der Gegend Straßenfeste stattfanden, aus Freude darüber, dass endlich wieder Frieden war und keine tapferen jungen Männer mehr sinnlos ihr Leben lassen mussten. Sie schüttelte den Kopf, um die Gedanken zu vertreiben, und blickte auf die bunten, patriotischen Wimpel, die zwischen den Straßenlaternen hingen.
»Wie fühlen Sie sich?«, fragte sie, da ihr plötzlich einfiel, dass sie vielleicht gerade einem kranken Mann bei der Flucht geholfen hatte.
»Frei«, gestand er. »Wie einer dieser bunten Ballons.« Er blickte kurz zum Himmel und erwiderte dann lächelnd ihren Blick. Edie ertappte sich bei dem Wunsch, sein jungenhaftes Grinsen einmal ohne den Bart zu sehen, der sein Gesicht verdeckte. »Danke, Miss Valentine. Ich habe mein Versprechen nicht vergessen. Ich stehe in Ihrer Schuld.«
Sie lächelte und räusperte sich, um die leichte Verwirrung zu überspielen, die sie befallen hatte. Er war ein Fremder; sie sollte keine derartige Verbindung zu ihm fühlen. »Und, in welche Richtung wollen Sie gehen?«
Er zuckte mit den Schultern. »So weit weg von hier wie möglich. Was würden Sie vorschlagen?«
»Wenn Sie mir die Bemerkung erlauben, so klingen Sie, als ob Sie aus dem Süden kämen. Ich würde Ihnen zwar nicht raten, nach London zu gehen, aber vielleicht könnten Sie fürs Erste in einen kleinen Ort in der Nähe von London reisen.«
»Perfekt«, sagte er. »Dann mache ich mich besser mal auf den Weg, ich fürchte nämlich, es fängt gleich an zu regnen.«
»Hier«, sagte sie und griff in die Stofftasche, die sie bei sich trug. »Nehmen Sie meinen Schirm.«
»Auf Sie wird es genauso regnen wie auf mich, Miss Valentine.«
»Aber ich habe es nicht so weit.«
»Wohin müssen Sie denn?«
»Nach Golders Green.« Sie sah ihm an, dass ihm das nichts sagte.
»Darf ich Sie zur Bushaltestelle begleiten?«
Edie blickte auf, als der erste Regentropfen mit einem dumpfen Geräusch auf ihrer Schulter zerplatzte. Sie spannte ihren Schirm auf. »Warum nicht, dann können wir beide unter dem Schirm gehen.« Bei dem Gedanken daran, seine Gesellschaft noch ein paar Minuten genießen zu können, empfand sie schuldbewusstes Vergnügen, aber das ignorierte sie. »Schade für die Partyteilnehmer.«
Unbewusst ergriff er wieder ihren Arm und zog sie dichter an sich heran, damit sie beide unter den Schirm passten. Es regnete jetzt heftiger. Lachend rannten sie los und erreichten leicht außer Atem das Schutzhäuschen.
»Der Schirm hat nicht viel geholfen.« Edie streifte lächelnd das Wasser von ihrer Jacke.
»Aber hier kommt ja schon der Bus«, sagte er und nickte zu dem Gefährt, das aus der Ferne langsam auf sie zukam. Der Motorbus hatte ein offenes Dach, weshalb das abgehärtete Paar, das oben saß, völlig durchnässt war, genau wie der Fahrer, der unten ebenfalls den Elementen ausgeliefert war. Im Gegensatz zu den Passagieren jedoch war er von Kopf bis Fuß in einen Wachstuchmantel gehüllt. »Ihr Timing ist tadellos«, sagte Jones. »Ich nehme an, das ist Ihr Bus?«
»Ja«, sagte sie stirnrunzelnd. »Kommen Sie allein zurecht?«
»Ich habe ja meinen Glücks-Sovereign.«
»Oh, warten Sie bitte«, sagte sie. Sie kramte erneut in ihrer Tasche und zog ihre Geldbörse heraus. »Ich wollte Ihnen noch sagen, dass Sie diesen halben Sovereign besser nicht verwenden.«
»Warum?«
»Es ist zu viel. Hier«, sagte sie und drückte ihm einen silbernen Threepence in die Hand. »Sparen Sie sich Ihre Glücksmünze auf. Sie werden sie noch brauchen.«
»Ich kann doch unmöglich Ihr Geld annehmen …«
»Bitte, nehmen Sie es. Ich kann Sie ohne das Geld nicht mit gutem Gewissen zurücklassen. Außerdem haben Sie doch selbst gesagt, was man anderen Gutes tut, kommt irgendwann zu einem zurück. Bestimmt erweist auch mir jemand einmal eine Wohltat. Und wenn Daniel …« Sie brach ab und schüttelte den Kopf. Sie wollte nicht ständig von Daniel reden. Fast vier Jahre waren inzwischen vergangen, Zeit, die Toten endlich ruhen zu lassen.
Er legte die Münze wieder in ihre behandschuhte Hand und schloss ihre Finger darüber. Kopfschüttelnd sagte er mit traurigem Lächeln: »Ich werde …« Plötzlich kam der Bus in schnellem Tempo mit einer lauten Fehlzündung auf sie zu. Im Bruchteil einer Sekunde hockte Jones sich hin und hielt schützend die Arme über den Kopf.
Edie beugte sich zu ihm herunter. »Mr Jones?« Er sagte nichts, aber sie hörte ihn stöhnen. Er tat ihr so leid, als sie begriff, was der Knall bei ihm ausgelöst hatte. »Ich glaube, Sie kommen besser mit mir.« Als er verwundert den Kopf hob, fügte sie hinzu: »Bitte. Ich kann Sie hier nicht zurücklassen.«
Jones ließ zu, dass sie seine Hand ergriff und ihn zum Bus führte. Obwohl Edie bei dem schlechten Wetter eigentlich nicht offen fahren wollte, nahm sie an, dass er nicht in der Enge des geschlossenen Fahrgastraums sitzen wollte.
»Ist oben in Ordnung?«
Er nickte, plötzlich ganz grau im Gesicht. Edie ging mit ihm die Treppe hinauf und setzte sich mit ihm ganz nach hinten, wo sie alleine waren.
»Atmen Sie tief durch«, drängte sie ihn, als sie sah, dass seine Stirn feucht von Angstschweiß war.
»Es tut mir so leid«, murmelte er und starrte auf den Sitz vor sich. »Ich dachte, ich sei schon bereit. Ich weiß noch nicht einmal, wovor ich eigentlich Angst habe. Mein Gedächtnis sagt es mir jedenfalls nicht. Ich habe einfach nur reagiert. Gewohnheit, nehme ich an.«
Der Regen wurde zu einem Tröpfeln und hörte dann genauso schnell auf, wie er begonnen hatte.
»Das ist völlig verständlich«, versicherte sie ihm. Sie schüttelte ihren Schirm aus und schloss ihn. »Ich weiß zwar nicht viel darüber, aber wir haben alle gehört, wie schlimm es in den Schützengräben und an der Front war. Sie mussten sich vermutlich ständig zum Schutz ducken. Sie müssen sich Zeit geben, um gesund zu werden, und außerdem müssen Ihr Geist und Ihr Körper erst einmal akzeptieren, dass wir jetzt Frieden haben. Vielleicht wird Sie eine Zeitlang jede Fehlzündung, jeder laute Knall oder jede laute Stimme erschrecken.« Sie drückte seinen Arm. »Es kommt schon alles wieder in Ordnung«, sagte Edie beruhigend über dem rumpelnden Geräusch, mit dem der Bus anfuhr.
»Ich glaube, ich bin Ihnen eine Last, Miss Valentine.«
»Überhaupt nicht«, sagte sie. Sein trauriger Blick hielt sie fest. Er hatte tief dunkelblaue Augen. Sie fragte sich, was um alles in der Welt sie bloß mit ihm machen sollte, aber eines wusste sie genau: Sie konnte Mr Jones jetzt nicht so einfach verlassen. Und sie wollte auch nicht von diesem gutaussehenden, etwas hilflosen Burschen weggehen. »Würde es Ihnen helfen zu reden?«
»Ich weiß nicht. Ich tue nichts anderes als reden, aber es ist alles zwecklos.«
»Nun, wenn es Sie tröstet, ich gäbe alles, um noch einmal mit Daniel reden zu können. Und irgendwo gibt es sicher auch Leute, die das Gleiche für Sie empfinden. Bitte, verlieren Sie nicht den Mut.«
Endlich wandte er den Kopf, um sie anzusehen. »Danke, Miss Valentine. Das werde ich nicht.«
»Sagen Sie Edie zu mir.«
»Dann müssen Sie mich Jones nennen.«
Sie wechselten einen amüsierten Blick.
Edie kam eine Idee. »Strengen Sie sich nicht zu sehr an, aber warum sagen Sie nicht einfach den ersten Männernamen, der Ihnen in den Sinn kommt?«
Er zögerte nur eine Sekunde. »Thomas«, sagte er. Dann runzelte er die Stirn.
»Thomas?«, wiederholte sie, als ob sie den Namen an ihm ausprobieren wollte. »Warum?«
Er zuckte mit den Schultern.
»Sie sehen nicht aus wie ein Thomas, aber ich denke, Tom könnte zu Ihnen passen.«
»Tom«, wiederholte er. »Ja, das klingt fröhlich. Es gefällt mir.«
»Klingt es vertraut?«
Er schüttelte den Kopf. »Nein.« Edie seufzte insgeheim enttäuscht auf. »Seltsamerweise fühlt es sich jedoch ein bisschen vertraut an.«
»Wirklich?« Sie strahlte ihn an.
»Ja. Aber fragen Sie mich nicht, warum.«
»Dann heißen Sie eben Tom, es sei denn, Sie müssen sich irgendwo formell vorstellen. Wenn wir diesen Namen benutzen, dann erinnern Sie sich vielleicht auch irgendwann daran, warum er Ihnen als Erstes eingefallen ist. Es ist ein Anfang, verstehen Sie?«
»Sie tun mir sehr gut, Edie. Warum hat das Krankenhaus das nicht vorgeschlagen?«
»Ich bin kein Arzt.« Sie beugte sich zu ihm, um ihm zuzuflüstern: »Aber ich glaube, Frauen sind einfach praktischer veranlagt.«
Er lächelte. »Wo setzen Sie mich ab?«
»Ich werde Sie nirgendwo absetzen. Ich nehme Sie mit nach Hause zu meinem Vater.« Der Satz war ihr herausgerutscht, bevor sie darüber nachgedacht hatte. Tom war wie ein verirrtes, hilfloses Tier. Wenn sie ihm nicht helfen würde, wer sonst? Und immerhin hatte sie sich bereiterklärt, ihn aus dem Krankenhaus herauszuholen.
Und aus welchem Grund noch? Sie konnte die Stimme ihres Vaters förmlich in ihrem Kopf hören, ignorierte sie jedoch.
Tom starrte sie an, als spräche sie plötzlich eine fremde Sprache. »Aber warum?«
Edie zuckte mit den Schultern. »Ich fühle mich verantwortlich.«
»Das sollten Sie aber nicht. Ich habe Sie ja gezwungen. Sie haben schon genug für mich getan.«
»Nein, ich bin erst zufrieden, wenn Sie sich ein bisschen besser an die … äh … Außenwelt gewöhnt haben. Abba – mein Vater – ist ein sehr kluger Mann. Er wird wissen, was zu tun ist. Vielleicht müssen Sie wenigstens für eine Nacht unter Freunden sein. Ihm macht das nichts aus.«
»Freunde. Das klingt so nett und normal.«
»Sie sind normal, Tom. Sie sind nur verwundet. Ihr Geist ist so verletzt worden wie bei anderen Soldaten Arme oder Beine.«
Der Schaffner kam. »Einen schönen Nachmittag.« Dann runzelte er die Stirn. »Ist es überhaupt noch Nachmittag? Das kann man bei diesem grauen Himmel gar nicht sehen.«
»Zwei, bitte.« Edie reichte ihm ihren Threepence.
»Danke, Liebchen.« Der Blick des Schaffners ruhte auf Edie, als er ihr die beiden Tickets gab. Dann ging er.
»Soll ich ihm eins auf die Nase geben, was meinen Sie?«
Edie lächelte verlegen. »Noch vor einem Jahr wäre dieser Schaffner eine Frau gewesen. Ich bin mir sicher, dass die Frauen ihre Aufgaben vermissen, jetzt wo die Männer heimgekehrt sind.«
»Ja, sie haben wahrscheinlich ein Gefühl der Freiheit empfunden und müssen jetzt wieder zu ihrem Leben zu Hause zurückkehren.«
Edie nickte – er sagte die Wahrheit –, aber insgeheim hörte sie »Gefängnis« statt »Leben«.
»Er hat den gequälten, erschreckten Blick eines heimgekehrten Soldaten«, fuhr Tom fort.
»Woher wissen Sie das? Ihr Gedächtnis kann Ihnen doch keinen Hinweis geben.«
»Eine logische Frage. Vielleicht liegt es einfach nur daran, dass seine Schaffner-Uniform ihm um den Leib schlottert und ich daraus eine Schlussfolgerung gezogen habe, egal ob sie nun richtig oder falsch ist.« Er kniff die Augen zusammen. »Aber haben Sie den Ausdruck in seinen Augen nicht gesehen?«
Sie schüttelte den Kopf.
»Er sucht nach Gesellschaft, ist aber trotzdem distanziert … irgendwie unruhig.«
Edie zuckte mit den Schultern. »Nein, mir ist nichts aufgefallen.«
»Ich glaube, ich habe diesen Blick schon über tausend Mal gesehen, das sagt mir mein Bauchgefühl. Wahrscheinlich gucke ich genauso.«
»Sie sehen sehr gut aus und keineswegs distanziert«, versicherte sie ihm, spürte jedoch sofort, wie ihr die Röte in die Wangen stieg. Er warf ihr einen Blick von der Seite zu, sagte aber nichts. Stattdessen wandte er sich ab und beobachtete den vorbeifahrenden Verkehr, der immer dichter wurde, da sie an der Innenstadt von London vorbeifuhren.
»Evening News, Schweppes Water, Oakey’s Messerpolitur, Claymore Whisky, Iron Jelloids …«, las er leise.
»Wie bitte?«
Er schüttelte den Kopf. »Ich lese nur die Werbung auf den anderen Bussen. Es fällt mir schwer zu glauben, dass der Krieg gerade erst zu Ende gegangen ist. Es sieht alles so bunt und fröhlich aus.«
Edie fand nicht, dass mitten im November etwas bunt oder fröhlich aussah, aber vielleicht war das nach den Schützengräben so. »Weckt irgendetwas Erinnerungen?«
»Der Whisky vielleicht.« Er grinste entwaffnend, und Edie wusste, dass der Charme dieses Mannes sie schon in der kurzen Zeit, in der sie zusammen waren, angesteckt hatte. Sie fand seine aufrechte Haltung, seine vorsichtige, höfliche Art und seine ruhige Art zu sprechen attraktiv.
»Golders Green liegt an der Endstation, Sie können also einfach die Eindrücke genießen. Man weiß ja nie.«
»Macht es Ihnen etwas aus, wenn ich rauche?«
Sie schüttelte lächelnd den Kopf, und er griff in seine Tasche. »Höchstens meinem Vater.«
Er riss ein Streichholz an und entzündete die Zigarette, die er aus dem kleinen Päckchen klopfte. Es war nur noch eine drin. »Das ist meine letzte«, sagte er ohne Bedauern.
»Warum?«
»Neuanfang. Heute fühlt sich alles neu an, und ich möchte mich so fühlen, als ob ich ein neues Leben beginnen würde.« Er nahm einen letzten tiefen Zug und schnipste die Kippe dann achtlos weg.
Den Rest der Fahrt über schwiegen sie, aber Edie war sich der Wärme zwischen ihnen nur allzu bewusst. Ihr Inneres brannte wie ein Feuerrad, das unsichtbare Funken sprühte. Es fühlte sich gefährlich und aufregend an.
Eine zierliche Frau, elegant in einem tief scharlachroten Mantel, stieg vor dem Hauptportal des Edmonton-Krankenhauses aus einem Taxi und bat den Fahrer zu warten. Wenn sie jemand beobachtet hätte, hätte er festgestellt, dass die Besucherin nicht nur bei der Farbe, sondern auch beim Design ihrer Kleidung Mut bewies, denn der Mantel war eigentlich ein Cape, das mit einem übergroßen Knopf an einer Seite geschlossen wurde. Darunter trug sie einen mitternachtsblauen schmalen Rock, der ihr bis zu den Knöcheln reichte, und ihre behandschuhten Hände griffen automatisch nach der breiten Krempe ihres dunkelblauen Hutes, als ein Windstoß ihn von ihren goldblonden, sorgfältig gescheitelten und an beiden Ohren zu Schnecken gedrehten Haaren wehen wollte.
Am Empfang sagte man ihr, dass die Friedensparty für die Patienten in vollem Gange sei. Als sie sagte, sie suche nach einem speziellen Mann – einem Gentleman, einem Kriegsheimkehrer –, wurde sie gebeten zu warten.
Schwester Bolton setzte gerade einen Becher warmen Holunderblütensaft an die Lippen, als sie ins Schwesternzimmer gerufen wurde. Sie bemühte sich, nicht die Augen zu verdrehen.
»Wer will denn was von mir?«
»Miss Fairview hat mich zu Ihnen geschickt.«
»Warum?«
Das Mädchen sah so aus, als wollte es mit den Schultern zucken, besann sich aber gerade noch rechtzeitig. »Ich weiß nicht genau, Schwester. Ich glaube, sie hat einen wichtigen Gast erwähnt.«
»Nun gut. Dann lauf, Smith.«
Bolton machte sich auf den Weg zum Empfang. Hilflos verzog sie die Lippen, weil sie von den Feierlichkeiten weggeholt worden war, die den heimgekehrten Soldaten ein wenig Glück schenken sollten, während ihre Wunden heilten und sie zu vergessen versuchten, was sie auf den Schlachtfeldern Europas erlebt hatten. So viele mussten sich noch von ernsthaften Verletzungen erholen, dabei litten die meisten an viel tieferen Narben, die auch die entschlossenen Pflegerinnen mit ihrer Fürsorge niemals heilen könnten.
In der Empfangshalle traf sie auf eine junge Frau, die nach einem exquisiten blumigen Parfüm duftete und so teuer gekleidet war, dass die Krankenschwester beinahe einen Knicks gemacht hätte.
»Oh hallo, Schwester Bolton«, sagte die Frau. Ihre zwanglose Begrüßung sagte der Schwester, dass der Gast sich offensichtlich nichts aus sozialem Status machte. »Man hat mir gesagt, ich solle mit Ihnen sprechen.« Ihr warmes Lächeln brachte Emilia Boltons kühle Fassade zum Schmelzen. »Ich bin Penelope Aubrey-Finch.«
»Miss Aubrey-Finch.« Schwester Bolton nickte und schüttelte der Frau die Hand. Ihre dunkelblauen Handschuhe waren aus so feinem Leder, dass es sich anfühlte wie eine Liebkosung. »Wie kann ich Ihnen behilflich sein?« Ihr Blick glitt zu einem jungen Mann, dem man in einem Feldlazarett während der Schlacht an der Somme beide Beine amputiert hatte. Sie blickte dem Patienten, der in einem Rollstuhl zur Party gefahren wurde, nach, bevor sie ihre Aufmerksamkeit wieder Miss Aubrey-Finch zuwandte.
»… und ich habe in allen Militärkrankenhäusern und Einrichtungen, in die verwundete heimgekehrte Soldaten gebracht worden sind, nachgeforscht«, sagte diese gerade.
Schwester Bolton verstand. »Natürlich. Ihr Vater? Ihr Bruder?«, fragte sie.
»Nein. Ein sehr entfernter Vetter«, antwortete die andere, dann fügte sie hinzu: »So entfernt, dass wir eigentlich mehr befreundet als blutsverwandt … äh, ein ganz besonderer Freund.«
Die ältere Frau lächelte sie ermutigend an. Sie verstand sofort, was diese Art von Suche einer Familie abverlangte. So viel Hoffnung und doch auch so viel potenzielle Verzweiflung.
»Und offensichtlich ein sehr wichtiger Freund, da Sie ihn mit so großem Aufwand suchen.« Die junge Frau zögerte. Schwester Bolton fand Penelope Aubrey-Finch außergewöhnlich schön – wie ein zarter Schmetterling –, und sie fragte sich, warum eine junge Frau wie sie sich alleine auf die Suche gemacht hatte. »Hat Sie jemand begleitet?«
Miss Aubrey-Finch schüttelte lächelnd den Kopf. »Nein. Ich habe mich alleine aufgemacht, Cousin Lex zu finden. Draußen wartet ein Wagen.«
»Lex?« Schwester Bolton runzelte die Stirn. »Sie können Ihren Schirm zum Trocknen hierlassen. Kommen Sie mit.« Sie ließ sich am Empfang eine Maske geben, die sie ihrer vornehmen Besucherin reichte. »Es ist nur eine Vorsichtsmaßnahme, aber darf ich Sie bitten, sie aufzusetzen? Die Influenza wütet, und wir bitten alle Besucher darum, eine Maske zu tragen.«
Die Frau nickte. »Danke. Ich habe mich schon fast daran gewöhnt, mein Gesicht zu bedecken«, sagte sie. Die Vorsichtsmaßnahme brachte sie kaum aus der Fassung.
»Sie wären bestimmt eine gute Krankenschwester«, bemerkte Schwester Bolton und bedeutete ihrem Gast, ihr zu folgen.
Während sie durch die Flure gingen, erzählte Penelope Aubrey-Finch von ihrer Fahrt von Belgravia, wohin ihre Eltern sich für die Festlichkeiten begeben hatten, hierher zum Krankenhaus. »Das Anwesen meiner Familie steht in York, aber ich bin in London und in der Schweiz zur Schule gegangen, und ich denke, im Süden fühle ich mich einfach wohler.«
»Natürlich«, erwiderte Schwester Bolton, die sich das privilegierte Leben dieser jungen Frau, die kaum älter als zwanzig sein konnte, nur mit Mühe vorstellen konnte, aber es war äußerst schwierig, Miss Aubrey-Finch, die so gut duftete und so makellos gekleidet war, so gute Manieren und vor allem so eine unbekümmerte, reizende Art hatte, nicht zu mögen.
»… aufgegeben. Nur ich nicht. Ich glaube von ganzem Herzen, dass er noch lebt. Vielleicht ist er verletzt.«
»Ich verstehe.«
Sie führte ihren Gast in den »Speisesaal« – wie die Schwestern ihn nannten –, der der Hauptort für die Friedensparty geworden war. Allerdings leerte er sich jetzt zusehends, da es aufgehört hatte zu regnen und die Leute in den Garten eilten, um die Freiheitsballons zu sehen, die aufgestiegen waren.
»Hier, meine Liebe. Alle bis auf die kränksten Soldaten sind versammelt. Erkennen Sie Ihren Cousin? Ich muss Sie jedoch warnen, wir haben hier niemanden, der Lex heißt.«
Miss Aubrey-Finch blieb vor jedem der Männer stehen und wechselte mit jedem ein oder zwei Sätze, bevor sie sich zum nächsten begab. Schwester Bolton war beeindruckt von der Haltung der jungen Frau, vor allem davon, wie großzügig sie jeden der verwundeten Soldaten mit freundlichen Worten bedachte. Egal, wie schwer die Verwundungen waren, sie wich nicht zurück, und als sie achselzuckend wieder zu Schwester Bolton trat, blickten die Patienten ihr grinsend nach. Ja, wirklich, sie würde eine gute Krankenschwester abgeben.
»Es tut mir so leid«, sagte Schwester Bolton, als offensichtlich wurde, dass der entfernte Cousin sich nicht unter den Männern befand.
»Das muss es nicht. Es war sehr freundlich von Ihnen, dass Sie mir erlaubt haben, einen besonderen Tag zu unterbrechen«, erwiderte Miss Aubrey-Finch. Ihre Augen waren feucht, aber ihre Stimme klang fest. Sie nahm ihre Maske ab.
»Glauben Sie mir, meine Liebe, solche Unterbrechungen machen uns gar nichts aus. Wenn ich heute einen dieser Männer mit Ihnen nach Hause schicken könnte, dann wäre das das schönste Weihnachtsgeschenk für mich.«
Die junge Frau lächelte. »Danke. Ich würde am liebsten alle mit nach Hause nehmen und sie wieder lachen sehen.«
»Wir können noch auf die Station nebenan gehen. Dort sind zwei … äh, nein, drei andere Männer, denen es zu schlecht geht, um die Party zu besuchen.«
Miss Aubrey-Finchs Miene hellte sich auf. »Danke.« Sie setzte die Atemmaske wieder auf und folgte Schwester Bolton.
Doch auch unter diesen drei Patienten war der gesuchte Cousin nicht. »Trotzdem, meinen aufrichtigen Dank«, sagte sie und schüttelte Schwester Bolton erneut die Hand, dieses Mal ohne Handschuhe. Die ältere Frau stellte fest, wie weich und makellos die Hand ihrer Begleiterin war. Die Nägel waren perfekt manikürt und poliert.
»Ich wünschte, ich hätte Ihnen und Ihrer Familie zu Weihnachten eine Freude machen können, Miss Aubrey-Finch.«
Penelope schenkte ihr ein trauriges Lächeln. »Es wäre das perfekte Weihnachtsgeschenk gewesen.«
»Lassen Sie sich nicht entmutigen. Ich bewundere Sie für Ihre Entschlossenheit. Wenn er noch lebt, werden Sie ihn finden.« Sie musste die Frage einfach stellen: »Sind Sie mit ihm verlobt?«
Penelope Aubrey-Finch schüttelte den Kopf. »Nein, Schwester, aber ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich nicht darauf hoffe.« Die ältere Frau sah, wie ein Schatten über das offene Gesicht der jungen Frau glitt. »Für mich hat es nie einen anderen gegeben.«
»Nun, vielleicht lassen Sie eine Beschreibung oder ein Foto hier oder …«
»Ach du lieber Himmel! Ich habe doch ein Foto mitgebracht. Fast hätte ich es vergessen!« Sie kramte in einem Satinseitenfach ihrer kleinen blauen Ledertasche, in die sie ihre Handschuhe gesteckt hatte. »Hier«, sagte sie seufzend. »Das ist er.« Sie lächelte. »Die Aufnahme ist schon ein paar Jahre alt, und Lex hat es immer gehasst, fotografiert zu werden …«
Schwester Bolton ergriff das Foto und starrte auf die Gestalt, auf die die junge Frau zeigte. Blinzelnd runzelte sie die Stirn, dann schüttelte sie den Kopf. »Es tut mir leid, aber …« Sie zögerte.
»Was ist? Kennen Sie ihn?«, fragte die junge Frau flehend.
Die Krankenschwester betrachtete nachdenklich das Bild, aber dann schüttelte sie erneut den Kopf. »Ich kenne diesen Mann nicht, das muss ich ehrlich sagen … aber er hat etwas Vertrautes. Ich weiß nicht, was es ist – die Form seines Kopfes oder wie er ihn leicht zur Seite neigt. Ich …« Sie seufzte leise. »Ich kann es wirklich nicht sagen.«
Ihre Besucherin stöhnte leise. »Es ist kein gutes Foto, zumal es ja auch noch eine Gruppenaufnahme aus einiger Entfernung ist. Und alle tragen weiße Tenniskleidung.« Sie zuckte mit den Schultern. »Glücklichere Zeiten.«
»Haben Sie es bei allen Militärkrankenhäusern versucht?«
»So gut wie. Aber ich habe an alle geschrieben und ihnen eine äußerst detaillierte Beschreibung von Lex gegeben.«
»Nun, Sie tun sicherlich alles, was Sie können. Äh … haben Sie es auch in den psychiatrischen Abteilungen versucht?«
Miss Aubrey-Finch keuchte auf. »Nein. Sollte ich?«
Schwester Bolton hob eine Schulter. »Viele unserer Soldaten sind nicht nur körperlich, sondern auch geistig versehrt zurückgekommen. Nehmen Sie zum Beispiel unseren Mr Jones. Das ist nicht sein wirklicher Name. Wir nennen ihn nur so.«
Miss Aubrey-Finch schaute sie verwirrt an. »Warum?«
»Er leidet an einem Schützengrabentrauma und erinnert sich an nichts, noch nicht einmal an seinen Namen. Die mit Amnesie eingelieferten Patienten in Edmonton bekommen einfach übliche Nachnamen – wir hatten vier. Mr Smith, Mr Green, Mr Brown und Mr Jones. Die Soldaten zeigen eine unterschiedliche Symptomatik. Manche werden depressiv, andere ziehen sich komplett zurück. Nachts haben sie schreckliche Albträume, und ich habe schon von normalerweise friedlichen und netten Männern gehört, die ohne jede Vorwarnung gewalttätig wurden.« Traurig schüttelte sie den Kopf.
»Hat denn niemand nach ihnen gefragt?«
»Oh doch. Smith, Green und Brown sind bereits wieder zu ihren liebenden Angehörigen zurückgekehrt.«
»Und Mr Jones?«
»Er weiß überhaupt nichts über sich. Er hat keine Erinnerung mehr an sein früheres Leben.« Schwester Bolton blinzelte. »Es ist schon komisch, aber ich dachte gerade, dass er mich irgendwie an Ihren gutaussehenden Freund erinnert.« Sie lächelte die junge Frau an, die sich über das Kompliment zu freuen schien. »Kann ich das Foto bitte noch einmal sehen?«
Miss Aubrey-Finch reichte ihr noch einmal die Fotografie, und Schwester Bolton studierte sie eingehend. »Wissen Sie, er könnte es durchaus sein. Ähnlich groß, ähnliche Figur …«
Ihre Besucherin stieß einen hoffnungsvollen Seufzer aus.
Die Krankenschwester fuhr fort: »Seit er das Bewusstsein wiedererlangt hat, fehlt ihm jegliche Erinnerung. Wir nehmen an, dass er Ende 1917 in Ypern verwundet wurde, dann an verschiedenen Orten in unterschiedlichen Einrichtungen war, bevor er vor ein paar Monaten zu uns gekommen ist.«
»Er hat mir zuletzt aus Flandern geschrieben! Lex ist hier?«, rief die junge Frau aus. Die Tränen strömten ihr übers Gesicht, und sie schlug sich die Hand vor den Mund. »Wirklich?«, fragte sie mit bebender Stimme.
Schwester Bolton richtete sich auf. »Nein, ich bin mir keineswegs sicher, Miss Aubrey-Finch. Bitte, erwarten Sie nicht zu viel. Aber irgendetwas an dem Foto erinnert mich an ihn. Mr Jones weigert sich aus irgendeinem Grund, sich den Bart abzurasieren. Ich habe noch vor kaum einer Stunde mit ihm darüber gesprochen. Warten Sie, ich hole Nan. Sie kennt ihn am besten. Warten Sie hier, meine Liebe. Ich verstehe gar nicht, warum er nicht auf der Party ist.« Sie ging wieder zum Speisesaal. Nan trank gerade einen Schluck Ingwerbier und kicherte mit zwei der Patienten.