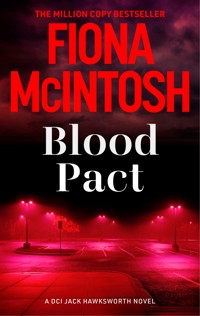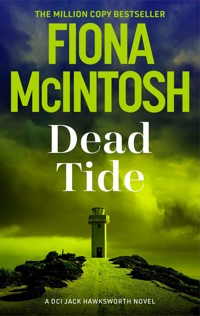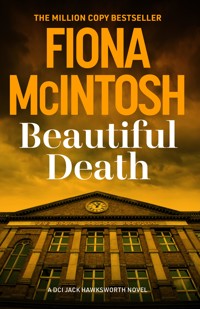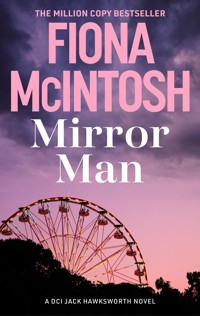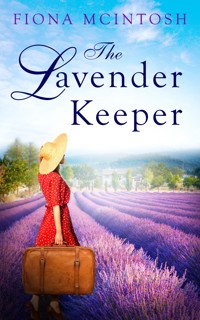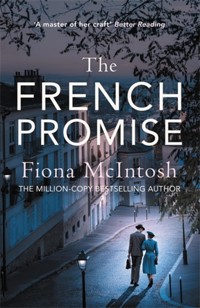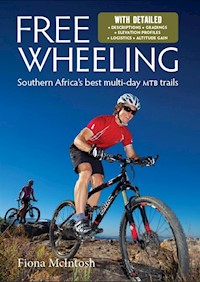9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine atemberaubende Geschichte über Vertrauen, Verrat und eine Liebe, die funkelt wie ein lupenreiner Diamant!
Südafrika, 1870. Nach dem Tod ihrer Mutter wächst Clementine in Kimberley auf, wo ihr Vater, ein englischer Ingenieur, nach Diamanten sucht. Als er übrraschend fündig wird und kurz darauf unter tragischen Umständen ums Leben kommt, muss Clem sich fragen, wo ihre Zukunft liegt und wem sie wirklich trauen kann …
London 1894. Clem ist zu einer selbstbewussten jungen Frau herangewachsen, die in England ein neues Heim gefunden hat. Durch ihren Onkel Reggie macht sie Bekanntschaft mit Will, dem Sohn seines Geschäftspartners. Reggie steht kurz vor der Insolvenz und hofft, eine Liaison zwischen den beiden jungen Leuten könne den Bankrott aufschieben, wenn nicht gar verhindern. Sein Plan scheint aufzugehen: Clem und Will verbringen wunderschöne Stunden zu zweit, doch als Will anfängt, Fragen zu stellen, bringt er Clem auf eine Fährte, die weit in die Vergangenheit zurückführt. Zurück zu bewegten Tagen in Afrika ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 596
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Buch
London 1894. Clem ist zu einer selbstbewussten jungen Frau herangewachsen, die in England ein Heim gefunden hat. Durch ihren Onkel Reggie macht sie Bekanntschaft mit Will, dem Sohn seines Geschäftspartners und verliebt sich in ihn. Clem und Will verbringen wunderschöne Stunden zu zweit, doch als Will anfängt, Fragen zu stellen, führt er Clem damit auf eine Fährte, die sie weit in die Vergangenheit zurückführt. Zurück zu bewegten Tagen in Afrika …
Autorin
Fiona McIntosh, geboren in Brighton, England, ist zeit ihres Lebens viel gereist: Sie verbrachte einen Teil ihrer Kindheit in Afrika, arbeitete in Paris und siedelte schließlich nach Australien über. Gemeinsam mit ihrem Mann gibt sie ein Reisemagazin heraus. Die Autorin lebt mit ihrer Familie in der Nähe von Adelaide, Südaustralien.
Von Fiona McIntosh bereits erschienen:
Herzen aus Gold
Der Duft der verlorenen Träume
Wenn der Lavendel wieder blüht
Das Mädchen im roten Kleid
Der Schokoladensalon
Besuchen Sie uns auch auf www.instagram.com/blanvalet.verlag und www.facebook.com/blanvalet.
Fiona McIntosh
Die Diamantenerbin
Roman
Deutsch von Theda Krohm-Linke
Die Originalausgabe erschien 2019 unter dem Titel »The Diamond Hunter« bei Penguin Randomhouse Australia Pty Ltd.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright der Originalausgabe © 2019 by Fiona McIntosh
This edition published by agreement with Penguin Randomhouse Australia Pty Ltd.
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2021 by Blanvalet in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Judith Schneiberg
Covergestaltung: www.buerosued.de
Covermotiv: Ildiko Neer/Arcangel Images; www.buerosued.de
KW · Herstellung: sam
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN 978-3-641-26682-0V002
www.blanvalet.de
Für den ersten Mann, den ich je liebte … und immer noch liebe.Ruhe in Frieden, Dad,nach einem langen, wundervollen Leben.
Frederick Richards 1926–2019
Prolog
Vaal River, Kapkolonie, Südafrika
September 1871
Die Luft war schwer unter der Hitze des Tages, und die afrikanische Sonne kam ihr so unbarmherzig vor wie der Blick ihrer Mutter bei der ersten Begegnung mit dem Mann, den Louisa geheiratet hatte.
Louisa Knight wusste jetzt, dass der Tod sie im Visier hatte. Sie betrachtete es als persönlichen Triumph, dass weder Zorn noch Verzweiflung ihre Gedanken beherrschten, als ihr klar wurde, dass sie sich von diesem letzten Fieberanfall nicht mehr erholen würde. Das Fieber hatte so viele getötet, warum sollte gerade sie verschont bleiben?
Was Louisa jedoch empfand, als sie an ihr eigenes Ende dachte, war Trauer um alles, was sie zurücklassen musste. Es würde nicht lange dauern, denn sie wusste, dass ihr Körper nicht mehr lange durchhalten würde, auch wenn ihre Gedanken nach jedem Fieberanfall, bei dem ihre Zähne klapperten wie Würfel in einer Faust, wieder völlig klar waren.
Louisa würde ihren letzten Atemzug tun, und die beiden Menschen, die ihr am nächsten standen, würden nicht wissen, dass sie gegangen war. Irgendwie war es so leichter für sie. Sie wollte nicht mehr das Schuldgefühl in den Augen ihres Mannes sehen, und schon gar nicht die Angst in den Augen ihres Kindes. Stattdessen ließ sie all ihren Kummer vor sich antreten. Der gewichtigste starrte sie mit wehmütigem Lächeln an; sie wünschte so sehr, sie könnte erleben, wie ihre Tochter erwachsen wurde und all ihre vielversprechenden Anlagen entfaltete. Clementine hatte einen großen Wortschatz, ihre Instinkte – besonders ihre Empathie – waren bereits so ausgeprägt, und ihre Gedankengänge manchmal so komplex, dass Louisa sich um sie sorgte. Ich hoffe, meine Tochter erwartet mehr vom Leben, als nur eine pflichtbewusste Ehefrau zu werden, dachte sie.
Welche Ironie! Sie hatte sich nicht nur mit der Ehe als der einzigen Errungenschaft in ihrem Leben begnügt, sondern hatte auch noch den Zorn ihrer Familie auf sich gezogen, weil sie sich in jemanden verliebte, der weder über Bildung noch über Vermögen verfügte. Trotz ihrer spöttischen Gedanken kam kein Lächeln über ihre Lippen; sie hatte bereits die Kontrolle über ihren Körper verloren. Nur noch ein bisschen länger, flehte sie, damit sie ihre Gedanken vollends ordnen und dieses Leben angemessen aufgeräumt verlassen konnte.
Ja, sie hatte einen armen Mann geheiratet. Ihn zurücklassen zu müssen war ihr zweiter Kummer. In ihren sieben gemeinsamen Jahren hatte sie bei James nur Liebe erlebt. Ihre Leidenschaft füreinander hatte so hell gelodert wie Magnesiumflammen. Sie war so stark, dass sie beide wie geblendet waren und alles um sie herum in Dunkelheit versank.
Sie hatte ihn instinktiv gewählt und von Anfang an gewusst, dass sie irgendwann dafür würde bezahlen müssen. Und tatsächlich musste sie die Schuld früher begleichen, als sie gedacht hatte. Wie schade. Aber wenn sie auf ihre siebenundzwanzig Jahre zurückblickte, war sie nie ohne Liebe gewesen. Ihre Eltern überschütteten sie mit Zuneigung, ihr Halbbruder vergötterte sie – und sie ihn –, und dann James, ihre Liebe – nun, er betete sie einfach nur an. Oberflächlich betrachtet passten sie nicht gut zusammen – das konnte sie kaum leugnen –, aber in Wahrheit waren sie das perfekte Paar, süchtig nacheinander.
Armer, geliebter James. Sein grenzenloses Verlangen, ihrer Familie zu beweisen, dass Armut nicht sein Leben bestimmen sollte, war maßgeblich für seine kapriziösen Entscheidungen. Einer dieser unberechenbaren Beschlüsse würde sie jetzt umbringen. Es gab keinen Ausweg mehr.
Sie wandte sich ihrem dritten Kummer zu: dem geliebten Reggie. Sie hatte ihn nie als Halbbruder betrachtet. Er war ihr großer Bruder, und sie liebte ihn bedingungslos. Sie sah ihn in diesem Moment vor sich, wie er in England die Faust schüttelte, weil sie so eine törichte Romantikerin war. »Was ist mit deiner Familie? Was mit deinem Leben hier in England? Woodingdene gehört dir – es wird nie mein Besitz sein; wir sollten es gemeinsam führen. Und wenn du schon nicht an dich denkst, wie wäre es, wenn du bei deinem unvernünftigen Abenteuer mal an Clementine denkst? Meine Nichte ist von Kopf bis Fuß eine Grant.«
Das konnte sie nicht leugnen. Ihre Tochter benahm sich eher, als sei sie sein Kind und nicht James’. Sie war ernst, ehrgeizig, nicht die Spur unzuverlässig. Schon mit sechs Jahren konnte man sich auf sie verlassen, auf ihre Stimmungen, ihre Art und ihre Versprechen. Und doch liebte das kleine Mädchen seinen Vater genauso sehr, wie Louisa es tat. James konnte ihr gemeinsames ernstes Kind in den angespanntesten Situationen zum Lachen bringen, und Clementine würde sich von jetzt an darauf verlassen müssen, denn die schwierigsten Umstände standen drohend bevor. Der Charakter des Kindes würde auf die härteste aller Proben gestellt. Sie konnte nur hoffen, dass ihr Mann dieses Zelt, das er als Zuhause bezeichnete, verlassen, sein Scheitern einsehen und wieder nach England zurückkehren würde.
Woraus bestand denn im Moment ihr Leben? Sie aßen, schliefen und liebten sich unter der Zeltleinwand. Ihre Familie wäre entsetzt. Hoffentlich würden sie nie von ihrem Leben in Afrika erfahren. Vielleicht erstatteten sie ja James das Geld für den Grabstein, den sie bereits bestellt hatte. Er wartete beim Bestattungsunternehmen darauf, dass die Worte in den Stein gemeißelt wurden, die er dort sehen wollte. Nichts Großartiges. James würde es schlicht halten, aber seine Trauer würde tief und komplex sein. Vor einem Monat noch hatte sie ihm einen Brief geschrieben, als sie sich von ihrem zweiten Fieberanfall erholt hatte. Danach hatte sie ihn versteckt, damit er ihn zum richtigen Zeitpunkt finden sollte. Sie hatte das Gefühl gehabt, ihn davor warnen zu müssen, in seiner Trauer nicht nur an sich zu denken … er durfte ihr Kind nicht vergessen. Sie hatte diesen Brief in dem Wissen geschrieben, dass sie Afrika nie wieder verlassen und das weiche, dunstige Grün des Tals von Woodingdene nie mehr wiedersehen würde. Dieses neue und mit Sicherheit tödliche Fieber war grausam früh in den dunklen Stunden kurz vor der Dämmerung aufgetreten, nachdem James gegangen war, um als einer der Ersten am Fluss anzukommen, wo er nach seinen kostbaren Diamanten grub.
Wieder wandte sie sich ihrem Innersten zu, um ihren letzten Kummer zu betrachten. Zu klein, um für irgendjemand anderen eine Rolle zu spielen, und doch schmerzte dieser Verlust am tiefsten. Das Kind, das in ihr wuchs, hatte nie eine Chance gehabt, obwohl sie so sehr gehofft hatte, dieses Jahr zu überleben. Sie hatte James nicht gesagt, dass er wieder Vater werden würde; seit sie das Schiff in Kapstadt verlassen hatten, hatte es den richtigen Moment noch nicht gegeben, denn sie wollte erst ganz sicher sein. Ihr war während der gesamten Reise von England hierher übel gewesen, was sie zunächst darauf geschoben hatte, nicht seefest zu sein. Leider jedoch hatte ihre Gesundheit sich weiter verschlechtert. Ihr kostbarer Junge – und sie war sicher, dass es ein Sohn war – würde sie ins Grab begleiten. Die kleine Karoo – diese afrikanische Wüste – würde sie und ihren Sohn in ihre geheimnisvollen, stummen Tiefen ziehen und sie bewahren, bis ihre Knochen zu Staub zerfallen würden. James hatte nie verstanden, warum er sie in der kleinen Koje, die sie miteinander geteilt hatten, nicht berühren durfte. Er hatte ihre Verweigerung als Verzweiflung gelesen, – als eine Art Strafe für das Unglück, in das er sie geführt hatte. Dabei hatte sie jede Unze ihrer Kraft für das Baby gebraucht. Doch jetzt war es zu spät für ihn. James sollte nicht der Qual ausgesetzt sein zu wissen, dass sie sein Kind mit sich genommen hatte.
Louisa schob die dunklen Gedanken beiseite und dachte an die Ereignisse, die sie dazu bewogen hatten, in die Kapkolonie zu reisen. Das ganze bedauerliche Chaos lag nur am Wetter. Typisch britisch, dachte sie freudlos.
Ihr Schiff war am Kap der Guten Hoffnung gestrandet. In London hatte man ihnen gesagt, dass die P-&-O-Schiffe jetzt durch den Suezkanal fuhren, der vor etwa zwei Jahren eröffnet worden war, aber James, der die Unterstützung durch ihr privates Vermögen ablehnte, hatte die Passage bezahlt, die er sich leisten konnte. Die Schiffe von Saw, Savill und Co befuhren immer noch die Route um das furchterregende Kap und versuchten, den Roaring Forties zu trotzen, die sie schneller auf die andere Seite der Welt zu dem großartigen Kontinent Australien brachten.
Seine Entschlossenheit und sein Stolz, mit dem er ihr Geld abgelehnt hatte, hatten sie beeindruckt. Zu Hause in Northumberland hatte alles noch wie ein großartiges Abenteuer geklungen. Auf Woodingdene konnte sie nichts verletzen. Sie hatte immer die Verpflichtung gefühlt, eine gute Partie zu machen – um den Reichtum und den guten Namen ihrer Familie fortzuführen. Sie wusste, wie sehr ihr Vater gehofft hatte, durch sie den Respekt zu erlangen, den er ersehnte.
»Heirate altes Geld«, hatte er sie gedrängt. »Ich möchte, dass du einen guten Namen trägst, der dir alle Vorteile bietet.«
»Aber mir gefällt Grant«, hatte sie unzählige Male gesagt.
»Das war bei deiner Mutter genauso, als sie mich geheiratet hat, aber selbst sie sieht die Vorteile, wenn ihre einzige Tochter unsere Familie strategisch mit einer anderen verbindet, damit es unseren Enkelkindern einmal besser geht.«
»Was ist mit Reggie?«
»Fang nicht damit an, Louisa. Es ist so schon schwer genug. Ich mag Reggie sehr, aber er wird immer …«
»Ich betrachte ihn als meinen Bruder, einen echten Grant, und nicht als das, was du gerade sagen wolltest.«
Ihr Vater hatte gelächelt. »Er hat Glück, dass du seine Halbschwester bist, aber er wird nicht mehr lange der einzige Mann in deinem Leben sein. Du bist jetzt zwanzig. Ich fürchte, wir müssen deiner Mutter gestatten, dass sie sich auf die Jagd nach den besten Partien macht.«
»Ich will aus Liebe heiraten, Vater.«
»Selbstverständlich willst du das. Ich nehme an, deine Mutter liebt mich, aber glaube nicht einen Moment lang, dass sie sich nicht zuerst in mein Bankkonto und meine Großzügigkeit verliebt hat.«
Es stimmte. Ihr Vater war nicht knauserig mit seinem Geld; sie hatte gehört, wie einige eifersüchtige Frauen hinter dem Rücken ihrer Mutter darüber getuschelt hatten.
»Habt ihr gesehen, wie er damit um sich wirft? Dieses protzige Haus, das er im Norden gebaut hat! Geschmacklos!«
»Das ist neues Geld immer, meine Liebe.«
»Und seht euch doch einmal an, wie er es für sie verschwendet. Sie funkelt ja wie ein Kronleuchter.« Louisa hatte das Bild ihrer Mutter als funkelnder Kronleuchter gefallen, aber als sie das grausame Gelächter hörte, das diesen Vergleich begleitete, begriff sie, dass das kein Kompliment gewesen war.
Der Landsitz ihres Vaters war in der Tat riesig. Er befand sich auf fast tausend Hektar privatem Land, aber in ihren Kinderaugen war Woodingdene Estate ein freundliches Haus mit einem magischen Garten. Henry Grant hatte sich mit diesem Backsteinbau ein Denkmal gesetzt und mit seinem Geld aus seinen zahlreichen Investitionen in Übersee ein idyllisches Fleckchen geschaffen, das Erinnerungen an all seine Reisen barg. Als Louisa älter wurde, hatte sie begriffen, dass es weniger elegant als vielmehr protzig war. Dennoch war Woodingdene seiner Zeit in Design, Einrichtung und vor allem mit dem neumodischen, wasserbetriebenen elektrischen Generator, der das Haus mit Strom versorgte, weit voraus. Kein Wunder, dass die Leute über Woodingdene redeten, als sei es direkt vom Mond auf einen natürlichen Vorsprung unterhalb des Hügels gefallen. Das weitläufige Anwesen lag an einem See und einem langsam dahinplätschernden Bach und verfügte über einen Steingarten, einen großartigen Park und Gärten im Tal mit sanften Wasserfällen.
Im Moment wagte sie es nicht, an die eiserne Brücke mit ihren romantisch verschlungenen Initialen zu denken. James hatte sie im Auftrag ihres Vaters entworfen, und so waren die junge, leidenschaftliche Frau und der verschlossene schottische Ingenieur zusammengekommen. Sie hatte sich in ihn verliebt, bevor sie seiner Abenteuerlust erlag.
Komm jetzt, flüsterte der Tod. Es ist Zeit.
Louisa Knight spürte einen ganz leichten Luftzug an ihren Haaren, die ihr Ehemann einmal als »Feenflechten« bezeichnet hatte. Als sie ihn gefragt hatte, warum, erklärte er, sie seien so lang und weich, dass eine Fee sich in ihre dunkelblonden Locken einkuscheln und einschlafen könnte. Heute waren ihre Haare feucht – sicherlich waren sie strähnig, dachte sie, aber das spielte keine Rolle mehr.
»Clementine?«, flüsterte sie.
»Ich bin hier, Mummy.« Sie fühlte, wie eine kleine Hand nach ihrer griff. Clementine war also die ganze Zeit an ihrer Seite gewesen.
»Hol deinen Vater … aber umarme mich zuerst.«
Sie fühlte, wie sich die weichen Ärmchen ihrer Tochter um ihren Hals schlangen, und eine weiche, warme Wange schmiegte sich an ihr trockenes, fieberheißes Gesicht. Clementine sagte, sie liebe sie, und sie würde zum Fluss laufen, um ihren Vater zu holen.
»Das ist lieb von dir, mein Liebling.« Ihre Kraft reichte gerade noch aus, um einen Kuss auf die Wange des Kindes zu drücken. Die Haut war samtig wie ein reifer Pfirsich. Sie konnte nur hoffen, dass ihre Tochter ihr Lächeln noch sah, als sie sich zum Gehen wandte, denn sie wusste, bei ihrer Rückkehr war es erloschen … wie sie.
James Knight stand kurz davor, alles zu verlieren.
Er hatte bereits seine Chance auf Australien verpasst, und sein Status als aufstrebender junger Ingenieur hatte sich ebenfalls in Wohlgefallen aufgelöst. Seine Frau sah ihn in der letzten Zeit anders an. Ihr Blick war nicht mehr verständnisvoll, und ihre Mundwinkel zogen sich immer weiter nach unten und vermittelten ihre Enttäuschung. James wusste, dass Louisa dagegen ankämpfte; sie sagte ihm immer noch, dass sie ihn liebte, und trotz seines Scheiterns lag eine besondere Zärtlichkeit in ihrer Stimme. Aber sie wollte seine Hände und die Hitze seines Verlangens nicht mehr auf ihrem Körper spüren. Durch ihre immer wiederkehrende Krankheit war ihre stolze Erscheinung zum Skelett abgemagert, und sie konnte sich kaum noch aufrecht halten. Ihre einst straffen Schultern hingen jetzt resigniert herab. Er hatte ihren Idealismus bewundert, als sie sich kennengelernt hatten und er sich in die Frau verliebt hatte, die seine Abenteuer teilen wollte und ihrem verwegenen Glück suchenden Ehemann begeistert und beseelt folgen wollte. Aber er hatte auch das Entsetzen in ihren Augen gesehen, als er ihr den Vorschlag unterbreitet hatte, nicht weiter mit dem Schiff nach Australien zu fahren und hier auf diesem Kontinent zu bleiben. Es war ein kühner, äußerst riskanter Plan gewesen, bei dem alles auf dem Spiel gestanden hatte: alles, was ihm wichtig war, und alles, was sie aufgrund ihrer Erziehung vermied.
Seine Energie und seine Versprechungen hatten sie schließlich überzeugt, aber sie musste die Erkenntnis verdauen, dass James ihre Reise zu den Diamantfeldern der Kapkolonie bereits gebucht hatte, bevor sie ihr Einverständnis dazu gegeben hatte. Er hatte auf seine Überredungskünste gebaut. »So sind wir näher an unserem Zuhause«, hatte er ihr versichert, als sie am Dock standen und sich von den Leuten verabschiedeten, die sie kennengelernt hatten.
Aber jetzt, ein Jahr später, wusste James, dass es keine Rolle spielte, ob sie in Australien oder in Afrika waren – seine geliebte Louisa gab nichts mehr auf seine Abenteuerlust und seine Versprechungen auf ein großes Vermögen. Vor allem Letzteres hatte eine große Bedeutung gehabt, da sie selbst eine reiche Frau war und schon ein paar Mal angeboten hatte, entweder ihre Schiffspassage nach Hause zu bezahlen oder seine Unternehmungen zu finanzieren, damit ihr Leben einfacher würde. Er hatte beides in seiner gewohnt ritterlichen Art abgelehnt und erklärt, wenn sie jetzt in einem Zelt wohnten, würden sie das Leben viel mehr schätzen, wenn ihm endlich der große Wurf gelänge. Aber jetzt blieben ihm nur noch wenige Pfund auf seinen Namen. Sein Name! Der hatte auch keinen Wert; wenn überhaupt, so war er nur ein schmutziges Wort für die Familie seiner Frau, und er wusste nur zu gut, wie sehr sie es hassten, dass ihre beiden geliebten Mädchen, Louisa und Clementine, seinen Namen trugen.
James stieß die Schaufel in den Boden und warf die Erde auf sein Tablett. Unglücklich holte er tief Luft, bereits sicher, dass kein Diamant in der Sonne aufblitzte. Selbst ungeschliffen wurde manchem Mann beim Anblick dieser prachtvollen Steine die Kehle eng. Er hatte sich den Tausenden anderer Glücksritter aus der ganzen Welt angeschlossen, die hofften, schnell zu Reichtum zu kommen. Nur wenigen war es gelungen. Aber kaum jemand wollte aufgeben, solange manche noch Erfolg hatten.
»Daddy?«
»Clementine – was ist, mein Schätzchen?«
Seine Tochter watete barfuß auf Zehenspitzen durch das Wasser auf ihn zu. Ihr Rock war völlig durchnässt.
»Mummy ist wieder krank. Kannst du kommen?«
»Hat sie dich geschickt?« Er hoffte es, denn in diesem Fall brauchte er die Schuld für Clementines durchnässte Kleidung nicht auf sich zu nehmen.
»Ja.«
»In Ordnung, Liebling. Ich bin gleich fertig.«
»Kann ich hier bei dir warten? Ich bin nicht gerne alleine bei ihr, wenn sie so traurig aussieht.«
James runzelte die Stirn. »Schläft sie jetzt?«
Sein kleines Mädchen blickte ihn ernst aus Augen an, die viel zu groß für ihren Kopf schienen, und nickte. »Sie ist kurz aufgewacht, aber dann wieder eingeschlafen.«
»Gleich bin ich so weit. Ich gebe nur noch ein paar Schaufeln ins Sieb.«
»Erzählst du mir die Geschichte vom Stein des kleinen Erasmus?«, fragte sie ihn. »Ich helfe dir auch beim Schauen.« Mit forschendem Blick sah sie auf das Tablett.
James lächelte. Selbst seine kleine Tochter war fasziniert von den Geschichten, die sich vor zehn Jahren zugetragen hatten und zur Legende geworden waren. James sah, dass der Mann, der nicht weit von ihm entfernt arbeitete, ihm einen Blick zuwarf. Er mochte den Zulu, der ruhig und stetig arbeitete, ohne sich ablenken zu lassen. Vor allem durch Clem, die mit jedem redete, hatten sie sich angefreundet.
»Kennst du die Geschichte von dem besonderen Stein schon, Joseph?«
»Nein, Mr Knight.«
»Nun, er ist einer der Gründe, warum wir alle hier sind.«
Joseph One-Shoe nickte, arbeitete aber weiter, und James begann zu erzählen, während er seine Pfanne rüttelte, um dieses allerwichtigste Glitzern in der nassen Erde zu entdecken. »Der Sohn eines Buren-Farmers fand einen Stein, als er sich unter einem Baum ganz in der Nähe des Ufers des Orange River ausruhte. Er fand, dass er ›glitzerte‹.«
»Sein Name ist Erasmus«, sagte Clementine zu Joseph.
James grinste. »Und er nahm ihn mit nach Hause, damit seine kleine Schwester damit spielen konnte.«
»Ich hätte auch gern eine kleine Schwester.«
»Vielleicht bekommst du ja eines Tages eine.«
»Hier ist nichts drin, Daddy.«
Er nickte traurig. Seit einem Monat schon fand er nichts, trotz der unzähligen Siebe, die er hoffnungsvoll geschüttelt hatte. Er gab eine weitere Schaufelvoll in das Sieb, und während das schlammige Wasser in den Fluss zurücktropfte und ihre Kleidung bespritzte, kehrte er zu seiner Erzählung zurück.
»Die Kinder spielten schon längst nicht mehr mit dem glänzenden Stein, als ein Nachbar, dem er gefiel, anbot, ihn zu kaufen. Er hielt ihn für einen Topas. Die Familie sagte, die Kinder wollten ihn nicht mehr und schenkten ihn dem Nachbarn.«
»Warum?«, fragte Clem.
»Weil sie großzügig waren.«
»Wollten sie das Geld nicht? Ich dachte, es wären arme Bauern gewesen.«
»Arm ist relativ.«
»Was bedeutet das?«
»Nun, wir bezahlen den Buren-Farmern Geld, damit wir auf ihrem Land schürfen dürfen.«
»Dann sind wir also ärmer als sie«, sagte sie.
Du bist viel zu klug für deine sechs Jahre, Clem, dachte er. »Auf jeden Fall hat ihn der Nachbar einem irischen Hausierer gegeben.«
»Für wie viel?«
»Nun, das weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall sagten die Leute damals, O’Reilly – so hieß der Hausierer – wusste, dass es ein Diamant war, weil er damit seinen Namen in eine Fensterscheibe geritzt hatte.«
Clementine wandte sich an Joseph. »Wusstest du, dass man mit einem Diamanten Glas schneiden kann, Joseph?«
Joseph blickte von seinem Sieb auf und wischte sich mit seinem Taschentuch den Schweiß von der Stirn. Er lachte sie an. »Jetzt weiß ich es, Miss Clementine.«
Sie erwiderte sein Lächeln. Ihr Vater erzählte die Geschichte zu Ende.
»O’Reilly zeigte ihn schließlich einem Mineralogen – das ist jemand, der etwas von der Erde versteht, Clem –, der ihn untersuchte und bestätigte, dass es in der Tat der als Diamant bekannte seltene Edelstein sei. Er schätzte seinen Wert auf fünfhundert Pfund. Der irische Hausierer verkaufte voller Freude den Stein an den Gouverneur des Kaps, der ihn 1867 zur Weltausstellung nach Paris schickte. Die Leute waren erstaunt über seine einundzwanzig ein Viertel Karat Perfektion.«
»Und er war gelb.« Clementine runzelte die Stirn. »Das hast du vergessen.«
»Ja, von einem bräunlichen Gelb, so wie Vickery’s Darjeeling-Tee, wenn man ihn nicht lange genug ziehen lässt.« Er zwinkerte Joseph zu und erklärte, was er mit dieser Bemerkung meinte.
»Auf jeden Fall nannte man ihn ›Eureka‹, und es muss ein wirklich außerordentlicher Stein gewesen sein, dessen Anblick allen den Atem raubte. Später wurde er zu einem kissenförmigen Diamanten von fast elf Karat geschliffen. Und ich schwöre, wir werden unseren eigenen Eureka finden, und er wird uns reicher machen, als man es sich vorstellen kann.«
»Und er wird viel größer sein als einundzwanzig ein Viertel Karat, Daddy.«
»Meinst du, vielleicht fünfzig?« James grinste.
»Einhundert«, sagte sie und machte einen Luftsprung.
Joseph One-Shoe lachte, und James wusste, dass er sie verstanden hatte. »Genau, Clem. Ich glaube, du solltest besser deine Unterröcke trocknen lassen, bevor deine Mutter dich sieht.«
»Ich glaube nicht, dass sie heute noch einmal aufsteht und es sieht«, sagte sie. Dabei klang sie viel älter, als sie war.
James bekam ein schlechtes Gewissen; er sollte jetzt wirklich nach Louisa schauen. »Lauf schon mal vor. Ich komme sofort, Liebling.«
Er blickte ihr nach, als sie durch das flache Wasser zum Ufer watete. »Wiedersehen, Joseph.«
»Auf Wiedersehen, Miss Clementine.«
James beugte sich wieder über seine Arbeit. Dieses sonnenverbrannte, ausgedörrte Land gehörte den Jägern, Sammlern und Kriegern, die hier schon seit Jahrhunderten lebten. Die Buren waren Farmer, aber ihm kam es so vor, als ob sie nur existierten, nicht lebten. In ihren Gesichtern war so wenig Freude; sie waren ernste, harte Holländer, die in einem unbarmherzigen Land um ihr Überleben kämpften, in dem fast jede Kreatur sie töten konnte, wenn nicht die Sommer sie dahinrafften. Briten und andere weiße Glücksjäger, die nur die wenigen warmen Monate in ihrer Heimat kannten, hatten hier nichts verloren. Und doch war er hier, ein Teil des gierigen Mobs, und suchte an einem der gefährlichsten und bedrohlichsten Orte im Reich Seiner Majestät nach einem verborgenen Schatz.
James Knight presste grimmig die Lippen zusammen und begann erneut, die Erde durch das Sieb zu rütteln. Er versuchte sich einzureden, dass heute nach afrikanischen Maßstäben ein milder Morgen war. Aber ganz gleich in welcher Jahreszeit war er immer abhängig von den Elementen, immer stand er knöcheltief im Wasser, todmüde und hungrig, und allein der Gedanke an den nahenden afrikanischen Sommer deprimierte ihn. Das entsprach nicht seiner normalen Gemütsverfassung; sein Schwager Reggie hatte ihm einmal vorgeworfen, er sei ein unerträglich fröhlicher Mensch. Aber Afrika forderte seinen Tribut. War der Preis zu hoch?
Du hast dir die Suppe eingebrockt, jetzt musst du sie auch auslöffeln, sagte eine Stimme mit dem mürrischen Tonfall seines Vaters in seinem Kopf. Das stimmte. Aber was war ein Leben ohne Risiken? Allerdings litt Louisa am meisten unter seinen Entscheidungen. Er hatte ihre Treue und ihr Vertrauen in ihn nicht verdient, solange er für seine Familie noch nichts geleistet hatte.
Sollte er ihr Geld annehmen, um eine Überfahrt nach Hause zu buchen und sich mit der schmerzhaften Verachtung seiner Verwandten konfrontieren? Er stellte sich gerade Reggies Zorn vor, als ein Schrei ertönte. Er drang durch die Steppe bis an den Fluss, wo schwitzende, erschöpfte Männer in ihre Arbeit vertieft waren. Alle hatten Hunger, die meisten freuten sich wahrscheinlich schon auf den Sonnenuntergang, wenn sie in der Bretterbude, die als Kneipe zusammengezimmert worden war, ein wässeriges Bier oder ein paar Schnäpse kippen konnten.
James stand zufällig als einziger Weißer am nächsten zu dem Uferbereich, auf den der Mann zurannte; näher stand nur noch Joseph One-Shoe, mit dem er bei den Grabungen im Fluss ein seltsames, meistens stummes Einvernehmen teilte.
Der Mann, immer noch weit entfernt, schrie erneut. Seine Worte waren nicht zu verstehen, aber man spürte ihre Intensität in der klaren Luft. James setzte den Hut mit der kecken Feder ab und richtete sich auf, um seine schmerzenden Gliedmaßen zu strecken. Sein Hemd hing wie ein feuchter Lappen auf seinem Rücken, und seine Hose war nass bis zu den Knien vom Wasser des Vaal River. Louisa hatte nach ihm gerufen, Clem wartete auf ihn. Aber erst einmal wollte er hören, was da los war, sagte er sich.
Der aufgeregte Mann sprang über kleine Erdhügel, ohne auf den Weg zu achten. Anscheinend war es ihm egal, ob er stürzte, was erschwerte Arbeitsbedingungen wegen eines verstauchten Knöchels oder potenziellen Tod durch einen Schlangenbiss bedeuten konnte. Er war gekleidet wie alle Goldgräber: eine Hose, die mit Schnur in der Taille zusammengebunden war, durchgelaufene Stiefel. Am Anfang hatte James noch versucht, sich ordentlich anzuziehen, hauptsächlich Louisa zuliebe, doch in dieser Umgebung und bei der Arbeit hier war das unmöglich, und mit der Zeit sah er genauso zerlumpt und heruntergekommen aus wie die anderen. Es war einfach nicht durchzuhalten, sich jeden Tag zu rasieren, weiße Hemden und polierte Stiefel zu tragen. Das Halstuch saugte den Schweiß auf, und die silbergraue Raubvogelfeder, die seine Tochter gefunden hatte, war seine Identifikation. Clementine sagte, ihr Nachname bedeute bestimmt, dass seine Vorfahren eine Rüstung getragen hätten, deshalb sollte auch er etwas Silbriges tragen. Clementine zuliebe tat er alles. Trotzdem war James froh, dass in ihrem Familienzelt kein Spiegel hing, der ihm zeigen konnte, wie heruntergekommen er mittlerweile aussah.
Der Mann schrie erneut und schwenkte die Arme, um ihre Aufmerksamkeit zu erregen. Offensichtlich schrie er aus freudiger Erregung und nicht, um sie zu warnen. Immer mehr Männer im Flussbett richteten sich auf und blickten ihm entgegen, aber James würde die Nachrichten sicher als Erster hören.
Er blickte nach rechts, wo sein Gefährte, der gebaut war wie die Dampfmaschinen, die James einst entworfen hatte, seinen Claim unermüdlich weiter bearbeitete. Aber auch Joseph hatte den Rufer natürlich gehört und erwiderte James’ Blick.
»Was sagt er?« Das bescheidene, aber adäquate Englisch des Mannes beeindruckte James. Es verstand von Josephs Sprache kein einziges Wort – bekam noch nicht einmal das Pidgin-Englisch über die Zunge, das die Buren mit den Eingeborenen sprachen. Er wusste, dass der Zulu ein Krieger war, weil er ein Stirnband aus Leopardenfell trug, das von seinem Mut zeugte. Ansonsten war er in eine zu große, geflickte Hose, die er an den Schienbeinen abgeschnitten hatte, und ein Hemd gekleidet, letzteres jedoch trug er nur, wenn er nach Sonnenuntergang mit Frauen zusammen gewesen war. Obwohl der Afrikaner sich mühelos über den steinigsten Boden fortbewegen konnte, trug er an einem Fuß einen zerrissenen Stiefel. Er war ihm zu klein, deshalb hatte er die Kappe abgeschnitten.
»Ich kann ihn noch nicht verstehen«, erwiderte James. Er wischte sich mit dem Ärmel über das Gesicht, bedauerte aber sofort den Schmutzfleck, der dadurch entstand. Louisa würde darauf bestehen, das Hemd zu waschen.
»Daddy!« Er wandte seinen Blick wieder seinem Kind zu, das erneut am Flussufer stand. Seit dem Tag ihrer Geburt war er sich sicher, dass alleine schon ihretwegen Louisas Familie ihm nicht so ablehnend gegenüberstehen sollte. Clementine war so anmutig in ihren Bewegungen wie ihre Mutter, von der sie auch die dunkelblonden Haare geerbt hatte – ihr ernster Gesichtsausdruck erinnerte an ihren Onkel Reggie –, aber sie besaß auch den analytischen Verstand der Familie Knight. James fand, dass seine Tochter für ihre sechs Jahre beängstigend frühreif war. Voller Neugier speicherte sie Wissen wie in einem Tresor. Ihr Mund stand nicht still, und mit ihrer ernsthaften Art und dem unwiderstehlichen Charme, den sie mit Sicherheit von ihrer Mutter geerbt hatte, zog sie alle in ihren Bann. Vor der Geburt seiner Tochter hatte er sich nicht vorstellen können, ein anderes Mädchen mehr lieben zu können als Louisa … und doch wusste nur er allein, dass es so war. Seine Tochter war der Grund dafür, dass er sich jeden Morgen aufs Neue wieder an die Arbeit machte und hoffte, dass heute der Tag war, an dem er ihre Zukunft würde sichern können. Triumphierend würde er sie nach England zurückbringen; er würde seine beiden Mädchen mit feinen Kleidern überschütten, für sie ein oder zwei prächtige Häuser anschaffen und Einladungen zu den wichtigsten gesellschaftlichen Ereignissen für sie annehmen. Sie würden als das Paar gelten, dem der Himmel lächelte.
Erneut rief seine Tochter nach ihm, die kleinen Hände trichterförmig vor den Mund gelegt, damit der Schall ihre Worte weitertrug. Ihre Mutter drehte ihr die Haare nicht mehr zu Löckchen, sondern ließ sie offen fließen, sodass sie in der Sonne golden schimmerten. Gehalten wurden sie von einem Satinband, das Louisa ihrer Tochter jeden Tag in die Haare band. Heute passte es in der Farbe zum wolkenlosen blauen Himmel, aber auch zu ihren Augen, die so blau waren wie der blaue Schmetterling in seiner Heimat Schottland.
Damit sie ihn gut hören konnte, rief er mit lauter Stimme: »Geh nicht wieder durchs Wasser, Clem. Ist deine Mutter wach?« Er blickte zu der Zeltstadt, in der sie wohnten, und versuchte, nicht an Woodingdene zu denken, das riesige Anwesen, das seine Frau aufgegeben hatte, um mit ihm zusammen zu sein.
Was als weitläufige kleine Ansammlung von nicht mehr als über Stöcke gezogene Leinwände begonnen hatte, hatte sich so ausgedehnt, dass die Zelte jetzt dicht beieinanderstanden, keine Grenzen mehr zu erkennen waren und bevölkert waren von Menschen aus aller Herren Länder, die hier ein kümmerliches Dasein fristeten. Sein Kind hatte nicht genug zu essen, sie wurde mager, und ihre Haut war braun statt rosig. Ihre Beine waren so dünn und staksig wie bei einem neugeborenen Kalb. Aber sie war nicht unglücklich – da war er sich sicher.
»Was?«, rief er.
Sie war näher gekommen. »Ich sagte, sie ist sehr krank. Sie will sich nicht bewegen.«
Er blickte über die Schulter zu dem Mann hinüber, der auf sie zurannte. Joseph hatte aufgehört zu arbeiten und wartete auf ihn. Er rief seinem Kind zu: »Setz dich zu ihr. Ich bin sofort da.« Er blies ihr einen Kuss zu.
Sie schickte ihm ebenfalls einen Luftkuss und lief wieder zu den Zelten. Clementine kannte sich in der Zeltstadt genauso gut aus wie er; sie trugen beide einen Lageplan im Kopf. Aber die alte Frage brannte in seinem Magen wie ein Geschwür: Was für ein Leben war das für ein Kind, das eigentlich an die Schule denken und hübsche Kleider tragen sollte? Eine überflüssige Frage. Sie saßen jetzt nun einmal in der Kapkolonie fest, bis sie die Schiffspassage nach Hause bezahlen konnten. Der Erfolg konnte sich heute, morgen, nächste Woche einstellen. Sein Recht, hier zu graben, war nicht teuer. In diesem Flussabschnitt waren regelmäßig Diamanten gefunden worden, und die Syndikate begannen offen, Farmen zu kaufen. Auch diese Farm würde bald schon gekauft werden.
»Diamanten?« Der Afrikaner runzelte die glatte Stirn. Er hatte sich ganz aufgerichtet und beschirmte die Augen gegen die grelle Sonne mit der Hand. Unter der Haut seiner Oberarme, die von einem dünnen Schweißfilm überzogen waren, spielten die Muskeln. James kam sich Joseph gegenüber immer klein und mickerig vor, und das, obwohl er in seiner Familie mit knapp eins achtzig der Größte war. Die meisten Leute aus dem Westen hatten wenig mit den Afrikanern am Hut, sie kamen besser mit den Indern und Malaien, den sogenannten Kap-Farbigen, zurecht. Es war Clementine gewesen, die sich mit dem Mann angefreundet hatte, weil er ein Stück Fluss neben ihrem Vater bearbeitete. Sie teilten sich die Ausrüstung, kümmerten sich gegenseitig um ihre Claims und ihre Habseligkeiten, und von Zeit zu Zeit aßen sie auch zusammen. Louisa fühlte sich in seiner Gegenwart sicher.
»Ich kann seinen Namen nicht aussprechen, deshalb hat er mir erlaubt, ihn Joseph One-Shoe zu nennen«, hatte Clementine ihren Eltern eines Abends erklärt.
James hatte gelacht. »Das ist aber ein seltsamer Name. Joseph nach deinem Kuschelkaninchen?«
»Ja. Eigentlich wollte ich ihn Joseph Two-Pence nennen.«
»Warum?«
»Weil er mir erzählt hat, dass er mehr nicht gespart hat.«
»Wahrscheinlich spricht er unsere Sprache nicht.«
»Doch, Daddy. Er hat es gelernt, in einer … einer … besonderen Schule, die ein Pastor geleitet hat.«
»Einer Missionsschule?«
»Ja, genau das hat er gesagt. Eine Missionsschule. Er versteht alles, was wir sagen, aber er kann nur langsam sprechen, weil er nicht alle unsere Wörter kennt … außerdem hat er gesagt, spricht er nur, wenn er auch etwas zu sagen hat.«
James dachte daran, wie er über diese Bemerkung gelacht hatte, weil der Mund seiner Tochter nie stillstand. »Ihr gebt ein gutes Paar ab.«
»Ich mag Joseph – genauso gerne wie meine Puppe, vielleicht sogar mehr.«
»Weil er dir antworten kann?«
»Nein, weil er so weise ist.«
»Weise.« Er hatte gelächelt. »Weißt du überhaupt, was das bedeutet?«
»Es bedeutet klug.«
»Ja, eine bestimmte Art von klug.«
»Bist du weise?«
»Leider nicht.«
»Ich glaube, er ruft etwas über einen neuen Diamantenfund«, unterbrach Joseph James’ Erinnerungen.
James wandte den Kopf. »Du hast recht«, erwiderte er. Sein Puls ging schneller. »Es handelt sich um ein gerade erst ausgetrocknetes Flussbett!«
Beide Männer wateten durch das flache Wasser zum Ufer.
»Wo?«, fragte Joseph.
»Er sagt, die De-Beers-Farm. Das muss von hier fast zwanzig Meilen weit weg sein.« Er warf seinem Begleiter einen Blick zu. »Wenn es eine neue Ader ist, und er scheint ganz aufgeregt zu sein, muss ich mit meiner Familie dorthinziehen. Wir müssen das Zelt abbauen und unsere Sachen packen.« Er stöhnte. »Eine kranke Frau und ein kleines Kind können sich nur langsam fortbewegen. Ich muss zusehen, dass wir einen Karren für den Transport bekommen.« Er schüttelte den Kopf. »Das schaffe ich nie. Ich werde gar nicht erst die Chance haben, einen Claim abzustecken.«
»Das mache ich für dich«, sagte Joseph. »Ich muss nichts packen. Ich kaufe deinen Claim.« Er streckte die Hand aus.
James starrte auf die rosige Handfläche mit den deutlich ausgeprägten Linien. Weise Linien, laut Clem. »Warum willst du das tun?«
»Dein Kind ist nett zu mir. Sie hat mir ein paar neue englische Wörter beigebracht, und jetzt kann ich weiter als zwanzig zählen. Ich kann besser mit Geld umgehen, und keiner kann mich mehr betrügen. Sie will mir alle Zahlen bis hundert und noch viele Wörter beibringen.«
»Und du willst das für uns tun?«
»Wenn du mir vertraust?«
»Ich vertraue dem Herzen meines Kindes.« Er legte die Hand auf die Brust. »Sie nennt dich ihren Freund. Andere Freunde hat sie nicht.«
Der Mann nickte. »Ich bin Zenzele …«, sagte er. Er fügte noch andere Namen und einen Klicklaut hinzu, den James verwirrend fand und nicht aussprechen konnte.
»Ich bin James, aber mir fällt es schwer, deinen Namen auszusprechen. Clementine …« Er zeigte zum Ufer. »Sie nennt dich Joseph One-Shoe.«
Joseph nickte lächelnd. »Dieser Name gefällt mir.« James hatte das sichere Gefühl, dass sein Gefährte einen ganzen Saal voll düster dreinblickender Menschen zum Strahlen bringen konnte, wenn er so lächelte.
Er schüttelte dem Mann die Hand und wies auf seine Füße. »Warum trägst du übrigens nur einen Schuh? Ich bin sicher, dass wir dir einen zweiten Stiefel organisieren können.«
Joseph blickte ihn nachdenklich an und suchte nach den richtigen Worten. »Ich bin Diamantengräber wie du, Mr James, aber ich bin ein Krieger von meinem Stamm. Das will ich nicht vergessen.« Er hob den Fuß, an dem er keinen Schuh trug. »Das hier bedeutet, ich vergesse nie, dass ich meilenweit gelaufen bin, um einen Löwen zu töten, der meinen Freund getötet hat, dass ich für meinen Stamm gekämpft habe und dass ich hier bin, weil mein Häuptling mich geschickt hat. Es sagt mir, ich bin ein Zulu, kein weißer Mann.« Er zupfte an seiner abgeschnittenen Hose, um seinen Standpunkt klarzumachen.
James pfiff leise. »Du hast einen Löwen getötet.«
»Deshalb wache ich in der Nacht. Sie beobachten uns.«
»Wir haben Gewehre.«
»Das ist eher etwas für die nicht so Tapferen. Ein Krieger darf einen Löwen nur mit seinem Speer bekämpfen und mit seinem …« Das richtige Wort fiel ihm nicht ein, deshalb tippte er sich an die Schläfe.
James nickte lächelnd. Er kramte in seinen Hosentaschen und zog ein paar zerknüllte Scheine hervor. »Das ist mein letztes Geld. Es müsste reichen. Wenn du rechtzeitig dorthinkommst, kaufe den größten Claim, den du kriegen kannst – wir bearbeiten ihn zusammen. Wir werden Partner.«
Stirnrunzelnd wiederholte Joseph das Wort. »Partner.«
»Du und ich.« James zeigte ihm und sich auf die Brust und schüttelte das Sieb, das Joseph in der Hand hielt. »Zusammen.«
»Ah, Partner?«, wiederholte Joseph, als wollte er das neue Wort abspeichern. James grinste ihn ermutigend an. »Dann will ich rechtzeitig dort sein, Mr James. Ich gehe jetzt. Niemand wird mich einholen.«
Der Läufer war angekommen. Er war so außer Atem, dass er nicht mehr sprechen konnte. Er beugte sich vor und stemmte die Hände auf die Knie, um wieder zu Luft zu kommen. Aus dem Flussbett und den Zelten strömten die Männer herbei, um die Neuigkeiten zu hören. »Eine neue Diamantenader!«, stieß er hervor. »Sie haben Diamanten bei De Beers Farm gefunden. Sie lagen einfach auf dem Veld herum. Hals über Kopf sind Claims abgesteckt worden. Ich bin nur gekommen, um mein Werkzeug zu holen.«
Joseph erwiderte den Blick, den James ihm zuwarf, mit einem wissenden Grinsen. Er zeigte über den Fluss auf das gegenüberliegende Ufer. James verstand, was er meinte, glaubte es aber erst, als der Zulu wieder in den Fluss watete und zu schwimmen begann. Er hatte sich einen Lederbeutel zwischen die Zähne gesteckt. Offensichtlich sorgte er dafür, dass James’ Geld trocken blieb. Nur wenige der anderen Männer sahen, wie der Afrikaner sich von der Menge entfernte, aber ein Schrei ertönte, als zwei gerissene Australier auf ihn zeigten.
»Hey, seht mal! Der schwarze Bastard rennt los!«
»Er hat genau denselben Anspruch wie jeder von uns«, warf James ein.
»Ja, und er wird lange vor uns da sein, weil er quer übers Land laufen kann. Habt ihr schon mal gesehen, wie diese Kerle rennen können?«
James schüttelte den Kopf. Er war froh, dass Clementine nicht in der Nähe war, auch wenn sie an diese Sprache durch das Leben im Lager gewöhnt war.
»Pass auf, Kumpel! Der ist schon da, bevor auch nur einer von uns überhaupt zusammengepackt hat.«
James grinste innerlich. Zum ersten Mal seit fast einem Jahr überkam ihn wieder das Gefühl der Vorfreude und des Glaubens an sein Schicksal, das ihn bewogen hatte, das Schiff zu verlassen und den gut bezahlten Job bei einem großen technischen Unternehmen auf der anderen Seite der Welt aufzugeben. Mit seinem Kind auf dem Arm und seiner bangen Frau an der Seite hatte er das Schiff verlassen. Louisa hatte viele Fragen gestellt, aber sie hatte auch auf ihre Jugend und ihre Liebe vertraut. »Komm mit mir«, hatte er gefleht, als sie ihn ungläubig angeschaut hatte. In ihrem Blick stand der Vorwurf: Du hast Australien versprochen, nicht Afrika. Du hast ein Zuhause versprochen, kein Zelt. Du hast eine richtige Stadt versprochen mit Hotels, Theatern und Mode, nicht die Wildnis …«
»Ich werde hier ein Vermögen machen, und du wirst stolz auf uns sein … und deine Familie wird Kreide fressen«, hatte er stattdessen versprochen.
Und hier war sie nun. Seine letzte Chance, sein Versprechen gegenüber der schönen, vertrauensvollen Louisa zu halten.
»Wir sollten besser keine Zeit mehr verlieren«, sagte er zu dem Aussie.
Die Männer rannten sich gegenseitig fast über den Haufen, als sie voller Gier und Hoffnung zu ihren Zelten liefen. Sie wühlten das Wasser auf wie ein Fischschwarm und schubsten sich gegenseitig zur Seite, um schneller voranzukommen. James ließ sich Zeit. Es würde bestimmt noch zu Prügeleien kommen. Der heißeste Teil des Tages stand noch bevor, wenn sie die Ochsen vor die Karren spannten, in denen die schmutzigen, staubigen Zelte vom Fluss zum rauen Veld transportiert wurden.
Er würde auf Joseph One-Shoe vertrauen. Er blickte in die Ferne, wo er gerade noch Josephs Gestalt erkennen konnte, der schnell und furchtlos querfeldein ihrem Vermögen entgegenlief.
Während James Knights Stimmung sich hob, tat Louisa Knight ihren letzten Atemzug. Still verabschiedete sie sich, während neben ihr ihre Tochter darüber schwatzte, dass sie einen Diamanten so groß wie eine Kastanie finden würden.
Teil I
1
Das Große Loch, Kimberley, Kapkolonie
März 1872
Sie diskutierten, ob Handschuhe nötig waren, um gemäß den Queensberry-Regeln zu boxen, obwohl Joseph bevorzugte, was James als »Faustkampf« bezeichnete. Sein Gegner – John Rider, auch Knuckles, »Knöchel«, genannt – hatte eine ähnliche Neigung für die schnellere, blutigere Version. Zweifellos wollte die brüllende Menge das Knacken und Krachen ungeschützter Fäuste gegen Nase, Kinn und Rippen hören … vor allem von den Körperteilen, die zu Knuckles gehörten.
Die Männer hatten für ihren Wetteinsatz bisher viel zu sehen bekommen. Der Schnurrbart von Knuckles bildete eine natürliche Plattform, über die Ströme von Blut aus seiner übel zugerichteten Nase rinnen konnten. Clem hatte gehört, dass dieser Kämpfer erstaunliche Knockouts lieferte und sich seine finalen Siegerschläge gerne für die späteren Runden aufhob.
»Du hast ihn schon in der Tasche, Knuckles. Sieh ihn dir doch an. Er ist schon halb am Boden«, hatte Clementine seinen Trainer sagen hören, als er dem Mann die Schultern massierte. Sie hatte ihre Fähigkeit zum Lippenlesen im unablässigen Lärm im Großen Loch so verfeinert, dass sie aus der Ferne erkennen konnte, was zwei Männer zueinander sagten. Der Boxkampf, den ihr bester Freund heute Abend bestand, ärgerte sie. Sie versuchte sich der dicken Luft, die scharf nach dem Schweiß der Männer und verschiedenen Ölen roch, zu entziehen. Die Männer im Publikum hatten ihre Haare mit einer Pomade geglättet, die nach Lavendel roch, aber die Seile, die um den Ring gespannt waren, waren mit Tierfett eingerieben worden, und dieser Geruch bereitete ihr Übelkeit. Die schwitzenden Körper der beiden Boxer glänzten von einem mineralisch riechenden Fett, damit die Schläge abglitten. Auch die zahlreichen Öllampen gaben einen stechenden Geruch ab. Die Zuschauer tranken Ale und lachten dröhnend, wenn jemand einen Witz machte oder eine gewagte Wette abschloss. Einzelne Stimmen waren nicht herauszuhören; es herrschte einfach ein allgemeines, aufgeregtes Gebrüll. Clem ging durch den Kopf, dass sie alles Schöne im Leben mochte – da kam sie ganz nach ihrer Mutter. Sie trug zwar keine hübschen Kleider, weil sie nicht praktisch waren, aber das bedeutete nicht, dass sie ihr nicht gefielen. Sie spielte auch nicht mit ihren beiden Puppen, weil sie so schnell schmutzig wurden und kaputtgehen konnten. Ihre Lumpenpuppe hingegen vertrug alles – wie Joseph –, und lächelte sie immer an, ganz gleich, wie mitgenommen sie aussah.
Sie hatte zwar nur wenige Erinnerungen an Woodingdene, aber die standen ihr lebhaft vor Augen, und ein alter Mann, der für ihren Großvater arbeitete, hatte bleibenden Eindruck auf sie gemacht. Er war Schotte und anscheinend verantwortlich für alles, was auf dem Besitz mit Fischen und Jagen zu tun hatte. Jeder nannte ihn den »Ghillie«, was so viel heißt wie Jäger. Seinen richtigen Namen wusste sie nicht, aber er hatte ihr einmal eine Puppe aus Lumpen gemacht, als sie sich bei der Unterhaltung der Erwachsenen gelangweilt hatte und zu den Bootsschuppen gelaufen war. Der Ghillie war gerade dabei gewesen, eine Angelschnur aufzuwickeln und die Angeln zu säubern. Sie hatten sich unterhalten, und bald schon hatte er zu einem der sauberen Lappen, die er in einem Korb aufbewahrte, gegriffen und eine Puppe daraus gemacht.
»Ich habe diese Puppen immer für meine Meggie gemacht, als sie noch ein kleines Mädchen war.«
»Wer ist Meggie?«
»Meine schöne Tochter.« Sie hatte bemerkt, dass sich ein Schleier über seine Augen legte und nicht mehr weiter gefragt, weil sie spürte, dass er traurig war.
»Möchtest du gerne einen Jungen oder ein Mädchen?«
»Einen Jungen, bitte«, hatte sie erwidert.
»Warum das?«
»Weil ich gerne einen Bruder hätte. Mädchen sind so zimperlich. Die, die zu mir zum Spielen kommen, wollen nie mit mir auf Bäume klettern oder herumlaufen. Sie wollen immer nur Teegesellschaft im Puppenhaus spielen.«
Er hatte gegrinst. »Dann mache ich deiner Stoffpuppe eine Hose. Du musst ihr einen Namen geben.«
»Ich werde ihn Gillie nennen, nach Ihnen.«
»Ich fühle mich geehrt, Miss Clementine.«
Gillie, der hauptsächlich aus Kattun bestand, grinste sie immer noch mit seinem aufgemalten Lächeln an, das ihre Mutter regelmäßig erneuert hatte, damit es nicht verblasste.
Ein Aufschrei ging durch die Menge. Clem war es in diesem Moment egal, dass Joseph One-Shoe mittlerweile der Held des Boxrings für die Leute in Kimberley war, ungeschlagen bis zum heutigen Tag. »Jetzt ist Schluss, Daddy«, versuchte sie zu verhandeln. Ihr Vater wandte den Blick von Josephs blutüberströmtem Gesicht ab.
»Er besiegt ihn, Clem.«
»Mr Knuckles denkt das auch«, beharrte sie. Der Gegner spuckte erneut ins Stroh.
»Der Engländer hält nicht mehr lange durch, aber Joseph schon, oder?« Ihr Mann nickte keuchend. Wie immer machte er nicht viele Worte. »Außerdem sind für den Sieger bei diesem letzten Kampf viele Rohdiamanten drin.«
»Davon haben wir genug«, entgegnete sie.
»Bald haben wir den ganz großen, das verspreche ich dir, und dann können wir nach Hause fahren.«
Nach Hause. Mit diesen zwei Wörtern versuchte ihr Vater sie immer wieder zu überreden, wenn er sie auf seine Seite ziehen wollte. Aber England war nicht ihr Zuhause. Ihr Zuhause war hier. Und wenn sie in die Heimat ihres Vaters zurückgingen, müssten sie ihre Mutter alleine in ihrem Grab zurücklassen. Sie könnte nicht mehr jede Woche dorthin gehen, könnte keine wilden Blumen mehr daraufstellen, damit ihr kaltes Bett hübsch aussah, könnte nie mehr beten oder einseitige Gespräche führen, um zu erklären, warum sie keine Unterröcke mehr trug und ihre Haare nur noch alle vierzehn Tage wusch. O ja, und es tat ihr leid, dass sie so oft die Schule schwänzte, weil sie Daddy und Joseph lieber dabei zusah, wie sie versuchten, »die Kastanie« auszugraben, den riesigen Rohdiamanten, den ihr Vater unbedingt finden wollte. Und wenn sie nach Hause zurückgingen, müssten sie auch Joseph One-Shoe zurücklassen.
Sie beugte sich vor. Dass sie an einem Ort war, den andere kleine Mädchen nicht zu betreten wagten, brachte sie nicht in Verlegenheit. »Joseph?«
Sein großer runder Kopf drehte sich zu ihr. Ein Auge war zu einem schmalen Schlitz zugeschwollen, und aus einem tiefen Schnitt über dem anderen Auge floss das Blut, obwohl ihr Vater ihn mit Fett zugeschmiert hatte. »Ja, Löwin?« Er klang erschöpft.
»Hast du gespürt wie der Knochen unter seiner Brust gebrochen ist?«
Er nickte. »Ich habe gesehen, wie er sich gekrümmt hat.«
»Eine seiner Rippen ist gebrochen«, murmelte sie. »Und eines seiner Augen ist vollkommen zugeschwollen.«
Ihr Vater lachte. »Niemand würde mir glauben, wenn ich erzählte, dass mein Boxer seine Strategie mit einer Siebenjährigen diskutiert. Wir sollen also auf die Rippen zielen.«
»Nein«, sagten Clementine und Joseph gleichzeitig.
»Joseph tut nur so«, erklärte Clementine. »Mr Knuckles wird sich unwillkürlich schützen.« Ihre Stimme wurde von der Glocke übertönt, und Joseph richtete sich auf. »Du musst ihn in dieser Runde k. o. schlagen«, schrie sie angstvoll. Mit dem Mund formte sie ein Wort auf Zulu, das nur Joseph verstehen konnte; es bedeutete »aufsteigend«, aber sie wussten beide, dass sie damit die Richtung seines Schlags meinte.
»Der Einsatz auf diese letzte Runde beträgt eins zu sechs«, warnte James Joseph.
»Das weiß er, Daddy.« Sie warf ihm einen vorwurfsvollen Blick zu.
Selbst wenn Clementine sich aufrichtete, konnte sie Joseph nur in die Augen blicken, wenn er mit gekreuzten Beinen auf dem Boden saß, so wie er es jetzt tat in ihrer winzigen Hütte. Das Brüllen der blutrünstigen Menge hatten sie hinter sich gelassen, und das Sägemehl vom Boxring wurde wohl gerade wieder zusammengefegt, um es für einen späteren Kampf zu verwenden.
Clem wischte Joseph das Blut aus dem Gesicht. Ihr Vater hatte den Schnitt über seinem Auge genäht und war dann losgezogen, um ihren Preis abzuholen und den Erfolg mit einem oder zwei – oder sechs – Whiskys in einer der Kneipen am Ort zu feiern.
»Tue ich dir weh?«
Er schüttelte den Kopf.
»Bist du der stärkste Mann der Welt, Joseph?«
Er zuckte zusammen, als der Riss an seiner Lippe wieder aufplatzte, und lächelte. »Vielleicht.«
Sie gab ihm ein Läppchen. »Drück es darauf.«
»Es würde deiner Mutter nicht gefallen, wenn sie sähe, was du tust.«
»Mummy ist tot. Sie kann mich nicht daran hindern.«
»Du klingst wie eine alte Frau.«
»Und du jetzt wie ein Engländer.«
Joseph zuckte mit den Schultern. »Das hast du mir beigebracht.«
Sie lächelte. »Du kannst zurück zu deinen Leuten gehen und ihnen meine Sprache beibringen. Du kannst wieder unter deinem richtigen Namen Zenzele leben und wieder deine Sprache mit den ganzen Klicklauten sprechen.«
»Für den Augenblick bin ich mit Joseph ganz zufrieden.«
»Ist der Häuptling immer noch böse?«
»Wahrscheinlich. Ich sollte den Stamm ja nur bis intwasahlobo verlassen.« Er runzelte die Stirn. »Tut mir leid.« Erneut zuckte er zusammen, als er grinste. »Wie heißt das Wort für die Zeit, wenn die Blätter kommen?«
»Frühling.«
Er nickte. »Zwei Frühlinge sind gekommen, und ich bin immer noch hier.«
»Vermisst du deine Leute?«
»Ja.« Er war jetzt froh, dass er Thandiwe nicht bestätigt hatte, dass sie Mann und Frau wurden. Er hatte sich darauf vorbereitet, sich mit ihrer Familie zusammenzusetzen, um den Brautpreis zu bezahlen, aber dann hatte ihn der Häuptling auf seine wichtige Mission geschickt. Er hatte ihr gesagt, er würde bis zum nächsten Regen wegbleiben. Damals hatte er ja nicht gewusst, dass er sie anlog. Thandiwe hatte mittlerweile sicher seinen Freund Lungani zum Mann genommen. Er wünschte ihnen Wohlstand und viele Kinder, aber er ließ die Gedanken an die Frau, die er liebte, nur selten zu … er wurde hier gebraucht, von einer anderen, viel jüngeren Frau.
»Ich will nicht, dass du gehst.« Plötzlich umarmte Clementine ihn. »Bitte, du darfst mich nie verlassen, Joseph.«
Der Zulu war vorsichtig. Er war beliebt bei den Weißen, aber den Frauen würde es nicht gefallen, wenn sie sähen, wie er mit dem Kind Zärtlichkeiten austauschte.
Sanft schob er sie weg. »Bevor ich dich verlasse, wirst du mich verlassen müssen«, versicherte er ihr.
»Sie werden mich mit Gewalt fortzerren müssen«, sagte sie.
»Pass auf, dass du deine Bluse nicht mit Blut beschmutzt«, fügte er hinzu, um einen Vorwand zu haben, sich ganz aus der Umarmung zu lösen.
»Zu spät. Mrs Carruthers hat gesagt, ich solle Unterröcke tragen wie ein richtiges Mädchen, und sie will mit Daddy darüber sprechen.« Er nickte stumm. »Aber Röcke und Unterröcke sind so hinderlich«, fuhr sie verärgert fort. »Daddy sagt, ich muss sie tragen, wenn wir nach England zurückgehen, aber ich gehe nie zurück.« Er beobachtete sie aufmerksam. Sie wollte auf irgendetwas hinaus, das spürte er. »Mrs Carruthers sagt, ich werde bald nach Hause geschickt, damit ich richtig in die Schule gehen kann. Sie sagt, meine Mutter habe es versucht, aber bei meinem Vater sei Hopfen und Malz verloren, und was er mir über griechische Mythen und Astronomie oder die Geografie der Welt beibringt, nützt einem Mädchen nichts. Sarah Carruthers sagt, ihre Mutter findet, ich sei verwahrlost und sollte nicht so viel Zeit mit dir verbringen.«
Er nickte. Das überraschte ihn nicht. Ihr Gespräch wurde vom Gesang Betrunkener unterbrochen, und Clementine musste kichern, obwohl sie so ärgerlich war.
»Ich hole deinen Vater, bevor noch jemand einen Eimer mit etwas Garstigem über ihm auskippt«, sagte Joseph. Seufzend erhob er sich, musste sich aber bücken, weil er viel zu groß war für die Hütte, in der die Knights lebten.
Clementine blieb in der behelfsmäßigen Tür stehen, als ihr Gefährte in die Nacht hinausging. Seine leicht gebeugte Haltung sagte ihr, dass die gebrochene Rippe und seine blauen Flecken ihm wehtaten. Hoffentlich fing er nicht wieder an zu bluten.
Sie hatten mit einem Knockout überzeugend gewonnen; ein blitzschneller Uppercut, für den Joseph eine Menge Prügel eingesteckt hatte, bis der genau richtige Moment dafür gekommen war. Clementine hatte es im gleichen Augenblick gesehen wie Joseph. Jetzt!, hatte sie innerlich geschrien.
Dann hatte es dem Boxchampion aus England den Boden unter den Füßen weggerissen, als Josephs Faust in einem Bogen von unten an seinem Kinn gelandet war. Sie hatte gehört, wie seine Zähne knirschten, und das Gebrüll der Menge hatte beinahe das Dach des Schuppens angehoben, in dem der Boxkampf stattfand. Das Bier floss in Strömen, ebenso wie das Blut aus Mr Knuckles’ Mund. Clem dachte, dass er sich bestimmt auf die Zunge oder in die Lippe gebissen hatte. Die Leute waren außer Rand und Band.
Clem blickte zu ihrem Vater, der gerade eine Flasche ansetzte, um die letzten Reste Schnaps daraus zu trinken. Er sagte oft, dass er unten auf dem Glasboden nach ihrer Mutter suche, aber Clem verstand nicht ganz, was er damit meinte. Unter dem gleichen Vorwand suchte er in ihrem Gewinn nach dem Glück und hielt Ausschau nach dem Diamanten, der so groß war wie eine Kastanie.
Er wirkte zufrieden, wie er seine Ballade herausbrüllte, aber sie konnte sich nicht erinnern, wann er das letzte Mal wirklich glücklich ausgesehen hatte. Sie wollte nicht, dass er sie hochhob, so tat, als ob alles in Ordnung sei, und ihr dabei seinen Whisky-Atem ins Gesicht blies. Das war immer, wenn er eine Flasche ausgetrunken und weder das Glück noch ihre Mutter darin gefunden hatte. Dann weinte er, umarmte sie und sagte, wie leid es ihm täte, dass er ihr so ein schreckliches Leben zumutete. Er versprach, alles wiedergutzumachen, gelobte Besserung, was ihm für ein paar Tage auch gelang, aber dann holte ihn sein Schatten – wie Joseph One-Shoe es nannte – wieder ein.
Clementine schlüpfte aus ihrer kargen, kleinen Hütte, deren Einrichtung nur aus zwei Betten und ein paar zusammengehämmerten Regalen bestand. In dem sogenannten Zuhause hatten sie den Wüstenwinter erlebt, und in den Nächten hatte ihr Atem weiß vor ihrem Mund gestanden. Fasziniert hatte sie ihn betrachtet, und der Gedanke, dass der Dunst ihr Lebensatem war, der sich in nichts auflöste wie ihre Mutter, hatte sie von der Kälte abgelenkt und fasziniert. Joseph One-Shoe hatte ihr versichert, solange sie sehen könnte, wie dieser Dampf ihren Mund verließ, könnte sie alles erreichen, was sie sich vornähme.
Clementine wünschte sich, dass ihr Vater so mit ihr reden würde. Früher war das so gewesen, aber jetzt starrte er nur noch in ein schwarzes Loch der Trauer, in das er all seine Lebenskraft, seine Hoffnung, seinen Sinn für die Zukunft und seine Begeisterung für das Leben schüttete. Für Clementine blieb nur Leere. Sie versuchte, sie mit fröhlichem Geplapper zu füllen, mit Liebe und Zuneigung, aber sie bekam nicht viel dafür zurück. Ein leichtes Lächeln ab und zu, aber sie spürte, dass er es nur aus Pflichtgefühl tat – weil er ein kleines Mädchen hatte, das in seinem Gesicht etwas anderes sehen sollte als nur den Schmerz.
Der Alkohol betäubte den Kummer, aber ihr Vater war ihr fremd, wenn er betrunken war, und diese betrunkenen Nächte kamen immer häufiger vor. Ihre Rollen waren vertauscht, und immer öfter war sie diejenige, die ihren Vater ins Bett brachte. Heute Abend half Clem Joseph, ihn hinzulegen, aber vorher schwenkte er einen kleinen Stoffbeutel mit Geld.
»Es gehört dir«, sagte er zu seinem Zulu-Freund. »Ich glaube, meinen Anteil habe ich vertrunken.« Sein Kopf sank auf das flache Kissen zurück.
Clementine schmunzelte, wie es eine nachsichtige Ehefrau tun würde. »Er wird jetzt schlafen.«
Im Schein der einzigen Kerze in der Blechhütte ließ Joseph aus dem Beutel fünf kleine Rohdiamanten in seine Handfläche gleiten. Er blickte Clem an.
Sie zuckte mit den Schultern. »Er will sie dir geben. Morgen werdet ihr die Kastanie finden«, sagte sie und tippte sich an die Nase, wie es ihr Vater immer tat.
»Bist du nicht müde?«
Clem schüttelte den Kopf. »Kann ich noch ein Weilchen bei dir bleiben?« Sie blickte sich in der Hütte um. Außer einem Tintenfass, in dem Gänseblümchen standen, die sie gepflückt hatte, gab es keine Dekoration. »Ich will noch ein bisschen in den Sternenhimmel gucken.«
Joseph nickte, und sie folgte ihm nach draußen. Sorgfältig achtete sie darauf, nicht nach seiner Hand zu greifen, so gerne sie es auch getan hätte … nur für den Fall, dass sie jemand beobachtete.
Sie gingen von der armseligen Siedlung in Richtung des Großen Lochs.
Es war eine kühle Nacht. Joseph trug nur seine Stammesdecke, aber Clementine war froh, dass sie sich noch rasch ihren Umhang und ihre Wollmütze gegriffen hatte. »Daddy hat gesagt, es ist die größte, von Hand gegrabene Grube der Welt«, sagte sie.
Der Rand war ab und zu von Laternen beleuchtet. Niemand arbeitete um diese Uhrzeit – außer ihnen waren nur noch ein paar Männer da, die in der Ferne saßen und tranken; sie waren so weit weg, dass sie nicht hören konnten, worüber sie redeten. Jemand zupfte auf einem Banjo, und die melancholische Melodie hüllte sie ein wie eine Decke.
Joseph setzte sich und zog seinen Umhang fester um sich.
»Daddy hat auch gesagt, dass du gerne an unserem Claim Wache hältst.«
»Wir wollen ja nicht, dass jemand unsere Kastanie stiehlt, wenn sie mitten in der Nacht auf einmal aus der Erde kommt.«
»Nein.« Sie lachte. Plötzlich hörten sie Schritte. Jemand hustete. Es war ihr Vater.
»Oh, dieser Staub, der bringt mich noch um«, sagte er laut in ihr behagliches Schweigen hinein.
Clementine kannte keine Welt ohne die Staubwolke, die über dem Großen Loch hing, aber ihr waren die Nächte lieber, weil man sie dann nicht sah; nachts legte sie sich so, sodass sie den Himmel sehen konnte, grenzenlos in seiner unendlichen Schwärze.
»Du hast mich allein gelassen«, jammerte James und hockte sich neben sie.
Clementine kicherte. »Du hast geschnarcht, Daddy. Ooh, sieh mal!« Clementine stupste Joseph an und zeigte zum Himmel.
»Was war da?«
»Eine Sternschnuppe. Daddy, du hast gesagt, wenn man eine Sternschnuppe sieht, muss man sich etwas wünschen.« Sie konnte nicht sehen, wie der Zulu zusammenzuckte, als sie nach seiner großen Hand griff, deren Knöchel immer noch bluteten. Sie ergriff auch die Hand ihres Vaters und legte die Hände der Männer in ihren Schoß.
»Was sollen wir uns denn wünschen, Liebling?«
»Dass wir morgen den großen Diamanten finden.«
Sie kniff die Augen übertrieben fest zusammen und drückte die Hände der beiden Männer so fest, wie sie konnte. »Ihr müsst es euch mit mir wünschen.«
Die beiden gehorchten, und schließlich öffneten alle wieder die Augen.
»Clem, sieh nur, wie hell die Venus ist.«
Damit auch Joseph wusste, wovon die Rede war, zeigte sie auf den Himmelskörper. »Sie wird auch der helle Planet genannt.«
»Komm, lass uns mit dem Astronomie-Unterricht weitermachen, Clem«, sagte ihr Vater. »Kennst du den hellsten Stern am Himmel?«
»Nördliche oder südliche Hemisphäre?«, fragte sie, wobei das schwierige Wort ihr beinahe die Zunge verknotete.
Ihr Vater schmunzelte. »Sei nicht so kokett.«
»Der Nordstern?«, sagte sie unsicher.
»Guter Versuch, Clem, aber der hellste Stern ist der Sirius. Wir können ihn von überall auf der Welt sehen, weil er so funkelt. Da ist er. Er wird auch ›Hundsstern‹ genannt.«
»Warum, Daddy?«