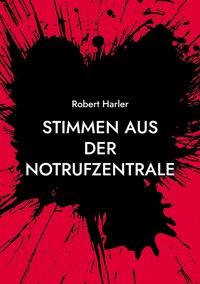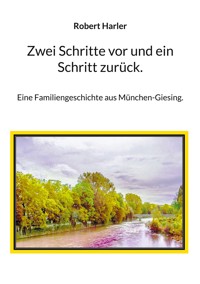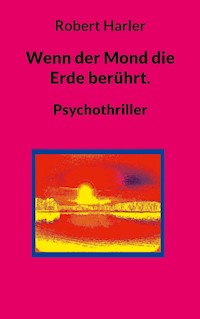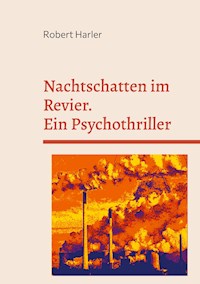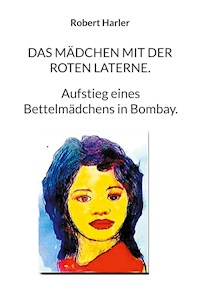
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Laila erblickte in einem kleinen abgelegenen und vom Staat vergessenen Dorf im indischen Staat Maharadscha die Welt. Kein guter Ort, um die Zeit zwischen Geburt und Tod sinnvoll zu gestalten, mit Liebe zu füllen, seine Zukunft zu planen oder der Welt einen Sinn abzugewinnen. Mit vier Jahren, als ihr Bewusstsein erwachte, litt sie unter der zunehmenden Verachtung ihres Vaters. Ihr Erzeuger verzweifelte daran, dass sie als Mädchen auf die Welt kam. Als armer Gerber gab es für ihn keine Möglichkeit, die erforderliche Aussteuer für seine Tochter aufzubringen? Darum versuchte er, sie zu töten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 279
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Robert Harler.
Der Aufstieg eines Bettelmädchens in Bombay.
Roman von
Robert Harler
Alle in dem Buch geschilderten Handlungen und Personen sind frei erfunden Ähnlichkeiten mit lebenden und verstorbenen Personen sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Inhaltsverzeichnis
1. Kapitel- die Kastenlose.
Kapitel 2 - Lailas Dorf.
Kapitel 3 - Lailas Vater Shabnam.
4. Kapitel – der Kastenlose.
Kapitel 5 - Lailas Hütte.
Kapitel 6 - Dorftempel.
Kapitel 7 - Lailas Mutter.
Kapitel 8 - kleine Hütte.
Kapitel 9 – Maria.
Kapitel 10 - der Fluss.
Kapitel 11 - Lailas Brüder.
Kapitel 12 - Gefahren im Wald.
Kapitel 13 - der Affenfänger.
Kapitel 14 - Lailas Tante.
Kapitel 15 - Dreschmaschine.
Kapitel 16 - kein Schulbesuch.
Kapitel 17 - Marias Wohnung.
Kapitel 18 - Lastwagen.
Kapitel 19 - Lailas Geburtstag.
Kapitel 20 - Juhu - Beach.
Kapitel 21 - Lailas erster Job.
Kapitel 22 - Vellya.
Kapitel 23 - Mutters Tod.
Kapitel 24 - Ebbe.
Kapitel 25 – Sunita.
Kapitel 26 - Abendsonne.
Kapitel 27 - zerrädert.
Kapitel 28 - illegale Mieten.
Kapitel 29 - Juni.
Kapitel 30 - Yvonne.
Kapitel 31 - Wachtraum.
Kapitel 32 - kondensierte Wolken.
Kapitel 33 - Sardar.
Kapitel 34 - Mumbai.
Kapitel 35 - Besuch von Sardar.
Kapitel 36 - Weltschmerz.
Kapitel 37 - der glühende Strand.
Kapitel 38 - Bahnhof. Chhatrapati_Shivaji_Terminus
Kapitel 39 - Gateway of India.
Kapitel 40 - Ungerechtigkeit.
Kapitel 41 - Monsun.
Kapitel 42 - wieder allein.
Kapitel 43 - Geeta.
Kapitel 44 - Rama.
Kapitel 45 - Laila und Rama.
Kapitel 46 - Kudis.
Kapitel 47 - Mister Suchander.
Kapitel 48 - König der Bettler.
Kapitel 49 - Hardans Wohnung.
Kapitel 50 - die Reisenden.
Kapitel 51 - Kalkutta.
Kapital 52 - Benares.
Kapitel 53- schlechtes Gewissen.
Kapitel 54 - heimwärts.
Kapitel 55 - Rund um den Hafen.
Kapitel 56-Schwester-Sita.
Kapitel 57 – Sitas Rückkehr.
Kapitel 58 - Elektroautos.
Kapitel 59 - Frühling am Juhu - Beach.
1. Kapitel- die Kastenlose.
Laila erblickte in einem kleinen abgelegenen und vom Staat vergessenen Dorf im indischen Staat Maharadscha die Welt. Kein guter Ort, um die Zeit zwischen Geburt und Tod sinnvoll zu gestalten, mit Liebe zu füllen, seine Zukunft zu planen oder der Welt einen Sinn abzugewinnen.
Sie wohnte als Kastenlose mit ihren Eltern und drei Geschwistern in einer ärmlichen, vom Sturm zerzausten Lehmhütte, am Rande des Dorfes.
Wenn der Wind aus dem Westen wehte, stank es aus dem kleinen Wäldchen, in dem alle Bewohner ihre Notdurft verrichteten, nach Scheiße und Gülle.
An allen Außenwänden ihrer Behausungen pappten die Bewohner mehrmals in der Woche Kuhfladen zum Trocknen. Sobald der Dung an den Wänden alten knochigen Händen ähnelte, diente er als Brennmaterial oder als Heil bringenden Tee.
Auf dem lehmigen, mit vielen Schlaglöchern übersäten rotsandigen Dorfplatz der Gemeinde thronte ein gewaltiger 250 Jahre alter Banyanbaum. Seine verschlungenen, saugarmigen Wurzeln ähnelten lauernden Krakenarmen.
Im Sommer, wenn die glühenden Sonnenstrahlen ungefiltert vom blau wirkenden Himmel brannten, musste der gewaltige Baum anfangs, in der Trockenzeit, um das Überleben kämpfen. Mit dem zunehmenden Alter lernte der Banyan, über seine winzigen Poren in den Blättern, Kohlendioxid aus der Luft aufzunehmen. Daraus produzierte er für das Wachstum Kohlenhydrate.
Seit Generationen versuchten alle Jungen des Dorfes, vergeblich bis an die dünnen Spitzen der Luftwurzeln zu gelangen.
Abgelegen, auf einer, von Parias geschaufelten Hochebene, standen aus rotbraunen Ziegeln aufgeschichtete Häuser. Darin wohnten fünf wohlhabende Brahmanen Familien.
Sie verfügten über beachtliche Ländereien. Alle Dorfbewohner waren direkt oder indirekt von ihnen abhängig.
Mit vier Jahren, als Lailas Bewusstsein erwachte, litt sie unter der zunehmenden Verachtung ihres Vaters. Ihr Erzeuger verzweifelte daran, dass sie als Mädchen auf die Welt kam. Als armer Gerber gab es für ihn keine Möglichkeit, die erforderliche Aussteuer aufzubringen?
Im angetrunkenen Zustand wuchs in ihm das Bedürfnis, sie zu erwürgen oder sie im Fluss zu ertränken. Er fürchtete den Zorn, der Dorfhebamme, die aus dem katholischen Kraal kam, um die Kindersterblichkeit im Dorf zu mindern.
Ihm blieb lediglich, das Töchterchen verhungern zu lassen oder in dem nahen Wald auszusetzen. Eine Tochter konnte er sich als Kastenlose nicht leisten.
Die Hebamme, die Lailas Aufgewecktheit erkannte, versorgte die Kleine jeden Tag mit Nüssen, getrockneten Insekten und Feigen. Ihr Vater wunderte sich, dass seine Tochter keinen von der Mangelernährung ausgelösten, aufgedunsenen Bauch bekam. Um ihr Ableben zu beschleunigen, schickte er sie in den Wald, um Brennholz für die Feuerstelle in seiner Hütte zu holen. Keine Schlange biss sie.
Die beiden Bären, die sich bis zum Dorfeingang heranschlichen, griffen sie nicht an. In seiner Verzweiflung flehte er zu den Göttern Shiva und Ganesha, sie erhörten ihn nicht.
Ihr Erzeuger verstand nichts mehr. Seine Tochter gehörte zu den unbedeutenden Kindern. Sie verfügte über schöne große Kinderaugen. Wenn sie ihn von unten vorwurfsvoll und überlegen ansah, rumorte sein Gewissen. Wieso verfügte sie über die Gabe, ihn geheimnisvoll in die Augen zu schauen?
Trotz aller Demütigungen besaß sie an guten Tagen ein Lachen zum Dahinschmelzen. Alle die kleinen Dorfmädchen verfügten über die Gabe, die Leichtigkeit des Seins in den ersten drei Jahren zu genießen.
Die Gesellschaft, das Kastensystem und die bildungsfernen Väter hindern sie an der Entfaltung.
Lailas Zukunft bestimmte normalerweise ihre Kastenzugehörigkeit.
Mit 4 Jahren ahnte sie nicht, dass außerhalb des Nachbardorfes, die große weite Welt existierte. Für sie bedeutete der Ort ihrer Tante, das Ende ihres Lebensraums. Niemand erklärte ihr die Lichter am Himmel in der unendlichen Weite. Ihr Vater und ihre Mutter interessierten das Weltall nicht. Zu Maria, der katholischen Hebamme versuchte sie, eine töchterliche Bindung aufzubauen.
Wenn in der langen, von hoher Luftfeuchtigkeit durchtränkten Monsunzeit, der Regen aus den bergeähnelnden Wolken plätscherte, besuchte sie mit ihrer Mutter, das Nachbardorf. Für Laila und ihrer Schwester Geeta bedeutete der 8 Kilometer Fußweg eine Reise in die Unendlichkeit.
Um zu heizen und zu kochen, holzten die Bewohner aus den umliegenden Dörfern, den Urwald an den Rändern ab. Im Innern gab es dichte Waldflächen, sodass dort niemand den Himmel von unten sah.
Anfangs scheuten die Mädchen davor, das dichte Unterholz zu betreten. An der Lichtung angekommen, klagte Laila. »Unser Vater hofft, dass uns die Giftschlangen umbringen, um ungestört bis zum Lebensende am Abend, in seinem geliebten Teehaus zu verweilen. Ein aus dem Reservat entlaufender Tiger versuchte sie, von hinten anzuspringen. Zum Glück schrien die Wachtposten der Affen, sodass die Raubkatze verschreckt flüchtete und abdrehte.
Ihren Vater hänselten die alten Männer im Dorf: »Wer war dir bei der Zeugung deines schlauen Mädchens behilflich? Mit ihrer Intelligenz hält kein Dorfjunge mit.
Im Alter wirst du von ihr, statt von deinen Söhnen versorgt! Später erstrebt sie den Posten des Dorfältesten an. »Den absurden Vorschlag strich er sofort aus seinem Gedächtnis. Ausgiebig zeigte er den Anwesenden den Vogel.
Seine Frau, die ihn nie anlachte, sagte mit leiser, überzeugter Stimme: »Das Schicksal schob unsere Laila an die letzte Stelle der Menschheit. Wo sie hingehört! Wenn sie versucht, die gottgegebene Kastenzugehörigkeit zu ignorieren, bestrafen sie die Götter! »
Wenn seine Gattin gescheit daherredete, stieg sein Blutdruck. Sie durfte ihn nicht belehren.
Seit Geeta, wegen ihrer ungenügenden Ernährung abnahm, sah sie nicht mehr wie ein pausbäckiger Engel von Raffael aus. Die beiden Mädchen trugen bis zu ihrem fünften Lebensjahr nichts weiter als ein Schlüpfer artiges, ausgewaschenes Höschen. Damit sie die Stofffetzen am Morgen halbwegs gereinigt anziehen konnte, wuschen sie ihre Unterhosen jeden Abend am Dorfteich.
In den Monaten des Monsuns versuchten beide vergeblich ihre Shorts nachts in ihrer von Schimmel überzogenen, mit Feuchtigkeit übersättigten Hütte zu trocknen. Warum das Vorhaben misslang, konnte ihnen niemand erklären.
Ihr Vater beantwortete keine Fragen seiner unerwünschten Töchter. In allen indischen Orten leben die Menschen in einem überschaubaren nach Kastenzugehörigkeit zugeordneten Gesellschaftssystem. Für die Kinder in Indiens Dörfern zählen die Infektionskrankheiten wie Lungenentzündung, Durchfall, Masern und Tetanus zu den größten Lebensgefahren.
Obwohl Tochter eines Unterklassigen, schienen die Götter Laila zu lieben. Als Mädchen war sie ein nahezu entrechtetes Kind und Opfer einer dreifachen Diskriminierung: Abstammung, Geschlecht und ohne Aussicht auf Bildung. Weil sie mit ihrer Wissbegier ihren Vater überforderte, drohte der wiederholt. »Sie eines Tages als Dekadisch (Sklavin Gottes) einem Gottesdiener mit Tempel als Hure zu verkaufen.
Kapitel 2 - Lailas Dorf.
Mit fünf Jahren erkannte Laila, was sie seit vielen Monaten ahnte. Sie rangierte am Ende ihrer Dorfgemeinschaft. Die Erkenntnis lähmte ihren Geist und ihren Körper. Am liebsten wäre sie im Wald verschwunden und sich, ohne Spuren zu hinterlassen, aufgelöst.
Himmelsleuchten.
Maria, die Hebamme drückte sie: »Du bist kein Kind ohne Verlangen. Du startest vom letzten Platz in der Rangordnung aller Erdenbewohner. Mit der roten Laterne auf dem Rücken. Wenn du die Schmach deines Vaters überwindest und du ihm verzeihst, geht es mit dir aufwärts! Sein Herz ist fundamentiert in der Überlieferung!“
Ihre Mutter erklärte ihr am Abend, als sie ihr vorheulte, dass sie sich ungeliebt fühlt: „Du büßt dafür, dass du im vormaligen Dasein zu viel gesündigt hast! »Sie riet ihr, die Strafe klaglos hinzunehmen, um im nächsten Leben eine höhere Stufe im Kastensystem zu erklimmen.
Das Karma besagt, das der Mensch für seine schlechten Taten aus dem vorherigen Leben büßt. Es ist das Gesetz von Ursache und Wirkung.“
Die Aussage ihrer Mama verschreckte sie. Wieso glaubte sie, dass viele Dorfbewohner mehrmals lebten? Respektlos fragte sie ihre überforderte Mutter. »Ob ein Mensch aus dem Jenseits zurückkam und das Kastensystem bestätigte?
Aus Wut, dass ihre Tochter eine gotteslästerliche Frage stellte, haute sie ihr mit der flachen Hand ins Gesicht. »Sei froh, dass ich deine Gotteslästerung im Dorf nicht weitererzähle!“
Kapitel 3 - Lailas Vater Shabnam.
Lailas Ernährer, der gemäß seiner untersten Rangordnung im Kastensystem, unreine Arbeit verrichten durfte, erbte seine Tätigkeit eines Gerbers vom Urgroßvater und Vater.
Mit 18 Jahren verfügte der kompakte Mann, mit pechschwarzen glänzenden Haaren, über einem muskelbepackten Oberkörper. Die Dämpfe der Gerbsäuren zersetzen allmählich seine imposante Erscheinung. Seine Magenfalten gruben sich jedes Jahr tiefer von der Nase bis zum Mundwinkel ein. Hinzu kam der ständige Ärger mit seiner Tochter.
Shabnam verstand seinen Lieblingsgott Wischnu nicht mehr. Was beabsichtigte er, als er Laila das Gehirn eines schlauen Mannes vererbte. Verzweifelt sagte er zu seiner Frau. »Für ein Mädchen ist unsere Tochter zu intelligent! Was beachteten wir bei ihrer Zeugung nicht? Ich fürchte, dass Krishna als Hirtenjunge sie mit dir zeugte, ohne dass du es merktest! Was für ein Mann heiratet eine zu schlaue Frau?«
Nach einem kurzen Zögern antwortete seine Gattin: »Für ihr stärker werdendes Bewusstsein tragen die Götter die Verantwortung! Sie haben in ihrem Körper eine erfahrene Seele übertragen! «
Sobald Shabnam die Geier am Himmel kreisen sah, rannte er los, um den toten Kühen, Wasserbüffeln oder Antilopen (Schwarzböcke) das Fell abzuziehen.
4. Kapitel – der Kastenlose.
Lailas Vater stank am Feierabend nach Aas und Säure, auch, wenn er frisch gewaschen dem Fluss entstieg. Seine Tätigkeit beschränkte ihn, wie alle Menschen, die einseitig arbeiten und vor Herausforderungen scheuen.
In der Trockenheit, wenn im Dorf, die Arbeit ruhte, arbeitete er nebenbei für den Großgrundbesitzer.
Für ihn reparierte er Wasserkanäle, die das kostbare Nass, zu den Reis-, Baumwolle-, Hirse- und Getreidefeldern führten.
Zum Glück für die Frauen gab es für die umliegenden Dörfer die katholische Ordensfrau und Hebamme Maria. Ihr verdankten viele ihr Leben. Ohne sie wäre Laila kurz nach ihrer Geburt von ihrem Vater ertränkt worden.
Als er sie in den Fluss werfen wollte, sagte sie zu ihm: „An das Geschenk der Götter dürfe er sich nicht versündigen!
Schauen sie, wer über feingliedrige Hände und einer hohen Stirn verfügt, findet einen Weg zum Überleben! Ihre Tochter benötigt keine Mitgift. Es gibt Erdenbürger, die aus ärmeren Verhältnissen, der Sonne entgegenliefen!«
Lailas Erzeuger betrachtete daraufhin Maria ungläubig, mit feindseligen verzweifelten Augen an! »Wie soll die Kleine, mit einem kleinen Mädchengehirn, mit ausgestreckten Armen, in einer korrupten Welt ihren Weg finden? Von Geburt her ist sie, wie der überwiegende Teil der Menschen auf Leiden programmiert!«
Die Hebamme erschrak; über die hasserfüllte Person. In ihrer Verzweiflung drohte sie dem Mann mit der Rache der Götter Shiva, Rama und Wischnu.
Zu Marias Verwunderung schockte ihn die Drohung mit den Göttern, dass er die Ungeliebte in den Schoss ihrer Mutter legte. Nach einigen schlurfenden Schritten drehte er schimpfend seinen Körper: »Als katholische Hebamme, gehörst du aus unserem Dorf vertrieben. Du hetzt die Frauen gegen uns Männer auf, die ohne uns erbärmlich verhungern würden!«
Die Kerle im Dorf störte die Selbstständigkeit der Ordensfrau. Sie qualifizierten die Fremde als Mannweib ab.
Ihr Stammesältester forderte mehrmals bei der Bezirksregierung die Absetzung der Geburtshelferin. Die drohte, ohne sie, sei die Kindersterblichkeit im Dorf zu hoch!
Vor allem sei die Tötung der weiblichen Föten verfassungswidrig. Wegen der zwei Aspekte käme eine Abschiebung der Hebamme nicht infrage. Wenn wir die abziehen, treibt ihr alle weiblichen Embryos ab. Die nächste Generation von Männern bleibt nur der Bordellbesuch bzw. Mädchen aus den anderen Ländern zu importieren!«
Laila wagte die ersten Schritte, als ihre Schwester Geeta die Sonne über den gewaltigen Baum erblickte und gegen ihre Geburtsschmerzen weinte. Ihr Vater drehte aus Enttäuschung durch und warf in seiner Verzweiflung die Neugeborene in den Fluss.
Zum Glück beobachtete Maria, den Vorgang und zog das nackte Mädchen aus dem Wasser.
Mount Everest
Nahezu alle Dorfbewohner billigten die Handlung des Vaters, als gottgegeben. Der Dorfälteste, mit dem er den schwarzgebrannten Hirseschnaps trank, stufte die Tat, als rechtmäßig ein. Bei den älteren Frauen verbreitete sich Unmut. Sie protestierten mit der Hebamme, unter dem stattlichen Banyanbaum.
Alle Männer wunderte die Aufregung wegen einer überflüssigen Tochter: „Die Katholikin wiegelt alle unsere braven Weiber gegen uns auf. Wieso beharrt die Regionalregierung auf ihren Verbleib. Wozu verteile sie jeden Freitag Kondome? Sie will, dass unser Dorf ausstirbt! Wer soll im Alter für uns sorgen? Der ungerechte Staat zahlt uns keine Rente!«
Nach weiteren zehn Monaten des Hoffens und der Gebete an Shiva und Hanuman gebar Lailas Mutter endlich den ersehnten Sohn. Der Gerber kletterte unter großer Anteilnahme seiner Kumpels auf den heiligen, in den Himmel wachsenden Banyanbaum und schrie seinen angestauten Frust wiederholt hinaus.
Vor Begeisterung geriet er in Ekstase und fiel wie ein nasser Sack vom Baum. Weil seine Zechkumpane damit rechneten, fingen sie ihn unten mit einem gespannten Jutesack auf. Nachdem er zu sich kam, holte er den nackten Jungen, der neben seiner Mutter auf einer Strohmatte lag.
Auf dem Dorfplatz zeigte er allen Anwesenden mit Tränen in den Augen den Neugeborenen. In diesem einen Moment überschauerte ihn das größte Glück der Erde.
Von allen Seiten kamen die Unberührbaren herbei, um den gedemütigten Vater zu beglückwünschten.
Die Frauen der Unterschicht fertigten mehrere Kränze aus gelben Ringel- sowie bunten Wiesenblumen und schmückten damit den Eingang seiner Hütte.
Wie ein Olympiasieger genoss er seine Aufwertung.
In den nächsten Wochen feierte er seine Männlichkeit ausgiebig beim Reiswein und beim Hirseschnaps im Teehaus.
Das verlorene Lächeln, seiner jungen Frau kehrte allmählich zurück. Es schnitzte ihr, ihre verschollenen Grübchen ins wieder ins Gesicht. Ihr Mann behandelte sie menschlicher. Manchmal holte er sich das Essen vom Tisch. In den kommenden Jahren wertete sie die Anerkennung der anderen Ehefrauen auf. Die duldeten endlich, dass sie mit ihren Kindern überall hingehen gehen durfte. Von da an wagte sie, ihm zu widersprechen und ihn vor dem vielen Alkohol zu warnen.
Die vollkommene Achtung der Dörfler erlangte Dhoba nach der Geburt des zweiten Sohnes. Aus Begeisterung genoss ihr Gatte seine Glückshormone mit den gebrannten Schnäpsen des Dorfältesten in der Teestube.
Wiederholt feierte er das Ereignis mit seinen Spießgesellen bis zur Bewusstlosigkeit. Eine züngelnde unbewusste Todessehnsucht trieb ein Großteil der Männer dazu, sich allen möglichen Anlässen zu betrinken. An Feiertagen verstarb einer aus dem harten Kern an dem unausgegorenen Alkohol.
Lailas Mutter und ihre Leidensgenossinnen rätselten darüber, warum Männer saufen. Wollen sie spüren, wie die Erde ihre Bahnen zieht? Ertragen sie das Leben ohne Stoff nicht?
Mit größter Wahrscheinlichkeit erleben sie in der Übergangsphase zum Besoffensein ein Glückserlebnis.
Kapitel 5 - Lailas Hütte.
Als Laila ein streunender Hund auf dem Dorfplatz, unter dem monströsen Banyanbaum am rechten Bein pinkelte, vergaß sie ihre Erziehung und alle Drohungen ihrer Mutter. »Füge niemanden ein Leid an. »
Sie fühlte sich von dem Tier unendlich gedemütigt. Hinzu kam die Wut, dass ihre Eltern ständig an sie herummäkelten. Frustriert trat sie den Köter barfüßig in den Allerwertesten. Wutschnaubend schwor sie, gegen alle Widrigkeiten des Lebens anzukämpfen.
Es gefiel ihr wie der Hund sie nach ihrem Tritt, ergeben anjaulte und davonschlich.
Ihre Mutter, die den Vorfall beobachtete, schlug ihr mit der flachen Hand ins Gesicht: »Wer ein Tier quält, der tötet eines Tages Personen. Zur Strafe wirst du als Wurm wiedergeboren! »
Den Satz hörte sie von ihr. Wenn sie die Hühner nicht versorgte. Wenn sie den Hof nicht fegte. Wenn sie das Getreide nicht ordentlich schrotete. Wenn sie beim Wasserholen zu lange trödelte. Wenn sie zu ungeduldig mit ihren jüngeren Geschwistern umging.
Gegen morgen träumte sie, dass sie eines Tages das Fliegen lernte. Ihre positiven Träume ließen sie die Demütigungen ihrer Familie ertragen.
Seit ihrem dritten Lebensjahr musste die ungeliebte Tochter, barfüßig, mit ihrem Höschen bekleidet, Wasser aus dem Dorfbrunnen der Parias holen. Mit dem Tonkrug auf dem Kopf balancierte sie wie eine kleine Prinzessin, durch den rotbraunen mineralhaltigen, angerosteten Staub.
Da sie selten die ausgetretenen Pfade entlanglief, steuerte sie, die vom Wind angehäuften Staubhügel an und wirbelte den Sand mit ihren Füßen empor. Die Frauen, aus den nahe gelegenen Hütten fluchten, wenn der feine Sand, ihre Türen, Fenster und Atemwege verdreckten.
Damit sie den Unsinn einstellte, verprügelte ihr Vater sie, sodass sie eine Woche, mit angeschwollenen blauroten Wangen herumlief.
Weitab von ihrem Dorfviertel gehörte den Brahmanen ein eingezäunter, bewachter Brunnen. Sie befürchteten, dass die Unberührbaren durch ihren Schatten, ihr Wasser verseuchten. Damit sie mit ihnen nicht in Berührung kamen, bauten sie ihre prunkvollen Anwesen auf die Südseite der ersten Hügelkette in Hufeisenform auf.
Um den Wert der Häuser und ihre Erhabenheit zu demonstrieren, ließen sie ihre Behausungen außen hellblau tünchen.
Vor dem Eingang stand ein kleines Häuschen, in dem die Wachposten Tag und Nacht standen.
Aus ihrer Zisterne förderte eine mit einem Dieselmotor angetriebene Wasserpumpe, das begehrte Nass in ihr Tonröhrensystem. Von dort floss es zu den einzelnen Feldern.
Auf dem Dorfplatz wuchsen in größeren unregelmäßigen Abständen Palmen, deren untere Blätter, als Sonnenschutz für die Hütten im Sommer dienten.
In der erbarmungslosen Hitze glichen die kahlen Äste unterernährten Beinstümpfen.
Unter der Pagode, rechts vom Tempel lächelte der in Sandelholz geschnitzte Elefantengott Ganesha. Je nach Gemütsverfassung seiner Verehrer wirkte er auf die Betrachter gütig oder verächtlich.
Laila glaubte, dass er sie gutherzig anlächelte. Dankbar grinste sie zurück. Es konnte nicht schaden. Obwohl sie den Tempel als Unberührbare nicht betreten durfte, spürte sie einen unbändigen Drang, die Schwelle zu überwinden. Als alle Frauen und Kinder auf den Feldern arbeiteten und die Männer in der Teestube saßen, schlich sie durch den Hintereingang in die Kirche.
Vor Ehrfurcht erstarrte sie zu einer Säule. Ihr Blutdruck stieg an, als wollte er ihre jungen Adern sprengen. Mit jedem Schritt, den sie voranging, spürte sie, wegen ihres Herzrasens, die Enge ihres Körpers.
Die weißen Wände des runden Bethauses wiesen bemalte Gottheiten mit geflochtenen Ringelblumen auf. Aus den Ritzen des Mauerwerkes roch es penetrant nach Weihrauch.
Ein- bis zweimal im Monat las der Pastor, in dem mit einem Weidezaun eingegrenzten weitläufigen Hof, seinen Gläubigen; heilige Verse vor. An Feiertagen traten dort reisende Gruppen auf, die ihre regionalen Tänze vorführten.
Wenn ihr Vater in der Teestube hockte, kletterte Laila mit zwei Nachbarsjungen oft auf den Banyanbaum.
Es gefiel ihr, wenn der Priester das Liebeslied über den Gott Shiva und seiner Frau Parvati vorsang. Die Legende rührte sie in den jungen Jahren, zu tränen. Mit zunehmendem Alter fand sie die langweilig.
Kapitel 6 - Dorftempel.
Der Hindutempel ragte zehn Meter in die Höhe. Von der vergoldeten Kuppel hingen seitwärts die ausgebleichten Kupferbleche. Die hohe Eingangstür, die aus rissigen, zerfaserten Bohlen bestand, knarrte bei jedem Windstoß.
Das massige, klobige Gebäude setzte sich aus gebrochen aneinander gemauerten Felsbrocken, die nach jedem Monsun oberhalb des Fundamentes abbröckelten, zusammen.
An manchen Tagen diente der Tempel als Mehrzweckhalle für Versammlungen als Tagungsstätte für die Dorfältesten und als Unterkunft für die von Ort zu Ort ziehenden Sadhus.
Seit ihrem dritten Geburtstag durfte Laila mit den Frauen zum Koten und Strullen morgens in den westlich gelegenen, vollgekackten Buchenhain gehen. Nach Beendigung der Notdurft tauchten alle, ihre linke Hand in die mitgebrachten Wasserbehälter. Mit den nassen Fingern wuschen sie ihre After aus.
In der matten Abendbeleuchtung wirkten die vielen Gruppen aus der Entfernung wie Scherenschnitte. Für die Männer im Dorf handhabte sich die Entleerung einfacher. Sie drückten ihre Kothaufen auf die Felder. Alle urinierten wie die Hunde gegen Bäume und Wände, indem sie eine Seitenfalte ihrer Dhotis öffneten.
Das dahinplätschernde Dorfleben bestimmte der Rhythmus der Landwirtschaft.
In der großen Sommerhitze ernteten die Frauen alle Gemüse-, Reis- und Getreidefelder ab. Die harte Arbeit, die Hitze und die mangelnde Ernährung, ließen die Arbeiterinnen, schneller altern. In den Dörfern, die wirkten, als wären sie von der Welt abgeschnitten, fehlte es vor allem an dem nötigen Knowhow.
Die meisten Bewohner arbeiteten für den reichsten Landwirt. Wenn der Monsun ausblieb, starben viele Alte und Kinder an Unterernährung.
Lailas Vater gehörte ein kleines Stück Land, sieben Hühner und vier Ziegen.
In der Erntezeit arbeitete ihre Mutter für die vier Großbauern in der Umgebung.
Ihr Vater zog den verendeten Rindern oder Ziegen, in der Umgebung die Felle ab, um die zu gerben.
Mit fünf Jahren musste Laila in der Ernte- und Pflanzenzeit ihr 50 Quadratmeter große Stückchen Land beackern, bepflanzen, bewässern und vom Unkraut befreien.
Nachdem sie den kargen, mit zermahlten Felsspalt angereicherten Boden, mit einer kleinen Hacke bearbeitete, verteilte sie darauf Kuh-, Ziegen- und Hühnermist. Sie stach mit einem Stock in einem Abstand von drei und fünf Zentimetern Löcher in den Boden.
In die steckte sie Mais-, Getreide- und Linsenkörner. Für jede Pflanze, die zu dicht aus dem Boden spross, schlug ihr Vater sie, sodass ihre Wangen blau anschwollen.
Ihrer viel zu unterwürfige Mutter erregte die Bestrafung ihrer Tochter. Sie durchbrach ihre unendliche Duldsamkeit gegenüber ihrem Gatten und hielt seine schlagende rechte Hand zurück: »Du erschlägst mir das schlauste Kind im Dorf!«
Vor Schreck, dass seine Frau aufbegehrte, trat er sie in den Allerwertesten. In den nächsten Tagen liefen Mutter und Tochter vor Qualen mit schmerzverzerrten Gesichtern umher. In der kommenden Woche konnte seine Frau nicht mehr auf den Feldern arbeiten. Es gab weniger zu essen und die geringfügige Nahrung, durften ihr Vater und ihre Brüder vertilgen.
Wenn der launige und unzuverlässige Monsun verspätet niederprasselte oder ausblieb, vertrockneten die meisten Pflanzen auf den Feldern und Kleingärten. Über eine von Dieselmotoren angetriebene Wasserpumpe, wie die Großbauern sie besaßen, verfügten die Unberührbaren nicht.
Allen Kastenniedrigen fehlte das Fachwissen, um die Motoren zu pflegen, instand zu halten und zu reparieren. Um nicht zu verhungern, blieb vielen keine andere Wahl, als die Flucht in die Slums der Großstädte.
Wie vor vierhundert Jahren zogen die Zebuochsen und die Wasserbüffel die spartanischen Holzgabelpflüge sowie die knarrenden Ochsenkarren. Den halb nackten Kindern fehlte aus Mangel an Vitaminen und ausreichender Nahrung der Übermut.
Der Dorfschmied hämmerte nach wie vor, kleine, große Sensen und Messer aus Eisen zum Schneiden von Ähren, Stroh, Zuckerrohr und Gras. Wie eh und jäh arbeiteten die Frauen und Mädchen in ihren gerafften Saris, auf den Feldern oder vor ihren armseligen Hütten.
Die Männer liefen wie früher mit dem hässlichsten, dem praktischen Kleidungsstück der Welt, dem Dhoti, umher. Der besteht aus einem weißen Baumwolltuch, das sie um Gesäß und Beine schlingen. Ein undefinierbarer Mix aus Lendenstück, Rock, Hose und Schürze.
Zur Unterstreichung ihrer Männlichkeit tragen heute die meisten Dörfler einen Schnurrbart und einen, vor der Sonne schützenden Turban.
Die Ochsen zogen wie zu damaliger Zeit, den am Hanfseil hängenden Ziegenledersack, aus dem 50 bis 200 Meter tiefen Brunnenschacht, über eine heiß laufende Holzrolle nach oben.
Dort klinken Helfer den Sack aus der Halterungsöse, um das Nass in den Verteilergraben zu kippen.
Kapitel 7 - Lailas Mutter.
Lailas Mutter wirkte trotz ihrer 30 Jahre wie eine Kindfrau. Ihre Weiblichkeit wuchs durch die frühen Geburten nicht aus.
Die Tochter eines unberührbaren Wanderarbeiters kam aus dem größeren Nachbardorf. Ihre langen schwarzen Haare knüpfte sie wie alle Bewohnerinnen zu einem langen Zopf.
Ihr verwurzelter Glaube suggerierte ihr ein besseres Leben nach ihrem Tod. Seit ihrer Kindheit schuftete sie auf den Feldern.
Mit 15 Jahren verheiratete ihr Vater sie, mit dem Sohn eines Gerbers aus der Nachbarschaftshütte.
Filme, Bücher oder Fernsehsendungen, die eine heile Welt Vorgaukeln oder von Helden, die das Schreckliche vernichteten, kannte sie, als Analphabetin nicht.
Sie glaubte, dass über Gut und Böse die Götter entscheiden würden.
Mit einer tiefen Sorgenfalte erblickte sie die Welt.
Shoba wunderte sich, dass ihre Laila über keine verfügte.
Ihre Tochter rebellierte im Mutterleib durch heftiges Treten gegen die Widrigkeiten des Lebens. Es beunruhigte sie, dass ihre Kleine mit zunehmendem Alter, ihre Bestimmung ignorierte.
Wohin führte ihre Entwicklung? Wie konnte sie in der Welt von Freud, Leid und Missgunst überleben?
Nach ihrer Zwangsverheiratung erlitt Shoba mit 15 Jahren ihre erste Fehlgeburt. Für ihren Mann, der in der Dorfgemeinschaft mit seiner Potenz prahlte, bedeutete das vorzeitige Sterben, des Stammhalters eine Abwertung seiner Manneskraft.
Shoba
Jede Schwangerschaft erlebte sie anders. Ihre Laila komplizierte sie mit ihrer Ungeduld. Scheinbar litt sie in der Enge des Mutterleibes.
Geeta, ihre zweite Tochter bemerkte sie erst ab dem achten Monat. Ihre Söhne ließen sie zum Skelett abmagern, weil sie sich nur von einer Hand voll Reis ernährte.
Zum ersten Male erlebte sie glückliche Momente, als sie ihre beiden Jungs gebar. Sie genoss es, dass ihr Mann, vor Begeisterung weinte.
Vor dem Zeugen der Jungen schmückte Shoba, ihr dürftiges Bettenlager mit Ringelblumen. Ihr Mann und sie standen morgens auf und badeten im seichten Fluss.
In dem Gewässer spülten sie ihre Münder mit Sesamöl aus und rieben ihre Körper mit Butterfett ein. Mit diesem Ritual wollten sie die Geburt eines Sohnes erzwingen.
In jungen Jahren beobachtete Lailas Mutter im Wald mit ihrem Vater über eine längere Zeit ein Tigerweibchen mit drei Jungen.
Es faszinierte sie wie das Tier seine Existenz, dem Nachwuchs widmete. Instinktiv handelte sie nach der Geburt ihrer beiden Söhne genauso.
Auf den großen Feldern des Patrons säte sie mit den anderen Frauen von Hand, Weizen, Baumwolle, Möhren, Blumenkohl, Hirse und Zuckerrohr.
Zur Erntezeit schnitt sie mit einer kleinen Sense im Akkord die reifen Reiseähren, die faserigen Zuckerrohrstangen ab.
Beim Großgrundbesitzer grub sie die Kartoffel und Möhren mit bloßen Händen aus der Erde.
Kapitel 8 - kleine Hütte.
Vor Sonnenaufgang und nach Feierabend versorgte Shoba ihre Familie. Zwischendurch wusch sie die armselige Wäsche am Ufer des Flusses. Abends reinigte sie die kleine Hütte, holte Äste aus dem Wald, schrotete die vom Großbauern als Lohnersatz erhaltenen Hülsenfrüchte sowie Reis- und Getreidekörner.
Mit zunehmendem Alter genoss sie innerlich, wenn ihr Gatte in der Dorfteestube saßt, um den vom Wirt gebrannten Schnaps zu trinken. Sie schauderte vor seinen Berührungen.
Nachdem ihr Mann wegen einer Alkoholvergiftung im Sterben lag, sehnte sie seinen Tod herbei.
Die drei Wochen, in denen er mit dem Ableben rang, gehörten zu den schönsten in ihrem Leben.
Laila blühte auf und sie tanzte mit den anderen Kindern auf dem Dorfplatz »Ringelrein«.
Statt aus der Strafe Gottes zu lernen, wie der Dorfpriester die Alkoholsucht Shabnams nannte, trank er nach seiner Gesundung weiter.
Jeden Abend kochte Shoba Dahl, Reis oder Hirse mit viel Curry und Ingwer.
Lailas Eltern besaßen sechs Hühner, einen Hahn, zwei Ziegenpärchen und einen kleinen Garten. Indem pflanzte ihre Mama Kartoffeln, Zwiebeln, Möhren und Gewürze.
Mit zweieinhalb Jahren musste Laila, wenn ihre Mutter auf den Feldern arbeitete, die Versorgung der Tiere übernehmen. Mit drei Jahren kamen das Schroten und das Malen des Getreides, der Hülsenfrüchte sowie das Säubern der Hütte hinzu.
Im Zuge der Landreform bekam ihr Großvater vor 30 Jahren zwei Hektar Boden zugeteilt. Wie ein stolzer Hahn auf dem Mist krähte er durch das Dorf, als ihm seine Frau nacheinander drei Buben gebar. Er verzweifelte, als drei Mädchen folgten. Sein Herz takte aus dem Rhythmus, als er für die Brautausstattung der Töchter die Hälfte des Landes verkaufen musste. Seine Söhne teilten nach seinem Ableben das Grundstück auf, um auf ihrem Erbe jeweils eine Hütte zu errichten. Das zerfledderte Land konnte keine der neuen Familien ernähren.
Vaters Brüder gaben auf, verkauften die kleinen Liegenschaften und wanderten mit ihrem Anhang in den größten Slum von Bombay.
Seitdem beherrschte die Angst, die kleine Dorfgemeinschaft.
Kapitel 9 – Maria.
Mit vier Jahren besuchte Laila regelmäßig die Hebamme Maria, die in der Nähe der Brahmanen Behausungen wohnte. Die liebte das lebendige Mädchen, mit Augen, die wie Fackeln leuchten konnten.
Bei ihrem ersten Besuch blubberte Lailas Herz vor Angst.
Ihre Schüchternheit ließ sie zu einer lang gezogenen Holzfigur erstarren und ihre Hände zitterten. Beruhigend strich ihr die gütige Geburtshelferin über die schwarzen Haare: »Laila, ich hoffe, wir erleben eine angenehme Zeit miteinander.«
Nach ihrer Zuwendung gab sie der Besucherin ein Glas mit Lassiejoghurt. Marias Liebenswürdigkeit saugte aus dem verschüchterten Mädchen alle aufgebürdete Scheu.
Endlich blickte sie zu jemand auf, der er es wohlwollend mit ihr meinte, und der versuchte, ihre vielen Fragen zu beantworten. Ihr Vater schlug sofort zu, wenn sie ihn fragte und schrie: »Als Mädchen, musst du das wissen, was dir deine Mutter beibringt.
Mehr verlangt keiner von dir! Mit deiner Mitgift und der deiner Schwester bin ich genug bestraft.«
Die ständigen Demütigungen brachten Laila seelisch und körperlich aus dem Gleichgewicht. Ihr aufrechter stolzer Gang verkümmerte allmählich. Unbewusst schlüpfte sie in die gebeugte Haltung von alten Frauen. Maria päppelte sie psychisch und physisch auf. Nachdem sie ihr versprach, das Lesen und das Schreiben beizubringen, weinte das ungeliebte Kind Freudentränen. Ihrem Vater zahlte die Hebamme für Lailas Unterstützung im Haushalt, zwanzig Rupien am Tag. Begierig nahm er das Geld für seinen abendlichen Teestubenaufenthalt an.
Der katholische Orden versetzte Maria vor einigen Jahren in das auf Tradition bedachte, stromlose Dorf.
In dem strengen, überlieferten, hinduistischen Gesellschaftssystem störte sie die Ordnung.
Das Feindbild, das die Männer Aufschichteten, zerbröselte allmählich.
Der Ordensfrau gelang zunehmend, das Immunsystem vieler Kinder, die an Unterernährung, Vitaminmangel, Röteln, Keuchhusten und Tetanus erkrankten, durch ihre ayurvedischen Anwendungen zu heilen.
Zwar verunglimpften die Medizinmänner Maria. Über die Hebamme verbreiteten sie erfundene Horrorgeschichten.
Eine besagte, dass sie den kleinen Jungen nach der Geburt den Samenstrang durchtrennte. Als der Medizinmann an seine Grenze stieg und die Gebärende vor der Geburt verstarb, rette Maria das Leben des Kindes. Seitdem gewann sie bei den älteren und einflussreichen Frauen an Ansehen.
Statt die Wunderheiler aufzusuchen, kamen die Kranken und deren Angehörige in ihrer Not zu ihr.
Ihre wabernde Mütterlichkeit hob ihre kompakte Figur hervor. Ihr warmes vertrauensvolles, rotwangiges Gesicht rahmte ihre offenen schwarzen langen Haare ein. Sie ruhte in einer Mischung aus Güte und Entschlossenheit.
Weil der armen Breitenschicht das Geld für die chemischen Medikamente fehlte, praktizierte Maria die tausend Jahre alte indische Ayurveda-Medizin.
Nach ihrer Ankunft pflanzte sie die wichtigsten Kräuter, mithilfe von Laila an. Im Wald sammelten die beiden Wurzeln, Blüten und Rinden und an den Rändern der Felder. Die setzte die Ordensschwester bei Malaria, Durchfällen, Kreislauferkrankungen, Infektionen, Erschöpfungen und Entzündungen ein.
Die alten Männer, die sie anfangs am stärksten bekämpften und verleumdeten, suchten sie durch ihre altersbedingten Krankheiten häufiger auf.
Kapitel 10 - der Fluss.
Seit ihrem vierten Lebensjahr liebte Laila den Fluss, der ihr Dorf wie einen gespannten Flitzbogen umkurvte. An seinem Ufer spürte sie das pulsierende Leben und die fließende, nicht aufzuhaltende Zeit. Durch gezieltes Ein- und Ausatmen versuchte sie, ihre verkümmerten Energien aufzutanken.
Nachdem die Hebamme ihr erklärte, dass der Fluss in den Ganges mündete, verstärkten sich ihre angeborenen Sehnsüchte nach Veränderungen und ihre Träume vom Fliegen.
Während der Zeit des Monsuns bewunderte sie seine geballte, reißerische und zerstörerische Kraft. Ihr schien es, als könne er die notwendigen Veränderungen im Dorf, durch seine Zerstörungen, anschieben. Wenn die Pfauen mit ihrem quakenden Geschrei ihre radschlagende Balz ankündigten, hofften alle Dorfbewohner, dass der Monsun endlich das ausgedörrte Land überflutet. Kommt der Tropensturm verspätet, wie im letzten Jahr, verbrennt die Saat. Plätschert der Niederschlag zu heftig und zu lange, spült er die Körner fort.
Flutet er wie kleine Sturzbäche vom Himmel, saugt die verkrustete, verhärtete Erde, die Wassermassen nicht auf.
Die kleinen Bäche und der anschwellende Fluss trieben alle Hindernisse fort, wickelte sie um Bäume oder karrten sie vor die Hütten.
Die Alten im Dorf erzählten wiederholt, obwohl die Zuhörer die Geschichten alle kannten, dass der Himmel vor zwanzig Jahren zur Monsunzeit sich pechschwarz färbte.
Die gestandenen Männer auf den Feldern bekamen es mit der Angst zu tun. Heute bleibt der Monsun jenseits der 1500 Meter hohen Berge hängen. An den Felsen verweilten die üppigen Wasserschwaden gleich gefüllten Fischernetzen am Himmel.
Wir müssen uns Jahr für Jahr mit den Wolken begnügen, die über die Bergketten ziehen. »Der Klimawandel, ausgelöst durch die Globalisierung hungert uns aus«, klagte der Dorfälteste. Je höher die Tagestemperaturen anstiegen, so lauter zirpten die Grillen.
Wenn die Materhitze die 40-Grad-Marke überschritt, drehten viele Dorfbewohner, die an Unterernährung litten, durch. Viele Kreislaufkranke starben vorzeitig und manche Alkoholiker führten Veitstänze auf. Nachdem endlich Sturmböen einen Himmel voller Regenwolken, zu den ausgedörrten Feldern schoben, blieb die Zeit einen Atemzug lang stehen. Binnen Stunden sah die Tiefebene, auf der die Behausungen der Parias standen, wie ein riesiger Stausee aus.
Die Ausgegrenzten retteten verzweifelt ihre kargen Armseligkeiten aus ihren Hütten.
Aus Sicherheitsgründen schlugen sie auf dem Dorfplatz ihr Lager auf. Die Kobras, die das Wasser aus ihren Löchern spülte, suchten auf dem Hügel, ein trockenes Plätzchen. Auf den Hügeln prügelten Lailas Vater und seine Saufkumpane sie mit Dreschflegel in die steigende Flut.