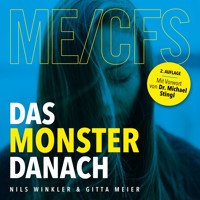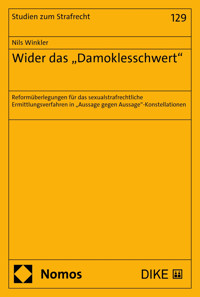9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Millionen Menschen weltweit leiden an ME/CFS, das auch Chronisches Fatigue Syndrom genannt wird. ME/CFS ist eine postvirale Erkrankung, die auch nach einer Covid-Infektion häufig auftritt. Es ist die schlimmste Form von Post Covid bzw. Long Covid. Die Fallzahlen sind seit der Pandemie explodiert. ME/CFS ist „Das Monster danach“ – die schlimme Langzeitfolge einer akuten Erkrankung und kann jeden treffen. Im Buch wird die Krankheit verständlich und leicht lesbar erklärt. Das notwendige Basiswissen für Gespräche mit Ärzten wird ebenso vermittelt wie Hilfe für soziale Fragen, wie die Anerkennung einer Behinderung, Reha oder Rente. Es ist ein leichter und kompakter Einstieg ins Thema für Betroffene und Angehörige, aber auch für behandelnde Ärzte und medizinisches Personal. Und das auf dem Stand der Wissenschaft. -Woran erkenne ich, dass ich ME/CFS habe? -Was ist dabei zu beachten? -Wie kann ich mit der Krankheit leben und mit Behörden und Leistungsträgern umgehen? -Vielleicht die wichtigste Frage: Was bedeutet die Diagnose überhaupt? Und was hat das mit Covid zu tun? Abgerundet wird das Buch durch zahlreiche Interviews mit Betroffenen, die das abstrakte Wissen über die Krankheit anschaulich und greifbar machen. Die erste Auflage des Buches, 2022 erschienen, war schnell ein Erfolg. Über 7000 verkaufte Exemplare sprechen für sich. Ebenso die vielen positiven Stimmen, wie diese von Grit: „Ich wusste zwar schon vorher einiges, aber Euer Buch hat Lücken gefüllt und meine Expertise definitiv erweitert. Vieles, was ich schon zu wissen glaubte, hat sich bestätigt und gefestigt. Ein gutes Gefühl, so wertvoll!“ Die zweite Auflage wurde vollständig überarbeitet und um weitere Kapitel und Interviews ergänzt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
2. Auflage, 2025
© Nils Winkler Redaktionelle Bearbeitung und Herausgeber: Maren Winkler
Lektorat: Amancay Kappeller
Satz & Layout: DNGL Media GbR, 20457 Hamburg
ISBN: 9783759293350
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Autor verantwortlich.
Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig.
Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag des Autors, zu erreichen unter:
Nils Winkler Lottbeker Weg 79 D-22397 Hamburg
Die Autoren
NILS WINKLER, Jahrgang 1974, ist eine „Kieler Sprotte“ und ausgebildeter Redakteur mit jahrzehntelanger Erfahrung sowohl als Journalist (u.a. für Radio NORA, den Norddeutschen Rundfunk und die ddp Nachrichtenagentur) als auch im Management im Bereich digitaler Medien und Zahlungssysteme (bei ADTECH, Yapital, Hi-Media oder FirstData). Er leidet seit dem Frühjahr 2020 selbst an ME/CFS, als Folge einer COVID-19-Erkrankung.
GITTA MEIER, Jahrgang 1974, stammt aus Bremerhaven und ist in Kiel aufgewachsen. Nach ihrer Ausbildung zur examinierten Gesundheits- und Krankenpflegerin arbeitete sie an Kliniken in Schleswig und München. Es folgte ein Studium der Humanmedizin am Universitätskrankenhaus Eppendorf (UKE) in Hamburg, wo sie 2011 ihr Staatsexamen ablegte. Sie lebt in Berlin und arbeitet als Ärztin in der ambulanten Versorgung in den Fachbereichen Innere Medizin und Allgemeinmedizin. Heute arbeitet sie festangestellt in der Arbeitsmedizin.
Vorwort von Dr. Michael Stingl
ME/CFS wurde in den letzten Jahren durch die Überlappung mit Long Covid sichtbarer, merkliche Verbesserungen für die Betroffenen lassen aber leider weiterhin auf sich warten.
Dabei weist die Diskussion um Long Covid durchaus Parallelen mit ME/CFS auf, wo in den letzten Jahrzehnten eine vorwiegend psychiatrische Einordnung vorherrschend war. Diese ist zwar im Lichte der laufenden Forschung zur Pathophysiologie von ME/CFS nicht mehr haltbar, manche Dogmen sind aber hartnäckige Begleiter.
Es fehlt weiterhin an banalsten Dingen. Fehlende medizinische Aus- und Weiterbildung führt zu oft noch fehlender Akzeptanz von ME/CFS und falscher Behandlung sowie Stigmatisierung. Anlaufstellen, wo nach aktuellem Wissensstand gearbeitet wird, sind ebenso rar wie ein verlässliches Verständnis des Schweregrads der Erkrankung im gutachterlichen Bereich.
In dieser Versorgungslücke findet die Selbsthilfe ihren wichtigen Platz. Dass Menschen mit ME/CFS oftmals bestens über ihre Erkrankung informiert sind, ist keine Neuigkeit mehr. Dass diese Information meistens selbst erarbeitet werden muss und nicht aus der ärztlichen Betreuung erwächst, ebenso.
„Das Monster danach“ von Nils Winkler und Gitta Meier gab bereits in der ersten Auflage eine wertvolle Hilfe zur Selbsthilfe. Das Buch liefert eine Übersicht über Symptome von ME/CFS und Ansätze zu deren Behandlung.
Die zweite Auflage wird hoffentlich ebenso viele Betroffene dabei unterstützen, die Komplexität von ME/CFS zu meistern. An einer Verbesserung der Versorgung zu arbeiten, bleibt inzwischen auch Aufgabe von uns Ärzt*innen.
Dr. Michael Stingl ist der führende Experte für ME/CFS in Österreich und praktiziert in Wien.
Einleitung
Wenn Sie dieses Buch in Händen halten, sind Sie vielleicht selbst betroffen und an ME/CFS erkrankt oder Sie haben den Verdacht. Vielleicht kommt es auch unter dem Namen „Chronisches Fatigue Syndrom“, „Chronisches Erschöpfungs-Syndrom“ oder „Chronisches Müdigkeits-Syndrom“ daher – Begriffe, die wir in diesem Buch vermeiden, da sie irreführend sind. ME steht für Myalgische Enzephalomyelitis. Wir verwenden in der Folge die Bezeichnung ME/CFS, die sich international durchgesetzt hat.
Möglicherweise sind Sie Angehörige oder Angehöriger von Betroffenen. Oder Sie sind im Zusammenhang mit Post-COVID auf das Thema aufmerksam geworden.
Auch wenn viele Menschen im medizinischen Betrieb ME/CFS nicht kennen, ist es keineswegs – anders als oft behauptet – eine Mode-Erkrankung oder Verlegenheitsdiagnose, sondern wurde bereits 1969 von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) als neurologische (also somatische / körperliche) Erkrankung anerkannt. Weltweit waren vor der Pandemie geschätzte 17–20 Millionen Menschen betroffen, allein rund 300.000 davon in Deutschland. Heute gehen Experten konservativ von einer Verdoppelung dieser Zahlen aus. Weniger konservative Zahlen sind jenseits einer Million Betroffener. Inzwischen ist auch klar, dass ME/CFS die schlimmste Form des Post-COVID Syndroms ist.
Die Symptome sind gleich. Die Betroffenen leiden genauso. Der Auslöser ist logisch nachvollziehbar die Virusinfektion – wie in den meisten Fällen von ME/CFS Viruserkrankungen am Anfang der Leidensgeschichte stehen. Auch ist längst bekannt, dass Corona-Viren ME/CFS auslösen können. In der SARS-Pandemie in den Jahren 2002 und 2003 entwickelten rund 27,1 % der Erkrankten das sogenannte „Chronic Post SARS Syndrom“ – ME/CFS, wie man heute weiß. Das ist gesichertes Wissen, belegt durch eine Studie zu den Folgen der Krankheit in Hongkong. Das Virus, das damals zum Glück nicht so ansteckend war wie die heutige Variante, hieß „SARS-CoV-1“ – die aktuelle Pandemie wurde ausgelöst durch das Virus „SARS-CoV-2“, besser bekannt als COVID-19.
Der Gesundheitsminister Karl Lauterbach schrieb schon am 28. Mai 2020 auf Twitter: „Auch bei SARS 2002–2003 haben viele Jüngere später langfristige Schäden wie Chronic Fatigue Syndrome oder Depressionen entwickelt.“
Heute ist klar, dass er damit recht hatte. Die Erkrankung macht es weder den Betroffenen noch den Ärzten leicht: Die Symptome sind vielfältig und betreffen den gesamten Organismus – von Muskel- und Gelenkschmerzen über Schlafstörungen, Kreislaufstörungen bis hin zu kognitiven Problemen wie Merkschwierigkeiten, Wahrnehmungsstörungen oder Überempfindlichkeit auf Sinnesreize.
Diese Symptome können aber auch von vielen anderen Krankheiten herrühren. Allerdings ist das Kardinalsymptom einer nicht linderbaren, körperlichen und mentalen Erschöpfung typisch für ME/CFS.
Bisher gibt es keinen sogenannten „Biomarker“ für ME/CFS, mit dem sich die Krankheit eindeutig belegen lässt. Es müssen für die Diagnose alle anderen möglichen Ursachen ausgeschlossen werden. Ein Aufwand, den viele Ärzte scheuen – auch, weil ME/CFS in der Ausbildung für angehende Ärzte keine Rolle spielt, viele Ärzte das Krankheitsbild daher gar nicht kennen und ähnlich ahnungslos wie die Patienten dieser Krankheit gegenüberstehen. Und auch in der Facharztausbildung kommt ME/CFS nicht vor. Mehr als die Hälfte der Betroffenen, geschätzte 60 %, sind nicht mehr arbeitsfähig. Ein Viertel kann das Haus kaum noch oder gar nicht mehr verlassen, viele sind bettlägerig und auf Pflege angewiesen. In dieser Situation sind sie oft auf sich allein gestellt. Pflege- und Krankenkassen, Versicherungen und andere Leistungsträger haben ME/CFS nicht in ihrem Katalog.
Ein Betroffener, Wilfried, schreibt in einer Selbsthilfegruppe auf Facebook: „Ärzte, Gutachter und die Deutsche Rentenversicherung (DRV) haben mich Lebenszeit gekostet. Als jüngstes Beispiel: Der Grad der Behinderung (GdB) 50 ist durch mein Gutachten für die Rente durch. Weder im Gutachten noch im Bescheid zum GdB kommt das Wort ME/CFS überhaupt auf, obwohl ich ca. 10-fach erhöhte Autoantikörper habe. Das empfinde ich als Skandal.“
Wilfried ist kein Einzelfall. Sehr oft führt ME/CFS in existenzielle Krisen, löst finanzielle Nöte und Zukunftsängste aus. Ich bin erkrankt – aber niemand will mir helfen. Das ist ein Gefühl, das die meisten an ME/CFS Erkrankten leider sehr gut kennen.
Oft wenden sich die Menschen im privaten Umfeld von den Betroffenen ab, weil sie die Krankheit nicht verstehen. Man sieht als Betroffener einigermaßen gesund aus. Da hört man Sätze von Betroffenen wie diesen: „Bei mir kann keiner etwas mit ME/CFS anfangen und Interesse ist auch nicht vorhanden“, schreibt Patrick. „Dann kommen so tolle Sprüche wie ,geh arbeiten und es wird dir besser gehen‘. Oder ,such dir eine Freundin, das wird dir helfen‘.Es sei nur psychisch. Würde man Personen mit einer anderen Krankheit solche Dinge sagen?“ Sein Fazit: „Es ist doch der totale Scheiß, dauerhaft dem Unrecht ausgeliefert zu sein.“
Egal, ob es nun Post-COVID genannt wird oder ME/CFS – es ist für Betroffene, die teilweise seit Jahrzehnten mit der Erkrankung alleingelassen werden, wie für Mediziner eine echte Herausforderung. Und obwohl es nicht so sein sollte, ist es für die meisten Mediziner Neuland. Und obwohl viel Bewegung aufgekommen ist in Medizin und Forschung, ist das bei den Betroffenen auch Jahre nach Beginn der Corona-Pandemie noch nicht angekommen.
Mit diesem Buch wollen wir etwas Licht ins Dunkel bringen und Betroffenen, Angehörigen, aber auch Ärzten, die sich erstmals mit dem Thema konfrontiert sehen, erste Anhaltspunkte geben. Das Ziel ist die Unterstützung, möglichst schnell zu einer gesicherten Diagnose zu gelangen und die notwendige Hilfe durch beispielsweise Sozialversicherungsträger zu bekommen.
Dieses Buch ist kein medizinisches Fachbuch. Vielmehr haben wir zahllose seriöse Quellen ausgewertet und Informationen zusammengetragen, die den Stand der Wissenschaft zu der Erkrankung widerspiegeln. Dabei haben wir uns streng an biomedizinischen Fakten und dem Stand der Wissenschaft orientiert, auch in Abgrenzung zu vielen teils pseudomedizinischen und esoterischen Heilversprechen, die im Internet kursieren. Auf „anekdotisches Wissen“ wurde bewusst verzichtet.
Wir wissen, wie schwer es sehr viele Betroffene haben, einen Arzt zu finden, der sich ihnen unvoreingenommen annimmt. Dennoch ersetzt dieses Buch nicht das vertrauensvolle Gespräch mit dem Hausarzt und weiteren behandelnden Ärzten, denn die Beschwerden und Symptome sind vielfältig und müssen individuell abgeklärt werden. Auch ersetzt das Buch keine Rechtsberatung, auch hier ist eine individuelle Betrachtung und Klärung mit Fachleuten unerlässlich. Aber was es leistet, ist Denkanstöße und Hinweise zu geben, damit diese Gespräche möglichst erfolgreich verlaufen und möglichst wenig kostbare Energie erfordern.
Dabei wissen wir auch – und das ist auch so gewollt –, dass wir nicht zu sehr in die Tiefe gehen können, damit die Informationen verständlich und nachvollziehbar bleiben. Wir wissen, dass es eine Unmenge von Versuchen gibt, die Beschwerden zu lindern – nicht auf alle können wir hier eingehen, zumal viele sehr individuell zu bewerten sind. Ebenso ist uns bewusst, dass manche zwischen ME und CFS unterscheiden. Aber das führt zu sehr in die Tiefe und würde im Rahmen dieses Buches nur verwirren. Wir bitten an dieser Stelle also um Nachsicht und hoffen, dass unsere Arbeit möglichst vielen Betroffenen hilft, Angehörigen und Freunden beim Verstehen dieser Erkrankung hilft und Anreiz für Mediziner ist, sich ernsthaft mit ME/CFS auseinanderzusetzen.
Der Wiener Neurologe und ME/CFS-Experte Michael Stingl sagte der Neuen Zürcher Zeitung sehr treffend: „Wenn ein Patient mit ME/CFS oder Post-COVID zum Arzt geht, wird er in den allermeisten Fällen sehr viel mehr über seine Erkrankung wissen als der Arzt. … Es ist vielleicht ein Paradigmenwechsel in der Medizin, dass wir nun gemeinsam mit ihnen die Forschungsfragen definieren.“
GITTA MEIERNILS WINKLER
Was ist ME/CFS?
ME/CFS ist die Abkürzung für Myalgic Encephalomyelitis (ME) beziehungsweise das Chronic Fatigue Syndrome (CFS). Der Begriff ME ist weiter verbreitet im englischen Sprachraum, während in Europa häufiger vom Chronischen Fatigue-Syndrom oder auch dem Chronischen Erschöpfungssyndrom, manchmal auch dem „Chronischen Müdigkeits-Syndrom“ gesprochen wird. Wobei beide Namen ein Stück weit irreführend sind: Der Begriff ME impliziert eine Entzündung im Gehirn oder Rückenmark, die aber mit den gängigen diagnostischen Methoden oft nicht nachweisbar ist. Und beim Begriff CFS ist die Reduzierung auf das Stichwort „Erschöpfung“ (Fatigue), oder schlimmer noch „Müdigkeit“, ein grober Fehlgriff, denn das verniedlicht, wie schwerwiegend ME/CFS wirklich ist. Entgegen früheren Annahmen, die inzwischen widerlegt sind, ist ME/CFS eine rein körperliche, neuro-immunologische Multisystemerkrankung und nicht psychisch oder psychosomatisch bedingt.
In Deutschland waren vor der Pandemie – Betroffene durch Post-COVID (also Erkrankte, die auch zwölf Monate nach einer COVID-Infektion Symptome aufweisen, die nicht anders erklärt werden können und denen von ME/CFS gleichen) noch gar nicht mitgezählt – rund 300.000 Menschen an ME/CFS erkrankt. In den USA ging man vor der Pandemie von 2,5 Millionen Erkrankten aus. Das Center for Disease Control (CDC), die US-Gesundheitsbehörde, geht davon aus, dass von diesen Betroffenen nur rund 10 % eine Diagnose erhalten haben – und davon, dass nun in Folge der Pandemie dort rund 15 Millionen Menschen an ME/CFS erkrankt sind. In Deutschland und Europa sieht das Bild nicht anders aus. Hier wird nach neuen Zahlen von rund einer Million Betroffener ausgegangen.
Während das CDC für die USA (vor der Pandemie) von einem gesamtwirtschaftlichen Schaden durch ME/CFS in Höhe von jährlich rund 24 Milliarden Dollar durch Gesundheitskosten und verlorene Einkommen ausgeht, ist diese Zahl für Europa noch höher: 40 Milliarden Euro. Rechnet man dies auf die Bevölkerungszahl in Deutschland um, ergibt sich für Deutschland ein volkswirtschaftlicher Schaden von 7,4 Milliarden Euro im Jahr. Nochmals: diese Zahlen beziehen sich auf die Zeit vor der Pandemie. Man muss also von einem Vielfachen ausgehen.
ME/CFS ist eine Krankheit, die systematisch und andauernd von der Politik, der Forschung und auch weiten Teilen der Medizin ignoriert oder zumindest vernachlässigt wurde.
Dabei gibt es auch prominente Beispiele von ME/CFS-Erkrankten: Der Fußball-Profi Olaf Bodden von 1860 München, dem eine große Karriere in der Nationalmannschaft vorausgesagt wurde, erkrankte 1996 an Pfeifferschem Drüsenfieber, das durch das Epstein-Barr-Virus (EBV) ausgelöst wird. EBV ist bekannt, in etlichen Fällen Spätkomplikationen auszulösen – nämlich ME/CFS. Bodden hat es hart getroffen: Im Dezember 1997 musste er nach monatelanger Krankheit seine Karriere aufgeben. Heute, 25 Jahre später, ist er ein Pflegefall und weitestgehend ans Bett gefesselt. Schon 2016 sagte er der Welt: „Wenn ich wüsste, ich liege hier noch weitere 20 Jahre, mache ich das nicht mehr mit. Da wirst du doch irre. Aber noch kämpfe ich!“ Dieses Gefühl der Ohnmacht, aber auch des Aufbegehrens gegen diese Krankheit, teilt er mit den meisten Betroffenen.
Auch die Publizistin und Grünen-Politikerin Marina Weisband, eine zuvor dynamische junge Frau, ist schwer an ME/CFS erkrankt. Aufmerksam wurde die Öffentlichkeit durch einen Tweet an ihrem 35. Geburtstag im Jahr 2020: „Hi, ich hatte gestern Geburtstag. Ich habe ihn an einem Tropf verbracht. Ich habe ME/CFS. Wenn ihr mir ein Geschenk machen wollt, informiert euch ein wenig über die Krankheit“, schrieb sie. Marina Weisband hat eine kleine Tochter, der sie erklären muss, dass Mamas Energie für den Alltag nicht ausreicht, dass sie sie an schlechten Tagen nicht von der Kita abholen kann. In einem Interview mit dem Spiegel sagte Weisband, die Krankheit fühle sich an wie eine Dauergrippe. Sie könne zwar Dinge tun, wie ein Interview zu geben, aber danach sei sie oft tagelang ans Bett gefesselt. Weil ihre Kraft dann für nichts anderes mehr reicht.
Und so spricht die ME/CFS-Spezialistin Prof. Dr. med. Carmen Scheibenbogen vom Fatigue-Zentrum der Charité auch von einer
„unterschätzten Krankheit“. ME/CFS sei eine „häufige und schwer verlaufende Multisystemerkrankung mit Dysregulation des Immunsystems, des autonomen Nervensystems und des Energie-Stoffwechsels“. Die Krankheit werde „oft fehlinterpretiert“ und es bestehe ein „enormes Informationsdefizit, auch bei den Ärzten“.
„Der Pschyrembel“, das führende Nachschlagewerk für Mediziner im deutschsprachigen Raum und eine absolute Instanz, beschreibt ME/CFS so:
„Chronische neuroimmunologische Systemerkrankung unklarer Ursache. Leitsymptom ist die andauernde geistige und körperliche Erschöpfung (Fatigue) bis zur Bettlägerigkeit sowie weitere Symptome wie Kopf- und Muskelschmerzen, Lymphknotenschwellungen, neurologische Störungen.“ Außerdem beschreibt der Pschyrembel für ME/CFS eine „Dysregulation von Nervensystem, Immunsystem sowie Herzkreislaufsystem, auf zellulärer Ebene Störungen von Energiestoffwechsel und Ionentransport“ sowie „zahlreiche Störungen auf immunologischer, neuronaler, hormoneller Ebene“. Die Liste wird fortgesetzt mit einem massiv gestörten Immunsystem, entzündlichen Prozessen im Nervensystem – also im Gehirn oder Rückenmark – und Veränderungen am Gehirn, einer verminderten Durchblutung des Stammhirns und der Hirnrinde, der Störung der Mitochondrien, einer gestörten Glucose-Aufnahme der Zellen und weiterer Probleme.
Kurz kann man zusammenfassen: Die Effekte von ME/CFS betreffen den gesamten Organismus und die Kombination von mangelnder Energieaufnahme der Zellen, gestörter Durchblutung und gestörtem Nervensystem, das alle Körperfunktionen steuert, bedeutet, dass für die Auflistung der möglichen Symptome hier der Platz nicht reicht.
Charakteristisch für ME/CFS, bei der gesamten Spannbreite aller Symptome, ist jedoch die anhaltende physische und mentale Erschöpfung, die meist auch durch Ruhepausen nicht gebessert werden kann, und vor allem eine ausgeprägte Belastungsintoleranz. Prof. Scheibenbogen: „Die Belastungsintoleranz ist dadurch gekennzeichnet, dass es nach einer körperlichen oder geistigen Anstrengung zu einer Zunahme der Symptomatik kommt, die tage- oder auch wochenlang anhalten kann. Dies wird in Fachkreisen als Postexertionelle Malaise (PEM) bezeichnet.“
Postexertionale Malaise ist ein lähmender Zustand, der ME/CFS-Patienten von denen unterscheidet, die lediglich unter einfacher Müdigkeit leiden. Während Müdigkeit eine häufige Reaktion auf Überanstrengung für jeden ist, stehen ME/CFS-Patienten vor einer einzigartigen Verschlechterung der Symptome, die nach jeder Form von Anstrengung tagelang oder sogar wochenlang anhalten kann.
Auf PEM und den richtigen Umgang damit gehen wir an anderer Stelle gesondert ein.
Von ME/CFS Betroffene leiden aber nicht nur unter dem Kardinal-Symptom PEM, sondern klagen über anhaltendes, allgemeines Krankheitsgefühl, wie „eine Grippe, die nie weggeht“ (Weisband), Halsschmerzen, geschwollene Lymphknoten, erhöhte Körpertemperatur, ausgeprägte Konzentrations- und Gedächtnisprobleme, Wortfindungs- und Artikulationsstörungen, Überempfindlichkeit für Licht, Gerüche oder Lärm und motorische Probleme. Häufig sind Auswirkungen auf den Kreislauf, die zu Benommenheit, Schwindel und Ohnmacht führen können – die sogenannte Orthostatische Intoleranz. Hinzu kommen Gelenk-, Muskel-, Nerven- und Kopfschmerzen und trotz der anhaltenden, bleiernen Erschöpfung schwere Schlafstörungen. Viele Betroffene leiden auch unter häufigen Infekten, die dann natürlich weiter schwächend wirken.
Häufig, so Prof. Scheibenbogen, bestehen auch Symptome einer autonomen Dysfunktion. Das macht sich durch eine Vielzahl von Beschwerden im gesamten Organismus bemerkbar:
Tachykardie (Herzrasen)Orthostatische Intoleranz mit Herzrasen, Benommenheitsgefühle, Kopfschmerzen, Schwindel, Schwarzwerden vor den Augen und gelegentlich auch kurze BewusstseinsverlusteSehstörungenLichtempfindlichkeitDyspnoe (Atemnot)Reizdarm (IBS)ReizblaseFehlregulierung der Körpertemperatur, Frieren und / oder SchwitzenFatigueEine Grafik auf den Folgeseiten zeigt, welche Bereiche des Organsystems durch ME/CFS in Mitleidenschaft gezogen werden können.
Eine Grafik auf den Folgeseiten veranschaulicht die Funktion und Wirkung des autonomen Nervensystems, das regelmäßig durch ME/CFS schwer gestört ist.
Entsprechend betrifft ME/CFS tatsächlich das gesamte Organsystem, durch Autoimmunprozesse und durch Fehlfunktion des autonomen Nervensystems.
Viele dieser Symptome sind einzeln betrachtet schon eine riesige Belastung für Betroffene – die Symptome zusammengenommen erlauben es sehr vielen Betroffenen aber kaum noch, am Leben teilzunehmen. So wird davon ausgegangen, dass rund zwei Drittel der an ME/CFS Erkrankten nicht mehr arbeitsfähig sind oder sich in gewohnter Weise am Sozialleben beteiligen können. Ein gutes Drittel ist zumindest vorübergehend, rund 10–15 % dauerhaft ans Bett gebunden. Dabei fallen ihnen auch die Dinge extrem schwer, die für sie enorm wichtig sind: Arztbesuche, die Auseinandersetzung mit Behörden, Sozialversicherungsträgern und Versicherungen. Oft ein Kampf gegen Windmühlen, denn, so Prof. Scheibenbogen: „Die Versorgungslage für Patienten mit ME/CFS ist bislang schwierig, da es keine spezialisierten Zentren gibt und viele Ärzte die Erkrankung und adäquate Therapieansätze kaum kennen.“ Gleiches gilt auch für Gutachter und Sachverständige und Sachbearbeiter bei den verschiedenen Institutionen, was letztendlich dazu führt, dass an ME/CFS Erkrankte oft einen langen Leidensweg haben und sehr viel Unrecht erfahren. Leider hat sich daran auch in Folge der Pandemie, die viel mediale Aufmerksamkeit brachte, nicht grundlegend etwas geändert.
Die Erkrankung führt oft zur Vereinsamung der Betroffenen und zu einem „schleichenden Verschwinden“ an ME/CFS-Erkrankter aus dem Leben. Sie erleben, dass frühere Freunde und Bekannte sich nicht mehr melden. Und sie sortieren aktiv Menschen aus ihrem Leben aus, die ihnen konstant mit Unverständnis begegnen. Genötigt zu sein, sich ständig zu erklären, erfordert zu viel Kraft. Aber sie verschwinden noch viel häufiger aus der Wahrnehmung ihres Umfeldes, weil sie die Belastung sozialer Kontakte kaum noch (beziehungsweise gar nicht mehr) meistern können. Professor Scheibenbogen erklärt dies in einer Fortbildungs-Präsentation für Ärzte auch mit einem natürlichen Krankheits-Mechanismus, den sie „biologisch sinnvoll“ nennt: Energie wird durch die Erkrankung für Immunfunktionen und Temperaturerhöhung eingesetzt statt für körperliche Aktivität. Das führt zu einem Rückzug aus der Herde, damit Ansteckung vermieden wird. Hilft dieses „Einigeln“ bei zeitlich begrenzten Infektionskrankheiten, von denen man sich nach gewisser Zeit wieder vollständig erholt, ist es bei chronischen Erkrankungen wie ME/CFS allerdings in einem Höchstmaß problematisch. Wichtig ist hierbei zu unterstreichen, dass ME/CFS nicht mit einer psychischen Erkrankung zu verwechseln ist.
Der häufigste Auslöser für ME/CFS sind Virusinfektionen. Sehr häufig tritt ME/CFS nach einer Infektion mit dem Epstein-Barr-Virus (EBV) auf, und zwar entweder recht zeitnah nach der Infektion oder auch Jahre später. Das EBV verbleibt, hat es sich einmal fest-gesetzt, ein Leben lang im Körper und kann durch unterschiedliche Faktoren später wieder reaktiviert werden. Wie in der Einleitung erwähnt, gab es nach der SARS-Pandemie Anfang des Jahrhunderts eine Häufung von ME/CFS – rund 60 % der damals an SARS Erkrankten hat in der Folge ME/CFS entwickelt. Solche Ausbrüche sind in der Geschichte bereits mehrfach beobachtet worden – auch als Folge der Spanischen Grippe zu Anfang des 20. Jahrhunderts beispielsweise. Und ganz aktuell als häufige Langzeit-Folge von COVID-19.
Die Wissenschaft war natürlich nicht so weit, aber nach heutigen Standards beurteilt zeigt sich, dass es ME/CFS vermutlich schon immer gab. So haben diverse Mediziner die Vermutung geäußert, dass Charles Darwin an der Krankheit gelitten hat. Er hat ausführliche Aufzeichnungen und Berichte hinterlassen, die kaum einen anderen Schluss zulassen. Die beschriebenen Symptome passen geradezu mustergültig zum Vollbild von ME/CFS.
Inzwischen gibt es wissenschaftliche Erkenntnisse, dass in vielen Fällen bestimmte Autoantikörper bei an ME/CFS erkrankten nachweisbar sind. So belegen diverse Studien, dass bei rund 30 % der Betroffenen solche Autoantikörper nachgewiesen werden können. Professor Carmen Scheibenbogen von der Charité in Berlin sagte dazu: „Wir haben Beweise dafür, dass ME/CFS eine Autoantikörper-vermittelte Krankheit ist, und wir haben Beweise dafür, dass die Bekämpfung von Autoantikörpern bei dieser Krankheit wirksam ist. Bisher gibt es nur wenige und unterfinanzierte klinische Studien, aber die gute Nachricht ist, dass wir vielversprechende neue Behandlungsmöglichkeiten haben“.
Forschern an der Universität Würzburg um Dr. Bhupesh Prusty, der inzwischen in Lettland forscht, ist es gelungen, einen Zusammenhang zwischen Virusinfektionen, vornehmlich mit Herpesviren wie dem EBV-Virus, und ME/CFS nachzuweisen. Dabei wurde nachgewiesen, dass nach einer Infektion die Mitochondrien, die Kraftwerke in den Zellen, in Mitleidenschaft gezogen und teilweise zerstört werden. Die Forschung stehe noch am Anfang, aber bei schwer betroffenen gelingt dieser Nachweis bereits, so Prusty: „Bei schwer betroffenen ME/CFS-Patienten bekommen wir zu 100 % klare Ergebnisse“.
Allerdings sind nicht in allen Fällen Virusinfektionen als Auslöser nachweisbar: So kommen in selteneren Fällen auch Veränderungen an der Halswirbelsäule beziehungsweise am Kopf-Hals-Übergang und Traumata in Frage, beispielsweise durch Unfälle, oder Umwelteinflüsse.
Dabei ist ME/CFS eine chronische und unheilbare Erkrankung mit meist „chronisch-progredientem Verlauf“: Damit beschreiben Mediziner eine langanhaltende Erkrankung, bei der die Ausprägung der Symptome über Jahre hinweg zunimmt. Allerdings ist bei ME/CFS typisch, dass die Symptome wellenförmig auftreten. Betroffene beschreiben es oft so, dass in einer Phase ein Symptom im Vordergrund steht, während das nach Tagen, Wochen oder Monaten wechseln kann, das Symptom in den Hintergrund tritt und andere Beschwerden die Oberhand gewinnen. Das kann leicht als eine Besserung fehlinterpretiert werden („Gut, dass Ihnen nicht mehr schwindelig wird, dann geht es Ihnen ja besser!“) – denn diese Welle schwappt meist auch wieder zurück.
Wie man nun schon vermuten kann, ist es für ME/CFS-Betroffene ein großes Problem, eine gesicherte Diagnose zu bekommen. Zum einen ist das Bewusstsein und Wissen zu ME/CFS in weiten Kreisen der Medizin kaum vorhanden. Ärzte wissen also schlicht nicht, wonach sie suchen müssen. Zum anderen sind die Symptome so diffus und vielfältig, dass zunächst der Verdacht auf andere Ursachen fällt – leider auch sehr häufig auf psychische Ursachen. So wird Betroffenen regelmäßig unterstellt, sie seien psychisch krank, Auslöser für „die Fatigue“ seien Depressionen oder sonstige psychische Erkrankungen. Gerade Frauen berichten sehr häufig davon, nicht ernst genommen zu werden – sie seien wohl einfach überlastet oder gestresst und sollten sich nicht so anstellen / mal einen Gang langsamer schalten / mehr Sport machen, heißt es.
Parallel fehlt meist die Kraft, sich gegen solche Aussagen zur Wehr zu setzen und so fahren die Betroffenen von solch einem Arzttermin nach Hause und es folgt der Crash – der totale Zusammenbruch. Deswegen ist es wichtig, dass die Patienten selbst sehr gut informiert sind und sich auch auf Termine mit Ärzten, Behörden und Leistungsträgern sehr gut vorbereiten. Dazu mehr im Verlauf dieses Buches.
Die Diagnose erfolgt dann als sogenannte Ausschlussdiagnose oder auch Differentialdiagnose und anhand fester Kriterien. Dabei wird geschaut, welche Beschwerden ein Patient hat und zu welchem Krankheitsbild – oder auch welchen Krankheitsbildern – diese passen können. Für die in Frage kommenden Erkrankungen werden dann Untersuchungen ausgeführt, die zu einem Ausschluss führen sollen – also dem Nachweis, dass eine Erkrankung Ursache der Beschwerden ist oder nicht. Die Liste der Erkrankungen, die auf den ersten Blick ähnliche Symptome auslösen wie ME/CFS, ist recht lang und viele Besuche bei Fachärzten werden nötig sein, bis alle anderen Möglichkeiten ausgeschlossen wurden.
Der Grund dafür ist, dass es zwar viele jüngere Erkenntnisse und auch Forschung zu häufigen Veränderungen der Blutwerte bei Erkrankten gibt. Jüngste Forschung zeigt beispielsweise typische Blutwerte bei schwerst an ME/CFS Erkrankten. Aber bei leicht oder moderat erkrankten Menschen funktioniert das noch nicht. Es fehlt der sogenannte „Biomarker“.
Sind nun die anderen möglichen Ursachen ausgeschlossen, gibt es sogenannte „Internationale Konsenskriterien“ beziehungsweise „Kanadische Konsenskriterien“, anhand derer die Diagnose ME/CFS gesichert gestellt werden kann. Auf diese Kriterien gehen wir im folgenden Kapitel ein.
Für die Messung des Grades der Einschränkungen, die ein Mensch durch ME/CFS erleidet, gibt es definierte Messgrößen. Hierbei handelt es sich um die sogenannte Bell-Skala. Der Mediziner David S. Bell veröffentlichte die Skala 1995 in seinem Buch „The Doctor’s Guide to Chronic Fatigue Syndrome“. Er ist Vorstandsmitglied der International Association of ME/CFS und war Vorsitzender der Beratungskommission zu ME/CFS des amerikanischen Gesundheitsministeriums. Die nach ihm benannte Bell-Skala ist seit Jahren die anerkannte Währung zur Einstufung des Grades der Behinderung von ME/CFS-Patienten. Auch wenn dies nach wie vor durch Gutachter und Sachverständige, die die Existenz der Krankheit viel zu oft insgesamt anzweifeln, negiert wird. Oder sie die Skala gar nicht kennen, weil Ihnen das spezifische Wissen zu ME/CFS fehlt.
Zwar gibt es in der Forschung inzwischen spannende und vielfältige Ansätze zur Heilung von ME/CFS und es ist endlich, nach vielen Jahren, Bewegung in die Forschung gekommen – aber zum gegenwärtigen Stand bleibt ME/CFS unheilbar und die Behandlung ist nur symptomatisch möglich. Sprich, es werden die Beschwerden behandelt, aber an der Ursache kann man nichts machen. Auch hierauf wird im Verlaufe des Buches ausführlich eingegangen.
In der Vergangenheit empfohlene Therapien wie die „stufenweise Aktivierung“ durch Übungen und Sport gelten heute nicht nur als überholt, sondern heute weiß man, dass sie nachweislich schädlich sind und sogar gefährlich sein können. ME/CFS-Patienten beschreiben ihren Energie-Status wie den eines Handys mit defektem Akku: Der steht immer auf 30 % oder weniger, egal, wie viel er geladen wird. Und diese 30 % müssen reichen, um den Alltag zu bewältigen – wo gesunde Menschen 100 % zur Verfügung haben, und zwar in der Regel nach jeder Nacht erneut. Sport- und Bewegungstherapien führen also dazu, dass sich Patienten dauerhaft und systematisch außerhalb ihrer Leistungsreserven bewegen. Oft sogar zunächst unbemerkt durch den gestörten Hormonhaushalt (der Körper schaufelt dann mit dem Ausstoß von Adrenalin Reserven frei). So führen diese Therapien zu einer nachhaltigen und oft andauernden Verschlechterung der Gesundheitssituation der Betroffenen.
Heute wird daher empfohlen, dass die Patienten das sogenannte Pacing lernen, nämlich, ihre Energie genau einzuteilen und zu planen, um nicht über die Reserven zu gehen. Ebenso werden Entspannungsübungen empfohlen, um zur Ruhe zu kommen, denn der Körper befindet sich bei ME/CFS im Dauerstress. Und schließlich sollten sich Ärzte darauf konzentrieren, durch Behandlungen (u.a. Medikamente) die einzelnen Beschwerden möglichst stark abzumildern, um Betroffenen eine verbesserte Lebensqualität zu verschaffen.
Die Zahlen und Erkenntnisse zum Krankheitsverlauf sind nicht sehr genau und so wird ein Arzt, selbst ein ausgewiesener Experte, sich mit einer Prognose zurückhalten. Meist ist die Aussage, dass man lernen muss, mit der Krankheit zu leben und mit ihr umzugehen. So wird in verschiedenen Studien von 8–63 % der Betroffenen berichtet, die bei entsprechender Behandlung eine Symptomverbesserung erleben. Ausgeblendet ist hierbei allerdings, wie stark die Symptomverbesserung ist und ob sie nur subjektiv ist oder auch objektivierbar. Auch ist nicht erfasst, wie lange die Symptomverbesserung nach einer bestimmten Therapie anhält. Und eine Symptomverbesserung, selbst eine Remission (verschwinden von Symptomen), ist natürlich keine Heilung.
Die Wahrscheinlichkeit der sogenannten Spontanheilung, bei der die Krankheit von allein verschwindet, geht gegen null.
Die Lebenserwartung von krebskranken ME/CFS-Patienten ist im Schnitt um über 20 Jahre verkürzt – von 70 Jahren auf 47,8 Jahre. CFS-Patienten sterben bei Herzversagen 25 Jahre früher als der Durchschnitt der an Herzversagen Gestorbenen: Mit 58,7 statt mit 83,1 Jahren.
Zu je rund 20 % sind Herzversagen, Krebs und Suizid die häufigsten Todesursachen von ME/CFS-Patienten, gefolgt von Komplikationen durch ME/CFS wie Infektionen, Nierenversagen oder Atemversagen.
Der Weg von Neurasthenie zu ME/CFS in der Medizin und Wissenschaft
Die Entwicklung des Krankheitsbildes ME/CFS zeigt eindrucksvoll, wie sich medizinische Diagnosen im Laufe der Zeit verändern können und wie dies das Leben der Betroffenen beeinflusst. Bereits im 19. Jahrhundert begann man, über eine Krankheit nachzudenken, die man damals „Neurasthenie“ nannte. Die Diagnose wurde vor allem bei Menschen gestellt, die über eine extreme Form der nervösen Erschöpfung klagten. Diese Betroffenen litten unter starker körperlicher und geistiger Ermüdung, selbst nach alltäglichen Tätigkeiten wie der Selbstversorgung oder einfachen beruflichen Aufgaben. Viele Ärztinnen und Ärzte konnten allerdings keine physischen Anzeichen finden, die diese Erschöpfung erklären konnten, was damals noch zu einer starken Skepsis gegenüber den Beschwerden führte. Da Neurasthenie besonders häufig bei Frauen diagnostiziert wurde, entwickelte sich die Theorie, die Ursachen könnten psychischer Natur sein – möglicherweise ausgelöst durch emotionale Konflikte oder ein „überreiztes Nervensystem“.
Diese erste Einschätzung führte dazu, dass Neurasthenie in vielen Fällen eher als „Frauenleiden“ abgetan wurde. Der Gedanke, dass es sich um ein psychisch bedingtes Problem handele, beeinflusste die ärztliche Sichtweise stark und sorgte dafür, dass die Betroffenen häufig nicht die notwendige medizinische Unterstützung erhielten. Der Fokus lag stattdessen auf psychologischen Erklärungen und Behandlungen, ohne die Möglichkeit einer körperlichen Ursache ernsthaft in Erwägung zu ziehen. Die gesellschaftliche Rolle der Frau, die im 19. Jahrhundert noch stark auf das Private beschränkt war, trug ebenfalls dazu bei, dass Neurasthenie als „nervöse Schwäche“ abgetan wurde, die besonders die „zart besaiteten“ Frauen zu betreffen schien.
In den folgenden Jahrzehnten änderte sich jedoch die wissenschaftliche Sichtweise langsam. Ab den 1930er Jahren wurden vermehrt Zusammenhänge zwischen langanhaltender Müdigkeit und Infektionskrankheiten untersucht. Ein bemerkenswerter Fall ereignete sich 1934 in den USA: Der Arzt Alexander Gilliam dokumentierte in einem Krankenhaus in Los Angeles einen Ausbruch einer rätselhaften Krankheit, die langanhaltende Symptome hinterließ. Da Polio zu dieser Zeit eine bekannte Bedrohung war, benannte Gilliam diese neue Erkrankung als „atypische Poliomyelitis“. Diese Beobachtung stellte den ersten dokumentierten Fall dar, bei dem eine Verbindung zwischen einer Infektion und einer langanhaltenden Erschöpfungssymptomatik hergestellt wurde.
Weitere Ausbrüche folgten, etwa in Island in den Jahren 1946 und 1948 und im Vereinigten Königreich im Jahr 1955. Im Royal Free Hospital in London wurde diese mysteriöse Erkrankung von Ärztinnen und Ärzten als „benigne myalgische Enzephalomyelitis“ (ME) bezeichnet. Mit dieser Namensgebung wollte man verdeutlichen, dass es sich um eine organische Erkrankung handelt – eine, die das Nervensystem beeinflusst und nicht bloß ein psychisches Leiden ist. Diese neue Bezeichnung bedeutete einen Meilenstein: Zum ersten Mal erkannte die medizinische Gemeinschaft, dass die Symptome, unter denen die Betroffenen litten, auf eine tatsächliche körperliche Krankheit zurückzuführen sein könnten.
In den 1980er Jahren erlangte ME/CFS in den USA durch einen weiteren Ausbruch einer postinfektiösen Erkrankung in Incline Village, Nevada, größere Bekanntheit. Im Zuge dieses Ereignisses führte man den Begriff „Chronisches Erschöpfungssyndrom“ (Chronic Fatigue Syndrome, CFS) ein. Die Idee dahinter war, eine Bezeichnung zu finden, die das Hauptsymptom – die anhaltende Erschöpfung – treffend beschreibt. Doch der Name CFS stieß bei vielen Betroffenen auf Unmut: Sie empfanden ihn als verharmlosend und irreführend, da er das komplexe und schwere Krankheitsbild, das ihr Leben prägte, nicht angemessen wiedergab. „Müdigkeit“ oder „Erschöpfung“ als Übersetzung von „Fatigue“ klang nach einer alltäglichen Erschöpfung, die man mit Schlaf oder Erholung beheben könne, was das Leiden der Betroffenen in den Augen der Öffentlichkeit zu banalisieren schien.
Ein zentrales Konzept, das in der ME/CFS-Forschung immer wieder auftaucht, ist das sogenannte „Post-Exertional Malaise“ (PEM) oder „Post-Exertional Neuroimmune Exhaustion“ (PENE). Hierbei handelt es sich um eine extreme Form der Erschöpfung, die nach körperlicher oder geistiger Anstrengung auftritt und sich oft erst mit Verzögerung zeigt. Die Betroffenen berichten von einem „Crash“, bei dem ihre körperlichen und geistigen Fähigkeiten für Tage oder sogar Wochen beeinträchtigt sind. Melvin Ramsay, ein britischer Arzt, prägte erstmals den Begriff „epidemische Malaise“, um diese belastende Symptomatik zu beschreiben. PEM ist mittlerweile ein zentrales Diagnosekriterium für ME/CFS geworden, da es eine klare Abgrenzung zu anderen Erkrankungen ermöglicht, bei denen Erschöpfung eine Rolle spielt.
In den vergangenen Jahrzehnten wurden zahlreiche Diagnoserichtlinien entwickelt, um die Krankheit besser zu erfassen und zu verstehen. Die ersten Versuche begannen in den 1980er Jahren mit den Holmes-Kriterien, gefolgt von den Oxford-Kriterien (1991) und den Fukuda-Kriterien (1994), die in der internationalen ME/CFS-Forschung häufig verwendet wurden. Diese genannten Kriterien haben aber eines gemeinsam: Eine, wie man heute weiß, mangelhafte Trennschärfe zwischen der körperlichen Erkrankung ME/CFS und psychischen Leiden, die zu einem gewissen Teil (zumindest, was die „Erschöpfung“ angeht) überlappende Symptome haben. Folglich wurden durch sie Diagnose und Forschung erschwert, weil hier Krankheitsbilder vermischt wurden, die nicht zusammengehören.
Später kamen die kanadischen Konsenskriterien und die internationalen Konsenskriterien für ME hinzu, die sich besonders auf PEM und andere spezifische Symptome konzentrierten, die für ME/CFS charakteristisch sind. Inzwischen hat auch das UK National Institute for Health and Care Excellence (NICE) in Großbritannien eigene Richtlinien zur Diagnose und Behandlung von ME/CFS veröffentlicht, die stärker auf die spezifischen Beschwerden der Betroffenen eingehen.
Ein weiterer wichtiger Schritt für die Anerkennung der Krankheit war die Aufnahme von ME/CFS in die Internationale Klassifikation der Krankheiten (ICD) der Weltgesundheitsorganisation. Seit der achten Ausgabe der ICD ist ME als eigenständige Krankheit gelistet und wird seit der neuesten Fassung nicht mehr als psychische oder Verhaltensstörung eingestuft. Diese Einordnung ist ein bedeutender Fortschritt für die betroffenen Menschen und ein Zeichen dafür, dass die medizinische Gemeinschaft zunehmend die Ernsthaftigkeit und Komplexität dieser Krankheit anerkennt.
Heute hat sich die Bezeichnung ME/CFS in der internationalen Forschung und Lehre etabliert, in klarer Abgrenzung zu anderen Erkrankungen, die mit Erschöpfungszuständen einhergehen. CFS sollte allein stehend nicht mehr verwendet werden, da es, auch durch Unkenntnis vieler Ärzte, mit „Fatigue Syndromen“, also anhaltenden Erschöpfungszuständen, zum Beispiel nach einer Krebstherapie oder auch aufgrund psychischer Leiden, verwechselt werden kann. Das hat dann für die Betroffenen regelmäßig schwerwiegende Konsequenzen, da es eine Fehldiagnose ist, die ebenso zu falschen Therapieempfehlungen führt. Darauf gehen wir an anderer Stelle ausführlicher ein.
Die Geschichte von ME/CFS verdeutlicht, wie langwierig der Prozess sein kann, bis eine Krankheit als reale, biologische Störung akzeptiert wird. Für die Betroffenen war und ist dieser Weg oft schmerzhaft, da sie lange Zeit missverstanden, nicht ernst genommen oder sogar als psychisch krank abgestempelt wurden. Heute wissen wir, dass ME/CFS eine reale, schwerwiegende Krankheit ist, die das Leben der Betroffenen massiv einschränkt. Die wissenschaftliche Forschung hat Fortschritte gemacht, doch die Arbeit ist noch lange nicht abgeschlossen. Doch die Aufnahme von ME/CFS in die ICD und die immer weiterentwickelten Diagnosekriterien sind Schritte in die richtige Richtung.
Quelle: „Long COVID Is Not a Functional Neurologic Disorder“ von Todd E. Davenport
Betroffenenbericht: Evelyn Glöß
Evelyn ist 47 Jahre alt, seit 26 Jahren verheiratet und hat drei Kinder im Alter von 25, 23 und 16 Jahren. Vor der Erkrankung war sie Erzieherin und Leiterin eines evangelischen Kindergartens mit 70 Kindern und 13 Mitarbeitern und für jeden als zuverlässiger Ansprechpartner da. Nun ist sie selbst auf Hilfe angewiesen. Eine große Umstellung.
Aus dem Leben gerissen und auf einen Bell-Wert von 30 gefallen, kann sie sich nur noch im Hause langsam bewegen. Spaziergänge in ihrer bergigen Heimat sind kaum möglich und der Alltag ist von Schmerzen und vielen Symptomen geprägt.
Du hattest im November 2020 eine COVID-Infektion und seitdem steht Dein Leben auf dem Kopf. Was genau ist passiert?
Am 3. November 2020 war ich zu einer OP im Krankenhaus. Am Tag meiner Entlassung aus dem Krankenhaus rief mich die Ärztin an und teilte mir mit, dass die für mich zuständige Krankenschwester positiv auf COVID-19 getestet wurde.