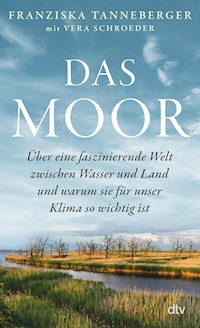
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Natur pur – Einblicke in das Leben im und mit dem Moor Das Moor: schmatzende, nasse Sumpflandschaften, wo Vögel nisten, Schilfpflanzen, Torfmoose und Gräser wachsen. Ein Lebensraum, der eine ganz besondere Artenvielfalt in sich birgt. Franziska Tanneberger, eine der bekanntesten Moorforscherinnen Deutschlands, nimmt uns mit zu Mooren auf der ganzen Welt. Wir zelten auf sinkendem Boden, folgen dem Seggenrohrsänger bis in den Senegal und erfahren, warum Moore Teil der Klimarettung sein müssen. Eine berührende Lektüre über die Liebe zur Natur und eine Moorexpertin, die zur Klimaschützerin wurde.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 362
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Franziska Tanneberger / Vera Schroeder
Das Moor
Über eine faszinierende Welt zwischen Wasser und Land und warum sie für unser Klima so wichtig ist
dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, München
Vorwort
Blinde Flecken sind unangenehm. Sie zu identifizieren und anzuerkennen, dass man sie hat, ist der erste Schritt zur Besserung. Erst nach der Erkenntnis, einen wichtigen Aspekt jahrelang unterbewusst ausgeblendet zu haben, kann die Heilung beginnen. Aber eine solche Erkenntnis kann wehtun.
Stellen Sie sich vor, Sie wachsen auf dem Land in einer Kleinstadt auf, die umgeben ist von Mooren. Stellen Sie sich vor, Sie fahren als Kind mit Ihrem Großvater regelmäßig in einen Ort namens Rothenmoor, ohne jemals zu verstehen, warum ihm das Gebiet so wichtig ist. Stellen Sie sich vor, Sie gehen mit der Familie regelmäßig im Wirtshaus »Moorbauer« essen, ohne zu wissen, dass es »nasse Landwirtschaft« tatsächlich gibt. Kurzum: Stellen Sie sich einen klimakatastrophenbewussten Menschen vor, der die Bedeutung von Mooren nicht kennt, obwohl er in einem Moorgebiet großgeworden ist.
Mir hat Franziska Tanneberger diesen blinden Fleck bereits aufgezeigt. Ihre Moorforschung und ihre beeindruckende Fähigkeit, die Bedeutung dieses Ökosystems für unsere Zukunft zu erklären, sucht in Deutschland ihresgleichen. Seit einem Gespräch mit Franziska für meine Sendung »Jung & Naiv«, in der ich regelmäßig Menschen aus der Politik und der Wissenschaft ausführlich interviewe, fahre ich mit anderen Augen durch meine Heimat und in meine Geburtsstadt Malchin in Mecklenburg-Vorpommern. Ich sehe Wiesen, auf denen Kühe grasen, und ich entdecke die Entwässerungsgräben oder kleinen Pumpenhäuschen außen herum. Ich sehe das Wasser, wie es am Rande des Kummerower Sees an manchen Stellen in die bereits wiedervernässten Felder fließt. Ich nehme endlich zur Kenntnis, dass diese Landschaft besonders ist, da sie schon immer vom Moor geprägt war, weil Malchin von Niedermoor umgeben ist, und dass das von meinem Großvater geliebte Rothenmoor ein Ort ist, der nach dem Zweiten Weltkrieg seine Jugend prägte, aber nicht nur die: Als ich ein Kind war, hat er mich regelmäßig in den dortigen Gutspark mitgenommen. Wir gingen spazieren, ließen uns von Mücken stechen und entdeckten gemeinsam seltene Pflanzen. Dass es dort manche Gattungen nur gibt, weil die Landschaft ein Moor ist, lernte ich wiederum erst später von meiner Biologielehrerin.
Franziska Tanneberger hat mir vor allem klargemacht, wie hoch die Kosten für die menschliche Urbarmachung in meiner Heimatregion für die Umwelt und das Klima sind. Die gute Nachricht: Es ist kein Geheimnis mehr, wie sich diese Kosten wieder einfangen oder zumindest begrenzen lassen. Wir brauchen unsere Moore und ihre Wiedervernässung, um ernsthaften Klimaschutz betreiben zu können. Und niemand kann die nächsten notwendigen Schritte so gut erklären wie Franziska Tanneberger. Deshalb ist dieses Buch so wichtig. Klar, Bäume pflanzen und Wälder schützen ist ebenfalls von Relevanz. Doch nichts speichert so viel Kohlenstoff über Jahrhunderte im Boden wie Moore!
Dieses Licht der Erkenntnis ist der Politik noch nicht hinreichend aufgegangen. Welch ein Skandal! Unser kollektives Handeln zerstört auch heute noch mehr Moor, als es schützt. Ernsthafte Klimaschutzpolitik muss die Moorwende vorantreiben – und zwar sofort. Im Großen wie im Kleinen. Es ist absurd, dass es im Jahr 2023 weiterhin politischer Wille ist, die »Küstenautobahn« durch Niedersachsen und Schleswig-Holstein fertigzustellen. Eine Strecke, die zur Hälfte durch Moorgebiete verläuft. Die Bedeutung der Moore wird zwar öffentlich anerkannt, ihr Schutz als Ziel definiert, doch es bleibt bei Lippenbekenntnissen und der Bereitschaft zur Zerstörung.
Franziska Tanneberger hat mir geholfen, klarer zu sehen. Dieses Buch lädt seine Leserinnen und Leser dazu ein, sich ebenfalls auf neue Wege der Erkenntnis zu begeben. Und es hilft hoffentlich auch dabei, dass die Regierungen mit ihrer halbherzigen Moorschutzpolitik nicht weiter durchkommen. Wie viele Jahre und Jahrzehnte wollen wir wegen unserer blinden Flecken noch verlieren? Wann verstehen wir in Deutschland, dass Moore nicht nur hübsche Landschaftsstriche für Wochenendausflüge sind, sondern für die Zukunft des Planeten elementar wichtig?
Tilo Jung, Januar 2023
Kapitel 1Von der Natur des Moores
Oft werde ich gefragt, wie ich zum Moor gekommen bin. Die schnelle, etwas oberflächliche Antwort lautet: Es hat sich halt so ergeben. So intensiv mein Engagement für dieses Thema heute als Leiterin des Greifswald Moor CentrumGreifswald Moor Centrum ist, so wenig war es ein lang geschmiedeter Plan, das mit mir und dem Moor. Für die tiefer gehende Antwort braucht es eine längere Geschichte. Ich glaube, es ist wichtig, sie zu erzählen. Nicht meine, sondern die des Moores. Aber beides ist heute für mich nun mal nicht mehr voneinander zu trennen.
Mein Herz schlug schon früh für die Natur. Für den großen Apfelbaum in unserem Garten in Rosenthal, Berlin-Pankow und für die große Buche, von der aus ich in meiner Kindheit in den 1980er Jahren, oben zwischen den Ästen sitzend, fast bis zur Mauer gucken konnte. Am liebsten spuckte ich Pflaumenkerne auf die Straße vor unserem Haus.
Mein Herz schlug für die Blumen und Pflanzen, die ich mit meiner Mutter in den ewigen Sommerferien auf UsedomUsedom sammelte. Behutsam trugen wir die Beute in unser Ferienzimmer unterm Dach und untersuchten sie mit Hilfe des dicken Buchs Pflanzen und Tiere. Ein Naturführer, das mir meine Eltern 1984 zum Schulanfang geschenkt hatten. Oder für die Vogelstimmen, die ich in diesen Urlauben mit meinem sieben Jahre älteren Bruder Thomas erraten durfte: Wiesenpieper, Schafstelze, Nebelkrähe. Mein Bruder war damals beim »Naturschutzaktiv Berlin-Pankow«, einer Gruppe junger Leute, die sich in der DDR vor allem um praktische Dinge vor Ort kümmerte: Feuchtwiesen mähen, Müll einsammeln, gefährdete Tierarten erfassen, solche Sachen. Oft lauschten wir auch einer Schallplatte mit Vogelstimmenaufnahmen und der sonoren, märchenonkelhaften Stimme von Prof. Günter Tembrock. Bis heute fühle ich mich überall dort zu Hause, wo Vögel zu hören sind.
Auch nasse Landschaften faszinieren mich, seit ich denken kann. Flüsse, Seen, das Meer. »So viel schöner Buddelsand!«, soll ich gerufen haben – so erzählt es meine Mutter jedenfalls –, als ich mit drei Jahren das erste Mal den Ostseestrand sah, mich mit voller Wucht in den Sand schmiss und jauchzte. Ich, das Berliner Stadtkind, die Mutter Dramaturgin, der Vater Arzt. Auf UsedomUsedom hatten wir ein schweres, altes Fischerboot namens Asti, in dem mein Vater uns als Kinder oft herumruderte. Ich erinnere mich an das schönste Sommergefühl, wenn meine Hand ins Meer eintauchte und das Achterwasser durch meine Finger glitt. Kleine, aus einem Schilfblatt zusammengebogene Boote machten sich in ungezählter Menge auf die Reise. Später liebte ich es, stundenlang mit unserer Segeljolle Asti II über die Schaumkrönchen zu gleiten.
Aber das Moor? Es lag sogar eines ums Eck auf UsedomUsedom, an das ich mich erinnere. Ein kleines Fleckchen Land im Lieper Winkel, kein Fußballfeld groß, Maibruch genannt. Wenn ich manchmal mit meiner Familie in der Dämmerung daran entlanglief, an toten Baumstämmen auf sumpfigem Boden, gruselte es mich. Ich war acht, meine Schwester dreizehn Jahre alt. Während die Mücken um uns herumschwirrten, erzählte Katharina die Geschichte der Käuzchenkuhle, ein DDR-Kinderbuchklassiker von Horst Beseler: Ein Junge aus Berlin entdeckt in den Sommerferien auf dem Land ein Geheimnis, eine in einem See versenkte Kiste mit Nazi-Raubkunst.
Ich bekomme es heute nicht mehr genau zusammen, ob es wirklich dieses reale Stückchen dunkle Landschaft war, das mich damals so berührte, dass ich es als erste bewusste Moorerinnerung abspeicherte – und zwar genau in dem klischeehaften Bild, gegen das ich heute als Wissenschaftlerin anarbeite. Oder ob es vielleicht doch eher der Buchumschlag von Käuzchenkuhle war, den ich nach den spannenden Erzählungen meiner Schwester immer wieder ehrfurchtsvoll studierte. Das Cover zeigt kahle Bäume, einen Mond und eine dunkle, feuchte Landschaft, also genau das, was man sich unter einem Moor eben vorstellt als Kind. Und genau so sah auch mein Maibruch aus. Menschen meines Alters, die im Westen aufgewachsen sind, verbinden ähnliche Gruselgefühle mit einer traumatisierenden Filmszene aus Michael Endes Die unendliche Geschichte, in der Atréjus Pferd Artax in den Sümpfen der Traurigkeit versinkt.
Obwohl ich mich heute als Moorforscherin dafür einsetze, dass die Menschen eben nicht immer gleich an Moorleichen denken oder an das schaurige Gedicht vom Knaben im Moor, wenn sie sich mit diesem so besonderen Ökosystem beschäftigen, kann ich die Gründe dafür nachvollziehen. Es ging mir schließlich selbst einmal so. Über Jahrtausende hat der Mensch sich gefürchtet vor dem, was ein natürliches Moor auch ausmacht: kalter Sumpf, undurchdringliche Dunkelheit, mysteriöses Verschwinden und versunkene menschliche Spuren.
Als der Moorforscher Hans JoostenJoosten, Hans und ich vor einigen Jahren mit Wissenschaftler*innen aus allen europäischen Ländern das dicke europäische Moorbuch Mires and peatlands of Europe zusammenstellten, sammelten wir Begriffe, die nasse Moorlandschaften in anderen Sprachen bezeichnen.[1] Hans JoostenJoosten, Hans, der im vorliegenden Buch noch öfter auftauchen wird, war nicht nur mein wichtigster Dozent, durch den ich überhaupt erst beim Moor gelandet bin – er ist auch ein Mensch, der seit über 25 Jahren Datenbanken zu unseren Mooren mit aufbaut und für diese weltweit einzigartige Arbeit das Bundesverdienstkreuz und den Deutschen Umweltpreis bekommen hat.
Die Briten sagen »wasteland« zu ihren Mooren, auf Deutsch in etwa: überflüssiges Land. Ähnlich die Niederländer: »woeste gronden«, wildes Gebiet. In Spanien gibt es den Begriff »tierra desolada«, trostloses Land. In Dänemark »ødemarken«, Ödland, oder in Frankreich »terrain vague«, was so viel wie »unbestimmbares Gelände« bedeutet. In Portugal nennt man Moore Ödland, »terra inculta«, und in Polen »Nichtnutzbares«, »nieuzytki«. Allein in der Sprache zeigt sich, dass dieses Land oft als nutzlos, wertlos, öde, wüst und kulturlos angesehen wird. Überall auf der Welt denken wir Moorforschenden deswegen auch darüber nach, wie man anders, zugewandter über Moore sprechen könnte.
Denn es ist höchste Zeit für einen Imagewandel des Moores. Der schön-schaurige Grusel gehört in die Vergangenheit. Ich wünsche mir freundliche, staunende Augen, mit denen wir Menschen in Zukunft auf unser nasses Land schauen – in voller Kenntnis all der faszinierenden und wichtigen Fähigkeiten, die das Moor besitzt. Hedwig, die Eule von Harry Potter, hat es geschafft, die Vogelordnung »Eule« vom mysteriösen Nachtkauz mit unheimlichen Glupschaugen und geheimnisvollem Ruf zu einem neuen Lieblingstier zu machen, das auf den T-Shirts ganzer Kindergenerationen zu sehen ist. So in etwa stelle ich mir das auch für das Moor vor.
Eines der ersten Dinge, die ich in meinem Studium um die Jahrtausendwende lernte, war, wie sehr Moore als Landschaften geschützt und bewahrt werden müssen – und wie stark das bisher übersehen wurde. Meinen Studiengang »Landschaftsökologie und Naturschutz« hatte der bekannte BiologeSuccow, Michael Michael Succow an der Universität Greifswald damals gerade frisch gegründet, er holte auch Hans Joosten dazu – ohne diese beiden wäre ich also nie Landschaftsökologin geworden und ganz sicherlich auch keine Moorkundlerin. Heute beschäftigt mich vor allem die Tatsache, dass das Ökosystem Moor für die beiden großen Themen der globalen Gegenwart, KlimawandelKlimawandel und BiodiversitätBiodiversitätsverlust, mitentscheidend sein wird.
Die Reise dieses Buches beginnt zwar dort, wo es schmatzt und tropft. Wo Mücken herumsausen und eine Stille herrscht, wie ich sie von keiner anderen Landschaft kenne. Die Reise beginnt im naturnahen Moor beziehungsweise bei den ökologischen Grundlagen, die wir aus diesem naturnahen und ursprünglichen Zustand unserer Moore ableiten können und die wir verstehen müssen, um die weitere Geschichte zu erzählen.
Aber die Beziehung von Mensch und Moor ist mit der Beschreibung weitgehend ursprünglicher, nasser Sumpflandschaften lange nicht zu Ende. Moore sind viel mehr als das. Sie können heute aussehen wie Kartoffeläcker oder eine Wiese mit Kühen. Die Reise dieses Buches beginnt deshalb auch mit der Beschreibung einer begrifflichen Verwirrung, die seit vielen Jahren zu zahlreichen Missverständnissen führt.
Was also ist ein Moor?
Meine Lieblingsantwort ist die, dass ein Moor ein Teil unserer Landschaft zwischen Wasser und Land ist. Im natürlichen Zustand ist diese Landschaft nass und hat die Eigenschaft, Pflanzenmaterial (also KohlenstoffKohlenstoff) im Boden langfristig zu sammeln und zu speichern. Entscheidend ist dafür das Zusammenspiel aus drei Dingen: Boden, Pflanzen und Wasser. Keins davon ohne das andere, nur alle drei miteinander machen ein intaktes Moor aus.[2] Nasse Moore funktionieren ganz ähnlich wie Wälder, nur dass der KohlenstoffKohlenstoff maßgeblich im Boden steckt und nicht in den Bäumen. Schicht für Schicht und über Jahrtausende bildete sich aus abgestorbenen und durch das Wasser luftdicht konservierten Pflanzenresten im Boden der für das Moor so typische TorfTorfboden.
KohlenstoffKohlenstoff, den die Pflanzen durch ihre Fähigkeit zur Photosynthese aus dem CO₂CO2 der Luft gewonnen haben, wurde im Boden eingelagert. Dieser Prozess der Kohlenstoffeinlagerung ist der Grund, warum man bei natürlichen MooreMoore, naturnahen auch von »CO₂-Senken« spricht. Es sind Landschaften, die der Luft CO₂ entziehen und den Anteil dieses Gases in der AtmosphäreAtmosphäre dadurch reduzieren. Jedenfalls solange sie nass sind. Werden Moore trockengelegt, entweicht genau dieser Kohlenstoff wieder als CO₂ in die Atmosphäre. Man kann sich das am besten vorstellen, wenn man an ein Gurkenglas denkt: Wenn die Gurken im Essigwasser liegen, bleiben sie jahrelang konserviert. Öffnet man den Deckel und nimmt die Gurke heraus, zersetzt sie sich binnen weniger Tage. Dieser Zersetzungsprozess macht die Moore für den menschengemachten KlimawandelKlimawandel relevant. Denn je mehr CO₂ in der Atmosphäre ist, desto heißer wird es auf unserem Planeten.
Die Dimension ist gigantisch: Etwa ein Drittel des Kohlenstoffs, der weltweit in den Böden stecktMoorböden, ist im Moor – obwohl diese nur 4 Prozent der Landfläche der Erde bedecken.[3] Beim Wald, mit dem das Moor oft verglichen wird, ist es viel weniger, dabei nimmt er weltweit eine fast zehnmal so große Fläche ein. Solange der KohlenstoffKohlenstoff im Boden verschlossen bleibt, haben die Moore eine Klimaschutzfunktion. Kommt er heraus, weil zum Beispiel der Mensch den Moorboden trockengelegt hat, um ihn zu bewirtschaften, beschleunigt das entwässerte Moor den KlimawandelKlimawandel.
Das sprachliche Missverständnis liegt nun darin, dass viele Menschen sich unter einem Moor allein die naturnahen MooreMoore, naturnahe vorstellen. Bei entwässerten Mooren sprechen sie von »ehemaligen Mooren« – wenn sie denn überhaupt als solche erkannt werden. Denn entwässerte MooreMoore, entwässerte sehen überhaupt nicht mehr wie glucksende Sümpfe aus, sondern zum Beispiel wie ganz normales Ackerland. Wir sollten aber auch entwässerte Moore weiterhin als Moore beziehungsweise Moorböden bezeichnen, so wie es in der Bodenkunde gemacht wird. So lange, wie eine Torfschicht im Boden vorhanden ist.
Oder noch anders erklärt: Die aktuelle Moorfläche in Deutschland beträgt in absoluter Größe etwa 1,8 Millionen Hektar, also in etwa die Fläche von Sachsen. Damit sind alle Flächen gemeint, in denen noch eine Torfschicht vorhanden ist, und auch die sogenannten Anmoore.[4] In der Vergangenheit gab es noch mehr dieser Flächen, vor 300 Jahren waren es wahrscheinlich über 2 Millionen Hektar. Aber einen Teil der Flächen haben wir durch TiefentwässerungenTiefenentwässerung oder TorfabbauTorfabbau unwiederbringlich verloren, es ist kein TorfTorf mehr vorhanden, sondern zum Beispiel nur noch der unter dem Torf liegende Sand. Hier kann man tatsächlich von »ehemaligen Moorflächen« sprechen, das eingelagerte CO₂CO2 ist bereits komplett in die AtmosphäreAtmosphäre entwichen.
Die heute noch vorhandenen 1,8 Millionen Hektar Moorböden befinden sich grob vereinfacht in drei verschiedenen Zuständen. Zuerst sind da die naturnahen, nassen Moorflächen, also solche MooreMoore, naturnahe, die bisher von menschlichen Eingriffen weitgehend in Ruhe gelassen wurden. Sie machen in Deutschland aber nur noch etwa 2 Prozent aller Moorflächen aus, ungefähr 30000 Hektar. Die allermeisten dieser Flächen sind NaturschutzgebieteNaturschutzgebiete.[5]
Dann gibt es die trockenen MoorbödenMoorböden, auf denen der Mensch wirtschaftet und die etwa 94 Prozent aller Moorflächen in Deutschland ausmachen. Sie sind auf den ersten Blick kaum mehr von anderem landwirtschaftlichLandwirtschaft genutztem Land zu unterscheiden. Auf diesem MoorMoore, entwässerte wachsen Mais oder weiden Kühe. Zum Teil sind Städte auf ihnen gebaut worden, wie Berlin oder Hamburg. Diese 94 Prozent sind die Flächen, die leider im allgemeinen Sprachgebrauch oft nicht mehr als Moore bezeichnet werden.
Und es gibt die wiedervernässten MoorflächenMoore, wiedervernässte, also Flächen, die einmal entwässert waren, auf denen die EntwässerungEntwässerung allerdings gestoppt wurde. Bei uns sind das insgesamt etwa 4 Prozent der gesamten Moorfläche, 70000 Hektar.[6] Auch wiedervernässte MooreMoore, wiedervernässte sehen anders aus als naturnahe Moore. Sie erinnern optisch manchmal an überspülte oder überflutete Landschaften. Wenn man genauer hinschaut, finden sich in den allermeisten wiedervernässten Mooren wieder moortypische Pflanzen und Tiere. Sie nehmen viele der nützlichen Fähigkeiten wieder auf. Sie speichern WasserGrundwasser, kühlen die Landschaft, können HochwasserHochwasser aufnehmen, filtern und reinigen Wasser. Vor allem aber geben sie kein CO₂CO2 mehr in die Luft ab.
Das deutsche Wort »Moor« kann also torfhaltigen Boden in unterschiedlichen Zuständen bezeichnen, und ich nutze es hier – übereinstimmend mit vielen modernen Moordefinitionen – für Landflächen mit einer Torfschicht. International ist das englischsprachige Wort »peatland« etabliert, das anschaulich beschreibt, worum es geht: Land, wo »peat«, also TorfTorf, vorhanden ist. Naturnahe Moore heißen »mire«. Das eigentliche Wort »Moor«, das es im Englischen auch gibt, ist dort kein Fachbegriff, sondern ein umgangssprachliches Wort, vor allem für Heidelandschaften.
Wie unsere Moore entstanden sind
Die MooreMoorböden in Deutschland begannen am Ende oder kurz nach der letzten EiszeitEiszeit zu wachsen. Vorher gab es natürlich auch welche – sonst hätten wir heute weder KohleKohle noch ErdgasErdgas. Ja, wirklich: Auch diese heute als Klimakiller bekannten fossilen Rohstoffe sind ursprünglich auf uralte Moore zurückzuführen: Schon vor 300 Millionen Jahren war die Erde zugewachsen mit riesigen Schachtelhalmwäldern, also torfbildenden Pflanzen, die über die Jahrmillionen enorme Mengen KohlenstoffKohlenstoff unter der Erde verpackten. Durch viel Druck und hohe Temperaturen aufgrund von Erdplattenverschiebungen entstanden über geologische Zeiträume daraus Kohle und Erdgas, deren menschengemachter Abbau uns wiederum heute so existenzielle Probleme bereitet. Der biologische Prozess, der am Anfang stand, war die Bildung von TorfTorf.
Unsere heutigen Moore begannen zu wachsen, als sich die Gletscher der letzten EiszeitEiszeit vor etwa 12000 Jahren endgültig wegen ansteigender Temperaturen aus Mitteleuropa zurückzogen. Diese Gletscher und die Trockenheit des kalten Klimas waren aus heutiger Sicht das letzte Störereignis für die Moore in unseren Breiten, von da an begann eine neue Zeitrechnung.
Die Gletscher verschwanden. An manchen Stellen blieben zunächst große Eisklötze zurück, die Bodenmulden bildeten und etwas länger brauchten, um schließlich auch zu schmelzen. In solchen Senken oder anderen Vertiefungen sammelte sich Wasser. Am Rande der Flüsse oder in Niederungen ebenso. Es wuchsen Pflanzenarten, die diese Feuchtigkeit tolerierten. Einige dieser Pflanzen waren torfbildend. Torfbildende PflanzenPflanzen, torfbildende wachsen wie alle Pflanzen oberirdisch, mit ihren unterirdischen Teilen aber letztlich im Wasser. Weil der Luftabschluss dort dafür sorgt, dass die Pflanzenreste weniger stark abgebaut werden als in trockenen Böden, sammelte sich ein Überschuss an abgestorbenem Pflanzenmaterial an. Das Moor wuchs – und wo man es in Ruhe gelassen hat, wächst es noch heute.
Dieses Wachstum der Torfschicht eines Moores beträgt bei uns im Mittel etwa 1 Millimeter im Jahr. In unseren Breiten konnten dadurch über die Jahrtausende MoorbödenMoorböden von bis zu 10 Metern Höhe entstehen. In Griechenland, wo sich in der letzten EiszeitEiszeit keine Gletscher bildeten und Torf weiter wachsen konnte, gibt es mit dem Philippi-MoorPhilippi-Moor sogar ein Moor mit einer 190 Meter dicken Torfschicht. Es hatte dort einfach sehr viel mehr Zeit, sich aufzubauen. Das Philippi-Moor erzählt kontinuierlich die Erdgeschichte der letzten 1,35 Millionen Jahre – und ab einer Tiefe von 120 Metern könnte man sogar »live« bei der InkohlungKohleInkohlung, also dem Entstehungsprozess von KohleKohle aus Torf, zusehen.[7]
Wo genau ein Moor entsteht, hängt vom Wasser ab, also davon, ob sich an einer entsprechenden Stelle zum Beispiel durch eine Bodenmulde oder eine natürliche Stauung Wasser gut halten kann, oder wie viel Niederschlag es gibt. Manchmal ist auch eine Grundwasserschicht angeschnitten, die wie eine Quelle für das entstehende Moor funktioniert. Die allgemein bekannte Unterscheidung zwischen Hochmooren und Niedermooren bezieht sich grob gesagt darauf, woher ein Moor sein Wasser bezieht. Während HochmooreHochmoore meist irgendwann den Kontakt zum GrundwasserGrundwasser als Quelle verloren haben und allein durch die Regenfälle feucht bleiben und immer weiter in die Höhe wachsen, gewinnen NiedermooreNiedermoore ihr Wasser von unten aus dem Grundwasser sowie zusätzlich von oben. In Deutschland liegen die meisten Niedermoore im Nordosten, also in Mecklenburg-Vorpommern und BrandenburgBrandenburg. Hochmoore gibt es vor allem in Schleswig-Holstein, in Niedersachsen und in Bayern. Es sind die Gebiete, in denen mehr Regen fällt. Ich selbst bin als Wissenschaftlerin spezialisiert auf Niedermoore, was sicherlich auch meinen Blick und die Auswahl der Geschichten in diesem Buch an der ein oder anderen Stelle prägt.
Sorgen Wasser und Umgebung nun für Bedingungen, unter denen torfbildende Pflanzen gut ihre Arbeit verrichten können, kann der TorfTorfboden Jahr um Jahr nach oben wachsen. Je nach Umgebung geht dieser Prozess zum Teil sehr lange weiter. Außer, der Mensch greift ein – so wie es auf der Erde in den vergangenen Jahrhunderten in einigen Regionen und ganz besonders in Deutschland geschehen ist.
Doch werfen wir zunächst noch einen genaueren Blick auf die biologischen Grundlagen der drei entscheidenden Elemente des Moors: den Boden, also den Torf. Die Pflanzen und das Wasser. Ergänzt durch die Tiere, weil auch sie mir besonders am Herzen liegen.
Torf
Torf besteht zu großen Teilen aus konservierten abgestorbenen Pflanzenteilen. Die Anwesenheit von Torf unterscheidet Moore von mineralischen Böden, die den Großteil der Böden auf der Erde ausmachen. Mineralische Böden bestehen zum Beispiel aus Kies, Sand, Lehm oder Ton. Sie speichern weniger KohlenstoffKohlenstoff in der Erde – im Gegensatz zu den Moorböden.
MooreMoorböden werden oft auch als Archive oder Chroniken der Landschaft bezeichnet. Die im Torf konservierten Reste von Pflanzen erzählenTorf über die Vergangenheit. Im Gegensatz zu Sedimenten, die sich irgendwo abgelagert haben, verrät ein Moorboden in seinen verschiedenen Schichten genau das, was an dieser Stelle über die Jahrtausende gewachsen ist und welche Bedingungen dort herrschten. Man spricht von der »Sprache der Moore«, die es in den Resten von Pflanzengewebe, Samen und Pollen aus dem Torf zu verstehen gilt. Der Pollen, der mit dem Wind weit fliegen kann, ermöglicht es sogar, die frühere Pflanzenwelt über die Grenzen des Moores hinaus zu rekonstruieren.
Die Inspektion des BodensMoorböden ist deswegen ein entscheidender Teil unserer Arbeit als Moorforschende. Die Klappsonde, mit der wir den Boden anbohren können, um unsere Reise in die Vergangenheit zu beginnen, ist das wichtigste Werkzeug. Detektivisch lässt sich anhand der Samen und Pollen aber nicht nur herausfinden, ob an dieser Stelle mal ein Wald war oder eine Wiese oder ein See. Mit geeigneten Techniken kann man auch die Zeiträume festlegen, in denen die jeweilige Schicht entstanden ist. Vor 13000 Jahren etwa ereignete sich in der Eifel ein großer Vulkanausbruch. Bis heute findet sich in Teilen Deutschlands eine Schicht Asche von diesem Ausbruch in den Ablagerungen der Moore. Diese Ascheschicht funktioniert als Zeitmarker, an dem man sich gut orientieren kann.
Wenn ich ins nasse Moor gehe, trage ich Watstiefel, also Gummistiefel, die bis zur Hüfte reichen und die ich auch mal ausziehen und ausschütten kann – eine eher wacklige Angelegenheit. Die Klappsonde, auch Kammerbohrer genannt, ist ein rundes und dabei hohles Gerät, etwa mit dem Durchmesser eines Schnapsglases, das man mit Kraft in den BodenMoorböden schiebt, dreht und anschließend wieder herauszieht und dann zur Hälfte aufklappt. Schicht für Schicht zeigt sich nun der MoorbodenTorfboden in seinen unterschiedlichsten Zuständen, bis tief unter den Grund. Mit dem Bohrer dringen wir manchmal bis zu 10 Meter vor. Besonders aufpassen muss man, dass der Bohrer beim Wechseln des Handgriffs, was bei jedem weiteren Anbau von Verlängerungsstangen notwendig ist, nicht einfach in die Tiefe des Bohrlochs runterrauscht und verloren geht. In SibirienSibirien haben wir einmal einen solchen Bohrer, der weit über 5 Meter im Boden steckte, am oberen Ende irgendwie wieder aus dem Dunkeln herausgefischt. Eine tagesfüllende und sehr matschige Beschäftigung, auch weil unter einem ständig alles nachgibt.
Die Spuren, die Pflanzen und ihre typischen Reste im TorfTorf hinterlassen, erzählen viel, ebenso wie der Grad der Zersetzung der jeweiligen Torfschichten.[8] Er beschreibt, wie stark die Pflanzenteile bei der Bildung des Torfes zersetzt waren. Sind die Pflanzen frisch und gut erhalten, war das Moor vermutlich durchgehend nass. Wenn der Wasserstand abgesenkt war oder stark schwankte, sind die Pflanzenreste bereits stärker zersetzt. Die Schichten und die Pflanzenreste lassen sich dann weniger gut unterscheiden und werden zu einem diffusen braunen Brei. Quetschprobe heißt die Methode, den Torf in der Hand so zu zerquetschen, dass man den Zersetzungsgrad erfühlen kann. Nicht zu verwechseln mit der Knirschprobe: Um zu testen, welche Anteile an Torf und mineralischem Material in einem Boden sind, nehme ich ein Stück in den Mund und beiße vorsichtig darauf herum. Torf hat nicht besonders viel Geschmack, aber fühlt sich im Mund frisch und kalt an. Je reiner der Torf ist, desto weniger knirscht es. Spürt man mehr Ton oder Sand zwischen den Zähnen, ist der mineralische Anteil des Bodens höher. Man lernt mit der Zeit, daraus die Verteilung grob zu schätzen. Will man es genau wissen, kann man die Probe auch verbrennen. Die Pflanzenreste verschwinden bei diesem Prozess, übrig bleibt der mineralische Anteil. Das nennt man dann »den Glühverlust bestimmen«.[9]
Aber ab welchem Verhältnis ist der BodenMoorböden, der TorfTorf enthält, überhaupt ein Moorboden? Bisher wurde Moorboden oft über die 30/30-Regel definiert: Man spricht von einem Moorboden, wenn die Torfschicht mindestens 30 Zentimeter beträgt. Diese Torfschicht wiederum ist erst dann wirklich eine Torfschicht, wenn der Anteil an abgestorbenen Pflanzenresten ebenfalls 30 Prozent ausmacht. Bei 15 bis 30 Prozent spricht man von AntorfAntorf und Anmoorboden. Unter 15 Prozent sind es Mineralböden, was der weitaus häufigste Boden auf der Landfläche der Erde ist.
Der Weltklimarat hat sich entschieden, alle kohlenstoffreichen Böden in den Treibhausgasinventaren zu berücksichtigen, also Moore und Anmoore.[10]Anmoore Denn auch Anmoore können, wenn sie entwässert sind, viel CO₂ freigeben. Nicht so viele Jahre wie ein richtiges Moor, weil die SchichtTorf schneller aufgebraucht ist, aber über die Größe der globalen Flächen doch in einem relevanten Ausmaß. Moore und Anmoore zusammen bezeichnet man als organische Böden.
Für mich persönlich ist ein intakter MoorbodenMoorböden vor allem kühl, frisch und einfach anders. Die gut erkennbaren Pflanzenreste erinnern an die Vergangenheit, das Wasser ist Leben, und das Wissen um die so enorme Bedeutung von Mooren für den KlimaschutzKlimaschutz lässt mich an die Zukunft denken.
Pflanzen
Die eleganteste Art, ein Moor zu erkennen, ist sicherlich, die PflanzenMoorpflanzen genau unter die Lupe zu nehmen. Allein von den Namen her macht das Spaß, weil es so viele Möglichkeiten gibt, Bekannte aus der Welt des Biologieunterrichts auch in ihrer Moorvariante kennenzulernen: eine hübsche Moororchidee, das unscheinbare Moorglöckchen, den weißlich blühenden Moorabbiss. Dazu die Varianten mit Moos, die auch oft im Moor wachsen – die leckere Moosbeere, den schlanken Moosfarn, das kleine Moosglöckchen.
Die PflanzenMoorpflanzen, die Menschen am schnellsten mit Mooren in Verbindung bringen, sind die TorfmooseTorfmoose, wissenschaftlich »Sphagnum« genannt. Ihre Schwestern und Brüder in den Niedermooren heißen »Braunmoose« und sind interessanterweise grün. Moose sind eine faszinierend einzigartige und uralte Gruppe von Pflanzen, was sich allein dadurch bemerkbar macht, wie viele verschiedene Moosarten es gibt. In Deutschland sind weit über tausend bekannt. Nicht alle Moose sind torfbildend, manche wachsen auch im Wald und verwandeln den Mineralboden dort in einen grünen Zauberteppich.
Aber die MooseMoorpflanzenMoose im MoorMoorpflanzen können TorfTorf bilden und besitzen eine zweite für Moore bestechende Eigenschaft: Sie speichern außergewöhnlich viel Wasser. Ein vollgesaugtes Torfmoos kann sein Gewicht verzwanzigfachen. Nimmt man die nasse Pflanze in die Hand und quetscht sie zusammen, fühlt sie sich an wie ein Schwamm. Das Praktische an dieser Eigenschaft ist für die MooreMoorpflanzen, dass es den Pflanzen so gelingt, unterschiedlichste Wasserstände auszugleichen. Die Moosteppiche dehnen sich und schrumpfen mit dem Wasserstand. Sie schützen das Moor auf diese Weise davor auszutrocknen.
Besonders beeindruckend sind Mooslandschaften in Feuerland, der Inselgruppe an der Südspitze Südamerikas. Hier sind viele Moore durch das typische, nach Ferdinand Magellan benannte Magellans Torfmoos knallrot. In Hangmooren können Torfmoose das Wasser so aufstauen, dass sich ein Gelände ähnlich einer gepolsterten Riesentreppe bildet. Manche Moose wachsen im Wasser und bilden schwimmende Inseln mit langen Teilen anderer Pflanzen bis in die Tiefe hinab.
Man kann bei MoosenMoorpflanzenMoose zwischen lebenden, gerade absterbenden und bereits abgestorbenen Pflanzenteilen kaum unterscheiden. Die Grenzen dieser Stadien sind viel fließender als bei anderen Lebewesen. Moose sterben nicht völlig, sie wachsen immer weiter und nur ältere Teile befinden sich in einem Zustand irgendwo zwischen Leben und Tod. Als Torfbildner sind sie auch deshalb so produktiv, weil sie nichts haben, was sie abwerfen könnten. Keine Blätter oder Äste. Stattdessen bringen sie ihren ganzen Pflanzenkörper in die Torfbildung mit ein.[11]
Allerdings sind Moose bei Weitem nicht die einzigen PflanzenMoorpflanzen, die nasse Moore prägen und TorfTorf bilden. Als markantes landschaftliches Element sind sie nur für HochmooreHochmoore typisch. Dort schimmern sie grün, gelb, braun oder rot, oft sind die Farben auch wild gemischt. Wenn dann noch ein paar verkrüppelte Birken im Moos stehen oder eine Kiefer vielleicht, dann bekommen die Landschaften genau die beinahe kitschige Schönheit, die man von Moor-Postkarten kennt.
Auch Erlen, Birken oder Kiefern können auf Moorboden wachsen. Aber sogar die recht stabilen Erlen sterben ab, wenn sie an die Nässe nicht bereits als junge BäumeMoorpflanzenBäume gewöhnt wurden, also lange im Trockenen standen und dann erst plötzlich mit viel Wasser zurechtkommen müssen. Die Anpassungsleistung der Bäume ist faszinierend. Manche bleiben ungewöhnlich klein, sinken so leichtgewichtig nicht zu tief ins Moor und ertrinken dadurch nicht, zum Beispiel die Krüppelkiefern. Andere, wie die Windflüchter, wachsen so, dass der Wind mit möglichst wenig Angriffsfläche um sie herumpusten kann. Wie Bäume ihre Wurzeln an Feuchtigkeit anpassen, kann man vor allem bei Mangroven und tropischen Sumpfwäldern sehen. Die Bäume haben spezielle Belüftungssysteme in ihren Wurzeln, die ein bisschen wie Stelzen aussehen, um im sauerstoffarmen Boden zurechtzukommen. Unsere Erlen können das auch und sind dabei die schnellsten Torfbildner von allen, weil sie viel Wurzelbiomasse produzieren und diese unter nassen Bedingungen kaum abgebaut wird.
Was für die HochmooreHochmoore die Moose, sind für die NiedermooreNiedermoore die SauergräserMoorpflanzenSauergräser. Das sind Pflanzen, die von Weitem aussehen wie hohes Gras, grün, dicht und manchmal ein bisschen struppig in ihrer Anmutung. Im Gegensatz zu den sonst vor allem bekannten runden Süßgräsern, die auf der Mehrzahl der Wiesen auf Mineralböden stehen, sind die Stängel der Sauergräser dreikantig. Die meisten Sauergräser nennen wir SeggenSeggen oder wissenschaftlich »Carex«. Es gibt unglaublich viele von ihnen; dünne, dicke, männliche, weibliche, zwittrige, grüne, lilafarbene oder braune. Viele Arten wachsen aufrecht und können zwischen 20 und 120 Zentimeter hohe Bulten, also regelrechte Erhebungen, bilden. Andere breiten sich eher am Boden wie ein Rasen aus. Seggen machen die typische Vegetation in einem NiedermoorNiedermoore aus. Zusammen mit dem berühmten SchilfSchilf, das wiederum jeder kennt. Schilf, auch als Schilfrohr bezeichnet, ist ein sehr groß geratenes Süßgras, hat einen runden Stängel und kann ebenfalls TorfTorf bilden. Das Schilf im Moor sieht zwar ähnlich aus, ist jedoch in vielen Funktionen anders als das am Rande eines Sees.
Es gibt auch SeggenSeggen in Hochmooren und TorfmooseTorfmoose in Niedermooren, aber eben nur wenig. Dazu kommen etliche Blütenpflanzen im Moor. Farne, auch Schachtelhalme. Moore können deshalb sehr unterschiedlich wirken. Die Fläche variiert stark. Ein Moor kann sehr klein sein, wie das Maibruch aus meiner Kindheit auf UsedomUsedom, gerade mal ein halbes Fußballfeld groß. Oder Tausende Hektar groß, wie das Teufelsmoor in Niedersachsen oder das Havelländische Luch in BrandenburgBrandenburg. Oder so groß wie das größte Moor der Welt in Russland, in das ich in meinen Zwanzigern mehrmals reisen durfte und von dem ich später noch erzählen werde. Die Pflanzen in all diesen Mooren unterscheiden sich. Aber auch, wie das Wasser sich in ihnen bewegt. Das Thema Moorklassifikation ist deshalb eines, das für Studierende ganze Semester füllt. Es gibt unterschiedlichste Ansätze, wie man Moore je nach Bodenbeschaffenheit, Pflanzenwachstum oder Wasserzulauf einteilen kann – und am Ende ist doch jedes ein eigenes Naturereignis für sich. »Jedes Moor ist ein Individuum«, sagen wir Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler.
Wasser
Die dritte entscheidende Komponente eines Moores muss ich wohl am wenigsten erklären: das Wasser. Der Grundstoff unseres blauen Planeten fällt entweder von oben auf die Erde – wenn es regnet, schneit oder Tau fällt. Oder es speist sich aus der Erde selbst, aus dem GrundwasserGrundwasser, aus Quellen, aus Flüssen und Seen. Wasser ist das, was alles am Leben hält, und wenn wir von der KlimakriseKlimawandel sprechen, sprechen wir durch die Effekte der Erwärmung immer auch von Verschiebungen, die den Wasserhaushalt betreffen. Unter anderem deshalb sind Moore, als Landschaften mit einem Wasserüberschuss, mitentscheidend in der aktuellen Krise – und eine große Hoffnung.
Nasse Moore ermöglichen die Speicherung von WasserGrundwasser, können Hochwasser und StarkregenNiederschlag aufnehmen sowie bei Dürren länger als die trockene Umgebung Wasser halten und durch Verdunstung kühlen.[12] Trockene Moore hingegen sind trocken wie ihre Umgebung auch, schlimmer noch: Die kaputten Torfe werden sogar wasserabweisend. Während natürliche Torfe große Poren haben, die sich je nach Wasserstand unterschiedlich füllen und wieder leeren können, verringert sich die Porosität nach längerfristiger EntwässerungEntwässerung irreversibel. Der TorfTorf verdichtet sich. Die Oberflächenstruktur ist dann nicht mehr benässbar. Der Boden kann kaum noch Regenwasser aufnehmen, es läuft ungenutzt ab.
Gleichzeitig ist das Wasser das Element, das in den Augen vieler MoorkundMoorforschunglerinnen und Moorkundler die schlüssigste Grundlage für eine Klassifikation der Moore bildet. Die bereits erwähnte Unterteilung in HochmooreHochmoore und NiedermooreNiedermoore, je nachdem, ob das Wasser vor allem durch NiederschlagNiederschlag oder durch das GrundwasserGrundwasser zugeführt wird, bleibt dabei naturgemäß grob.[13]
Als ich in den Jahren 2001 und 2002 Daten für meine Diplomarbeit sammelte, reiste ich durch Westsibirien und lernte verschiedenste Moortypen im Urzustand kennen. Die allermeisten dieser Moortypen gibt es in Deutschland überhaupt nicht mehr in einem naturnahen Zustand. Ich betrachte es heute als Geschenk, diese Vielfalt und Schönheit gesehen zu haben, bevor ich mich beruflich dann irgendwann vor allem den kaputten, degradierten Mooren zuwendete.
Wenn wir Moore danach einteilen, woher das Wasser kommt und wie es ihre Entwicklung ermöglicht hat – wie sie also »gespeist« werden –, spricht man auch von hydrogenetischen MoortypenMoortypen, hydrogenetische.[14] Wir unterscheiden bei uns in Deutschland: Quellmoore, Hangmoore, Versumpfungsmoore, Verlandungsmoore, Überflutungsmoore, Überrieselungsmoore, Durchströmungsmoore, Kesselmoore, Übergangsmoore und Regenmoore.
Wie diese Unterscheidung genau funktioniert? Nehmen wir als Beispiel das VerlandungsmoorMoortypen, hydrogenetischeVerlandungsmoor: Ein See ist entstanden. Am Rand dieses Sees ist das Wasser sehr flach. Dort setzen sich torfbildende Arten durch, die Stück für Stück nach innen laufend in den See hineinwachsen und unter sich TorfTorf bilden, bis der See aufgefüllt ist. Über einen langen Zeitraum wird so aus dem See ein Moor.
Ein VersumpfungsmoorMoortypen, hydrogenetischeVersumpfungsmoor wiederum entsteht, wenn sich der Wasserstand unabhängig von den torfbildenden Pflanzen verändert, zum Beispiel, weil irgendwo Wasser aufgestaut wird oder sich durch Waldrodung die Wassermenge in der Landschaft vergrößert hat. Dadurch wird ein Stück Land dauerhaft feucht, in dem sich nun ebenfalls torfbildende Pflanzen etablieren und mit dem Aufbau des Moorbodens beginnen können.
ÜberflutungsmooreMoortypen, hydrogenetischeÜberflutungsmoor entstehen an der Küste oder entlang von Flüssen, wenn wegen starker Wasserstandsschwankungen bestimmte Bereiche immer wieder sehr feucht werden, in denen torfbildende Pflanzen dann gleichfalls ihr Werk beginnen. An der Ostsee entsprechen viele der klassischen Salzwiesen diesem Moortyp: meernahe Weiden, die immer wieder überflutet werden, deren TorfTorf aber in trockeneren Phasen durch den Tritt der dort weidenden Tiere verdichtet wird, wodurch er auch bei Trockenheit ziemlich resistent gegen Mineralisierung ist und besonders lange hält. Die Torfschicht dieser Moore ist meist nur wenige Dezimeter mächtig, während der Torf in Verlandungsmooren bis zu einigen Metern dick sein kann.
Ganz andere, viel »aktivere« Moore sind die geneigten Moore, also solche, bei denen die Oberfläche einen (sei es auch nur sehr flachen) Hang aufweist. Hier verzögern die MoorpflanzenMoorpflanzen und die frisch gebildeten Torfe das Abströmen des Wassers und stauen so allmählich den Wasserstand an. Besonders verbreitet in Nordostdeutschland sind DurchströmungsmooreMoortypen, hydrogenetischeDurchströmungsmoore, in denen das Wasser langsam den leicht schrägen Moorkörper durchrieselt. Oder besser – durchrieselte. Die allermeisten Durchströmungsmoore in Deutschland sind entwässert und wir können uns nur denken, wie sie früher funktioniert haben.
Bei unregelmäßiger Wasserzufuhr führt ein Wechselspiel zwischen oberflächlicher Austrocknung, Torfverdichtung und dadurch wiederum stärkeren Wasserstandsschwankungen und zeitweiser Austrocknung zu Mooren mit ziemlich verdichteten Torfen. In ihnen kann das Wasser nur noch über den TorfTorf (und nicht durch ihn) rieseln, wir nennen sie daher ÜberrieselungsmooreMoortypen, hydrogenetischeÜberrieselungsmoore.
Auch KesselmooreMoortypen, hydrogenetischeKesselmoor gehören zu den besonders aktiven Mooren, denn sie bilden unter sich abdichtende Schichten. Dadurch steigt der Wasserstand in den oftmals kleinen, im Wald und wie in einem Kessel liegenden Mooren an und das Moor kann in die Höhe wachsen.
Die nur vom Regen gespeisten Moore werden meistens als HochmooreHochmoore, aber auch als RegenmooreMoortypen, hydrogenetischeRegenmoor bezeichnet. Bei ihnen sind die TorfmooseTorfmoose das A und O – sie bremsen die Wasserströmung sehr effektiv. Torfmoose können Wasser extrem gut speichern und zersetzen sich nur sehr langsam, und das trifft auch auf die von ihnen gebildeten Torfe zu. In Zeiten von Trockenheit und hoher Verdunstung können sie dadurch das Abfließen von Wasser minimieren und zumindest tiefere Torfschichten immer nass halten.[15]
In der Realität wachsen oft verschiedene Moortypen nebeneinander. Über die Zeit können auch unterschiedliche Typen übereinander entstehen.
Tiere
Die TiereMooreTiere, die in einem Moor leben, sind ein Schatz, der auf den ersten Blick gar nicht so leicht ersichtlich ist. Am bekanntesten sind wahrscheinlich noch die Vögel, die man mit einem nassen Moor in Verbindung bringt. Das können Kraniche sein, Schnepfenvögel, die Rohrweihe als typischer Greifvogel der Moore oder die Sumpfohreule. Aber es gibt auch ganz viele Schmetterlinge in Mooren, Libellen, Spinnen und Käfer, die sich tief in den Pflanzenschichten bewegen.[16] Manche Mäuse – wie die Wasserspitzmaus – können sehr gut schwimmen, finden sich zwischen den Pflanzen im Moor aber ebenfalls gut zurecht. In SkandinavienSkandinavien ziehen Elche durchs Moor, die außergewöhnlich große Hufe haben und so weniger Bodendruck ausüben. Auch Hirsche schaffen es, tief ins nasse Land vorzudringen, zumindest in bewaldeten Gebieten. In wiedervernässtenWiedervernässungMoorenMoore, wiedervernässte halten manche Landwirte WasserbüffelWasserbüffel.
Alles, was Beine hat, bewegt sich im nassen Land zwischen den Pflanzen hin und her, von Blättchen und Wurzel zum nächsten Halm. Deshalb ist der Bewuchs für viele Arten so wichtig. Dabei kommt es nicht nur auf die Pflanzen selbst an. Es ist auch entscheidend, wie dicht sie wachsen. Wenn die Pflanzen zu weit auseinanderstehen, kommen viele TiereMooreTiere nicht mehr voran. Wenn sie zu dicht wachsen, weil zum Beispiel über die Luft von einem benachbarten, stark gedüngten Feld zu viele Nährstoffe ins Moor eingetragen werden, die da eigentlich gar nicht hingehören, finden manche Arten keinen Platz für ihre Nester oder Brutstätten mehr.
Ich habe meine Doktorarbeit in den Jahren 2006 bis 2008 über den SeggenrohrsängerSeggenrohrsänger geschrieben, einen etwa 12 Gramm leichten, kleinen Vogel, der nur in Mooren vorkommt und eng an diesen Lebensraum gebunden ist. Wenn man ihn in der Hand hält, ist das ein ganz besonderes und berührendes Gefühl – man spürt das winzige Herz ganz schnell schlagen. Man fühlt, wie leicht und zerbrechlich so ein kleines Federbündel und Vogelleben ist. Leider ist der Seggenrohrsänger heute bei uns nicht mehr zu finden – weil er seinen Lebensraum verloren hat.[17]
Der Bestand des Seggenrohrsängers wird über die singenden Männchen gezählt, da man die Weibchen kaum zu Gesicht bekommt. Früher gab es den Vogel auch in Ländern wie Italien, den Niederlanden und in vielen Regionen von Deutschland. Heute findet man ihn nur noch in Polen, Belarus, Litauen und der Ukraine. Dort ist sein Lebensraum, intakte naturnahe NiedermooreNiedermoore, noch besser erhalten. Und doch auch bedroht.
In Deutschland gab es den letzten Nachweis eines Seggenrohrsängers zur Brutzeit 2014 im Nationalpark Unteres Odertal bei Schwedt an der deutsch-polnischen Grenze. Im Jahr 2007, als ich ihn für meine Doktorarbeit erforschte, zählten wir noch vierzehn Männchen in diesem Gebiet. Ausgestorben ist der SeggenrohrsängerSeggenrohrsänger in Deutschland damit noch nicht, da er dafür zehn Jahre nicht mehr zur Brutzeit vorgekommen sein müsste. Ich hege die heimliche Hoffnung, dass wir ihn vor Ablauf dieser Frist in unsere wiedervernässten MooreMoore, wiedervernässte doch noch zurücklocken können.
Was den SeggenrohrsängerSeggenrohrsänger für mich so besonders liebenswert macht? Da wäre zum Beispiel der wunderschöne Gesang der Männchen, die, auf der Suche nach der nächsten Liebelei, auf den SeggenSeggen sitzen und mit den schönsten Melodien und besonders abwechslungsreichen Lauten versuchen, die Weibchen zu beeindrucken. Seggenrohrsänger haben keine Paarbindung, die Männchen suchen sich verschiedene Weibchen und sind dadurch immer gleichzeitig an mehreren Gelegen beteiligt. Wenn es noch ausreichend Weibchen in der Nähe gibt. Ich habe auch Männchen beobachtet, die wohl ganz allein als Letzte ihrer Art in einem Moor sangen. Das ist unsagbar traurig, und noch mehr, wenn sie dann im nächsten Jahr ganz verstummt sind.
Die Weibchen wiederum ziehen ihre Küken alleine auf und sind auch für uns Forscher*innen kaum zu entdecken. Ich erinnere mich, wie ich stundenlang grünes Gras anstarrte, bis doch endlich wieder ein Weibchen zum vermuteten Standort eines Nestes geflogen kam und, um mögliche Verfolger in die Irre zu führen, einige Meter daneben auf den Pflanzen gelandet ist. Dort pfiff sie ein paar Warnlaute, ließ sich in die Pflanzendecke fallen und verschwand. Um Nester von Seggenrohrsängern zu finden, muss man äußerst geduldig sein.
Dass die Weibchen es schaffen, ihre Küken ganz alleine aufzuziehen, liegt vor allem daran, dass sie sich für die Fütterung kaum von ihren in die SeggenSeggen hineingebauten Nestern entfernen müssen. In den SeggenrohrsängerSeggenrohrsänger-Mooren finden sie ein großes Angebot an Insekten und Spinnen, einen reich gedeckten Tisch. Wie es den Weibchen gelingt, ihre Küken in den Nestern so dicht über der Wasseroberfläche dennoch trocken zu halten, ist für mich ein kleines Wunder. Genauso wie die gefährliche weite Strecke von Feuchtgebiet zu Feuchtgebiet, die die Seggenrohrsänger zurücklegen, um in Westafrika den Winter zu verbringen und dann wieder nach Mitteleuropa zu fliegen. Über die Sahara!
Neben dem kleinen hübschen Vogel selbst sind es die Menschen, die meine Verbindung zu diesem Tier so besonders machen. »Aquatic Warbler Conservation TeamAquatic Warbler Conservation Team« nennt sich eine Gruppe von Vogelschützer*innen aus den verschiedensten Ländern entlang des Zugwegs des kleinen Tieres, die seit über zwanzig Jahren zusammenarbeiten. Fast jedes Jahr treffen wir uns für eine gemeinsame Expedition zu den Lebensräumen des Vogels – und seit Kurzem auch, um hoffnungsvolle Ideen auszutauschen, wie wir ihn wieder ansiedeln könnten.
Und wir Menschen?
Kehren wir noch mal zur Frage ganz am Anfang dieses Kapitels zurück: Wie kam ich dazu, Moorforscherin zu werden? Es gibt dafür, das hat dieses Kapitel hoffentlich deutlich gemacht, zahlreiche faszinierende Gründe, die im Ökosystem Moor selbst versteckt sind. Als ich anfing, hatte ich keine Ahnung, dass neben den Moorblumen und den so schön blühenden SeggenSeggen, den Moosen, Moorvögeln und Schmetterlingen auch das große Thema KlimawandelKlimawandel hinzukommen und meine Arbeit sehr verändern würde. Heute hat sich das Fach MoorkundMoorforschunge durch die KlimakriseKlimawandel stark erweitert, wir Forscherinnen und Forscher reden jetzt in jedem zweiten Satz über TreibhausgaseTreibhausgase und Kohlenstoffsenken. Das Moor ist für alle Menschen existenziell bedeutend geworden.
Gleichzeitig sind wir durch die KultivierungKultivierung der Natur selbst verantwortlich für diesen Zustand. Die Unterscheidung zwischen Kultur und Natur ist mir wichtig. Genauso wie eine ehrliche Auseinandersetzung damit, weshalb wir als Menschheit KlimaschutzKlimaschutz und auch NaturschutzNaturschutz überhaupt betreiben. Denn die Erde an sich schafft es auch ohne uns Menschen. Ohne Zweifel: Durch die Arten- und die KlimakriseKlimawandel bewegen wir uns gerade in eine Situation hinein, in der sich auch die Natur enorm verändert. Andererseits hat sich der Planet in seinem Bestehen immer wieder stark gewandelt, ist durch verschiedenste Kalt- und Warmzeiten gegangen, hat Arten verloren und neue gewonnen. Die Natur braucht uns nicht. Die Erde selbst wird auch diese Krisen überstehen. Doch für Milliarden Menschen stehen die Lebensbedingungen auf dem Spiel. Es droht eine katastrophale Verschlechterung.





























