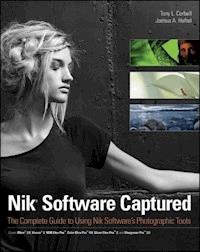Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edition Atelier
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Ist die Idee des Reisens nicht wunderbar? Man entdeckt neue Welten, lernt andere Kulturen und Menschen kennen, man entwickelt sich persönlich weiter und erlebt das Gefühl totaler Freiheit. Claudia kann sich ein Leben ohne Reisen nicht vorstellen, regelmäßig packt sie mit Begeisterung ihren Rucksack und startet in neue Abenteuer. Nun soll es für ein halbes Jahr zu ihrem Freund Tom nach Peru gehen. Doch am Flughafen kommt einfach keine Vorfreude auf. Sie beginnt ihre Reiselust zu hinterfragen und über die klimapolitischen Konsequenzen ihres polyglotten Lebens nachzudenken. Die folgenden Monate in Südamerika werden zu einer Suche nach Antworten. Direkt, ehrlich, mit einer sympathischen Portion Selbstironie – Claudia Endrich lädt uns dazu ein, unsere eigene Lebensweise zu hinterfragen und bewusster zu gestalten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 278
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
CLAUDIA ENDRICH
DAS NÄCHSTE MALBLEIB ICH DAHEIM
UMWELTBEWUSSTSEIN IM GEPÄCK
Für uns alle, die meistens das Beste wollen,deshalb aber oft etwas ganz Dummes tun.
»Wenn man für ein paar Tage die Möbel umstellt, kannman ganz billig Urlaub machen.« - Das Känguru
(Marc-Uwe Kling: »Das Känguru-Manifest«, Kapitel 5)
INHALT
Ende, Anfang und Mittelpunkt einer Reise
Ankunft in Lima
Gringo Ground Zero
Unser neues Zuhause
Nach Hause telefonieren
Das VW-Bus-Klischee und warum es völlig verlogen ist
Der Berg ruft
Exchange Students
Frei & willig um die Welt
Süchtig nach Arbeit
Fremde Welten
Klaus
Ungerechtigkeiten
Backpacking
Clandestina
Forschungsreise
Touristen auf der Flucht vor Touristen
»Endlich« Urlaub
Wahre Weihnachten
Besuch
Regenwald
Enttäuschungen
Grenzgänger
Columbia
Big City Life
Karibik
Menschliche Wüste
Der nicht ganz einsame Strand
Überdruss
Der letzte Flug
Heimkommen
Epilog
Glossar
Literaturverzeichnis
EINPACKEN
ENDE, ANFANG UND MITTELPUNKT EINER REISE
Ich hasse Flughäfen. Ganz ehrlich, wer verbringt gerne seine Zeit an diesen Orten der menschlichen Entwürdigung, wo dem durchschnittlichen Bobo der westlichen Welt – also Menschen wie mir – alles vorenthalten wird, was ihm lieb und teuer ist? Effizienz, Komfort, Freiheit, unverpackte Bio-Fairtrade-Lebensmittel und natürlich: unlimitiertes WIFI. Um es mit Marc-Uwe Kling zu sagen: »Flughäfen sind die Versuchslaboratorien unserer Gesellschaft. Dort wird ausgetestet, was sich die Menschen alles bieten lassen.«1 Überteuertes, in Plastik gehülltes Industrieessen, unbequeme oder gar keine Sitzmöglichkeiten, ewige Wartezeiten und Kontrollen, Kontrollen, Kontrollen. Flughäfen sind die höchste Form der Nicht-Orte, wie Marc Augé diese Durchgangsräume des Lebens bezeichnet.
Der Aeropuerto de Madrid bildet in alldem keine Ausnahme, stelle ich fest. Nachdem ich mich mit meinen zwei riesigen Rucksäcken mit der U-Bahn hergequält habe, stehe ich nun am Check-in-Schalter der Billigairline, die als einzige einen Direktflug von Europa nach Lima angeboten hat, Schlange. Die Dame am Schalter verlangt von mir eine Ausreisebestätigung, da ich nur den Hinflug gebucht habe. »No tengo … pero no necesito eso, no?«, versuche ich in meinem etwas unsicheren Spanisch zu erklären. Gesetzlich nein, bei dieser Fluglinie ja, erklärt sie mir. Na super. Sie schickt mich zu einem jungen Franzosen mit Rucksack, der neben dem Check-in-Schalter bereits nervös in sein Handy tippt. Er hat das gleiche Problem und wir buchen online beide kurzerhand eine Busreise von Peru nach Bolivien in drei Monaten. Fünf Minuten später halte ich der Dame die Reservierungsbestätigung vor die Nase und sie ist zufrieden. Weitere fünf Minuten darauf storniere ich die Buchung wieder. Was für eine sinnfreie Aktion. Ich habe jetzt schon keine Lust mehr auf diese Reise. Am Securitycheck soll ich meine Schuhe ausziehen. Solche unangenehmen Momente gehen inzwischen spurlos an mir vorüber, da sage noch einer, wir stumpfen bei allem nicht früher oder später ab.
Es folgt die Passkontrolle. In diesen Momenten muss ich immer an Stefan Zweig denken, der sich eine Welt ohne Grenzen und ohne Pässe gewünscht hat. Ich wäre sofort dabei. Am liebsten würde ich die pflichtbewusste Grenzpolizistin in ihrem Glaskasten in ein Gespräch verwickeln: »Wussten Sie, dass es Reisepässe eigentlich erst seit gut hundert Jahren gibt? Davor konnten sich die Menschen in Europa völlig frei bewegen, ganz ohne ihre Identität beweisen zu müssen. In Wirklichkeit ja auch absurd, dass jemand seine Identität beweisen muss. Ich stehe ja hier, das beweist doch schon, dass ich existiere und jemand bin, oder? Wie denken Sie darüber?« Ich vermute, ihr Gesichtsausdruck wäre als Antwort ungefähr genauso gleichgültig wie jener, mit dem sie mir nun eine gute Reise wünscht. Endlich erreiche ich mein Gate. Mit der von meinem Vater anerzogenen Überpünktlichkeit an Flughäfen komme ich hier normalerweise schon eine Stunde vor dem Abflug an, diesmal sind es nur noch fünfzehn Minuten bis zum Boarding. Aber wann hat ein Boarding schon jemals pünktlich begonnen? Ich habe also noch etwas Zeit, um mir einen Kaffee zu holen. Welche Optionen gibt es in Sichtweite? Natürlich nur Starbucks. Ich zögere. Diesem verantwortungslosen Konzern mein Geld geben, auch nur für einen einzigen Kaffee? Es schmerzt mich innerlich und ich beneide die Menschen rund um mich, die anscheinend völlig ohne schlechtes Gewissen ihre Bestellung aufgeben. »Jetzt dafür erst recht!«, denke ich mir und bestelle den über der Kasse angepriesenen neuen »Cappuccino Freddo«. Ich freue mich auf meine koffeinhaltige, neoliberalistische Sünde, und als schließlich mein Name von der Theke erklingt – »Claudia?« –, hole ich mir gleich die Strafe für diese Entscheidung ab. Plastikbecher, Plastikdeckel, Plastikstrohhalm. Doch das Schlimmste ist der Inhalt: fünfundachtzig Prozent Eis, vierzehn Prozent Milch, maximal ein Prozent Kaffee. Die dicht gedrängt liegenden Eiswürfel erlauben mir kaum, die überteuerte Plörre mit dem Strohhalm durchzumischen. Nach nur zwei Minuten ist der »Cappuccino« weg, das ganze Eis noch da und ich pfeffere den großen Haufen an Energie- und Ressourcenverschwendung frustriert zu den anderen hundert Bechern in den Mülleimer. »Nie wieder Starbucks, auch nicht am Flughafen«, schwöre ich mir. Die nächste Schlange erwartet mich beim Boarding. Warum wandern wir eigentlich immer freiwillig durch diese leeren, s-förmigen Wartelinien? Angeblich sollen sie Ordnung schaffen, vor allem aber stellen sie den maximalen Gehweg auf minimalem Raum her. Während ich warte, habe ich viel Zeit, um den Gesprächen rund um mich zu lauschen. Die deutsche Familie freut sich, dass der Flug so billig war. Müssen die ihr eigenes Klischee echt unbedingt bestätigen, wenn ich gerade zuhöre? Ein paar peruanische Rich-Kids, geschniegelte Jungs um die siebzehn mit Polohemden und neuen iPhones, reden über Chicas und die Eliteschulen in Frankreich, die sie kürzlich anscheinend besichtigt haben. Die Frau, neben der ich schließlich im Flieger meinen Platz finde, erklärt am Telefon auf Spanisch noch schnell jemandem ein Kochrezept. Der Flugzeug-Oldtimer ruckelt ordentlich beim Start, die Frau neben mir bekreuzigt sich. Mir ist das Ruckeln aber genauso sympathisch wie die Tatsache, dass man sich am Bildschirm keine Filme aussuchen kann, sondern dass einfach alle denselben sehen. Alles mutet fast schon kommunistisch an, und ich stelle mir vor, wie ich später einmal meinen Enkeln erzählen werde: »Früher gab es beim Fliegen halt nicht mehr! Damals sind wir beim Start und bei der Landung noch richtig nervös geworden.«
Die nächsten zwölf Stunden habe ich nun Zeit, mich auf diesen neuen Lebensabschnitt zu freuen. Sieben Monate Südamerika – und ich habe tatsächlich keine Lust darauf. Ich war in meinem jungen Leben bereits wirklich genug auf Reisen, und in diesem Kalenderjahr für meinen Geschmack schon zu viel. Wie es sich für die junge, vielsprachige Europäerin von heute gehört, habe ich zwischen zwanzig und fünfundzwanzig unter anderem eine Interrail-Reise, ein Erasmus-Austauschsemester und ein Volontariat in Afrika gemacht. Ich bin im Freundeskreis für meine Reiseversessenheit bekannt, werde von manchen darum beneidet und verwirre viele mit der Unzahl meiner Reisepläne. Bekannte, die ich nur alle paar Monate treffe, sind meist ganz überrascht, dass ich überhaupt gerade in Österreich anzutreffen bin. Das vergangene halbe Jahr habe ich zum Abschluss meines Studiums in Kanada verbracht. Und seit ich Ottawa vor einem Monat mit fünfunddreißig Kilogramm Gepäck verlassen habe, habe ich den Segen unserer Mobilität zu verabscheuen gelernt. Mit dem Zug nach Toronto, mit dem Bus durch die Großstadt, mit dem Flieger über Island nach München, Familie in Salzburg und Vorarlberg besucht, bei Freunden in Wien untergekommen und die Abschlussprüfung auf der Uni abgelegt, mit dem Zug nach Marseille zu Freunden, im Airbnb übernachtet, mit dem Bus nach Madrid, Couchsurfing, und jetzt, nur vier Wochen nach dem Abschied von Ottawa, bin ich hier. Ich sehne mich nach eigenen vier Wänden und einem Schrank, wo ich einfach nur mein Zeug hineinlegen kann. Wie der französische Rapper OrelSan schon erkannt hat: »Après avoir fait le tour du monde, tout ce qu’on veut c’est être à la maison.«
Ich war wahnsinnig stolz auf meinen Plan, mit dem ich meine Flugdistanz auf das minimal Notwendige, nur über den Atlantischen Ozean, reduziert habe. Doch ich muss auch zugeben, dass ich es während meines vierten Umstiegs am Bahnhof in Lyon langsam bereute, genauso wie mitten in der Nacht am Busbahnhof von Bordeaux, wo es schön dunkel war, wunderbar nach Urin duftete und ich aus Mangel an Nahrungsangebot über meine als Gastgeschenk gedachten Mozartkugeln herfiel. Umso stolzer berichtete ich Muriel, meiner früheren Mitbewohnerin aus Wien, bei unserem Treffen in Marseille von dieser Odyssee. Immerhin hatte ich ökologisches Denken im Grunde von ihr gelernt. Dementsprechend schockiert war ich, als ich erfuhr, dass sie selbst aus Brüssel mit dem Flugzeug hergejettet war, um mich zu treffen. Da hätte ich ja gleich selbst nach Madrid fliegen können. Wie zum Vorwurf berichtete ein Radiomoderator ihres Lieblingssenders eines Morgens, während wir auf dem Balkon unserer Airbnb-Unterkunft im Mistral-verwehten Marseille frühstückten: »Umweltforscher sagen, dass nur drei große Maßnahmen tatsächlich nachhaltig das Klima schonen: nicht Auto fahren, nicht fliegen und keine Kinder bekommen.«
»Also, Muriel, keine Kinder?«, lachte ich.
Muriel war sichtlich getroffen von meinem augenzwinkernden Vorwurf, das schlechte Gewissen war ihr deutlich anzusehen.
Dabei gehöre ich ja selbst zur schlimmsten Sorte, wenn es um das ökologische Gewissen geht. Die einen machen quasi alles richtig – vegan essen, Fahrrad fahren, unverpackt einkaufen oder NICHTS kaufen – und verurteilen jene, die das nicht schaffen, obwohl es doch »so leicht und so viel schöner« sei, während diese anderen permanent ein schlechtes Gewissen wegen ihres Lebensstils haben. Ich hingegen verurteile alle Menschen rund um mich herum für ihr unökologisches Verhalten und schaffe es selbst nur selten, konsequent zu sein. Ein Leben ohne Fleisch? Gerne weniger, aber bestimmt nicht ganz ohne. Ein Leben ohne Käse?! Da könnt ihr mich gleich erschießen. Und welche schöne Ausrede hatte ich also parat, um meinen anstehenden Flug um die halbe Welt zu rechtfertigen? Natürlich der einzige Grund, der immer erlaubt ist: die Liebe.
An jenem Morgen in Marseille beim Frühstück dämmerte mir langsam, dass das Fliegen selbst für die absoluten Ober-Ökos anscheinend eine eigene Kategorie darstellt. Ich begann zu recherchieren: Eine Umfrage in Deutschland im Jahr 2014 ergab, dass Menschen, die »Grün« wählen, am meisten fliegen. Und die Grün-Wählenden sind anscheinend auch die einzige Gruppe, in der tatsächlich alle schon einmal geflogen sind.2 Das habe ich davor nicht für möglich gehalten, doch nach längerem Nachdenken fand ich es wenig verwunderlich: Wer interessiert sich denn besonders für andere Kulturen? Wer spricht mehrere Sprachen? Wer ist häufiger akademisch ausgebildet und damit zu beruflichen und privaten Flugreisen privilegiert? Dabei wissen wir inzwischen auch, dass der Verzicht auf Flüge eine der wirkungsvollsten Entscheidungen ist, die eine Einzelperson treffen kann, um Emissionen zu reduzieren.3 Dazu kommt, dass bloß drei Prozent der Weltbevölkerung im Jahr 2017 und nur circa achtzehn Prozent aller Menschen überhaupt in ihrem Leben schon einmal geflogen sind.4 Ich werde in den kommenden Monaten so manch typisches Exemplar dieser Reisenden persönlich kennenlernen. Sie alle werden von meiner eigenen inkonsequenten Person, quasi auf Augenhöhe, für ihr Handeln infrage gestellt werden. Was ich wissen will, ist: Was treibt uns an, ständig unterwegs zu sein? Haben wir überhaupt ein Recht auf unendliche Reisefreiheit? Und lohnen diese Reisen sich überhaupt? Machen sie uns oder unseren Planeten in irgendeiner Form besser? Ich habe vor, bei anderen Travellern genauso wie bei mir selbst knallhart und ehrlich hinzusehen, ohne Facebook- und Instagram-Filter, und herauszufinden, ob und wem diese vielen Flugreisen tatsächlich etwas nützen.
Als Teil dieser gewissenlosen, elitären drei Prozent der Menschheit sitze ich jetzt also gerade in einem Flugzeug, das mich in zwölf Stunden von Spanien nach Peru bringen wird, und freue mich nicht einmal so richtig darüber. Doch, ich freue mich schon ein bisschen, denn in Lima erwarten mich zwei Dinge, die ich bereits schmerzlich vermisse: die eigenen vier Wände, inklusive Schrank statt Rucksack, und Tom.
1 Kling, Marc-Uwe: Die Känguru-Offenbarung, Ullstein, Berlin 2014
2www.boell.de/sites/default/files/oben_flugbroschuere_160603.pdf?dimension1=ds_fliegen (16.03.2018)
3iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/aa7541#erlaa7541f1 (06.01.2019)
4www.dw.com/de/der-klimawandel-und-das-fliegen/a-42094220 (16.03.2018)
ANKUNFT IN LIMA
Als ich in Lima ankomme, bin ich müde. Meine innere Uhr sagt mir, dass es bereits mitten in der Nacht ist, doch auf dem Weg hierher haben sich die Uhren sechs Stunden zurückgedreht. Tom erwartet mich inmitten einer Menge von Taxifahrern mit Namensschildern und strahlt. Ich strahle zurück, wir küssen uns. Obwohl ich ihn in den vergangenen sechs Monaten regelmäßig auf Skype oder FaceTime gesehen habe, hätte ich ihn mit seinem dichten Bart und den langen Haaren fast nicht erkannt. Es ist ein beruhigendes Gefühl zu wissen, dass die technischen Hilfsmittel den echten Anblick nicht vollständig ersetzen können. Doch eines ist bestimmt durch den ständigen Online-Kontakt anders geworden: Alles ist sofort wieder vertraut, wir sprechen so miteinander wie noch vorgestern am Telefon, er fragt »Wie war der Flug?« und ich erzähle entnervt von meinem Starbucks-Desaster. Kitschige Wiedersehensszenen à la Fünfzigerjahrestreifen, ungläubige Blicke, dass die andere Person tatsächlich noch am Leben ist und die geschriebenen Briefe doch nur in der Post verloren gegangen sind, so etwas gibt es heute nicht mehr.
Wir steigen in ein Taxi, Tom spricht inzwischen fließend Spanisch und verhandelt souverän mit dem Fahrer den Preis. Als wir durch das lärmende, blinkende und stinkende Großstadtchaos Limas fahren, steigen in mir Erinnerungen an Dakar hoch. Die halb auseinanderfallenden Autos, die die Straßen Limas verstopfen, unterscheiden sich von jenen in Dakar nur dadurch, dass sie statt aus Europa aus den USA hierhergebracht werden, wenn sie den westlichen Sicherheitsstandards nicht mehr entsprechen. Alle hupen, versuchen inmitten der Autokolonnen Softdrinks oder Kekse zu verkaufen, verschließen ihre Autotüren von innen vor mutmaßlichen Dieben. Die Werbetafeln und Aushängeschilder rundherum sind die gleichen wie bei uns: Visa, Mercedes, Coca-Cola, Multiplex-Kino, McDonald’s. Ich bin eher unbeeindruckt und beschäftige mich mehr mit Tom als mit dem, was rundherum passiert. Ist es nicht absurd, dass ein so ferner, fremder neuer Ort mich mit fünfundzwanzig Jahren nicht einmal mehr überrascht oder schockiert? Auch diese alten Szenen, mit großen Augen an der Fensterscheibe klebend, etwas beobachtend, was man noch nie zuvor nur annähernd gesehen hat, auch das gibt es für die Privilegierten unserer Generation kaum mehr. Ich erinnere mich an Ta-Nehisi Coates, der in seinem Buch »Between the world and me« erzählt, wie faszinierend und augenöffnend sein erster Besuch in Paris für ihn war, einen jungen, mittellosen Schwarzen aus den USA. Ich würde in diesem Moment gerne noch einmal so staunen können, wie er es beschreibt. Mittendrin in dieser mir viel zu vertraut wirkenden elf Millionen großen, vom Betonboden bis zur Smogwolke grauen Megacity navigiert Tom den Taxifahrer zu unserer Wohnung, die er vor Kurzem für den Rest seines Studienjahres für uns beide gemietet hat. Er hat sich parallel zu seinen Semesterprüfungen voll ins Zeug gelegt, um noch eine Wohnung zu finden, bevor ich ankomme. Auch wenn ich ihm immer versichert habe, dass es mir nichts ausmachen würde, noch ein paar Wochen in seiner Studenten-WG zu wohnen, bin ich heilfroh, dass wir jetzt von Anfang an unser eigenes, kleines Reich haben.
Tom studiert Internationale Wirtschaftswissenschaften und entspricht absolut nicht dem Klischee des aufstrebenden Wirtschaftsstudenten, der gerne einmal Consumer Brand Manager bei Procter & Gamble werden will. Als ich ihn kennenlernte, damals war er noch Zivildiener, war das zwar schon absehbar, aber längst nicht so deutlich wie heute. Durch sein Studium hat Tom bisher vor allem ganz genau herausgefunden, was er NICHT mit seinem Leben machen möchte. Er jagt nicht einem konkreten Karriereziel hinterher, sondern sucht meistens Antworten auf die großen, schwierigen Fragen unserer Menschheit: Wie schaffen wir mehr Frieden? Wie bekämpfen wir Armut und Umweltverschmutzung? Wie gelangen wir zu einer gerechteren Welt? Dabei macht er sich wenig Gedanken darüber, ob er bei den Lösungen eine tragende Rolle spielen wird, und genau dafür liebe ich ihn. Das Austauschstudium in Peru hat seine Ansichten über unsere ungerechte Welt nur noch mehr bestärkt, und die neue Langhaarfrisur ist in Wirklichkeit ein längst überfälliger modischer Ausdruck seiner alternativen, sozialkritischen Ansichten – auch wenn dieser Look momentan leicht mit dem eines stinknormalen Hipsters verwechselt werden kann. Wenn er mit seinen ausgelatschten Ledersandalen und einem bunten Stirnband durch Lima spaziert, erinnert er mich eher an einen modernen Jesus. Vielleicht auch, weil er das wirklich einmal zu mir gesagt hat, als ich während eines Sommerurlaubs zögerte, in Flip-Flops eine Kirche zu betreten: »Wenn dich jemand schief anschaut, dann denk einfach daran: Jesus hat immer nur Sandalen getragen.«
Nachdem wir nun unsere neue Wohnung betreten haben, gibt es für mich nichts Schöneres, als einfach nur ein paar meiner Habseligkeiten in den Schrank zu legen und zu wissen: Hier dürfen sie jetzt ein paar Monate bleiben. Gleichzeitig packe ich einen meiner zwei Rucksäcke schon wieder zusammen, denn in nur zwölf Stunden werden wir schon wieder am Flughafen von Lima sein. Diesen zugegebenermaßen größten Quatsch aller Zeiten hat Tom sich einfallen lassen, damit wir seinem Vater, der gerade zu Besuch ist, den Traum erfüllen können, den Machu Picchu zu besichtigen. Eine fünfundzwanzigstündige Busfahrt kommt für den alten Herren, wenn er auch noch sehr rüstig ist, nicht infrage, also fliegen wir in die Andenstadt, von der aus man zu diesen so berühmten Inka-Ruinen gelangt. Mir ist es jetzt, da ich wieder neben Tom einschlafen und aufwachen kann, relativ egal, wo das dazugehörige Bett steht und wie wir dorthin gelangen. Trotzdem habe ich mir fest vorgenommen, dass dies der letzte Kurzstreckenflug meines Lebens werden wird.
GRINGO GROUND ZERO
Noch ehe mein Jetlag richtig einsetzen konnte, sitze ich also bereits wieder im Flieger und betrachte durch die Fenster die imposanten Berggipfel der Anden unter mir. Wenn uns niemand sagen würde, dass hier alles ungefähr 2000 Meter höher ragt als in den Alpen, dann könnte diese Landschaft genauso gut daheim vor unserer Haustür liegen. Beim Warten auf unser Gepäck am Förderband hören wir plötzlich eine unverkennbar österreichische Stimme hinter uns: »Na he, des gibts jo jetzt echt ned, oda?« Ich drehe mich um und sehe zwei junge blonde Mädels mit den klassischen Traveller-Rucksäcken und Bergschuhen vor uns stehen. Nachdem Tom sie lachend begrüßt hat, erfahre ich, dass er mit den beiden Schwestern zur Schule gegangen ist. Eine der beiden macht derzeit den gleichen Studienaustausch wie er, allerdings in Brasilien. Aber »wenn man schon mal da ist«, kann man ja auch gleich noch 4000 Kilometer an die andere Küste Südamerikas fliegen, um mit seiner Schwester den Machu Picchu zu besuchen. Dass wir uns nun hier am Flughafen treffen, halten alle für einen unglaublichen Zufall. Doch seit ich gelesen habe, dass nur drei Prozent der Weltbevölkerung jährlich fliegen, ist mir klar, dass das mit Zufällen rein gar nichts zu tun hat. Ständig erzählen mir Leute nach einer Reise, dass sie zufällig der Arbeitskollegin des Anwalts ihres Onkels, die im Nachbardorf lebt, irgendwo auf einer Safari in Südafrika begegnet sind. Begeistert kreischen dann alle und stellen philosophisch fest: »Wie klein die Welt doch ist!« Doch da unterläuft uns ein grober Denkfehler. Nur die Welt derer, die sich diesen Lebens- und Reisestil leisten können, ist verdammt klein. Die anderen siebenundneunzig Prozent der Weltbevölkerung hätten garantiert keine Bekannten auf dieser Safari getroffen – es sei denn, sie sind Arbeiter im Safaripark.
Wir erreichen das Stadtzentrum dieser touristischen Hochburg Perus, ein fein säuberlich herausgeputztes koloniales Städtchen mit allen Angeboten, die das Gringo-Herz begehrt: Mit Sicherheitszäunen umgebene Hostels mit eigenem Irish Pub, spottbilligen Massagesalons, Boutiquen bekannter Sportartikelmarken, in denen man sich für das geplante Anden-Trekking ausrüsten kann, und kleine Hipster-Cafés mit 500 Zubereitungsarten ihres »Organic Coffees«. Ich frage mich: Gefällt das tatsächlich irgendjemandem, diese offensichtlich verwestlichte, unauthentische Altstadt, oder nehmen das alle nur in Kauf, weil nun mal jeder dieselbe Sehenswürdigkeit besuchen will? Anscheinend gefällt dieser geschützte Kokon den meisten, denn sobald wir den Stadtkern verlassen und in die heruntergekommenen Vorstädte spazieren, findet sich kein einziger Tourist mehr. Dafür Müllberge, unverputzte, aber bewohnte Rohbauten, ein Verkehrschaos voller alter Rostlauben und sehr viel Armut. Ein bisschen peruanische Realität darf auch auf dem Hauptplatz der Stadt auftreten: Gerade findet ein dreißigtägiger Streik der Lehrkräfte statt, denn nach fünf bis sechs Jahren akademischer Ausbildung verdienen Lehrerinnen und Lehrer in Peru umgerechnet etwa 350 Euro. Ein Polizist bekommt nach zehn Monaten Ausbildung mehr als dreimal so viel. Der Hauptplatz ist für die Demonstrierenden großräumig abgeriegelt – »para no molestar a los gringos«. Für die Peruaner sind nicht nur US-Amerikaner Gringos, sondern alle weißen Touristen, und die sollen natürlich möglichst wenig gestört werden. Die Gringos tragen selbst am meisten dazu bei, das möglich zu machen: Während ich begeistert mit den Demonstranten mitsinge: »No somos uno, no somos dos, hoy somos todos!«, bemerke ich, dass der Großteil der Touristen die Streikenden einfach ignoriert. Ein paar machen Fotos des Geschehens, einzelne sind verärgert, dass die Demonstranten ihr perfektes Fotomotiv des Hauptplatzes stören. Doch die meisten gehen vorbei, ohne die Protestierenden eines Blickes zu würdigen. Ich fühle mich genauso schuldig, denn was bedeutet schon ein bisschen Mitklatschen vom Straßenrand aus? Meine Reise in dieses Land nährt vor allem die peruanische Staatskasse, wo Geld unfair und korrupt verteilt wird. Das gilt leider für die meisten Reiseziele, die für uns Europäer so angenehm leistbar sind. Doch in den touristischen Pubs rund um den Hauptplatz kann man trotzdem an einem Abend leicht ausgeben, was ein Lehrer in Peru monatlich verdient. Wir bereuen es bald, ein solches Pub betreten zu haben. Im ganzen Lokal befinden sich, abgesehen von den Bedienungen, nur Gringos, überall wird Englisch gesprochen. Eine Gruppe von jungen Briten Anfang zwanzig unterhält sich lautstark und ausschweifend darüber, für welche organisierte Tour sie wie viel bezahlt haben. Niemand spricht davon, dass junge Peruanerinnen und Peruaner sich solch eine Reise nicht einmal ansatzweise leisten könnten. Niemand scheint sich daran zu stören, dass dieses Lokal mit dem realen Peru genau gar nichts zu tun hat. Die Kolonialzeit, die ist ganz offensichtlich nur auf dem Papier passé.
Das Hauptziel all dieser Gringos ist der Machu Picchu, eine riesengroße Inka-Ruine inmitten der Anden. Sämtliche Details zu dieser Geldmaschine lassen sich auf Wikipedia oder in jedem Reiseführer nachlesen, wesentlich ist: Alle wollen hin. Und darum ist das inzwischen ganz schön teuer, auch wenn es in Peru in Wirklichkeit fast an jeder Straßenkreuzung eine Inka-Ausgrabung zu bewundern gibt, für die sich aber kaum jemand interessiert. Jede Travel-Agency in der Stadt bietet geführte Trekkingtouren zum Machu Picchu an und jeder geschäftstüchtige Touristen-Informant erklärt dir, dass es viel zu gefährlich ist, diese Wanderung alleine anzutreten. Manche, so auch wir, versuchen es trotzdem und stellen fest, dass es problemlos möglich ist. Der wesentliche Unterschied liegt darin, dass wir unsere Campingausrüstung inklusive Zelt selbst tragen, auf- und abbauen und unser Essen selbst kochen. Während wir das tun, können wir bei den benachbarten Reisegruppen beobachten, wie die Gringos sich von den peruanischen Guides die Zelte aufbauen lassen, bekocht werden und tagsüber von Eseln und Pferden ihre Rucksäcke tragen lassen. Anders gesagt: Wer ohne Reisegruppe loszieht, überlegt es sich zweimal, ob er das Stativ seiner Spiegelreflexkamera einpackt. Der Besuch des Machu Picchu selbst ist eine reine Massenabfertigung, die den streitsüchtigen, verschlossenen Inkas wohl gar nicht gefallen hätte. Kein Wunder, denn täglich werden fast 3000 Personen hier durchgeschleust. Jeder Taxifahrer in Lima wird uns später fragen, ob wir den Machu Picchu besucht haben und stolz anmerken, wie beeindruckend dieser Ort sei. Die meisten gestehen im weiteren Gesprächsverlauf, dass sie selbst noch nie dort waren. Tom erzählt mir, dass für die meisten Peruanos der Besuch ihres größten Kulturerbes ein lebenslanger, kaum erfüllbarer Traum bleibt. Mir wird fast übel, wenn ich die fotografierenden Horden mit Selfiesticks betrachte, denen dieser Ort weit nicht so viel bedeutet – mich eingeschlossen – wie den vielen Menschen, die ihn wohl nie zu Gesicht bekommen werden. Auch wir warten brav, bis wir an der Reihe sind, um das klassische Foto mit der Machu-Picchu-Kulisse im Hintergrund zu machen, das ich schon tausendfach auf Facebook und in den Reiseberichten meines Vaters gesehen habe. Ich sende das Foto auch bald meinen Eltern via WhatsApp und ernte von Papa ein mit grinsendem Emoticon versehenes »Das kommt mir bekannt vor!« als Antwort. Für die meisten Backpacker in Peru ist dieser so besondere Ort nicht mehr als ein »nettes Must-see« auf ihrer Reise. Für mich ist dieser Besuch ein imposanter Einstieg in die peruanische Welt, doch es ist gewiss kein authentischer erster Eindruck. Ich fühle mich in dieser Touristenzone alles andere als nützlich. Wem bringt es irgendetwas, dass ich diese uralten Inka-Steine live gesehen habe? In Anbetracht der Lebensverhältnisse nur wenige hundert Meter von den Touristenzentren entfernt kann ich nicht glauben, dass ich etwas Gutes tue, nur weil ich mein Geld hierhertrage. Monate später werde ich Menschen, Lebensrealitäten und Wesensarten dieses Landes kennengelernt haben und den Machu Picchu nur als eines in Erinnerung behalten: als Touristenmagnet, der die Gringos von dem ablenkt, was dieses Land wirklich ausmacht.
AUSPACKEN
UNSER NEUES ZUHAUSE
Als wir uns nach zwei Wochen Andentour von Toms Vater am Flughafen verabschieden und ohne ihn mit dem öffentlichen Bus nach Lima zurückkehren, bin ich nach zweiundzwanzig Stunden Fahrt und nach eineinhalb Monaten des Reisewahnsinns mehr als erleichtert, endlich, endlich in meinem neuen Zuhause anzukommen. Für peruanische Verhältnisse ist die Wohnung ein wahrer Palast, frisch renoviert, mit Balkon und gut abgesichertem Eingangstor. Tom hat sie spärlich, aber sehr liebevoll und völlig ausreichend möbliert, mit einer Mischung aus Ausgeliehenem, Gebrauchtem und Selbstgebasteltem aus Altholz und Gemüsekisten vom Markt. Was bei uns als hip gelten würde, ist hier einfach nur gesunder Menschenverstand. Stolz präsentiert Tom mir den kleinen rosa Handspiegel, den er im ansonsten spiegellosen Badezimmer für mich installiert hat. Wir finden unsere Upcycling-Regale und die schon etwas von Termiten befallenen Schränke großartig und freuen uns allgemein, dass wir in den nächsten Monaten extrem energiesparend leben werden: So wie alle in Peru haben wir einen Gasherd, Heizungen gibt es hier nicht, Warmwasser ebenso nicht. Das kalte Duschen ist etwas gewöhnungsbedürftig, vor allem bei sechzehn Grad Tagestemperatur. Wir entscheiden uns außerdem gegen die Anschaffung eines Kühlschranks – vier Monate werden wir es wohl ohne aushalten. Dafür müssen wir akzeptieren, dass es in Peru praktisch keine Mülltrennung gibt. Mit etwas Mühe und viel Nachfragen erfahren wir nach einigen Wochen, dass es eine Sammlung für Recyclingmüll gibt. Die Abholzeiten der Müllsäcke sowie das vorherrschende Trennungssystem durchschauen wir bis zum Schluss nur schwer. Lima versinkt im Plastik. Jedes Gewürzsäckchen wird nochmals in ein Plastiksäckchen verpackt, sich gegen das Einpacken oder sogar doppelte Einpacken zu wehren, ist oft mühsam oder unmöglich. Die Bea Johnsons der heilen Zero-Waste-Welt behaupten immer, verpackungsfrei einzukaufen sei total einfach. In Ländern, wo alles auf Märkten verkauft wird, noch viel leichter. Ich schäme mich also für meine Inkonsequenz, dass ich zwar versuche, früh genug »Sin bolsa, por favor« zum Verkäufer zu sagen, aber dann nicht protestiere, wenn er aus jahrelanger Gewohnheit zum Plastiksack greift. Tom tröstet mich zwinkernd: »Wir brauchen die sowieso als Müllsäcke.« Ich schaue ihn daraufhin nur strafend an. Manchmal marschiere ich ganz stolz mit einer Tupperdose zum Laden an der Ecke und lasse mir Frischkäse vom großen Laib herunterschneiden, reiche die Dose über den Tresen und bitte die Verkäuferin, den Käse dort hineinzugeben. Als ich die Dose zurückbekomme, liegt der Käse darin – in einer Plastikfolie. Mit der Zeit wird es besser, denn ich kenne die Leute, bei denen ich einkaufe, ihre Gewohnheiten und weiß, wie ich es anstellen muss, damit ich zu meiner verpackungsfreien Ware komme. Und so kapiere ich auch: Am ökologischsten und ressourcenschonendsten ist Routine. Überall, wo ich neu und fremd bin und die Alternativen noch nicht kenne, muss ich das Angebot zuerst so nutzen, wie ich es vorfinde. Nach über einem Monat in Lima erfahren Tom und ich von einem wöchentlichen Biomarkt in unserer Nähe, bei dem wir von da an regelmäßig einkaufen gehen.
Avenida Jirón Libertad Número 683, das ist unsere erste gemeinsame Wohnung. Wir genießen die Zweisamkeit, die wir lange vermisst haben. Trotzdem ist das halbe Jahr, das Tom und ich getrennt voneinander verbracht haben, wie im Flug vergangen. Mir kommt es vor, als hätte ich gerade erst gestern am Flughafen in Ottawa unter tausend Tränen von Tom Abschied genommen, und doch haben wir beide in der Zwischenzeit so vieles erlebt. Es ist meine Idee gewesen, zeitgleich einen Studienaustausch an verschiedenen Orten zu beginnen. Ich fühlte mich durch meine vielen Reisen und einen Vorsprung von zwei Lebensjahren bemüßigt, eine Grundregel aufzustellen: Die Erfahrung, allein in einem fremden Land nur unter fremden Leuten zu sein, die darf auch Tom nicht auslassen. Zu prägend, zu lebensverändernd war das für mich selbst. Der ideale Plan kristallisierte sich nach und nach heraus: Tom würde mit mir nach Kanada fliegen und den ersten Monat mit mir verbringen, um dann nach Peru weiterzureisen. Nach einem Semester würde ich nach Peru kommen und die restliche Zeit dort mit ihm verbringen. Wir dachten an all die Vorteile unseres Reisemanövers: Wir würden das neue Umfeld des jeweils anderen kennenlernen, einander gut verstehen, wenn wir emotional Ähnliches durchleben, und niemand würde sich zu Hause sitzend im Stich gelassen fühlen. Das alles trug wirklich zum Erfolg unserer Fernbeziehung bei, doch der wesentlichste Punkt wurde mir erst bewusst, als ich die wenigen Wochen zwischen Kanada und Peru in Europa verbrachte: Zwischen Ottawa und Lima lag nur eine Stunde Zeitunterschied. Ein halbes Jahr lang erreichten Tom und ich uns praktisch problemlos abends vor dem Schlafengehen auf Skype. Während ich drei Wochen in Österreich war und die Zeitverschiebung plötzlich sechs Stunden betrug, sprachen wir viel seltener miteinander. Oft blieb dann eine Person enttäuscht zurück, wenn das Gespräch abrupt endete, weil der oder die andere noch etwas vorhatte. Da wurde mir klar, was uns außer unserer Liebe durch diese Zeit getragen hat – eine simple Uhrzeit, die es uns ermöglichte, trotzdem gemeinsam durch den Alltag zu gehen.
Tom zeigt mir sein Lima, all das, wovon er mir auf Skype erzählt hat, und ich fühle mich in den ersten Wochen als Besucherin, die diese fremde Stadt besichtigt. Es ist eine Stadt voller Ruß und Dreck, voller Lärm und Lichter, voller Flugzeuge, die man zwar ständig hört, aber vor lauter Smog nicht sieht. Eine Stadt voller Möglichkeiten, die man sich entweder nicht leisten kann oder zu denen man zu spät kommt. Eine Stadt voller Armut und extremem Reichtum, voller Alarmanlagen und Mauern um die Häuser. Ein etwas verrückter Mann lebt in unserem Viertel, er spielt den Straßenartisten, ohne wirklich etwas zu können, hält die Autos auf, tänzelt und lächelt dämlich dabei. Dann winkt er allen lustig zu, und nächstes Mal sehe ich ihn an einer anderen Kreuzung mit einem riesigen Plastikflieger Kunststücke vorführen. Manchmal ist er auch mit einem riesigen Holzkreuz auf der Schulter unterwegs. Mit seinem langen, grauen Bart, den zerrissenen Kleidern und den Sandalen aus alten Autoreifen sieht er tatsächlich aus wie ein kurz vor der Pensionierung stehender Jesus. Die Leute halten ihn für verrückt. In dieser Stadt erscheint er mir ganz normal.
Nach und nach beginne ich, mich hier einzuleben. Die Frau vom Laden unten, der Bäcker gegenüber, der Bettler an der Straßenecke, die Leute kennen mich inzwischen und grüßen. Die Gringa fällt natürlich auf, nicht nur weil sie selten Plastiktaschen annimmt, sondern auch optisch. Alle sind freundlich zu mir. Wenige hier im Viertel dürften so zuverlässige Kunden sein wie ich, die junge weiße Frau, die noch dazu selten einen Preis nachverhandelt. Doch mit der Zeit lerne ich, mich auf dem Markt beim Kauf von Früchten und Gemüse nicht linken zu lassen und, wenn schon nicht den Preis der Einheimischen, dann doch zumindest einen besseren Preis als den üblichen Touristentarif zu bekommen. Als Tom wieder zur Uni muss, habe ich plötzlich wahnsinnig viel freie Zeit, allein. Mir beginnt aufzufallen, dass ich nun seit fast vier Wochen in Lima bin und immer noch kein einziges Mal die Sonne gesehen habe, weil der versmogte Winterhimmel hier konstant grau ist. Es wird Zeit, dass ich mir eine Beschäftigung suche, oder zumindest ein Hobby, einen Sport, Leute, denen ich mich anschließen kann. Auf Studentenpartys von Toms Uni lerne ich nach und nach Leute kennen, mein Spanisch ist dafür gut genug und Schüchternheit schon lange kein Thema mehr. Meine erste Frage, so wie überall, wo ich hinkomme, lautet bald: »Wo kann man hier tanzen gehen?«. Tanzen ist für mich wie atmen, es ist mein Ventil und meine Meditation. In Südamerika sollte es doch hoffentlich leicht möglich sein, andere Tanzbegeisterte zu finden. Doch auch das braucht Zeit, denn die Leute, die mir versprechen, mich in ein paar gute Clubs mitzunehmen, leben nicht nach mitteleuropäischem Terminkalender. Es dauert also ein paar Wochen, bis ich einige Tanzlokale kennenlerne und sie auch gut genug kenne, um notfalls alleine hingehen zu können. Meine neu gewonnenen Freunde nehmen mich außerdem mit zu Akrobatik-Trainings, womit ich bisher kaum etwas zu tun hatte. Auch das macht mir viel Spaß. Was mich aber von Anfang an deprimiert, ist zu wissen, dass das alles nicht lange anhalten wird.