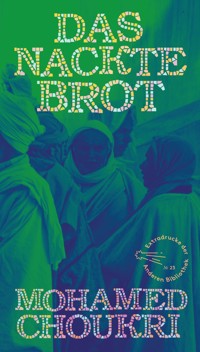
16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Andere Bibliothek
- Sprache: Deutsch
Ein Klassiker der Weltliteratur aus Marokko.
Mohamed Choukri erzählt seine Kindheit und Jugend in Marokko: Der Vater ist Berber-Bauer in einem kleinen Ort im Rif-Gebirge, wo Choukri 1935 geboren wurde. Die Hungersnot treibt die Familie in die verheißungsvolle Stadt, nach Tanger. Aber auch hier finden sie nichts als Elend und Armut. Die Mülltonnen machen die herumstreunenden Kinder nicht satt. Der Schrei nach Brot wird dem jüngeren Bruder zum Verhängnis: Vom Jähzorn der Verzweiflung übermannt, erwürgt ihn der Vater und vertuscht sein Verbrechen. Mohamed bricht mit den Eltern, er schlägt sich als Dieb und Bettler, als Strichjunge und Spieler durchs Leben. Als das Buch 1982 auf Arabisch erschien, wurde es aufgrund seiner Offenheit und Radikalität verboten. Heute zählt »Das nackte Brot« zusammen mit »Zeit der Fehler«, dessen Fortsetzung, zu den Klassikern der Weltliteratur.
»Dieses Buch ist ergreifend, zum Schmunzeln, zum Jauchzen – es ist zum Heulen schön.« DIE ZEIT.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 252
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Über das Buch
»Dieses Buch ist ergreifend, zum Schmunzeln, zum Jauchzen – es ist zum Heulen schön.« DIE ZEIT
Mohamed Choukri (1935–2003) erzählt seine Kindheit und Jugend in Marokko: Der Vater ist Berber-Bauer in einem kleinen Ort im Rif-Gebirge, wo Choukri 1935 geboren wurde. Die Hungersnot treibt die Familie in die verheißungsvolle Stadt, nach Tanger. Aber auch hier finden sie nichts als Elend und Armut. Der Schrei nach Brot wird dem jüngeren Bruder zum Verhängnis. Mohamed schlägt sich als Dieb und Bettler, als Strichjunge und Spieler durchs Leben.
Als das Buch 1982 auf Arabisch erschien, wurde es aufgrund seiner Offenheit und Radikalität verboten. Heute zählt »Das nackte Brot« zusammen mit »Zeit der Fehler«, dessen Fortsetzung, zu den Klassikern der Weltliteratur.
Über Mohamed Choukri
Mohamed Choukri, Sohn eines Bauern aus dem marokkanischen Rif, wurde 1935 in Beni Chiker geboren. Erst mit einundzwanzig Jahren lernte er Lesen und Schreiben – im Gefängnis von Tanger. Von seiner Kindheit und Jugend, geprägt von Armut, Hunger, Kriminalität, Alkohol, Haschisch und Nächten in Bordellen, erzählt Choukri in seinen autobiographischen Romanen »Das nackte Brot« und »Zeit der Fehler«. Später war Choukri Arabischlehrer an einem Gymnasium in Tanger und arbeitete als Literaturkritiker für den Rundfunk. Seine Freundschaft zu Literaten wie Paul Bowles, Jean Genet und Tennessee Williams führte zu seiner Entdeckung als Schriftsteller. Am 15. November 2003 starb Mohamed Choukri im Militärhospital in Rabat.
Georg Brunold, geboren 1953 in Arosa/Graubünden, ist Journalist, Schriftsteller und Übersetzer. Er war Afrika-Korrespondent der Neuen Züricher Zeitung mit Sitz in Nairobi, Stellvertretender Chefredakteur der Kulturzeitschrift »du« in Zürich und lebt heute wieder in Arosa. In der ANDEREN BIBLIOTHEK sind von ihm erschienen: »Nilfieber. Der Wettlauf zu den Quellen« (1993), »Afrika gibt es nicht. Korrespondenzen aus drei Dutzend Ländern« (1994), »Fernstenliebe. Ehen zwischen den Kontinenten« (1999, mit Klaus Hart und R. Kyle Hörst) und »Ein Haus bauen. Besuche auf fünf Kontinenten« (2006).
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Mohamed Choukri
Das nackte Brot
Roman
Aus dem Arabischen von Georg Brunold
Übersicht
Cover
Titel
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
EINS
ZWEI
DREI
VIER
FÜNF
SECHS
SIEBEN
ACHT
NEUN
ZEHN
ELF
ZWÖLF
DREIZEHN
VIERZEHN
Nachbemerkung — von Georg Brunold
Worterklärungen
»Wir drucken nur Bücher, die wir selber lesen möchten.«
Impressum
EINS
Ich weine, weil mein Onkel tot ist. Die Kinder um mich herum weinen mit mir zusammen. Sonst weine ich nur, wenn jemand mich schlägt oder wenn ich etwas verloren habe. Ich sehe auch andere Leute weinen. Der Hunger ist im Rif. Die Dürre und der Krieg.
Eines Abends bin ich nicht mehr imstande, meine Tränen aufzuhalten. Der Hunger schmerzt mich. Ich lutsche meine Daumen, lutsche und lutsche. Ich erbreche mich, doch nur Speichel sabbert aus meinem Mund.
Meine Mutter sagt immer wieder zu mir: »Schweig! Wir werden nach Tanger auswandern. Dort gibt es viel Brot. Du wirst nicht mehr um Brot weinen, wenn wir in Tanger angekommen sind. Dort essen die Leute sich satt.«
Mein Bruder Abdelkader weint nicht.
Meine Mutter sagt: »Sieh deinen Bruder Abdelkader an, er weint nicht, und du weinst.«
Ich schaue in sein bleiches Gesicht und in seine leeren Augen und höre auf zu weinen. Nach wenigen Augenblicken verlässt mich die Geduld wieder, die ich von ihm geborgt habe.
Mein Vater kommt herein. Er findet mich weinend. Er verpasst mir Fußtritte und Faustschläge.
»Schweig! Schweig! Schweig! Das Herz deiner Mutter wirst du fressen, du Hurensohn.«
Er hebt mich in die Luft. Er schleudert mich auf den Boden. Er tritt mich, bis seine Füße erlahmen und meine Hose durchnässt ist.
*
Auf dem Weg in unser Exil, zu Fuß, sahen wir Viehkadaver, um die schwarze Vögel und Hunde ihre Kreise zogen. Ekelhafte Gerüche. Zerfetzte Eingeweide, Gewürm, Blut und Eiter.
Nachts heulten die Schakale in der Nähe des Zeltes, das wir irgendwo aufstellten, dort, wo die Erschöpfung und der Hunger uns zum Halt zwangen. Da und dort begruben die Leute ihre Toten, wo sie soeben gestorben waren. Mein Bruder hustete und hustete.
Ich fragte meine Mutter voller Angst: »Wird er auch sterben?«
»Aber nein. Wer hat dir gesagt, dass er sterben wird?«
»Mein Onkel ist tot.«
»Dein Bruder wird nicht sterben. Er ist nur krank.«
In Tanger sah ich das viele Brot nicht, das mir meine Mutter versprochen hatte. Der Hunger war auch in diesem Paradies, aber es war kein Hunger, der die Leute umbrachte.
Wenn der Hunger sich mit Gewalt über mich hermachte, ging ich hinaus in unser Viertel Ain Ktiouet. Ich suchte in den Mülleimern nach essbaren Resten. Ich traf einen Knaben, in den Mülleimern wühlend wie ich. Sein Kopf und seine Hände voller Pusteln. Barfüßig, Hemd und Hose durchlöchert. Er sagte zu mir: »Die Mülleimer in der Stadt sind besser als die in unserem Quartier. Die Abfälle der Christen sind besser als die der Muslime.«
Nach dieser Entdeckung ging ich ab und zu weiter aus unserem Quartier hinaus. Alleine oder zusammen mit den Mülleimerkindern.
Einmal entdecke ich ein totes Huhn. Ich presse es gegen meine Brust und renne nach Hause. Meine Eltern sind in der Stadt. Mein Bruder hat sich in einer Ecke ausgestreckt. Sein Oberkörper liegt, etwas erhöht, auf einem Kissen. Er atmet schwer. Seine großen, matten Augen überwachen den Eingang. Er sieht das Huhn. Seine Augen werden munter. Er lächelt. Sein ausgemergeltes Gesicht rötet sich. Es kommt Bewegung in ihn, er erwacht aus seiner Bewusstlosigkeit. Er hustet vor Freude. Ich finde ein Messer. Er hustet und keucht. Ich wende mein Gesicht nach Osten, so wie ich meine Mutter beten sehe. Ich sage laut: »Im Namen Gottes. Gott ist groß.« So tun es die Erwachsenen. Ich schneide dem Huhn in die Kehle, bis sein Kopf ganz abgetrennt ist. Ich warte, dass es blutet. Ich massiere es, damit es vielleicht blutet. Etwas Schwarzes, ganz wenig, rinnt aus seinem Hals. Im Rif habe ich Nachbarn ein Schaf schlachten gesehen. Sie hielten ihm ein Becken unter die Kehle, aus der das Blut schäumte. Das Becken wurde voll, und sie gaben es meiner kranken Mutter. Sie hielten sie auf dem Bett fest, doch sie sträubte sich dagegen, das Blut zu trinken. Sie brachten sie mit Gewalt dazu. Das Blut lief ihr über das Gesicht und über die Kleider. Sie wälzte sich im Bett, dann verlor sie die Besinnung und versetzte die andern mit unverständlichen Worten in Aufregung. Warum fließt das Blut jetzt nicht aus der Kehle dieses Huhns, wie ich es aus der Kehle des Schafs fließen sah? Ich höre ihre Stimme: »Was machst du da? Wo hast du es gestohlen?«
»Ich habe es gefunden, krank. Da habe ich es geschlachtet, damit es nicht vorher stirbt. Frag meinen Bruder.«
»Du Narr!« Sie reißt es mir wütend aus den Händen. »Die Menschen essen kein Aas.«
Mein Bruder und ich wechseln traurige Blicke. Er schließt die Augen, in der Hoffnung auf etwas Essbares.
*
Mein Vater kommt jeden Abend verdrossen nach Hause. Wir wohnen in einem einzigen Raum. Manchmal schlafe ich mitten im Gerümpel. Mein Vater ist eine Bestie. Kein Mucks, kein Wort ohne seine Ermächtigung, als würde er über alle Dinge bestimmen und nicht Gott, wie ich es die Leute sagen hörte. Er schlägt meine Mutter ohne verständlichen Grund. Ich habe ihn öfters zu ihr sagen hören: »Ich werde dich verlassen, du Hurentochter. Mach deine Sache allein mit diesen zwei Welpen!«
Er zieht seinen Schnupftabak hoch. Er spricht mit sich allein. Er speit nach unsichtbaren Leuten. Er verflucht uns. Er sagt zu meiner Mutter: »Du bist eine Hure und die Tochter einer Hure.« Er beleidigt die ganze Welt. Manchmal lästert er Gott und bittet ihn hinterher um Verzeihung.
*
Mein Bruder weint. Von Schmerzen gepeinigt, weint er um Brot. Er ist kleiner als ich. Ich sehe IHN auf ihn zugehen. Die Bestie geht auf ihn zu. Wahnsinn in den Augen. Die Arme eines Kraken. Keiner kann ihn aufhalten. Ich will um Hilfe schreien: »Eine Bestie! Ein Verrückter! Haltet ihn!« Das Scheusal dreht ihm mit all seiner Kraft den Hals um. Mein Bruder krümmt sich zusammen. Blut spritzt aus seinem Mund. Ich stürze aus dem Haus, an ihm vorbei, während er meine Mutter mit Schlägen und Tritten zum Schweigen bringt. In einem Versteck warte ich auf das Ende der Schlacht. Nichts regt sich. Um mich die Stimmen dieser Nacht, nah und fern. Der Himmel. Die Lichter Gottes sind Zeugen des Verbrechens meines Vaters. Die Leute schlafen. Die Lichter Gottes leuchten auf und verschwinden. Die Silhouette meiner Mutter. Ihre erstickte Stimme. Sie sucht mich. Sie schluchzt. Warum ist sie nicht so stark wie er? Die Männer schlagen die Frauen, und die Frauen weinen und schreien.
»Mohamed, mein Mohamed! Komm! Hab keine Angst! Komm!« Ich sehe sie gerne so, ohne dass sie mich sehen kann.
»Schau, hier bin ich.«
»Komm!«
»Nein! Er wird mich töten, wie er meinen Bruder getötet hat.«
»Hab keine Angst! Komm mit mir! Er wird dich nicht töten. Sei still, dass uns die Nachbarn nicht hören.«
Er schluchzt und schnupft seinen Tabak. Seltsam: er tötet seinen Sohn, und dann weint er darüber.
Wir blieben alle drei wach, weinten und schwiegen. Mein Bruder wurde in ein weißes Leichentuch gewickelt. Ich schlief ein und ließ die beiden alleine schluchzen.
Am Morgen weinen wir wieder alle, schweigend. Ich mache mich zum ersten Mal zu einem Begräbnis auf. Mein Bruder, verhüllt, in den Armen des Schaichs, dann mein Vater, und ich hinke barfuß hinterher. Sie legen ihn in eine feuchte Grube. Ich zittere und weine. Ein Klecks von geronnenem Blut klebt auf seiner Lippe. Sie bedecken ihn mit Erde. Es bleibt ein kleiner Hügel zurück.
Als wir zum Friedhof hinausgingen, bemerkte der Schaich, dass meine Füße blutverschmiert waren. Er fragte mich auf Rifi: »Mana ’dh-dhamma? Was ist das für Blut?«
»Ich bin auf Scherben getreten.«
Mein Vater sagte: »Er kann nicht einmal richtig gehen. Der Schwachkopf.«
Der Schaich fragte mich: »Du hattest deinen Bruder lieb?«
»Sehr lieb. Meine Mutter hatte ihn sehr lieb. Sie liebte ihn mehr als mich.«
»Wer liebt seine Kinder nicht?!«
Ich dachte daran, wie mein Vater meinem Bruder den Hals umgedreht hatte. Beinahe hätte ich es hinausgeschrien: Mein Vater liebte ihn nicht. Er ist es, der ihn getötet hat. Ja, er hat ihn getötet. Er hat ihn getötet. Ich habe es gesehen, wie er ihn getötet hat. Er, er hat ihn getötet. Ich habe es gesehen, wie er ihn getötet hat. Er hat ihm den Hals umgedreht. Das Blut spritzte aus seinem Mund. Ich habe es gesehen, ich habe es gesehen, wie er ihn getötet hat. Mein Vater hat ihn getötet – dass Gott ihn strafe!
Um den ungeheuren Hass gegen meinen Vater zu unterdrücken, fing ich aufs Neue zu weinen an. Ich hatte Angst, dass er mich töten würde, wie er meinen Bruder getötet hatte. Er schimpfte mit leiser drohender Stimme: »Hast du jetzt genug geheult?«
Der Schaich sagte: »Ja, jetzt ist genug geweint. Dein Bruder ist zu Gott gegangen. Er ist jetzt bei den Engeln.«
Ich hasste auch diesen Mann, der meinen Bruder begraben hatte.
*
Er kauft einen Sack Weißbrot und billigen Tabak. Er geht weit hinaus aus Tanger, zu den Baracken der spanischen Soldaten, zu einer kleinen Schieberei. Am Abend kommt er mit Militärklamotten zurück. Er verkauft sie im großen Souk den marokkanischen Arbeitern und Armen.
Eines Abends kam er nicht zurück. Ich schlief und ließ meine Mutter in Sorge und Tränen. Wir warteten drei Tage. Manchmal weinte ich mit ihr. Ich tröstete sie. Liebt sie ihn? Liebt sie ihn nicht? Ich begriff ihren Kummer, wenn sie sprach:
»Da sind wir, alleine. Wer wird uns helfen? Wir kennen niemanden in dieser Stadt. Deine Großmutter Roukaya, deine Tante Fatma und dein Onkel Idriss sind auch aus dem Rif ausgewandert, nach Oran. Es kann nicht anders sein, die spanischen Soldaten müssen deinen Vater gefasst haben. Er ist aus der spanischen Armee davongelaufen.«
Wir erfuhren, dass sie ihn ins Gefängnis gesteckt hatten. Es hatte ihn ein marokkanischer Soldat verraten, der ihn aus Spanien kannte. Mein Vater wollte ihm eine Decke nicht so billig verkaufen, wie er es verlangte, und darum verriet er ihn. Das war es, was meiner Mutter erzählt wurde.
Sie geht in die Stadt auf Arbeitssuche. Sie kommt genauso enttäuscht zurück wie mein Vater in den ersten Tagen nach unserer Ankunft in Tanger. Sie nagt an ihren Fingernägeln. Sie schluchzt. Zauberer verschreiben ihr Wundermittel, damit mein Vater aus dem Gefängnis entlassen werde und damit sie Arbeit finde. Sie betet und ruft den Himmel an. Sie zündet Kerzen an auf den Gräbern der Heiligen. Sie sucht das Glück der Zukunft bei den Seherinnen. Es gibt keine Freilassung aus dem Gefängnis, es gibt keine Arbeit, es gibt keine Aussicht für uns, außer wenn Gott es will und sein Abgesandter Mohamed. So spricht sie.
»Warum«, frage ich meine Mutter, »gibt uns Gott nicht unser Glück, wie er es den anderen gibt?«
»Nur Gott weiß es. Wir wissen es nicht. Es ist nicht recht, wenn wir nach dem fragen, was der weiß, der über uns ist.«
*
Sie verkaufte Dinge aus unserem Haushalt. Eines Tages hieß sie mich mit den Kindern unserer Nachbarschaft Kraut pflücken zu gehen.
Ich fürchte, dass sie sich über mich hermachen. Es ist kein guter Freund unter ihnen, bei dem ich Hilfe finde, wenn ich mit mehr als einem in eine Keilerei gerate. Denn sie halten zusammen gegen die Neuankömmlinge in der Stadt. Ich bleibe hinter ihnen zurück und tue so, als müsste ich pinkeln. Dann laufe ich in die Stadt hinunter. Ich mag ihr Treiben. Im großen Souk esse ich Kohlblätter, Orangenschalen und Reste von verdorbenem Obst. Einem Jungen, der etwas größer ist als ich, rennt ein Polizist nach. Der Abstand zwischen den beiden ist gering. Ich stelle mir vor, ich sei dieser Junge. Ich keuche mit ihm. Die Leute schreien: »Er wird ihn erwischen! Er wird ihn erwischen!« Sie schreien: »Seht! Er hat ihn!«
Ich zittere. Ich habe Angst. Ich sehe mich, wie ich selbst erwischt werde. Ich habe zu Gott gerufen, dass der Junge nicht erwischt werden möge. Doch sie haben ihn. Ich bin voller Hass gegen jene, die sich darüber freuen. Doch sie haben ihn. Von Weitem sehe ich eine Frau, eine Europäerin, keuchend die Menge der Gaffer einholen. Ich höre sie etwas rufen, in einer Sprache, die ich nicht verstehe. Ein Marokkaner sagt: »Er hat ihr nichts außer dem Griff der Tasche gelassen.«
Ein Polizist drischt mir seinen Stock über den Hintern. Ich fahre hoch und jaule auf Rifi: »Aimainou! Aimainou! Mutter! Mutter!« Ich stoße lautlos Verwünschungen aus. Zwei andere Polizisten prügeln die Knaben und treiben die Männer auseinander. Sie schlagen auch die Erwachsenen, die arm aussehen.
Ich hatte schon gehört, dass die Polizei die Leute schlägt und sie ins Gefängnis steckt, wenn sie getötet oder gestohlen haben oder wenn bei einer Schlägerei Blut fließt.
*
Ich ging in den Friedhof Bouarrakia. Ich nahm ein paar Basilikumzweige von den schönen Gräbern und legte sie auf das Grab meines Bruders. Ich sah viele Gräber ohne Basilikum, ohne Grabplatte, wie das Grab meines Bruders: ein Erdhügel und zwei einfache Steine, der eine über dem Kopf, der andere über den Füßen. Die vergessenen Gräber machten mich traurig: über und über von Unkraut bedeckt, einige von ihnen ganz ausgelöscht. Auch hier, im Friedhof, gibt es die Reichen und die Armen. »Warum sterben die Menschen?« – »Gott will es so.« Das war die Antwort meiner Mutter. »Wohin gehen die, die sterben?« – »Ins Paradies oder ins Feuer.«
»Und wir?«
»Ins Paradies, wenn Gott will.«
»Was ist dort im Paradies?«
»Du stellst zu viele Fragen. Wenn du groß bist, wirst du alles das verstehen.«
Ich fand im Friedhof das Kraut, das mir meine Mutter beschrieben hatte. Ich sah drei Männer, die eine Flasche im Kreis herumgehen ließen und daraus eine dunkle Flüssigkeit tranken. Einer von ihnen rief mir zu: »He, du! Komm, Kleiner! Komm, ich gebe dir etwas.«
Ich bekam Angst und rannte davon.
»Gib es deiner Mutter, du Hurensohn!«
*
Beim Mittagessen sagte sie zu mir: »Dieses Kraut ist wunderbar.«
Ich verspeiste es mit demselben Genuss wie sie. Ich schlang mehr, als dass ich kaute.
»Wo hast du es gesammelt?«
»Auf dem Friedhof Bouarrakia.«
»Auf dem Friedhof?!«
»Ja, auf dem Friedhof. Was ist dabei?«
Sie brachte den Mund nicht mehr zu.
»Ich habe das Grab meines Bruders besucht, ich habe einen Basilikumzweig daraufgelegt. Der Erdhügel seines Grabes ist nicht mehr hoch. Wenn er sich weiter so senkt, wird das Grab bald dem Erdboden gleich sein, und wir werden es von den angrenzenden Gräbern nicht mehr unterscheiden können.«
Sie hatte aufgehört zu essen. Ihr Gesicht war versteinert. Ihre Augen füllten sich mit Tränen. Ich fügte hinzu: »Dieses Kraut gibt es dort im Überfluss, um die vergessenen Gräber herum.«
»Was im Friedhof wächst, darf man nicht essen.«
»Warum?«
Bestürzt sah sie mich an. Ich aß mit Appetit weiter. Ich glaubte, sie müsste erbrechen. Sie nahm mir den Teller weg und sagte auf Rifi: »Jetzt reicht’s! – Dass du dich selber isst!«
»Ich bin nicht satt.«
»Woher hast du den Basilikumzweig genommen?«
»Von einem der Gräber. Da ist eine Menge Basilikum.«
Sie sagte aufgebracht: »Morgen wirst du zum Friedhof zurückgehen und das Basilikum an seinen Ort zurücklegen. Das sind die Gräber von anderen Leuten. Pass auf, dass dich niemand dabei sieht. Wir werden für deinen Bruder auch welche kaufen. Dann machen wir ihm ein schönes Grab.«
Sie fing an zu schluchzen. Auch mich überkam der Kummer, und meine Tränen flossen. Sie drückte mich an sich, und ich schlummerte ein.
*
Sie nimmt mich mit zum großen Souk. Wir kaufen einen Haufen altes Brot, das die Bettler unter einem hohen Baum beim Grab des heiligen Sidi El Makhfi verkaufen. Sie kocht es im Wasser weich, mit einem bisschen Öl und Gewürzen. Manchmal ohne.
Eines Morgens früh sagte sie zu mir: »Ich gehe zum Markt. Ich will Gemüse und Obst kaufen und es weiterverkaufen. Du bleibst hier. Pass auf das Haus auf! Und dass du nicht mit den Kindern spielst und das Haus den Dieben überlässt!«
Die Kinder des Quartiers sind anders als ich. Ich fühle mich minderwertig unter ihnen, obwohl einige genauso elend dran sind wie ich. Als ich einen von ihnen Hühnerknochen aus einem Mülleimer klauben und daran lutschen sah, sagte er: »Die Herren des Hauses hier werfen immer guten Abfall weg.«
Doch über mich sagten sie: »Das ist ein Rifi. Er ist aus dem Land des Hungers und der Mörder gekommen.«
»Er spricht nicht Arabisch.«
»Die Leute vom Rif sind alle krank, dieses Jahr, sie haben die Krankheit des Hungers.«
»Sogar ihre Tiere sind krank.«
»Wir essen sie nicht. Sie essen sie. Das macht sie kränker und kränker.«
»Wenn ihnen eine Kuh stirbt oder ein Schaf oder eine Ziege, essen sie sie. Sie essen sogar Aas.«
Der Junge, der aus den Bergen in die Stadt gekommen ist wie der Rifi, teilt mit ihm diese Ecke, doch er wird nicht in gleicher Weise gedemütigt. Er schneidet besser ab, er ist ein Leichtgläubiger: Der Rifi ist ein Betrüger, der Junge aus den Bergen ist ein Einfaltspinsel.
*
An unser Haus grenzt ein kleiner Obstgarten. Der große Birnbaum führte mich jeden Tag in Versuchung. Eines Morgens früh erwischte mich der Besitzer des Gartens dabei, wie ich seine großen Birnen herunterschlug, die reifsten, mit einem langen Schilfrohr. Er schleifte mich hinter sich her, und ich versuchte heulend, mich frei zu machen. Meine weiße Pumphose war durchnässt von Urin, obwohl er mich nicht schlug. Er sagte zu seiner lächelnden Frau: »Da ist er, der Käfer, der unseren Birnbaum schädigt. Er zerstört mehr, als er essen kann, wie die Ratten.«
Sie fragte mich mit einer Freundlichkeit, die meine Angst milderte: »Wo ist deine Mutter, mein Kleiner?«
»Sie ist zum Souk gegangen, Gemüse und Obst zu verkaufen.«
»Hör auf zu weinen! Und dein Vater?«
»In Haft.«
»In Haft?«
»Ja, in Haft.«
»Der Arme! Warum ist er in Haft?«
Die Frage machte mich verlegen. Sie wiederholte sie, zärtlich mein Gesicht streichelnd.
»Sag mir, warum ist dein Vater in Haft?«
Ich dachte, die aufrichtige Antwort würde die Ehre meiner Eltern verletzen.
»Ich weiß nicht. Meine Mutter weiß es.«
Der Mann diskutierte mit seiner Frau, wo sie mich festhalten sollten, bis meine Mutter zurück war. Seine Tochter war dazugekommen, barfuß, um den Kopf ein weißes Tuch, ihre zierlichen, makellosen Hände nass. Ich merkte, dass die Frau und das Mädchen Mitleid mit mir hatten. Aber der Mann, zwischen Ernst und Scherz, schien in seinen Worten und Gesten entschlossen, mich zu bestrafen. Er führte mich in einen dunklen Raum, überfüllt mit altem Gerümpel, lauter kaputten Sachen. Er sagte zu mir, ehe er die Tür zuschloss: »Wehe, wenn du heulst. Ich geb’s dir mit dieser Rute hier, wenn du heulst.«
Gefangen in einem Zimmer. Es ist das erste Mal. Ich erfahre, dass Leute, die nicht zu meiner Familie gehören, über mich verfügen können. Die Birnen gehören denen, die mich jetzt eingesperrt haben. Aber warum verlassen wir das Rif, während andere Leute auf ihrem Land bleiben? Warum ist mein Vater im Gefängnis, warum verkauft meine Mutter Gemüse und lässt mich hungernd allein, während dieser Mann und seine Frau in ihrem Haus bleiben? Warum haben wir nicht, was die anderen haben?
Durchs Schlüsselloch sehe ich das Mädchen voll Eifer mit Wasser und Seife den Boden säubern, immer noch barfuß, das Kleid über die weißen Schenkel hochgezogen, ihre kleinen Brüste nackt. Sie hüpfen aus ihrer Bluse, verschwinden und tauchen wieder auf, wie zwei Trauben. Ihr Haar ist ganz von ihrem weißen, hennabefleckten Tuch umhüllt, wie ein Krautwickel.
Ängstlich klopfe ich gegen die Tür. Mein Auge folgt ihren Bewegungen. Mein Herz klopft mit ihren Bewegungen, bange und bezaubert zugleich. Sie hat sich zur Tür umgewandt, noch immer vornübergebeugt, um den Boden aufzutrocknen.
»Komm und mach mir diese verfluchte Tür auf!«
Einen Augenblick ist sie unentschlossen. Innerlich flehe ich weiter: Ich bitte dich, sei nicht so unentschlossen, komm zu mir! Sie lässt den Lappen liegen und richtet sich auf. Sie trocknet sich die Hände und stemmt sie in die Hüften. Ein leichter Schmerz huscht über ihr gerötetes Gesicht. Doch da kommt sie schon auf die Tür zu. Mein Herz klopft. Ich zittere. Sie schließt die Tür auf und sagt freundlich lächelnd: »Hier bin ich! Was willst du?«
Ich stottere, Tränen in den Augen: »Meine Mutter schlägt mich, wenn sie vom Souk zurückkommt und mich nicht im Haus findet. Sie hat mich dagelassen, es zu bewachen.«
Ich senkte den Kopf, voller Scham, herzerweichend. Mein Blick fiel auf ihre vollen Schenkel. Sie zog ihr Kleid zurecht. Sie musterte mich mitleidig. Ich blickte bittend zu ihr auf. Sie knöpfte ihre offene Bluse zu. Ihre Brüste saßen jetzt fest. Durch das Weiß der Bluse schimmerten ihre Warzen wie zwei Traubenbeeren.
»Wirst du noch einmal mit deinem Stock die Birnen vom Baum in unserem Garten schlagen?«
»Nie! Töte mich mit deinen eigenen Händen, wenn du mich noch einmal dabei erwischst!«
Sie lächelte. Ich nicht. Ich rannte hinaus. Ihre sanfte Stimme holte mich ein: »Komm! Bist du hungrig?«
Ich zuckte zusammen. In meiner Aufregung sagte ich: »Nein, satt.«
Sie bestand darauf, dass ich wartete. Ihre Eltern waren ausgegangen. Ich warf einen Blick zum Baum. In meine Liebe zu ihm hatte sich Abneigung gemischt. Ich würde nicht mehr von ihm essen. Sie streckte mir einen Fladen Brot hin, triefend von schwarzem Honig.
»Wenn du Hunger hast, schau bei uns vorbei! Hast du keine Schuhe?«
»Meine Mutter wird mir ein Paar kaufen.«
Sie schaute mir lächelnd nach, und ich entfernte mich, immer wieder zurückblickend. Bevor ich verschwand, sah ich sie winken. Ich winkte lächelnd zurück und verschwand.
*
Er folgt uns hartnäckig. Er macht sich an sie heran und flüstert ihr etwas ins Ohr. Sie entfernt sich von ihm. Wir wechseln die Straßenseite. Sie fasst meine Hand, zerrt mich ein paarmal jäh mit sich. Er bleibt uns verbissen auf den Fersen. Er grinst. Sie ist aufgebracht. Wir bleiben stehen. Er überholt uns und verlangsamt seine Schritte. Wir wechseln aufs Neue die Straßenseite. Er folgt uns hartnäckig. Ich bin wütend. Ich frage sie: »Was will er eigentlich, dieser Mann?«
»Das ist nicht deine Sache.«
Ich blicke mich nach ihm um. Er lächelt. Er folgt uns weiter. Was will er von meiner Mutter? Will er sie entführen? Kein Zweifel, er ist ein Räuber Ich halte ihre Hand, so fest ich kann.
»Klammer dich nicht so fest! Ich laufe dir nicht davon.«
Wütend schreie ich ihn an: »Geh weg! Geh weg! Was willst du?«
Al-la’ana alaihi! Er lacht. Er lacht mich an und lacht meine Mutter an. Sie sagt zu mir: »Ich habe dir gesagt, du sollst schweigen. Hörst du nicht?«
Obwohl ich es sie nicht merken lasse, bin ich auch auf sie böse. Ich verteidige sie, und sie heißt mich schweigen.
Da traf meine Mutter eine Frau. Sie fingen an, von meinem Vater zu sprechen. Der Verfolger entfernte sich. Die Frau strich mir durchs Haar. Ihre raue Hand fuhr mir liebkosend übers Gesicht. Ich ließ die Hand meiner Mutter los und umschlang ihre Hüften. Die Frau sagte: »Warum ist dein Mohamed so traurig?«
Meine Mutter schaute zu mir herunter und legte mir den Arm um den Hals. Meine Wut verging. Sie sagte zu der Frau: »Er ist immer so.«
Sie verabschiedeten sich. Meine Mutter sagte zu mir: »Küss Laila Luiza die Hand!«
Gehorsam küsste ich der Frau Luiza die Hand.
*
Der Bauch meiner Mutter schwillt an. Manchmal geht sie nicht zum Souk. Sie erbricht sich tagsüber öfter. Sie ist erschöpft. Ihre Beine schmerzen. Sie schluchzt. Ihr Bauch schwillt und schwillt. Ich habe Angst, dass er platzt.
Ihr endloses Schluchzen machte auf mich keinen Eindruck mehr. Ich wurde härter, immer härter und trauriger. Ich ließ auch das Spielen. Eines Nachts trugen sie mich halb schlafend in ein anderes Haus. Dort schlief ich mit drei Kindern zusammen. Am Morgen sagte die Nachbarin zu mir: »So, du, jetzt hast du eine Schwester. Sei lieb zu ihr!«
*
Sie besucht ihn einmal jede Woche im Gefängnis. Manchmal kommt sie in Tränen zurück. Ich habe begriffen, dass die Frauen mehr weinen als die Männer. Sie weinen und hören auf zu weinen, wie die Kinder. Manchmal sind sie traurig, wenn man denkt, sie müssten sich freuen, und sie freuen sich, wenn man denkt, sie müssten traurig sein. Wann sind sie traurig und wann froh? Ich habe meine Mutter schon zur selben Zeit weinen und lachen gesehen. Ist sie verrückt?
Ich bleibe zu Hause, um auf meine Schwester Rhimou aufzupassen. Ich weiß, wie ich sie zum Lachen bringen kann. Aber ich weiß nicht, wie ich sie zum Schweigen bringen kann, wenn sie weint. Ich bin es leid und gehe hinaus. Ich lasse sie liegen, weinend und mit ihren ungelenken Gliedern strampelnd, wie eine Schildkröte auf dem Rücken. Wenn ich wiederkomme, finde ich sie schlafend oder lächelnd. Meistens schlafend. Die Fliegen tummeln sich auf ihrem Gesicht, das von den Stichen der Mücken gefleckt ist. Nachts die Mücken, tags die Fliegen.
Meine Schwester wächst. Meine Mutter weint und jammert jetzt weniger. Ich werde immer gewalttätiger, gegen meine Mutter und gegen die Kinder im Quartier. Wenn ich gegen sie den Kürzeren ziehe, zerschlage ich Gegenstände, oder ich werfe mich zu Boden, schlage mich selbst, schreiend und heulend, und beschimpfe meine Mutter oder die Kinder.
Ich fragte sie: »Können auch die Frauen ins Gefängnis gesperrt werden?«
»Warum?«
»Ich frage nur.«
»Ja, auch die Frauen, wenn sie den Leuten etwas Schlechtes getan haben.«
*
Sie hat angefangen, uns zum Souk mitzunehmen. Meine Schwester saugt an ihrer Brust, und ich suche meine Nahrung meistens fern von den beiden, im Souk oder in den Gassen der Medina. Ich bettle und stehle. Wenn sie mich schilt, weil ich wegbleibe, sage ich zu ihr: »Ich verschwinde aus diesem Dreckhaus. Ich komme nie wieder.«
»So bist du! Du Käfer! Schon jetzt bist du so. Was muss ich erst sagen, wenn du größer bist …?«
Eines Morgens überraschte er uns im großen Souk, begleitet von einer Nachbarin, die ihn zu meiner Mutter geführt hatte. Meine Mutter schluchzte, im Souk und zu Hause. Warum schluchzt sie seinetwegen? Er ist roh und böse. Diese Nacht überfiel mich der Schlaf früher als gewöhnlich, und ich ließ die beiden einander ihr Leid klagen.
Am Morgen ging sie nicht zum Souk. Sie ging ins öffentliche Bad. Sie schmückte sich, putzte sich die Zähne und schminkte sich die Augen. Ich sah sie sehr fröhlich diesen Morgen. Eigenartig. Als mein Vater das Haus verließ, sah ich sie trotz ihrer Aufmachung schluchzen. Ich dachte, ich habe noch nie eine Frau so viel weinen sehen wie sie. Ich fragte sie, warum sie weine. Sie erklärte mir, dass mein Vater den Soldaten suchen gehe, der ihn verraten habe, und dass die beiden miteinander kämpfen würden. Das passte mir. Ich hoffte, dass er den Soldaten finden und töten würde, damit er ein zweites Mal wegbliebe, diesmal lange. Dass einer der beiden den andern töten würde. Das war alles, was ich wünschte. Ich wollte ihn weghaben, lebend oder tot.
Am Abend kam er missmutig nach Hause. Er hatte eine Weinfahne. Ich hörte meine Mutter zu ihm sagen: »Du hast getrunken, nicht wahr?«
Er stammelte ein paar Worte und sank niedergeschlagen und erschöpft zusammen. Er war traurig, weil er nicht gefunden hatte, was er suchte, und ich war traurig, weil er zurückgekommen war. Ich hörte sie über unseren Umzug nach Tetuan diskutieren. Es würde nicht bei unserem ersten Exil bleiben. Sie diskutierten immer noch traurig miteinander, als ich einschlief.
In der Nacht weckte mich meine volle Blase. Schmatzende Küsse. Unausgesetztes Keuchen. Die Verrenkungen der Liebe. Sie lieben sich. Fluch über ihre Liebe! Klatschendes Fleisch. Puh! Wie sie lügt! Nie mehr werde ich ihr glauben!
»Deinen Mund!«
»Hier bin ich. Nicht grob! Nicht so! Warte!«
Was tun sie?
»Ich will dir sagen, wie!«
»Ich lege mich auf den Fußboden schlafen!«
Er schlägt sie. Was tun sie?
»Hurentochter!«
»Aber nein, nein, du tust mir weh! Das ist mein Darm! So, so ist es besser. Nein, nein, nicht so! Ja, so.«





























