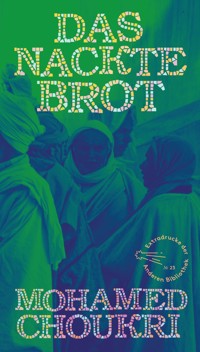16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Andere Bibliothek
- Sprache: Deutsch
20 Jahre nach seinem Tod: Die Wiederentdeckung des meistgelesenen Schriftstellers Marokkos, der jahrzehntelang wie Salman Rushdie auf der berüchtigten schwarzen Liste der Islamisten stand.
Ein Leben im Marokko der 1950er Jahre: Der zwanzigjährige Erzähler ist ein Rauf-, Sauf- und Hurenbold und zugleich ein ängstliches, einsames Kind. Nun ist er begierig darauf, lesen zu lernen. In 27 Kapiteln erzählt er, direkt und schonungslos, von einem Leben auf Messers Schneide, von den Tagen in der Schule in Larache und fiebrigen Nächten in Tanger. Darin verwoben die Gefühle und Erinnerungen: die zitternden Hände bei den ersten Schreibversuchen, die Jagd nach Essbarem, die Kälte und die Sehnsucht nach Rausch und Leidenschaft. Um zu Geld zu kommen, lässt er sich auf krumme Geschäfte ein. Das Geld braucht er nicht in erster Linie für Essen und Bleibe, sondern für Haschisch, Wein und Prostituierte. Doch immer mehr dringt Mohamed in die für ihn neue Welt der Bücher ein, und unmerklich geht eine Wandlung in ihm vor.
»Mohamed Choukris Leben ist spannender, poetischer, verzweifelter und wilder, als jeder Roman sein könnte. Und er hat es in blendenden Bildern festgehalten, die das Lesen zu einem Erlebnis machen – zu einem Erlebnis, das aufwühlt, das im Schrecken fasziniert.« SÜDDEUTSCHE ZEITUNG.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 286
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Über das Buch
Die Wiederentdeckung des meistgelesenen Schriftstellers Marokkos, der jahrzehntelang wie Salman Rushdie auf der schwarzen Liste der Islamisten stand
Ein Leben im Marokko der 1950er Jahre: Der zwanzigjährige Erzähler ist ein Rauf-, Sauf- und Hurenbold und zugleich ein ängstliches, einsames Kind. Nun ist er begierig darauf, lesen zu lernen. In 27 Kapiteln erzählt er, direkt und schonungslos, von einem Leben auf Messers Schneide, von den Tagen in der Schule in Larache und fiebrigen Nächten in Tanger. Darin verwoben die Gefühle und Erinnerungen: die zitternden Hände bei den ersten Schreibversuchen, die Jagd nach Essbarem, die Kälte und die Sehnsucht nach Rausch und Leidenschaft.
»Mohamed Choukris Leben ist spannender, poetischer, verzweifelter und wilder, als jeder Roman sein könnte …« SÜDDEUTSCHE ZEITUNG
Über Mohamed Choukri
Mohamed Choukri, Sohn eines Bauern aus dem marokkanischen Rif, wurde 1935 in Beni Chiker geboren. Erst mit einundzwanzig Jahren lernte er Lesen und Schreiben – im Gefängnis von Tanger. Von seiner Kindheit und Jugend, geprägt von Armut, Hunger, Kriminalität, Alkohol, Haschisch und Nächten in Bordellen, erzählt Choukri in seinen autobiographischen Romanen »Das nackte Brot« und »Zeit der Fehler«. Später war Choukri Arabischlehrer an einem Gymnasium in Tanger und arbeitete als Literaturkritiker für den Rundfunk. Seine Freundschaft zu Literaten wie Paul Bowles, Jean Genet und Tennessee Williams führte zu seiner Entdeckung als Schriftsteller. Am 15. November 2003 starb Mohamed Choukri im Militärhospital in Rabat.
Doris Kilias (1942–2008) studierte Romanistik und Arabistik in Berlin und Kairo. Sie arbeitete als Literaturwissenschaftlerin an der Humboldt-Universität zu Berlin und Übersetzerin aus dem Arabischen. Neben Mohamed Choukri übertrug sie Werke von Nagib Mahfuz, Gamal al-Ghitani, Miral al-Tahawi, Rajaa Alsanea, Baha Taher und Emily Nasrallah.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Mohamed Choukri
Zeit der Fehler
Autobiographischer Roman
Aus dem Arabischen von Doris Kilias
Übersicht
Cover
Titel
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Eine Blume ohne Duft
Der erste Unterricht
Im Speisesaal
Eine verbrannte Laus riecht nach Mensch
El Marouani
Eigensinnige Liebe ist hart wie das Brot der Armen
Fatima
Salz wird niemals blühen
Ein Besuch
Der Honig menschlicher Schönheit
Süẞe Ferne
Wiedergefundene Schönheit
Der Vogel des Glücks
Die Träumer
Rosario
Von Honig zu Asche
Leben in der Zeit der Fehler
Die Vergessenen
Sara
Und am Himmel beinlose Vögel
Der Narziss
Streichholzschachtel
Weihrauch
Luschuwali
Patricia
Bildteil
Blockade
Mallorca
Der Tod der Mutter
Eine Liebe, die nicht sein kann
Tingis
Georg Brunold — Begegnung mit Mohamed Choukri
Georg Brunold — Porträt einer Stadt: Tanger 1987/1988
Der äußerste Westen des Ostens
Temperamentvoller Empfang
Interkontinentalismus
Gravitation der Erinnerung
Anhaltender Verkehr
In der Sackgasse
Himmel und Hölle
Geld und Gut
Force majeure
Toleranz
Ölwaffe
Große Voraussicht
Die Abwesende
Bildnachweis
Erläuterungen
Impressum
Eine Blume ohne Duft
Vor dem Bus, aus dem ich ausgestiegen war, kam ein schmutziges Kind auf mich zu, barfuß, ungefähr zehn Jahre alt.
»Ein Hotel, wollen Sie ein Hotel?«
»Souk El Gabibat. Wo ist Souk El Gabibat?«
»Gehen Sie mir nach.«
Es sah mich und den schäbigen Koffer an. Es wollte ihn tragen. Ich gab ihm dafür fünf spanische Céntimos. Wir bedankten uns gegenseitig, und das Kind ging fort. Der Markt war mit Händlern bevölkert, die in Läden und im Freien frische und fast verdorbene Lebensmittel verkauften. Manche saßen, manche liefen herum. Die Sonne war am Untergehen. Aus den Läden waren arabische Rundfunksender zu hören. Ich schlenderte ein paar Minuten auf dem Markt herum. Ich fragte einen Verkäufer von gebrauchter Kleidung nach dem Café Si Abdallah. Gleichgültig und mit einer schnellen Bewegung wies er hinüber und fuhr gleich wieder mit der öffentlichen Versteigerung fort, indem er laut die Preise der Kleidungsstücke ausrief, die er über die Schulter geworfen hatte oder in der Hand hielt. Links am Eingang des Cafés stand ein hölzernes Gestell, auf dem Speisen angeboten wurden: gebratener Fisch und Paprika, gekochte Eier und ein Stapel Schwarzbrot. Auf allem saßen Fliegen. In der Nähe des Herds stand ein großer, langer Tisch, an dem einige Männer Karten spielten, während andere an kleinen Tischen nur dasaßen und Kif rauchten. Gesichtern und Kleidung war das Elend deutlich anzusehen. Sie nahmen kaum Notiz von mir. Ich setzte mich in eine Ecke an einen kleinen, schmutzigen Tisch und bestellte beim Küchenchef grünen Tee mit Pfefferminze. Ich dachte, das müsste Si Abdallah sein. In meiner Nähe saß ein Alter, der Kif verkaufte. Er erinnerte mich an Afiouna aus dem Café Si Mouh in Tanger. Ich kaufte ihm eine Packung ab. Er bereitete mir einen »Schakaf«[1] aus seinem »Matwi«[2] vor, und jedes Mal, wenn ich einen »Sabsi«[3] von ihm wollte, reichte er mir einen – mit seinem Kif – vollen zu, den ich ihm dann wieder – mit meinem Kif – gefüllt zurückgab. Er rauchte davon, hielt ihn dann einem der Umsitzenden hin.[4]
Si Abdallah kam mit dem Tee. Ich fragte ihn nach Mailudi, dem Freund von Hassan Zailachi.
»Er ist seit drei Tagen nicht gekommen.«
Später in der Nacht überwältigten mich das Kif, der Hunger, die Fremdheit. Ich schlürfte Tee aus Gläsern der anderen, sie tranken aus meinem. Ich fühlte mich heimisch unter ihnen. Ich erzählte von Tetuan, Tanger, Oran, und sie sprachen über Larache. Einer von ihnen sagte: »Es heißt, wer Tanger nicht gesehen hat, den beweint die Stadt, und wer Tanger sah, der weint ihr nach.«
»Sie ist uralt, und wer sich in sie verliebt, ist verloren.«
»Die schamlose Hurerei hat alle Schönheit verdorben.«
»Aber sie ist schön, und ihre Geschichte geht über Jahrhunderte.«
Ich war zu faul, um hinauszugehen und nach etwas Essbarem zu suchen. Immer, wenn ich an die Fliegen dachte, die ich beim Hereinkommen auf den Speisen gesehen hatte, wurde mir übel, so dass ich nichts davon bestellen konnte. Meistens ekele ich mich vor keinem Essen. Die trockenen Gesichter und das Herumsitzen machten mich müde. Schläfrigkeit überfiel mich. Ich schloss die Augen, öffnete sie träge. Alles, was ich sah, schien mir blässlich zu sein. Die meisten waren gegangen. Auch die Stühle und Tische schienen nicht mehr zu existieren. Ich warf einen Blick auf die drei geschlossenen Türen. In das Zimmer gegenüber gingen elende Figuren hinein, kamen heraus. Die beiden anderen Räume blieben meistens geschlossen. Als die Tür des einen Zimmers einmal geöffnet wurde, konnte ich als einziges Polster eine Matte erkennen. Ich dachte, Si Abdallah zu fragen, was das Schlafen in den Gruppenräumen kostete. Nein, keinesfalls, ich musste sparen. Noch wusste ich nicht, was mich in dieser Stadt erwartete. Der Patron des Cafés klopfte mir auf die Schulter – ich war eingenickt.
»Wir schließen.«
Drei Leute saßen kifrauchend am Spieltisch. Ich bat Si Abdallah, bis zum nächsten Tag meinen Koffer bei ihm lassen zu dürfen. Er verlangte, dass ich ihm den Inhalt zeigte: zwei große, gerahmte Porträts, eine Hose, zwei Hemden, ein Paar Socken.
Ich schlendere in den Straßen herum. Keine Spur von einer Patrouille der Sicherheitspolizei, auch keine Wachleute, die auf Läden und Autos aufpassen wie in Tanger. Mitternacht oder später. Ziellos streife ich umher. Es gibt nichts, was Angst macht. Milde Temperatur, Mondnacht. Eine Grünanlage entlang des Meers. Lichter funkeln auf dem Wasser. Ich denke an die Nächte in Tanger, verführerisch bis auf den Tod. An die Fischfangplätze: »Ras El Mnar«, »Malabata«, »Herkulesgrotten«, »Sidi Kankouche«, »El Marisa«, »El Raml Kal«. Hier bin ich allein. Der Mond verhüllt sich, kommt wieder hervor. Ich habe eine weiße Blume in der Anlage gepflückt, rieche daran. In meinem Innern regt sich keinerlei Gefühl. Schöne Blumen. Etwas, das nichts verströmt. Verlassene Schönheit. Sie blühen, bis sie welken oder gepflückt werden, einfach so, aus Spielerei, bevor sie zertrampelt werden. Ich habe nichts, was ich in dieser Nacht fürchten müsste zu verlieren. Ich bin wie diese Blume, die ich nun zwischen den Fingern zerquetsche. Ich werde hier oder an irgendeinem anderen Platz schlafen. Die Meeresluft nimmt mir ein wenig die Schläfrigkeit.
Ich kehre zum Souk El Gabibat zurück, hocke mich im Säulengang des Platzes hin. Ich lege den Kopf zwischen die auf den Knien verschränkten Arme. Solange ich wach bin, höre ich keinerlei Schritte auf dem Platz. Keinen Gedanken kann ich festhalten. Selbst die schönsten Melodien, die ich liebe, entschwinden mir, kaum dass sie gekommen sind. Mein Verstand ist leer, wie gewaschen. Als speicherte ich keinerlei Erinnerung auf, der um ihrer Schönheit willen nachzutrauern ist. Ein leichter Schmerz im Kopf und ein Summen. Mir kommt es vor, als hörte ich die Schläge meines Herzens. Vielleicht kommt das vom Kif. Und von der Leere im Magen.
Ich wachte früh auf. Meine volle Blase schmerzte mich, mein Ding stand aufrecht. Menschentrauben ergossen sich über der Place d’Espagne. Ich kaufte ein bisschen Schurrus[5] . Auf der Toilette des spanischen Cafés spritzte mein Urin wie eine Fontäne. Hose und Hände wurden nass. Ich trank Kaffee mit Milch. Im Café saßen viele Reisende. Das von Si Abdallah war noch nicht geöffnet. Ich stieg in den Bus zum Neuen Viertel, um nach der Schule El Mutamid Ben Abbad zu suchen. Wo man hinsah, gab es nur Staub, Müll und Feigenbüsche auf vertrocknetem Boden. Statt Häusern sah ich Hütten aus Blech und Ziegeln. Die Bewohner kamen vom Land, ihre Gesichter waren schmutzig grau, wie die Lumpen an ihrem Leib. Die Kinder kackten und pinkelten dicht bei den Hütten.
Der Wächter der Schule, den ich nach dem Direktor fragte, sagte: »Warum wollen Sie mit ihm sprechen?«
»Ich habe einen Brief für ihn.«
»Geben Sie her.«
»Ich soll ihn persönlich übergeben.«
Er sah mich an, als wäre ich das Letzte, was ihm unterkam, dann ging er weg, entweder um den Direktor zu fragen oder um gleich mit einer erlogenen Ausrede zurückzukommen. Er kehrte zurück, brachte mich zum Direktor. Ich gab ihm das Empfehlungsschreiben, das ich zerknüllt aus meiner Tasche hervorgeholt hatte. Er erlaubte mir, mich zu setzen, und begann zu lesen. Er lächelte. Was belustigte ihn? Hatte Hassan mich betrogen, und er spottete über mich? Der Direktor legte den Brief auf ein Aktenstück auf seinem Schreibtisch. »Von wo sind Sie?«
»Vom Rif.«
»Und wo leben Ihre Eltern?«
»Meine Mutter wohnt in Tetuan, ich bin nach Tanger gegangen, um mein Leben dort in den Griff zu bekommen.«
»Und Ihr Vater?«
»Ist gestorben.« (Mein Vater sollte erst im Sommer 1979, dreiundzwanzig Jahre später, sterben.)
»Was haben Sie in Tanger gemacht?«
Aha, das Verhör beginnt.
»Alles Mögliche.«
»Wie – alles Mögliche?«
»Ich habe jede Arbeit genommen, die sich fand.«
»Haben Sie jemals eine Schule besucht?«
Sein Dialekt klingt nach der Bergregion.
»Nie.«
Da stecke ich nun in der Falle. Das Blut schießt mir in den Kopf. Von einem Prüfungsverhör hat mir Hassan nichts erzählt. »Du übergibst dem Direktor den Brief, und er nimmt dich in seiner Schule auf«, das hat er zu mir gesagt. Meine Stirn ist mit Schweiß bedeckt. Ich fühle, wie kalte Tropfen aus den Achselhöhlen rollen.
»Es tut mir leid, aber ich kann Sie in dieser Schule nicht aufnehmen. Am besten, Sie kehren nach Tanger zurück. Dort können Sie sich den Lebensunterhalt wie bisher verdienen.«
»Aber ich will lieber lernen. Ich hasse das, was ich in Tanger gemacht habe.«
Er stützt die Hände auf die Umrandung des Schreibtischs, betrachtet das Empfehlungsschreiben. Er hebt den Kopf. »Wie alt sind Sie?«
»Zwanzig.«
»Wissen Sie, was Hassan vor ein paar Tagen hier in Larache gemacht hat?«
»Nein.«
»Man fand ihn betrunken mit einem Freund in der Moschee. Sie sind jetzt beide von der Schule verwiesen.«
Ich sage mir: Was mich betrifft, werde ich es mit niemandem treiben. Später erst sollte ich erfahren, dass die beiden im oberen Raum der Moschee übernachteten, dort, wo die Schüler schliefen, die kein Stipendium bekamen und keinen Wohnraum hatten. Hassan hatte mich also getäuscht. Wie einer, der sich eines fälschlicherweise vorgebrachten Verdachts erwehren will, antworte ich dem Direktor: »Ich bin nicht wie er.« Er lächelt. »Ich wusste nicht, dass er so etwas gemacht hat. Was er tat, ist Sünde.«
In Wirklichkeit interessiert es mich nicht, was Hassan angestellt hat. In Tanger hatte er zu mir gesagt: »Ich gehe nach Tetuan, dann kehre ich nach Larache zurück.«
»Es tut mir leid, aber in der Schulklasse, in der Sie lernen müssten, sind Kinder, und Sie haben einen Bart. Die, die älter sind, kennen meistens schon den Koran, die Garumija und Ibn Aschir.«
(Du hast recht. Und ich habe auch noch einen Bart unterm Bauch.) Instinktiv betaste ich mein Gesicht. Seit Tagen hatte ich mich nicht rasiert. Aber ich würde mich jeden Tag rasieren, wenn ich damit die Widerspenstigen fügsam machen könnte.
Ich sinniere vor mich hin: Die Propheten brauchten niemanden, der ihnen etwas beibrachte. Alles fiel fertig auf sie herunter. Aber alle anderen müssen von ihresgleichen lernen, wie die Affen.
Mit mörderischer Ruhe sagt er: »Tut mir leid.«
Die Glocke läutet. Durch das Fenster des Büros sehe ich den Hof und die Schüler, die um die Wette zu den Toiletten und Wasserhähnen laufen. Sie schubsen. Springen umher. Es kommt mir vor, als sei ich mitten unter ihnen. Zu spät – ich würde keiner von ihnen sein. Einer mit einem arroganten Gesicht kommt mit einem Bücherstapel herein. Der Direktor fordert ihn auf, mich mitzunehmen und in Mathematik zu prüfen. Die Zeit des Jüngsten Gerichts ist gekommen, denke ich. Ich folge ihm in einen leeren Klassenraum. Er gibt mir Kreide und diktiert mir Zahlen. Ich weiß nicht, wie ich sie schreiben soll, wenn in der Mitte Nullen sind. Bestimmt mache ich Fehler, wenn ich die Zahlen, die er mir diktiert, der Reihe nach unter die anderen schreibe und sie einmal zusammenziehen, ein anderes Mal wieder abziehen soll. So etwas habe ich, außer im Kopf, nie zuvor gemacht, und dann diktiert er noch diese Zahlen mit Nullen, und schlimmer noch – welche mit Nullen in der Mitte.
Wir gingen ins Büro zurück. Ich fühlte mich bei diesem Lehrer nicht wohl. Affen sind freundlich zueinander, der hier war nichts dergleichen. Ich hatte das Gefühl, mich sehr angestrengt zu haben. Fünfzig Kilogramm zu heben oder einen Kilometer damit zu laufen wäre mir leichter gefallen als diese geistige Anstrengung.
Beim Direktor saß ein Mann, der einen Djilbab trug. Er fragte mich auf Spanisch nach meinem Namen, Geburtsort, Alter, nach Tanger und was ich dort gemacht habe. Als ich ihm antwortete, hellten sich seine Gesichtszüge auf.
»Wo hast du Spanisch gelernt?«
»Bei unseren Zigeunernachbarn und den Andalusiern in Tetuan und Tanger.«
Er war nicht so mürrisch wie der Rechenlehrer. Ich dachte, dass er vielleicht Spanisch unterrichtet und der Direktor ihm gesagt hat, er soll mich mündlich prüfen. Der Direktor forderte mich auf, am nächsten Tag wiederzukommen.
Ich ging zu Fuß zurück, nicht auf der befahrenen, geteerten Hauptstraße, die ich gekommen war, sondern auf einem anderen, staubigen Weg. Meine Füße sanken im sandigen Boden ein. Auf beiden Seiten standen Feigendistelhecken, aus den Hütten kamen Kinder, barfuß, halbnackt, schmutzig, und magere, hässliche, zugelaufene Hunde und Hühner, die im Kot pickten. Am Ende des Wegs war ein frei liegender, nicht mehr betriebener Brunnen, und ich ging näher heran und beugte mich über den dunklen Abgrund. Die tiefe Stille verlockte dazu, sich fallen zu lassen – das Schweigen, das all mein Elend in mir weckte: mein endloses, ewiges Schweigen. Ich holte einen großen Stein, an dem ich schwer zu schleppen hatte, und warf ihn in den Abgrund. Mit dumpfem Hall schlug er auf dem trockenen Grund auf, dann war es wieder still, und ich blickte in die Finsternis hinab, aus der ein widerlicher, warmer, abgestandener Geruch aufstieg. Ich trat von dem stinkenden Loch zurück. Der Hall des Aufpralls dröhnte mir noch eine Zeit in den Ohren, machte mir die Härte des Aufschlags vorstellbar. Ich war kein Stein. Ich würde blutend auf dem Grund des Brunnens liegen bleiben und immer schwächer werden. Das Scheußlichste wäre, nicht gleich zu sterben. Schnell ging ich davon. Der Hall des Aufpralls zog mich mit gewaltigem Zauber an, und ich mühte mich, Widerstand zu leisten, bis mich schließlich ein Baum rettete, unter dessen üppigem Schatten ich mich ausstreckte.
Mir fiel der junge Mann ein, der sich auf die Felsen im Hafen von Tanger hinabgestürzt hat. Seine Mutter kam aus der Fahs-Wüste, ging auf den Friedhof und erzählte dem Wächter von der Tragödie ihres Sohns.
»Ich weiß nichts von dem, was du da erzählst. Man hat in den letzten Tagen viele Tote beerdigt. Geh zur Provinzbehörde, die für die Registrierung der Toten verantwortlich ist. Geh hin und erzähl ihnen vom Tod deines Sohns. Dort werden sie dir die Nummer des Grabes sagen, falls sie sie kennen.«
»Ach, was sind das für Zeiten! Da bleibt mir von meinem geliebten Sohn Abdelwahid nichts außer einer Nummer – ›falls sie sie kennen‹.«
Eine unglückliche Frau. Sie richtete das verhärmte Gesicht gen Himmel, weinte und bat Gott demutsvoll, ihrem Sohn seinen Frevel zu verzeihen. Beweinte ihn bis zur Ohnmacht, erwachte, besessen von der Erinnerung an ihren Sohn, und zog von dannen, zurück in ihr Dorf. Ich dachte daran, dass auch meine Mutter eine unglückliche Frau war: Sie betete für mich, flehte Gott demütig an, mich vor allen Widerwärtigkeiten zu bewahren.
Wenn der Herr entflieht, stirbt der Diener.
Arbeiter und Herumlungerer auf der Place d’Espagne. Stimmen, die erbittert schreien: »Nieder mit dem Pascha!« und: »Nieder mit den Verrätern!«
Sie stürzen zum Haus des Paschas mit dem Ruf: »Peitschende Rotten, der Pascha unter die Botten[6] !«
Der Pascha der Stadt war bereits auf den Markt Thalatha El Risana gegangen und hielt dort für die Bauern eine Rede. Die behagte denen gar nicht, und so beschimpften sie ihn, warfen mit Steinen und schlugen mit Stöcken um sich, woraufhin die Wache das Feuer eröffnete.
»Bestimmt hat er zu ihnen wie vor der Unabhängigkeit gesprochen.«[7]
»Sieh nur, sie strömen wie Ameisen in Scharen herbei!«
Der Marsch setzte sich mit Getöse in Gang: Männer, Frauen, Kinder. Die »Ordnungshüter«[8] umzingelten die Demonstranten, regulierten den Ablauf und die gegen den Pascha gerichteten Rufe. Die marokkanische Fahne, die sie in den Händen hielten, sollte ihre Macht bekräftigen.
»Von der Sicherheitspolizei ist keiner zu sehen.«
»Ich glaube nicht, dass sie kommt. Es gibt den Befehl, nicht einzuschreiten. Jetzt wissen alle, dass der Pascha gegen die Unabhängigkeit ist.«
Die Kinder wiederholten die paschafeindlichen Rufe der Großen. Kreischend schlugen sie auf irgendwelche imaginären Personen ein. Fürs Töten kannten sie die verschiedensten Waffen: Ein Stein war in ihrer Vorstellung eine Bombe, und die ballerten sie ab – bumm, bumm, bumm! Ein Stock stellte für sie einen Dolch oder einen Revolver dar, ein Knüppel diente als Flinte oder Maschinengewehr. Sie führten sich viel aggressiver auf als die Erwachsenen. Der Demonstrationszug machte vorm Haus des Paschas halt. Rufe erschollen: »Liefert euch aus!«
Ein Schuss in die Luft. Abgefeuert aus einem der Fenster des Hauses. Die Menge drängte zurück. Einer schrie: »Habt keine Angst! Man will uns nur einschüchtern!«
Einer der »Ordner« holte einen Revolver heraus, ein anderer trug ein altes Gewehr, und beide gingen in ein Haus, das dem des Paschas gegenüberlag. Es gab einen Schusswechsel mit denen im Haus.[9] Sie trennten sich, flohen, kehrten zur Menge zurück. In der Nähe des Hauses des Paschas hatte sich auf dem Bürgersteig eine spanische Division aufgestellt, die von einem Hauptmann befehligt wurde.
»Sie trauen sich nicht. Sie können nicht auf uns schießen. Sie versuchen nur, uns Angst zu machen. Wir werden das Haus anstecken.«
Einige gingen los, kamen mit Benzinkanistern zurück, legten Feuer auf dem Vorplatz des Hauses. Die Schüsse stoppten. Plötzlich öffnete sich die Tür, und ein Diener des Paschas, der sein Gewehr über dem Kopf hielt, erschien. Er war schwarz und riesig. Die Menge rief: »Rabah! Rabah! Das ist Rabah!«
Der Hauptmann versucht, die Menschen davon abzuhalten, sich auf den Diener zu stürzen. Aber sie stürmen los wie Wahnsinnige. Rabah wirft sein Gewehr auf die Erde, Blut fließt über sein Gesicht, doch kein Schrei ist zu hören. Sie krallen sich an seiner Kleidung fest, bohren ihre Fingernägel in sein Fleisch. Sie dreschen mit Knüppeln auf ihn ein. Er taumelt unter den brutalen, wahnsinnigen Schlägen, dann sinkt er nieder. Aufgebrachte Menschen stürmen los, um ihn in Stücke zu reißen. Man zerrt ihn mitten auf die Straße. Die Frauen stoßen Freudentriller aus. Die Kinder jauchzen laut. Mitten aus der Menge bricht ein Mann heraus, der all ihren Wahnsinn in sich vereinigt. Er schlägt dem Diener eine Flasche Öl über den Schädel, jemand anders zündet einen ölgetränkten Knüppel an und wirft ihn auf ihn. Alles jubelt wie wahnsinnig vor Freude. Ein Fest von Wilden. Jauchzer und Wutschreie für das Opfer.
»Tod diesem Schwein!«
»Tod diesem Hund!«
»Tod! Tod!«
Bebend wälzt er sich auf dem Boden, und sein Körper ist eine einzige entsetzliche Fackel. Er wird schwächer. Der Geruch von menschlichem Fett ist ekelhaft. Ein bröckliger Kohleklumpen, in dem sie mit Messern, Beilen und Fingernägel herumstochern. Sie reißen ihn in Stücke. Eine Frau hat den Unterschenkel erwischt, an dem noch ein bisschen Fleisch ist, sie beißt wie eine Wilde hinein, bevor sie den Knochen in einen Fetzen, den sie von ihrem Kleid abgerissen hat, dem Wahnsinn gleich, einwickelt, sich unter die Achsel klemmt und verschwindet.
»Was will sie mit dem Knochen?«
»Sie wird ihn als Zaubermittel für ihren Mann nehmen, damit er sie nicht schlägt oder sich in eine andere Frau verliebt oder sich von ihr scheiden lässt. So sagt man hier.«
Nach wenigen Augenblicken ist vom Leichnam nichts außer Resten von Gedärmen übrig. Der Fettgestank ist zum Kotzen. Die Leute holen die Möbel aus dem Haus heraus, türmen sie auf der Straße übereinander. Plündern und Brennen. Sie legen Feuer an Möbel und Bücher. Plündern und Brennen. Die Ordner schreien die Tobenden an: »Nicht die Bücher! Verbrennt sie nicht! Wir bringen sie in die Parteizentrale![10] «
Rauchwolken steigen vom Haus her auf. Freudentriller der Frauen, Schreie der bösartigen Kinder, und die zivilisierten Spanier schauen dem Geschehen von den Fenstern und Balkons ihrer Häuser schweigend zu.
Die spanischen Soldaten haben sich keinen Schritt von ihrem Platz auf dem Bürgersteig wegbewegt. Die Demonstranten rennen grüppchenweise in Richtung anderer Häuser von Pascha-Agenten. Ein Lastwagen und ein Jeep treffen ein; man beginnt, die Bücher und wertvollen Möbel, die noch nicht oder nur halb verbrannt sind, aufzuladen. Die Ordner versperren denen den Weg, die Möbel wegschleppen, nehmen sie ihnen weg. Manch einer hat sich seine Klamotten ausgezogen und sich vom Kleiderhaufen bedient. Man stürmt das Haus eines Agenten in der Barcelona-Straße. Niemand ist drinnen. Also klaut man und legt Feuer. Wie im Wahnsinn läuft man zum Haus eines anderen, der des nationalen Verrats verdächtigt wird. Beim Bab El Gabibat taucht eine tobende Menge auf, die einen alten, bewusstlosen Mann auf dem Boden hinter sich herschleift und mit Messern auf ihn einsticht. Der Alte ist halb nackt, seine Augen sind verdreht.[11] Ein Klumpen Fleisch, der nichts Menschliches mehr hat. Sie fesseln ihn an Händen und Füßen und binden ihn an einen Baum gegenüber vom Bab El Gabibat. Man gießt Öl über ihn, und dann wird er angezündet. Beifallsrufe, Jauchzer, Triller, Freudensprünge. Der Gestank menschlichen Fetts breitet sich auf der Place d’Espagne aus. Die Augen des Alten treten hervor. Sie rollen in den Höhlen. Sein Körper erschauert. Die Spanierin, die Schurrus-Verkäuferin, schreit (ihr Laden liegt neben dem Bab El Gabibat, gegenüber vom Baum mit dem Aufgehängten): »O Gott! Nein! Nein! … Nein!«
Sie wird ohnmächtig. Es hieß, sie starb an Herzschlag.
Bis auf ein paar Stadtstreicher, die im Haus des Paschas und in den Häusern der Agenten Reste der verbrannten Sachen sammelten, leerten sich am Abend die Straßen. Vor dem Baum hielten zwei Autos: das der Ersten Hilfe und das der Sicherheitspolizei. Die Männer vom Rettungsdienst trugen Masken und Gummihandschuhe. Sie packten die verstreuten Reste des Leichnams in eine Kiste, während die Sicherheitsleute den Platz überwachten. Sie spritzten schäumendes Pulver auf den verbrannten Baum und den Boden, und ein Teil des Platzes füllte sich mit widerlich riechenden, stickigen Wolken. Aber der Gestank menschlichen Fetts war stärker: Er blieb den Leuten in der Nase stecken.
Der erste Unterricht
Der Direktor führt mich in Raum 1 und stellt mich dem Lehrer vor. »Si Mohamed, der Bursche wird bei Ihnen lernen.«
Sie gehen vor die Tür, sprechen miteinander. Bestimmt reden sie über mich. Garantiert hat der Direktor mich nur zur Probe in die Klasse gebracht. Nach ein paar Tagen wird er sagen: »Du kannst hier nicht weiterlernen. Es ist besser für dich, nach Tanger zurückzugehen.«
Die Schüler flüstern, während sie mich prüfend mustern. Ich komme mir vor, als sei ich ein Eindringling. Nie zuvor haben mich mehr als vierzig Personen von unten bis oben angestarrt. Im Saal gibt es Schüler in meinem Alter, aber die können schon lesen und schreiben. An der Tafel steht etwas geschrieben, sie haben Hefte vor sich. Später würde ich erfahren, dass die älteren Schüler vom Land stammen.
Der Lehrer kommt wieder herein und weist mir einen Platz in der Mittelreihe zu, neben dem kleinsten Schüler der Klasse. Es gibt drei Reihen im Raum; rechts von mir sitzen auf den vordersten Plätzen vier vollbusige Schülerinnen.
Der Lehrer sagt: »Das ist ein neuer Kamerad. Versucht, mit ihm zusammenzuarbeiten.«
Flüsternd sehen sie zu mir hinüber, rutschen auf ihren Plätzen herum. Der Lehrer schlägt mit dem Lineal auf den Tisch. Sie schweigen. Die meisten sind mit einem Djilbab bekleidet. Sie schauen verblüfft drein. Es ist leicht für mich, die Beduinen von den Städtern zu unterscheiden – an den Gesichtszügen und an ihrem Äußeren. Sie übertragen jetzt das, was an der Tafel steht, in ihre Hefte. Was machen sie da wohl? Vor mir ist mein Heft und mein Stift, und beide warten, dass ich die erste Lektion beginne. Die Rätsel der Welt wechseln hinüber auf die Heftseite meines Tischgefährten, doch meine Seite bleibt weiß. Ich schaue mich um und denke: Sie schreiben behände. Wird mich der Direktor das Gleiche lernen lassen? Wenn nicht, dann gehe ich garantiert nach Tanger zurück und habe wieder meine professionellen Kumpel des Lasters um mich, wenn auch ohne zu erfahren, was in dieser Welt – mittels Zeichen – vor sich geht. Aber da ich nun einmal gekommen bin, muss ich auch lernen. »Das wirkliche Leben gibt es nur in Büchern«, hat mal jemand in Tanger gesagt.
Der Lehrer geht langsam durch den Saal, sieht auf das, was einige schreiben, bleibt aber nicht stehen, kommt an meinen Tisch. Ein ruhiger Mann, freundlich. Kein Zweifel, er hat nie mit Hurensöhnen gelebt. Er beugt sich über mein Heft und schreibt auf die zweite Seite Wörter: jedes auf eine Zeile. Leise spricht er sie vor sich hin, dann fordert er mich auf, jedes Wort so oft dahinterzuschreiben, bis die Zeile voll ist. Mein kleiner, dünner, sanfter Tischnachbar hört nicht auf, in mein Heft, auf mich und meine Hand zu schauen, seit er mitbekommen hat, mit welcher Mühe ich jedes Wort zu schreiben versuche. Meine Hand zittert. Seine verstohlenen Blicke bewirken, dass ich noch mehr zittere und mich noch stärker verkrampfe. Erst zwei Tage später erfuhr ich, dass ich in der dritten Klasse war.[12]
Drei Zeilen habe ich vollgeschrieben. Ich strecke den Arm aus, sehe zum Lehrer hinüber, der durch die Reihen geht oder an einzelne Schüler herantritt, die noch mit dem Abschreiben beschäftigt sind. Einige sind schon fertig. Er kommt zu mir, wirft einen Blick auf das Geschriebene.
»Gut. Du wirst es bald lernen, so Gott will.«
Dann fordert er meinen Nachbarn auf, mir weitere Wörter aufzuschreiben. Die Schüler beginnen zu flüstern. Der Lehrer richtet sich auf und umfasst mit einem Blick die Klasse. Sie schweigen. Mein Nachbar freut sich weit mehr als ich; es ist seinen Augen und Bewegungen anzusehen. Ich habe das Gefühl, dass ich von allen der Verächtlichste bin. Ich kenne doch nur die paar Buchstaben, die mir Hamid damals in Tanger beigebracht hat. Mir wird traurig zumute. Ich fühle mich schuldig. Ich gehöre nicht hierher. Ich komme aus der Sippe der Zuhälter, Diebe, Schmuggler, Huren. Aber hier fühle ich mich wie an einem geheiligten Ort, den ich beschmutze. Doch vielleicht gibt es unter den Schülern welche, die die Kinder dieser Unglückseligen sind. Ich beginne, mich selbst zu trösten. Dann stürze ich eben ins Fegefeuer. Wenn die da, die anderen, nicht hergekommen wären, dann hätten sie vielleicht das gleiche Leben wie ich geführt. Während ich mich also verteidige, selbst unter der Gefahr, dass ich etwas Falsches über die anderen denke, lässt meine Niedergeschlagenheit nach. Ich ringe mit der Entscheidung, entweder hierzubleiben oder nach Tanger zurückzugehen. Fauliger Sumpf erwartet mich dort oder an jedem anderen Ort, also werde ich hierbleiben, selbst wenn das Blau des Himmels auf ewig für mich verschwindet.
Mein Tischnachbar schreibt mir Wörter auf, murmelt sie leise vor sich hin wie der Lehrer. Ich danke ihm, und meine Hand zittert. Erneut strenge ich mich an, versuche, seine schöne Handschrift nachzuahmen. Seit diesem Augenblick lerne ich von den Schülern mehr als von den Lehrern.
Im Speisesaal
Wir rennen um die Wette, wer den ersten Platz in der Reihe bekommt. Ein Lehrer überwacht uns, jeder eine Woche lang, beim Frühstück und beim Mittagessen. Dann ist ein anderer Lehrer dran. Die Mädchen haben ihre eigene Reihe, sie gehen vor uns in den Saal. Besonders schöne sind nicht dabei. Eine ist halbwegs hübsch. Kichern und Gemurmel vermengen sich mit dem Geklapper der Löffel und Teller. Der wachhabende Lehrer spaziert im Saal herum. Manchmal dreht er uns den Rücken zu, weil er vor die Tür tritt und auf den leeren Hof schaut. Da machen wir dann mehr Lärm, werden immer lauter, so dass er schreit und schimpft: »Ihr Esel! Wer nicht essen und ruhig sein will, der soll den Saal verlassen.«
Dann raucht er auf der Schwelle seine Zigarette weiter. Das ist der mürrische Lehrer, der mich im Rechnen geprüft hat. Die Armut entstellt unser Aussehen. Sie hat uns nichts außer dem gelassen, was uns noch gerade als menschliche Gattung ausweist. Vielleicht werden sie einmal schön sein – die Mädchen, wenn sie in der Zukunft ihre Armut überwinden. Zuerst kommt die Suppe, Hülsenfrüchte. Die Teller stehen schon auf dem Tisch. Fliegen fallen hinein. Es bleibt uns nichts anderes übrig, als die toten oder noch ums Leben kämpfenden aus dem Teller zu fischen. Die noch zappelnden ertränkt man, wenn man sich nicht ekelt, in der Brühe, um die Bazillen zu töten. (Manche Leute sind davon überzeugt, dass in einem der Flügel der Bazillus sitzt und im anderen das, was ihn vernichtet.) Ich frage mich noch immer, wer dieses schlaue Rezept für Fliegen erfunden hat, das sie in Speisen und Getränke von Hungrigen fallen lässt. Vielleicht geschieht es, um die Fliegen weniger leiden zu lassen. Vom letzten Teller, der hingestellt wird, steigt Dampf auf.
Ich versuche immer am Ende des Saals zu sitzen, damit ich, wenn ich an den vorderen Tischen vorbeigehe, ein Stück Brot stehlen kann. Das Essen reicht uns, den Großen, nicht. Wir sammeln selbst hinuntergefallene Brocken auf und nutzen es schamlos aus, wenn Kranke, ob an- oder abwesend, keinen Appetit haben, und stürzen uns auf den Überfluss. Den ersten Teller verschlingen wir noch vorsichtig, denn da sind manchmal Steinchen drin. Ich weiß noch, wie einer von uns ein Stückchen Glas im Reis hatte und Blut spuckte. Beim zweiten Gericht gibt es ein Spiegelei oder Fisch mit Tomatensauce oder ein Stück Fleisch. Meistens ist es hart oder so zäh, dass wir fürchten, es könne beim Schlucken in der Kehle stecken bleiben. (Wir sind es zufrieden, darauf herumzukauen, zu saugen und es auszuspucken.)
Hülsenfrüchte und Gemüse sind der Hauptbestandteil unserer Nahrung. Ich fange drei oder vier Fliegen draußen vor der Schule. Ich wickle sie in ein Stück Papier ein, um sie dann in einen – oder zwei – Teller in der Nähe von meinem Tisch zu werfen. Manchmal fange ich sie, damit ich nicht zu spät komme, auf der Toilette. Es gibt keine schmutzigen oder sauberen Fliegen. Obwohl ich die Fliegen so heimlich wie möglich in die Teller schmeiße, beobachten mich einige Kameraden. Keiner verrät mich. Dafür erwischte mich der wachhabende Lehrer höchstpersönlich, als ich Brot klaute. Er gab mir ein paar Ohrfeigen und verbot mir für drei Tage den Speisesaal. Einige Schüler standen mir bei und sparten für mich von ihrer Ration Brot und Fisch auf, auch kleine Fleischstücke. Der Lehrer war gerechter als mitleidig.
Wir respektieren unsere Armut und helfen uns gegenseitig. Fast alle von uns sind arm. Unsere Armut wird von den Ausbeutern als naturgegebene Sache betrachtet.
Nach der Anstrengung des Essens brauche ich Schlaf, den ich mir nachts nicht gönne. Außerhalb des Schulgebäudes steht eine Betonbank, unmittelbar an einer der Mauern. Manchmal schlafe ich so tief, dass ich eine oder auch alle Unterrichtsstunden verpasse.
Im Viertel gibt es einen Krüppel, der in Mathematik allen Schülern überlegen ist. Wahrscheinlich ist er sogar besser als mancher Lehrer. Jedenfalls sagen das die Schüler der Abgangsklasse. Der Krüppel hat die Grundschule beendet, aber bei der Prüfung für die Sekundarschule hat er nicht mitgemacht. Seine Mutter ist tot, sein Vater hat vor Jahren die Stadt verlassen und sich nie wieder blicken lassen. Keiner weiß, was aus ihm geworden ist.
Seinen Krüppel ließ er bei einer taubstummen Tante, die den Lebensunterhalt damit verdient, dass sie am frühen Morgen den Müll durchsucht und mit Gottes Hilfe durch Betteln am Bahnhof etwas dazubekommt. Er macht die Rechenaufgaben, und wenn die Schüler ihn etwas fragen, zeigt er ihnen mehrere Wege, mit denen die Aufgabe gelöst werden kann. Weil die Schüler seine mathematische Klugheit schätzen, geben ihm manche einige Céntimos, ein paar Zigaretten oder etwas zu essen.
Manchmal schließen sie Wetten wegen einer Lösung ab, und dann teilt der Gewinner mit ihm den Einsatz. Er bietet uns seine Hilfe immer ohne Entgelt an. Wenn ich Glück habe und an ein paar Peseten herankomme, kaufe ich ihm blonde Zigaretten, weil er die den schwarzen vorzieht. Ich kaufe sie von einem der fliegenden Händler in der Stadt, weil die sie auch einzeln abgeben.