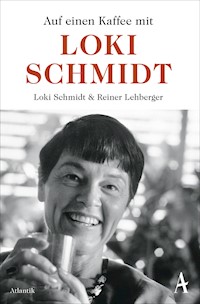9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2011
Loki Schmidt war als leidenschaftliche Naturforscherin bekannt: Pflanzen wurden nach ihr benannt, für ihr Lebenswerk erhielt sie eine Ehrenprofessur der Universität Hamburg. In ihrem «Naturbuch für Neugierige», entstanden in Zusammenarbeit mit dem Biologen Lothar Frenz, lässt sie uns anhand vieler Geschichten und Erlebnisse teilhaben an ihrer Leidenschaft. Sie schildert, wie sie als Arbeiterkind die Natur lieben lernte und wie sie als First Lady für ihren Schutz eintrat; sie berichtet von kühnen Forschungsreisen in ferne Länder und von der Pflanzen- und Tierfülle, die in einer ganz normalen Großstadt zu entdecken ist: vom Frauenmantel bis zur Krausen Glucke, vom Kartoffelkäfer bis zum Bärtierchen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 230
Ähnliche
Loki Schmidt
Das Naturbuch für Neugierige
Mitarbeit: Lothar Frenz
Inhaltsverzeichnis
Das weiße Kaninchen und die Wildgänse
Von Langenhorn in die Welt
Bratäpfel à la Schmidt
Eisblume oder Krause Glucke
Eine Expedition in den Rasen
Urig, knorrig: klack, klack, klack
Morgensinger und Nachteulen
Goldmilzkraut, Sonnentau und Schrottplatz-Uhu
Wenn’s ebbt und wenn’s quillt
Klatschmohn aus dem Paradies
Die Wildnis am Brahmsee
Die Kartoffel des Kolumbus
Ein Skorpion namens Loki
Geranien, die nach Gondwana driften
Buchempfehlungen
Bildnachweis
Das weiße Kaninchen und die Wildgänse
Ein Vorwort
Meine ersten Worte, die ich gesagt haben soll, waren «Papa», «Mama» – und ein Pflanzenname. Ich konnte noch nicht richtig sprechen und habe sie «Frau Mantel» genannt. Später hieß es sogar, ich hätte vor jedem Frauenmantel, so der offizielle Name der Pflanze, einen Knicks gemacht und gesagt: «Guten Tag, Frau Mantel.» Doch daran kann ich mich nicht erinnern, das ist mir von meinen Eltern erzählt worden.
Zwei Pflanzen aus meiner Kindheit sehe ich noch genau vor mir, wie sie im Kopfsteinpflaster im Hinterhof wuchsen, in dem wir wohnten. Solche Hinterhäuser gibt es heute gar nicht mehr – zwischen den beiden Häuserzeilen, die dicht nebeneinanderstanden, war es fast immer dunkel. Wo ein bisschen Erde zwischen den Ritzen war und ein wenig Licht auf den Boden fiel, da schoben die zwei sich mühsam zwischen den Steinen hervor: Poa annua, das Einjährige Rispengras, das ich viel später sogar in der Antarktis aufgespürt habe – aber das ist eine andere Geschichte–, und Löwenzahn.
In unserem dunklen Hof wuchs der nicht besonders hoch, auch seine Blüten blieben ganz niedrig. Aber eigentlich waren es seine Blätter, die mich von Anfang an faszinierten: Ich erinnere mich deutlich daran, wie wunderbar tief gezackt sie waren, wie ein Sägeblatt.
Ich kannte einen anderen Löwenzahn, der nicht so klein blieb: Meine Mutter führte uns nämlich oft in den Hammer Park, als wir noch nicht zur Schule gingen. Dort wuchs ein Löwenzahn mit großen, wenig gezähnten Blättern und langen Blütenstielen. Gerne hätte ich den Samen von beiden Löwenzähnen in einem Garten ausgesät und verglichen, wie sie sich dann entwickeln. Ob sie genauso aussehen würden wie die Mutterpflanzen.
Leider besaßen wir keinen Garten, in dem ich das hätte ausprobieren können. Dennoch finde ich es im Nachhinein erstaunlich, wie sich ein kleines Kind, das noch nicht zur Schule ging und sich zwei unterschiedliche Löwenzahn-Gewächse ansah, einen solchen wissenschaftlichen Versuchsansatz überlegt. Natürlich gehörten beide Löwenzähne zur selben Art – aber im Park war der Boden fruchtbarer, und so konnte der Löwenzahn dort weitaus kräftiger wachsen als in unserem Hinterhof.
Meine Geschwister waren nicht so neugierig wie ich; sie fanden es einfach nicht spannend, diese kleinen Hinterhofpflanzen sorgfältig zu beobachten. Auch meine Eltern haben keine besondere Begeisterung an mich herangetragen. Seither habe ich oft gedacht: Nicht ich habe die Pflanzen entdeckt – die Pflanzen haben mich gesucht und gefunden.
Gerne hätte ich daher Biologie studiert und wäre Forscherin geworden, aber die Studiengebühren konnte ich mir damals nicht leisten. Also wurde ich Volksschullehrerin. Denn dafür musste ich nur die Einschreibegebühr bezahlen, was für mich schon genug war – ich glaube, für ein Semester 200Mark. Meine Eltern hatten das Geld nicht, also habe ich es mir von Bekannten geschnorrt und später brav zurückbezahlt.
Natürlich habe ich dann als Lehrerin versucht, Schülern Natur nahezubringen. Wann immer es ging, sind wir zusammen nach draußen gegangen. Dann konnte ich meist gar nicht so schnell zuhören, wie die Schüler von selbst etwas entdeckten. Man kann Kinder aber auch zum Gucken und Zuhören anregen und so ihr Interesse wecken: mit kleinen praktischen Beispielen, bei denen sie etwas anfassen, ausgraben oder streicheln, am besten mit allen fünf Sinnen. Das funktioniert eher, als wenn man einen Lehrvortrag hält.
Heute kommen fast Achtzigjährige zu mir – meine ersten Ehemaligen sind ja nur elf Jahre jünger als ich – und erzählen: «Erinnern Sie sich noch? Ich hatte doch ein weißes Kaninchen, für das ich Futter gesammelt habe. Dann habe ich Sie gefragt: ‹Was darf ich davon meinem Kaninchen zum Fressen geben?› Und Sie haben gesagt: ‹Keinen schwarzen Nachtschatten, der ist giftig, auch für dich. Die schwarzen Beeren darfst du nicht in den Mund stecken. Besser ist, wenn du dem Kaninchen Löwenzahn gibst, und den gucken wir uns mal an, wenn die Schule zu Ende ist.›» Es war nur eine winzige Bemerkung nebenbei und dazu ein kleines Naturerlebnis, und das blieb hängen. Was man in dieser Zeit einpflanzt in Kinder – etwas pathetisch gesprochen: wie Samenkörnchen–, das behalten sie ihr ganzes Leben lang.
In meiner Bonner Zeit lernte ich einen Botaniker von der Uni kennen. Ab und an fragte er mich: «Wir machen wieder eine Exkursion durch die Eifel, wollen Sie mit?» Dann war ich mit Studenten des dritten, vierten oder fünften Semesters unterwegs. Ich erinnere mich, wie wir einmal einen heimischen Bärenklau fanden. Der wird nicht besonders groß, besitzt aber häufig schöne Blattscheiden, die den Stängel ganz umfassen, bevor sie in das eigentliche Blatt übergehen. In jeder Blattscheide steckt dazu ein Seitentrieb. Nicht ihren Professor, sondern mich fragten die Studenten dann: «Was ist denn das für eine Knospe?»
Eine Knospe! Als ich erstaunt sagte: «Gucken Sie doch mal genau hin», haben sie geantwortet: «In der Knospe ist gar keine Blüte drin.» Wenn ich dann erklärt habe: «Da kommt auch gar keine Blüte raus, gucken Sie doch bitte», blickten sie mich nur verblüfft an – und haben nichts verstanden. Sie konnten nicht genau beobachten und vergleichen.
Da bekam ich schon ein bisschen Wut im Bauch, auch wenn ich die nicht gezeigt habe. Die Studenten haben heute so große Möglichkeiten. Haben die das Hinschauen nie gelernt? Das tut mir nachträglich noch weh. Was haben die für Chancen verschenkt; ganz abgesehen davon, welche Wunder man entdecken kann, wenn man hinschaut.
Auch Erwachsene können noch darauf gestoßen werden, draußen einfach mal die Augen aufzumachen – und dabei Dinge zu entdecken, die ihnen sonst verborgen bleiben. Das habe ich oft erlebt. Ab 1974, als mein Mann Bundeskanzler wurde, bekam auch ich Sicherheitsbeamte an die Seite gestellt. Die mussten mit mir mit, ob sie wollten oder nicht. Für einige war das sofort neu und faszinierend: Einer, mit dem ich Vogelschutzgebiete an der Nordsee besucht hatte, freundete sich dort rasch mit Naturschützern an und ist jetzt schon lange Mitglied im Seevogelschutzverein Jordsand.
Andere dagegen nahmen diese Ausflüge in die Natur einfach hin, weil das mit mir eben so war. Doch ohne es zu merken, haben sie sich dabei «infiziert»: Einmal waren mein Mann und ich auf dem World Trade Center, den Twin Towers in New York. Plötzlich schrie einer der Sicherheitsbeamten laut auf: «Wildgänse! Wildgänse! Wildgänse!» Und er hatte recht. Es war ein wunderschönes Bild: die untergehende Sonne über Manhattan und davor ein Keil von Wildgänsen. Er war wirklich begeistert, sonst hätte er nicht so viele Male hintereinander gerufen. Da habe ich mich gefreut – und ihn dann doch sehr gelobt.
Ich finde, das ist ein schönes Beispiel dafür, dass Menschen sehr wohl durch die Naturbegeisterung anderer beeinflusst werden können, auch wenn sie meinen, dass es sie gar nicht interessiert. Vielleicht gelingt so etwas auch mit den Lesern dieses Buches: Sie sollen sich auf die nächste Ameise stürzen und verfolgen, wo die hinwill.
Für mich war die Zusammenarbeit mit Lothar Frenz eine Freude. Auch wenn uns zwei Generationen trennen, sind unsere Vorstellungen über Pflanzen- und Tierentwicklung im Laufe der Erdgeschichte ziemlich gleich – und nicht immer wie die gerade herrschende veröffentlichte Meinung. Ich wünsche Lothar Frenz noch viele Expeditionen und Erlebnisse, an denen wir später in Büchern und in Filmen teilhaben können.
Loki Schmidt
Von Langenhorn in die Welt
Zu diesem Buch
«Rauchen Sie, Herr Frenz?» Das fragte mich Loki Schmidt zu Beginn unserer ersten Begegnung. «Nein, Frau Schmidt, ich habe mein ganzes Leben lang nur getrunken», war meine Antwort, die ich – das gebe ich gerne zu – mir vorher überlegt hatte, bevor ich zum ersten Mal im Hause Schmidt in Hamburg-Langenhorn zu Besuch war. Und musste daraufhin in Loki Schmidts fassungsloses Gesicht blicken: «Sie haben es noch nicht einmal versucht?!»
Mit diesem Satz, das weiß ich heute, waren wir sogleich beim Thema dieses Buches: dem Drang und der Lust, alles um uns herum zu erforschen und zu erkunden, mit möglichst allen Sinnen zu erblicken, zu erhören, zu erschmecken, zu ertasten und zu erriechen. Einer Lebenshaltung, sich immer wieder Neuem zu stellen, eben weil man es noch nicht versucht und ausprobiert hat. Einer Neugierde des «Begreifens» also, aus der ein «Verstehen» werden kann. Dazu gehört das Unverständnis darüber, dass jemand vielleicht nicht genauso neugierig sein könnte.
Zum Glück konnte ich Loki Schmidt glaubhaft versichern, dass ich das Rauchen durchaus mal probiert hatte, es war nur einfach nicht mein Ding. Und so vereinbarten wir, beide mit dieser neugierigen Grundhaltung ausgestattet, uns regelmäßig zu treffen und zusammen für dieses Buch die Natur zu erkunden. Über Monate hinweg gingen wir gemeinsam auf «Expedition».
Zu jeder guten Expedition gehört, das wussten wir beide aus reichhaltiger Erfahrung, dass man ein Ziel hat und gut vorbereitet ist auf das, was kommen mag. Aber genauso, dass man sich überraschen lässt von dem, was kommt: Man hält die Augen, die Ohren auf, sucht und stöbert oder lässt einfach geschehen. So haben wir es auch in den vielen Stunden Gespräch für dieses Buch gehalten. Haben uns zunächst ein Thema vorgegeben und uns dann treiben lassen – bei Kaffee, Keksen, natürlich auch Zigaretten als Wegzehrung bei unseren Gedankenexpeditionen am Tisch in Langenhorn. Dabei stellten wir rasch fest, wie gut sich eine Lehrerin und ein Journalist ergänzen können, wenn die eine von der botanischen, der andere von der zoologischen Seite kommt; wenn dazu beide mit einem ähnlichen Faible fürs Denken in erdgeschichtlichen Dimensionen, dem Blick für den ständigen Wandel auf der Erde ausgestattet sind.
So wie Kinder die Welt entdecken, ließen wir bei unseren Expeditionen die Kreise langsam größer werden: Wir begannen nicht erst vor der Haustür, sondern sogar schon im Haus, in der Küche nämlich. Wir beobachteten zunächst ganz Alltägliches wie die Jahreszeiten oder einen schlichten Rasen; zogen dann immer größere Kreise, in die Stadt, die Landschaften um Hamburg herum und brachen schließlich zu wirklich großen Expeditionen in die weite Welt auf – bis nach Amazonien, Neukaledonien und in die Wüste Namib. Und haben dabei regelmäßig Dinge entdeckt, die wir jeder für sich nicht bemerkt hätten – das Rascheln im Walde etwa (S.64).
Unsere Grundidee war: Wer einmal genau hinschaut und dabei Schönes, Anrührendes, Spannendes, Überraschendes erkennt, der wird auch ein zweites und drittes Mal genauer hinsehen. Wer einmal eine Blüte betrachtet und deren Aufbau verstanden hat, wird Ähnliches auch in der nächsten Blüte entdecken – selbst wenn die anders aufgebaut ist. Wer einmal versucht hat, eine «Landschaft zu lesen», und sich Gedanken darüber gemacht hat, weshalb sie heute so und nicht anders aussieht, wird sich das auch bei der nächsten Landschaft fragen. Denn spannende Geschichten schlummern selbst im Pfefferkorn, im Blumenkohl oder in der vermeintlichen Einöde des Rasens – allesamt Geschichten aus dem Leben von Pflanzen und Tieren, dazu der Erdgeschichte und der Kulturgeschichte des Menschen.
In diesem Buch wollen wir uns der Natur nicht lehrbuchhaft-didaktisch nähern, sondern durch Betrachtung. Einzelne Artenporträts zeigen, wie man eine Pflanze anschauen kann. Bei jedem Hinschauen und Beobachten lässt sich lernen und vergleichen. Man kann nicht alles wissen und auch nicht alles gleich verstehen; immer bleiben Fragen offen, und aus jeder Beobachtung ergeben sich neue – zum Glück. Aber man kann sich selber ein Gerüst schaffen aus Kenntnissen und Erfahrung, in das man Selbst-Beobachtetes, Neues einordnet. Und so mehr von dem versteht, was täglich um uns herum ist.
Dieses Buch ist also eine Aufforderung, es uns nachzumachen – und einfach mal mit Neugier und Freude genau hinzuschauen, was da alles kreucht und fleucht und wächst. Wie? Sie haben es noch immer nicht versucht?
Lothar Frenz
Erstes Kapitel
Bratäpfel à la Schmidt
Kraut und Rüben in der Küche
Mögen Sie Bratäpfel?
Ich? Ja!
Und wie machen Sie die?
Nicht mit Zimt.
Ach, wie denn?
Wenn ich viel Zeit habe, dann steche ich ganz vorsichtig das Kerngehäuse aus, möglichst so, dass unten noch ein bisschen Apfel bleibt, damit der Inhalt nicht rausfließt. Und dort tue ich hinein: ein paar Brotkrümel, am besten vom Weißbrot, Rosinen und natürlich Zucker. Honig nehme ich nicht, weil der, wenn er warm wird, ins Endlose fließt. Das ist es schon: Rosinen, Weißbrotkrümel und Zucker, obendrauf noch ein paar Butterflöckchen, und dann kommt das Ganze in den Backofen. Hört sich doch gut an?
So, wie Sie das beschreiben, kann ich die Bratäpfel schon riechen! Aber lassen Sie mich das Rezept doch mal wiederholen: Sie haben aus dem Gewebe einer Sammelfrucht die eigentliche Frucht, einen Sammelbalg, entnommen – das Kerngehäuse. Dann haben Sie das entstandene Loch mit getrockneten Beeren und Krümeln eines Produktes aus gemahlenen Süßgrassamen und Treibmitteln sowie einem pflanzlichen Energiespeicherstoff wieder gefüllt. Und das Ganze mit einem Streichfett garniert – gewonnen aus einer Flüssigkeit, die aus Drüsen weiblicher Säugetiere zum Füttern ihrer Neugeborenen abgesondert wird.
Sie als Biologe überspitzen wieder gleich!
Was ich damit sagen will: Uns ist gar nicht klar, was wir da dauernd so selbstverständlich benutzen. Vielleicht sollten wir unsere Entdeckungsreisen in die Natur nicht vor der Haustür beginnen, sondern fangen am besten schon im Haushalt an.
Das gefällt mir. Beginnen wir bei den Pfefferkörnern in meiner Winzküche. Dann sind wir auch gleich da, wo der Pfeffer wächst. Der schwarze, den man kaufen kann, also nicht diese krümeligen Angelegenheiten aus dem Pfefferstreuer, sondern die dunklen Körner – die sind ja ganz hobbelig an der Oberfläche. Die weißen Körner dagegen sind glatt. Dabei stammen beide von derselben Pflanze.
Ich habe mal in Indonesien gesehen, wie der Pfeffer wächst. Die machen dort einen großen Unterschied zwischen schwarzem und weißem Pfeffer. Reifer Pfeffer ist groß wie eine Vogelbeere und knallrot – und wenn das eine edle Sorte ist oder er besonders behandelt werden soll, dann werden die reifen Körner per Hand gepflückt. Die Felder sehen übrigens aus wie Stangenbohnenfelder, mit zwei, drei Stöcken, an denen der Pfeffer sich hochranken kann. Aber sie sind gar nicht mal besonders groß. Daneben war immer eine Pfütze, wo sie die edlen, reifen, also roten Pfefferbeeren hineingeworfen haben. Diese Pfütze roch auch ein bisschen unangenehm, denn das rote Fruchtfleisch faulte im Wasser ab. Dann wurde der Pfeffer herausgefischt, viele Male gewaschen, noch ein bisschen gereinigt und auf hohe Stellagen gelegt. Dort liegen die edlen Körner also und sehen nun graubeige aus, werden immer mal ein bisschen umgedreht, damit sie schön trocknen. Das ist der weiße Pfeffer.
Wenn Körner aber nicht so edel sind und nicht so ordentlich aussehen, zum Beispiel, weil Tiere daran genagt haben, dann werden diese Beeren vorher abgepflückt. Für die Pfefferanbauer ist so ein Pfeffer nämlich nur noch zweite Wahl. Diese Beeren, zum Teil noch grün und unreif, kommen auch auf besondere Stellagen, aber nicht ins Wasser, und trocknen dort vor sich hin. Das wird dann der schwarze Pfeffer.
Für mich war überraschend, dass das, was wir meistens in der Tüte haben, dieses schwarze, etwas runzelige Korn, für die Pfefferanbauer nur minderwertig ist. Das Hobbelige an einem schwarzen Pfefferkorn ist also die völlig eingeschrumpfte, eingetrocknete Fruchtschale, die nicht abgewaschen wird, während sie bei dem weißen Korn ganz weggefault ist und dann sehr schön gesäubert wird. Wer weiß schon, dass Pfeffer eigentlich eine Frucht ist. Aber mit solchem Wissen guckt man sich die Pfefferkörner in der Tüte ganz anders an.
Wer genauer hinsieht, findet überhaupt viel Überraschendes in der Küche – oder beim Gemüsemann. Das kann eine echte Bereicherung sein, und ich bin immer erstaunt über türkische Gemüsegeschäfte – wie wunderbar dort Gemüse oder Obst wie ein Ornament ausgestellt sind: die verschiedenen Apfelsorten, Birnen, Orangen und Zitronen, Melonen, dazu Karotten und Gurken, die vielen verschiedenen Kohlsorten, Zwiebeln. Es ist immer ein Vergnügen, die Auslagen zu betrachten, die so halb auf der Straße platziert sind.
Pfeffer (Piper nigrum)
Und so kann man anfangen zu überlegen, genau wie beim Pfeffer: Was ist denn was? Wo benutze ich in der Küche eine Frucht – und was ist daran der Samen? Das muss man besonders betonen, weil die meisten Leute, wenn man «Frucht» sagt, an die ganze Birne oder die ganze Banane denken.
Saftig, fleischig, meist sehr süß und lecker – wie Äpfel und Birnen, Weintrauben und Pflaumen eben sind: So stellen sich viele Menschen «Früchte» vor. «Samen» dagegen sind demnach eher trocken – wie Nüsse, Eicheln, Kastanien oder Getreidekörner.
Botanisch gesehen ist das aber – Quatsch. Denn in der Sprache der Botaniker ist ein «Samen» nur der ruhende Embryo, der meist in Nährgewebe eingebettet und von einer Samenschale umgeben ist. Bei der Keimung entsteht aus diesem Embryo der Keimling, der die Samenschale durchbricht und sich zu Beginn des Wachstums oft vom Nährgewebe im Samen ernährt. Ursprünglich verbreiteten Pflanzen sich allein mittels eines «Samens», aber im Lauf der Stammesgeschichte kamen andere Organe der Mutterpflanze dazu: Der Fruchtknoten, in dem die Samenanlagen vor der Befruchtung liegen, andere Blütenteile, ganze Blüten oder Blütenstände entwickelten sich während der Reifung zur eigentlichen Frucht. Die Samen liegen also meist innerhalb der Frucht, die der Ausbreitung der Samen dient.
Vereinfacht kann man auch sagen: Eine Frucht ist all das, was aus einer Blüte wird. Die Frucht umgibt den Samen bis zur Reifung – und sorgt für dessen Verbreitung. Früchte dienen den Pflanzen demnach als Vehikel, um den Ort zu wechseln – sie sind Mittel zum Samentransport. Der nahrhafte Klumpen Fruchtfleisch, den wir normalerweise als Frucht bezeichnen würden, ist also nichts als eine süße Belohnung für Tiere, die den Samen verbreiten. Doch die Natur war erfinderisch und erfand noch mehr Fruchtmodelle: Fallschirme beim Löwenzahn, Propeller beim Ahorn und Klettverschlüsse bei der Klette, die sich alle aus Blüten entwickeln – um die Samen in die Welt zu bringen.
Wir können ja mal ein Spiel daraus machen: Man isst die Frucht so weit weg, bis die Samen übrig bleiben – beim Apfel also die Kerne im Gehäuse. Aber wie soll das bei der Erdbeere gehen? Wo sind denn da die Samen? Die sitzen außen auf der Beere – und die isst man mit, weil sie so klein sind. Die beiden sind übrigens Sammelfrüchte, weil viele Samen jeweils zu einer Einheit zusammengewachsen sind.
Kaum jemand wird sich, wenn er in eine Banane beißt, überlegen, was da im Querschnitt für kleine Körnchen zu sehen sind – die kleinen Samen eben. In Afrika kann man ja auf den Märkten auch Kochbananen kaufen, die haben etwas größere Kerne. Und die ursprünglichen Wildbananen hatten noch größere, harte Samenkerne.
Früher gab es öfter «Vielliebchen», die haben wir als Kinder immer in Orangen gesucht: zwei zusammengewachsene Kerne. Zwei von uns haben sich dann eine Orange geteilt. Wer darin ein Vielliebchen fand, der musste am nächsten Morgen sagen: «Guten Morgen, Vielliebchen!» Und der andere musste ihm dann irgendein kleines Geschenk machen. Das war bei uns sehr beliebt, aber später habe ich nie wieder zusammengewachsene Kerne gesehen. Vielliebchen scheinen ausgestorben zu sein, wie schade. Fast überall gibt es nur noch kernlose Apfelsinen – und immer mehr kernlose Weintrauben. Man kaut jetzt also nicht mehr auf den Kernen herum. Aber damit haben die Früchte nicht nur ihren Samen verloren, sondern auch ihren biologischen Sinn.
Doch wie vermehren sich Pflanzen heute, wenn es so viele Sorten ohne Samen gibt? Entweder man kann sie wunderbar durch Stecklinge vermehren, wie jeder Gärtner, der Ableger von seinen Geranien macht, damit sich eine neue Pflanze entwickelt. Oder durchs Pfropfen. Dabei wird auf einen Stamm einer nicht so edlen Sorte, einer Rebe oder eines Obstbaumes, ein Zweig der «veredelten» Sorte eingepflanzt, der dann weiterwächst. So können sich dann auch kernlose Weintrauben «verbreiten».
Aber nicht nur Früchte, auch echte Samen spielen in der Küche in unterschiedlichster Form eine Rolle– Getreidesamen etwa, und nicht allein als Brot. Wer sich eine Haferflocke genau ansieht, erkennt noch ein zerquetschtes Haferkorn. Dass eine Haferflocke auf ein zerquetschtes Getreidekorn zurückgeht, haben sich die meisten wahrscheinlich nicht klargemacht. Man muss sich mal grobe Haferflocken etwas sorgfältiger angucken, dann erkennt man auch, dass sie in sich farblich variieren: Es gibt die dunklen Flecken in der Flocke, die noch von Resten der Außenhülle des Korns stammen – und die hellen aus dem «Mehlkörper». Da ist die ganze Stärke drin, Kohlehydrate also, die ein gutes Startpaket für junge Pflanzen sind. Manchmal kann man in der Mitte einer Flocke sogar etwas erahnen. Das ist der Keimling – und der ist ja wieder besonders nahrhaft.
Das also ist das Getreide: Gerste, Roggen, Weizen, Hafer– Süßgräser, die wegen ihrer Körner angebaut werden. Ich bin ziemlich sicher, dass meine neun- oder zehnjährigen Schüler von früher immer noch imstande sind, diese Arten einigermaßen auseinanderzuhalten. Aber wer kann das heute noch? Hafer können Menschen wahrscheinlich am leichtesten von allen Getreidesorten erkennen, nicht nur, weil die Ähre herunterhängt – dies ist ein großer Unterschied–, sondern weil die kleinen Ährenbündelchen so schön voneinander getrennt sind.
Es gibt außerdem noch ein tropisches Getreide, das selbstverständlich in jeder Küche zu finden ist: Reis. Schon in meiner Kindheit konnte man im Geschäft unterschiedliche Reiskörner kaufen. Aber meine Mutter hat meistens nur Bruchreis mitgebracht, der war nämlich viel billiger. Es war ein Kindertraum von mir, mal eine Reispflanze oder ein Reisfeld zu sehen. Dass es die hier nicht gab, wusste ich, aber trotzdem stellte ich sie mir so schön vor, diese Gräser im flachen Wasser.
Meine ersten Reisfelder habe ich dann irgendwo in Brasilien gesehen, im Norden, wo dieser seltsame natürliche Kanal liegt, der Casiquiare, der den Orinoco über den Rio Negro mit dem Amazonas verbindet. Dort haben die Brasilianer kleine Kanäle an Abhängen gegraben, parallel zum natürlichen Wasserlauf, und dazwischen Reisfelder gepflanzt, sodass dort von oben ganz leise das Wasser runterrieseln kann. Es machte einen primitiven, aber sehr praktischen Eindruck. Also hatte ich Glück und kenne inzwischen Reisfelder: Im Grunde ist das eine Getreidewirtschaft wie andere auch, vielleicht mit mehr nassen Füßen als sonst.
Bis jetzt haben wir Früchte und Samen angeschaut, doch es gibt ja auch Gemüse im Haushalt. Aber was ist eigentlich Obst, und was ist Gemüse? Unter Obst versteht man die Früchte meist mehrjähriger Pflanzen, also auch von Bäumen und Sträuchern. Obst ist meist süß und wird hauptsächlich roh verzehrt. Gemüse stammt dagegen von Pflanzen, die nur ein- oder zweijährig sind – und Gemüse besteht oft aus anderen Pflanzenteilen, die nicht von der Blüte stammen. Außerdem wird Gemüse meist vor dem Essen gekocht – das Wort enthält «Mus», also einen Brei – oder anders zubereitet; Gewürze und Salz machen das Gemüse schmackhafter. Doch ganz scharf ist diese Trennung nicht: So sind Tomaten, Zucchini und Gurken ebenfalls Früchte. Sie zählen allerdings zum Gemüse, weil sie von Pflanzen stammen, die nur ein- oder zweijährig sind.
Darüber kann sich ja jeder mal den Kopf zerbrechen, was nun was ist. Als Kind fand ich jedenfalls schon faszinierend, wie viele verschiedene Gemüse die Menschen im Laufe von wohl Jahrhunderten aus einem harmlosen Kreuzblütler gezüchtet haben: von der «Friesenpalme», dem Grünkohl, bis zu einem knackigen festen Weißkohlkopf und zu Rosenkohl und Rotkohl natürlich – ich weiß gar nicht genau, wie viele verschiedene Kohlsorten es heute gibt.
Auf Helgoland findet man sogar noch wilden Kohl – den letzten und einzigen in Deutschland. Während der Schulzeit haben wir mal eine Klassenreise auf die Insel unternommen, wir waren damals fünfzehn oder sechzehn Jahre alt. Natürlich bin ich am Ende eines schmalen Weges noch ein bisschen auf den Klippen herumgeklettert. Dann habe ich im Gras auf dem Bauch gelegen und nach unten geguckt. Es gab ja auf der Insel sonst kaum botanische Sensationen, aber weil ich wusste, dass es dort den wilden Kohl gibt, habe ich gezielt gesucht und ihn dann gefunden.
Der «Klippenkohl», wie er dort auch heißt, hatte mit einem Kohlkopf, auch mit dem Chinakohl, keine Ähnlichkeit, eher mit einer Rapspflanze auf einem sehr mickerigen Rapsacker. Man muss sich eine Rapspflanze vorstellen, die aber noch ein bisschen dickere Blätter hat. Das fühlt sich zwischen den Fingern eher ledrig an; obendrauf wachsen magere Kreuzblüten mit vier gelben Blütenblättern – so etwa sieht der Wildkohl aus.
Wildes Gemüse: Auf Helgoland wächst noch der Urkohl
Der Grünkohl mit seinen krausen Blättern ist der wilden Urform wohl am ähnlichsten. Bei ihm gehen alle Blätter noch vom Stiel ab, also von der Sprossachse. Beim Weißkohl ist die Sprossachse dagegen zusammengestaucht, und die Blätter bilden daher einen schönen, runden Kohlkopf um den Strunk. Beim Rotkohl sind zusätzlich noch Pflanzenfarbstoffe eingelagert. In manchen Gegenden heißt der auch Blaukohl. Die Farbstoffe können ihre Farbe ändern – mit mehr Essig wird ein blauer Rotkohl immer roter. Und beim Wirsing sind die Blätter vom Kohlkopf eben etwas gewellter.
Beim Rosenkohl dagegen sind viele kleine Köpfchen aus den Seitentrieben entstanden – da essen wir also Knospen. An dem mehr oder minder harten Stängel, wo all die kleinen Knospen sitzen, würden sie, wenn man sie wachsen ließe, wie kleine grüne Röschen so richtig aufblättern. Die Knospenblätter kann man ja mit der Hand von den Rosenkohlköpfchen abzupfen – aber besonders, wenn der Rosenkohl schon ein bisschen älter ist, fängt er von selbst an, sich zu entblättern.
Ob aus jeder «Rose» ein Seitentrieb wachsen würde? Das habe ich nie ausprobiert. Wer aber auch so ein bisschen verrückt ist wie ich, hätte vielleicht Lust, einen Rosenkohl, wie das bei den Gärtnern heißt, «auswachsen» zu lassen im Beet. Das wäre doch ein schöner Versuch, den Kohl nicht zu ernten, wenn er reif ist, sondern weiterwachsen zu lassen. Ich habe das mal bei einem Weißkohl gemacht; es war interessant zu beobachten, wie sich die Blätter, die bei einem Kohlkopf dicht an dicht stehen, auseinandergezogen haben, wenn es ans Blühen geht. Und dann kommen wieder die gleichen mageren, gelben Blüten, wie ich sie beim Wildkohl beobachtet habe. Man sieht also, wo der herstammt.
Und dann ist da noch der Blumenkohl. Es ist den meisten Leuten vermutlich gar nicht klar, dass das weiße Gewebe aus den nicht voll entwickelten Blütenständen entstanden ist. Wer das weiß und einen Blumenkohlkopf durchschneidet, kann auch beobachten, dass die kleinen Röschen Knospen sind. Aber den Zusammenhang zwischen Wildkohl und seinen kleinen Blütchen und diesem Gebilde zu erkennen, das fällt doch sehr schwer. Auch der Broccoli ist ein veränderter Blütenstand; oder dieser knallegrüne Kohl, den es jetzt immer öfter gibt – der heißt Romanesco, und bei ihm sind die Knospen so ein bisschen zugespitzt und spiralig gedreht.
Diejenigen, die früher mal angefangen haben, Blumenkohl zu züchten, müssen gemerkt haben, dass die Knospen irgendeiner Vorform eigentlich ganz gut und würzig schmecken. Ich habe mir immer vorgestellt, welcher Fleiß, aber auch welche Aufmerksamkeit dazu gehören, das zu erkennen – und dann solche Formen herauszuzüchten. Dazu ist eine Menge Zähne-Zusammenbeißen und Ich-will-das-jetzt-aber nötig.
Sprossachse, Blätter und Wurzeln sind die Grundbausteine einer Pflanze. Erstaunlich, was die Menschen daraus alles Eigenes gezüchtet haben, das man essen kann. Beim Kohl fehlt da bisher nur die Wurzel. Beim Kohlrabi könnte man jetzt denken, dass der aussieht wie eine Rübe. Aber wer genau hinguckt, entdeckt etwas anderes: schuppige Triebe am Rand, das sind Blätter, die aus der Knolle rauswachsen. Manchmal hat man in einem Gemüsegeschäft aber das Glück, dass noch ein Stück Wurzel unten am Kohlrabi dran ist, doch die geht eben nicht von der Knolle aus, sondern fängt erst darunter an. Daran kann man erkennen, dass sich der eigentliche Kohlrabi, den wir essen, nicht aus der Wurzel bildet; er ist die Sprossachse, die sich verdickt zu dem Gemüse – eine verdickte Sprossknolle also. Auf Feldern sieht man, wie die dicken Knollen über der Erde wachsen, nicht darunter, wo die Wurzeln stecken.