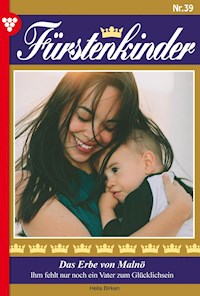Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blattwerk Handel GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Fürstenkinder
- Sprache: Deutsch
In der völlig neuen Romanreihe "Fürstenkinder" kommt wirklich jeder auf seine Kosten, sowohl die Leserin der Adelsgeschichten als auch jene, die eigentlich die herzerwärmenden Mami-Storys bevorzugt. Ihre Lebensschicksale gehen zu Herzen, ihre erstaunliche Jugend, ihre erste Liebe – ein Leben in Reichtum, in Saus und Braus, aber oft auch in großer, verletzender Einsamkeit. Große Gefühle, zauberhafte Prinzessinnen, edle Prinzen begeistern die Leserinnen dieser einzigartigen Romane und ziehen sie in ihren Bann. »Betty, wirst du auch bestimmt auf mich warten? Schließlich sind zwei Jahre eine lange Zeit…« »Zwei Tage ohne dich erscheinen mir schon wie eine Ewigkeit; aber ich warte auf dich, wenn es sein muß, mein Leben lang.« Innig schloß der Mann die Frau in die Arme, und während er sie küßte, huschte ein häßliches Lächeln über sein Gesicht, das Betty, die vor Glückseligkeit die Augen geschlossen hielt, aber leider nicht sehen konnte. Betty war neunundzwanzig Jahre alt und hatte den um fünf Jahre älteren Ferdinand Sauer vor drei Monaten auf einem Tanzvergnügen kennengelernt. Es war das erste öffentliche Tanzvergnügen gewesen, das die zurückhaltende Betty jemals besucht hatte, und hätte nicht Liesel, die Köchin, so viel geredet, dann wäre sie bestimmt nicht hingegangen und hätte niemals den Ferdi kennengelernt. Ferdinand Sauer, genannt Ferdi, wohnte noch nicht lange im Dorf, und niemand wußte so recht, wovon er eigentlich lebte. Er selbst behauptete, Ingenieur zu sein, und da er seine Miete pünktlich bezahlte und auch sonst immer Geld zu haben schien, kümmerte sich niemand darum, was er tatsächlich tat. Die Burschen im Dorf neideten ihm sein gutes Aussehen und sein sicheres Auftreten, aber bei den Mädchen war der Ferdi gern gesehen. Darum war es besonders erstaunlich, daß sich der vielumschwärmte Mann an diesem Sonntag so auffallend um die doch wirklich nicht besonders hübsche Betty kümmerte. Die anderen Mädchen waren böse, und ihr Neid gab zu häßlichen Gerüchten Anlaß. Bald aber mußte man im Dorf feststellen, daß der Ferdi es diesmal wohl ernst meinte. Immer wieder sah man ihn mit Betty zusammen, und schließlich kam man dann auch zu der Überzeugung, daß ein Kindermädchen aus dem Schloß wohl eine bessere Frau für einen Ingenieur abgäbe als irgendeine andere aus dem Dorf. Für Betty selbst aber war dieses späte Glück wie ein Traum, aus dem sie befürchtete, jeden Moment zu erwachen. Es war ihr unverständlich, wie dieser wundervolle Mann ausgerechnet sie lieben, sie zur Frau begehren konnte. Bevor sie nach Schloß Hammerstein kam, hatte sie immer im Schatten einer hübschen Schwester gelebt, und nie hatte ihr irgendein Mann Beachtung geschenkt – bis der Ferdi kam. In den letzten drei Monten war Betty aufgeblüht, und in ihren schönen Augen lag so viel Liebe und Glück, daß sie direkt hübsch war, eine Tatsache, die selbst der flotte Ferdi mit Erstaunen wahrnahm. Heute aber hatte ihr der Ferdi nun mitgeteilt, daß ihm eine amerikanische Firma ein einmaliges Angebot gemacht hätte, und daß er sich diese Chance auf keinen Fall entgehen lassen könne. Vom Erfolg dieser Aufgabe könne seine ganze Zukunft abhängen, und damit doch auch die ihre. Betty hatte das zwar nicht ganz eingesehen, aber da sie ungeheuer stolz war auf ihren tüchtigen Bräutigam, wagte sie auch nicht, ihm zu widersprechen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 159
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Fürstenkinder – 43 –Das Opfer einer Mutter
Aus übergroßer Liebe wollte sie auf ihr Kind verzichten
Hella Birken
»Betty, wirst du auch bestimmt auf mich warten? Schließlich sind zwei Jahre eine lange Zeit…«
»Zwei Tage ohne dich erscheinen mir schon wie eine Ewigkeit; aber ich warte auf dich, wenn es sein muß, mein Leben lang.«
Innig schloß der Mann die Frau in die Arme, und während er sie küßte, huschte ein häßliches Lächeln über sein Gesicht, das Betty, die vor Glückseligkeit die Augen geschlossen hielt, aber leider nicht sehen konnte.
Betty war neunundzwanzig Jahre alt und hatte den um fünf Jahre älteren Ferdinand Sauer vor drei Monaten auf einem Tanzvergnügen kennengelernt.
Es war das erste öffentliche Tanzvergnügen gewesen, das die zurückhaltende Betty jemals besucht hatte, und hätte nicht Liesel, die Köchin, so viel geredet, dann wäre sie bestimmt nicht hingegangen und hätte niemals den Ferdi kennengelernt.
Ferdinand Sauer, genannt Ferdi, wohnte noch nicht lange im Dorf, und niemand wußte so recht, wovon er eigentlich lebte.
Er selbst behauptete, Ingenieur zu sein, und da er seine Miete pünktlich bezahlte und auch sonst immer Geld zu haben schien, kümmerte sich niemand darum, was er tatsächlich tat.
Die Burschen im Dorf neideten ihm sein gutes Aussehen und sein sicheres Auftreten, aber bei den Mädchen war der Ferdi gern gesehen. Darum war es besonders erstaunlich, daß sich der vielumschwärmte Mann an diesem Sonntag so auffallend um die doch wirklich nicht besonders hübsche Betty kümmerte. Die anderen Mädchen waren böse, und ihr Neid gab zu häßlichen Gerüchten Anlaß.
Bald aber mußte man im Dorf feststellen, daß der Ferdi es diesmal wohl ernst meinte. Immer wieder sah man ihn mit Betty zusammen, und schließlich kam man dann auch zu der Überzeugung, daß ein Kindermädchen aus dem Schloß wohl eine bessere Frau für einen Ingenieur abgäbe als irgendeine andere aus dem Dorf.
Für Betty selbst aber war dieses späte Glück wie ein Traum, aus dem sie befürchtete, jeden Moment zu erwachen. Es war ihr unverständlich, wie dieser wundervolle Mann ausgerechnet sie lieben, sie zur Frau begehren konnte.
Bevor sie nach Schloß Hammerstein kam, hatte sie immer im Schatten einer hübschen Schwester gelebt, und nie hatte ihr irgendein Mann Beachtung geschenkt – bis der Ferdi kam.
In den letzten drei Monten war Betty aufgeblüht, und in ihren schönen Augen lag so viel Liebe und Glück, daß sie direkt hübsch war, eine Tatsache, die selbst der flotte Ferdi mit Erstaunen wahrnahm.
Heute aber hatte ihr der Ferdi nun mitgeteilt, daß ihm eine amerikanische Firma ein einmaliges Angebot gemacht hätte, und daß er sich diese Chance auf keinen Fall entgehen lassen könne. Vom Erfolg dieser Aufgabe könne seine ganze Zukunft abhängen, und damit doch auch die ihre.
Betty hatte das zwar nicht ganz eingesehen, aber da sie ungeheuer stolz war auf ihren tüchtigen Bräutigam, wagte sie auch nicht, ihm zu widersprechen. Und doch sagte sie jetzt, nachdem sie ihre ein wenig in Unordnung geratenen Haare wieder gerichtet hatte:
»Ferdi, warum heiraten wir nicht vorher, ich meine, bevor du nach Amerika gehst?«
Nachsichtig lächelnd antwortete der Mann: »Du bist doch wirklich ein Närrchen! Wovon sollen wir denn wohl heiraten? Ich habe dir doch gesagt, daß ich bei dem Schwindelunternehmen damals mein ganzes Geld verloren habe…«
»Aber Ferdi«, unterbrach ihn Betty mutig, »wozu brauchen wir Geld? Andere Leute heiraten auch und haben kein Vermögen.«
»Ja, aber ich nicht«, entgegnete er protzig. »Entweder kann ich meiner Frau eine Wohnung und ein standesgemäßes Leben bieten, oder ich heirate überhaupt nicht.«
Bewundernd sah Betty ihren Ferdi an, dann meinte sie verschämt:
»Ein paar tausend Mark habe ich mir ja auch gespart, und wenn du mich nicht mitnehmen kannst, dann könnte ich doch in den zwei Jahren weiterhin auf Hammerstein bleiben. Dann brauchen wir vorläufig keine Wohnung, und ich kann auch noch weiter sparen.«
Gerührt drückte ihr der Mann einen Kuß auf die Stirn, dann sagte er:
»Nein, nein, Liebste, das ist ausgeschlossen! Niemals würde ich meiner Frau erlauben, für fremde Menschen zu arbeiten. Laß uns warten, bis ich wiederkomme, und dann bin ich ein gemachter Mann, wenn ich jetzt auch ohne einen Pfennig in der Tasche die Reise in die Fremde antreten muß…«
Lauernd beobachtete er die Wirkung seiner Worte auf Betty, und wie erhofft, kam die Reaktion spontan und von Herzen.
»Ich weiß nicht, Ferdi«, sagte sie schüchtern, »ob ich dich recht verstanden habe; aber wenn du in einer momentanen Geldverlegenheit bist, dann kann ich dir doch gerne aushelfen. – Was mein ist, ist schließlich doch auch dein.«
Ferdinand Sauer protestierte, und so wurde dann vereinbart, daß er abends nach Hammerstein kommen und sich das Geld holen sollte.
Betty war glücklich, etwas für den geliebten Mann tun zu dürfen, und naiv wie ein ganz junges Mädchen baute sie Luftschlösser, ihre gemeinsame Zukunft betreffend.
Selbstgefällig lächelnd ließ Ferdi sie reden –, er hatte sein Ziel erreicht. Nun konnte er den letzten Akt in Szene setzen. Gespielt erschrocken sagte er plötzlich:
»Du, Betty, ich sehe Ariane gar nicht mehr…«
Gewaltsam auf die Erde zurückgerissen, meinte Betty ehrlich bestürzt:
»Ja, aber sie war doch eben noch dort unten bei der Sandkiste… Sie kann doch nicht fort sein…«
Aber so viel sie auch suchte und rief – Ariane blieb verschwunden.
Verzweifelt irrte Betty durch den Park.
Ariane war ein kleiner Kobold, vielleicht hatte sie sich hinter einem Baum oder einem Strauch versteckt, so jedenfalls hoffte das Kindermädchen; aber die Hoffnung war vergebens. Von ein paar Spaziergängern abgesehen – keiner von ihnen aber hatte ein kleines Mädchen gesehen – war der Stadtwald wie ausgestorben.
Betty hastete den Weg zurück.
›Sicherlich sitzt sie jetzt ganz brav in der Sandkiste und spielt‹, versuchte sich Betty einzureden. Aber als sie die Wegkrümmung erreichte, von der aus sie die Sandkiste sehen konnte, war diese leer. Nur Arianes kleine Schaufel und Förmchen zeugten davon, daß sie vor kurzer Zeit hier noch gespielt hatte.
Weinend brach das Mädchen auf dem Rand der Sandkiste zusammen.
Langsam schlenderte Ferdinand Sauer heran, und während er ganz gleichgültig auf das weinende Mädchen herabsah, sagte er wirklich ungewohnt grob:
»Nun, dein Heulen nutzt jetzt auch nichts. Das Kind ist eben weg. Vielleicht war es ihm zu langweilig und es ist nach Hause gelaufen.«
Betty hob das verquollene, verweinte Gesicht, und mit herzbewegender Stimme erwiderte sie:
»Ariane kennt den Weg nach Hause gar nicht. Gegen das Verbot der Baronin habe ich mit Ariane den Schloßpark verlassen und bin hierher gekommen, um dich zu treffen. Ich allein trage die Schuld, wenn was passiert ist. Du warst mir eben wichtiger als meine Pflichten und alle Verbote. Ferdi, sag, Gott wird es doch nicht zulassen, daß dem Kind was passiert?«
»Nein, nein, nun beruhige dich!«
Der Mann tätschelte ihr geistesabwesend den Kopf.
»Wenn du willst, kann ich ja noch einmal den Stadtwald durchkämmen, er ist ja nicht sehr groß.«
»Nein«, protestierte Betty schwach, »das ist sinnlos. Ich gehe jetzt zur Polizei.«
»Bist du verrückt!« unterbrach der Mann sie barsch. »Vielleicht ist das Kind ja doch zu Hause, vielleicht ist es mit irgendeinem Bekannten mitgelaufen. Bevor du den ganzen Polizeiapparat in Bewegung setzt, mußt du erst feststellen, ob Ariane nicht doch auf Hammerstein ist.« Und zärtlich fügte er hinzu: »Komm, ich begleite dich.«
Schwankend wie eine Schwerkranke taumelte das Mädchen neben dem Mann her. Betty wußte, für sie war alles aus, es gab kein Glück mehr; aber sie dachte nicht an sich. Ihre Gedanken kreisten nur um Ariane – das bezaubernde Mädchen mit den blonden Locken, das größte Glück ihrer Eltern, der Liebling aller, die sie kannten. Wenn Ariane etwas zugestoßen war, wollte auch sie nicht mehr leben…
Als der Mühlensee durch das Dunkel der Bäume schimmerte, schrie Betty mit weher Stimme:
»Ferdi, o mein Gott, Ariane wird doch nicht etwa zum See gelaufen sein und…«
»Aber nein, was du dir für dumme Gedanken machst!« sagte der Mann beruhigend.
Doch plötzlich wurde ihm klar, daß die Idee vielleicht gar nicht so schlecht war, und vorsichtig tastend meinte er daher:
»Möglich wäre es natürlich. Kinder spielen ja immer gern am Wasser; aber ich glaube nicht, daß das kleine Mädchen so weit gelaufen ist.«
Bis Hammerstein sprach Betty kein Wort mehr. Nur hin und wieder kam ein wehes Schluchzen aus ihrem Mund, und jedesmal gab es dem Mann einen kleinen Stich, denn wenn er sich aus Betty auch nichts machte, so sah er bei aller Skrupellosigkeit Menschen doch ungern leiden.
Vor dem großen, schmiedeeisernen Portal verabschiedete er sich herzlich mit einem Kuß, und mit ein paar gewählten Worten erinnerte er Betty daran, ihm heute abend, wie verabredet, das Geld zu bringen.
Betty nickte nur, und schon hastete sie mit großen Schritten quer über die gepflegten Rasenflächen dem Schloß zu.
*
Baron von Hammer war ein Mann von vierzig Jahren. Er war von großer, trotzdem etwas gedrungen anmutender Gestalt, und sein volles Gesicht wirkte anziehend durch die blauen, durchdringend blickenden Augen, die eine tiefe Güte ausstrahlten.
Er war bei seinen Angestellten wie auch bei den Dorfbewohnern überaus beliebt und geachtet.
Vor zehn Jahren hatte er die arme, aber sehr schöne Amelia von Lossow geheiratet, die neben ihrem vor Gesundheit strotzenden Mann wie eine zarte fremdländische Blume wirkte.
Die Hochzeit hatte damals große Überraschung ausgelöst, denn alle hatten fest damit gerechnet, daß der Baron die Komteß von Millner heiraten würde, mit der er schon seit frühester Jugend eng befreundet war.
Die Komteß, die nie ein Hehl daraus gemacht hatte, daß sie Bernhard von Hammer sehr zugetan war, nahm zwar an den Hochzeitsfeierlichkeiten teil, doch später sah man sie nie mehr auf Hammerstein.
Diese Heirat hatte man dem Baron nie so recht verziehen. Die Dorfbewohner, gewohnt, ihren Herren treu zu dienen, standen einmütig auf der Seite der jetzt einsamen, sitzengebliebenen Komteß, die sich zudem äußerster Beliebtheit erfreute.
Die Komteß konnte es an äußerster Schönheit zwar nicht mit der Baronin von Hammer aufnehmen, aber sie hatte ein Herz für die Armen und für die Kranken – und sie war eine tüchtige, umsichtige Gutsfrau, eine Tatsache, die bei den Dorfbewohnern höher im Kurs stand als Schönheit.
Amelia von Hammer war ganz das Gegenteil der praktisch veranlagten Komteß. Mit Arbeit hatte sie nicht viel im Sinn. Sie verbrachte ihre Tage im süßen Nichtstun. Stundenlang konnte sie vor dem Spiegel sitzen und sich aufrichtig wie ein Kind an ihrer eigenen Schönheit erfreuen. Die Kammerzofe, die wieder und wieder neue Haarfrisuren ausprobieren mußte, konnte davon ein Lied singen.
Amelia liebte den Luxus in jeder Form. Sie ließ sich ihre Garderobe aus Paris schicken, manchmal auch aus Rom. Sie engagierte einen französischen Koch und einen englischen Butler. Sie beschäftigte fünf Gärtner, die in Treibhäusern exotische Blumen züchten mußten, die sie dann, wenn sie endlich blühten, mit viel Geschmack in kostbaren Vasen arrangierte.
Und da die Blumen ja schließlich bewundert werden mußten, veranstaltete die Baronin Feste, die ob ihrer Großzügigkeit und Originalität berühmt waren.
Wenn man nun aber meinte, daß dem schlichten Bernhard von Hammer die Extravaganzen seiner Frau zuviel werden müßten, dann irrte man sich. Genau das Gegenteil war der Fall. Er liebte die weiche, frauliche Atmosphäre, die man jetzt in allen Räumen des Schlosses spürte.
Es machte ihm nichts aus, daß er sich auf Wunsch seiner Frau mehrmals am Tag umziehen mußte, weil sie sich einen eleganten Mann wünschte und weil ihr nichts mehr zuwider war als der Stall- oder Feldgeruch.
Später sehnte sich der Baron oft nach den gediegenen Möbeln seiner Vorfahren, in denen man bequem sitzen konnte, ohne zu befürchten, daß die zierlichen Füße brechen würden. Er verspürte ein unbeschreibliches Verlangen nach seinem alten, männlich-herben Wohnzimmer, das ihm vor seiner Ehe der liebste Aufenthaltsraum gewesen war.
Oh, mein Gott, was waren die Zeiten schön gewesen, da er, wie er war, in seinen Reitstiefeln, zusammen mit Troll, dem Jagdhund, in das Schloß hatte kommen und sich gemütlich eine Pfeife anbrennen können.
Amelia konnte Pfeifengeruch nicht vertragen. In ihrer Gegenwart durfte er nur ägyptische Zigaretten rauchen, die er verabscheute.
Immer öfter besuchte der Baron seinen Inspektor Hans von Wiener, dem er in wahrer Freundschaft zugetan war, der aber, seitdem die Baronin auf Hammerstein herrschte, nur noch selten eingeladen wurde.
Hans von Wiener konnte die Baronin nicht besonders leiden, und so war er froh, daß er nicht oft zum Theaterspielen gezwungen wurde.
Sein Freund Bernhard tat ihm leid, aber er hütete sich wohl, etwas zu sagen, denn anfangs war der Baron dermaßen in seine schöne Frau verliebt, daß er jeden getötet hätte, der etwas gegen Amelia gesagt hätte. Später, als Hans merkte, daß der Baron in seiner Ehe unglücklich war, da schwieg er aus Mitleid.
Das alles änderte sich schlagartig, als nach fast sechsjähriger Ehe die kleine Ariane geboren wurde.
Der Baron, der die Hoffnung auf Kinder schon aufgegeben hatte, war überglücklich, und zum Erstaunen aller entpuppte sich die eitle, etwas gefallsüchtige Baronin als eine überaus fürsorgliche, zärtliche Mutter.
Ariane hatte die Schönheit ihrer Mutter und das liebe, großzügige Wesen ihres Vaters geerbt. Sie war der Sonnenschein von Hammerstein, mit ihr war das Glück wieder eingezogen.
So lagen die Dinge, als Betty mit der Schreckensnachricht eintraf, daß Ariane verschwunden sei.
*
Baron von Hammer starrte Betty an, als wäre sie ein Geist. Dann sagte er mit schwerer Stimme:
»Das ist doch gar nicht möglich, ich meine, daß etwas passiert ist. Jeder Mensch hier im Ort kennt Ariane und liebt sie, niemand würde ihr etwas zuleide tun. Wenn sie also wirklich irgendwo herumirrt – im Stadtwald oder im Dorf –, dann wird es nicht lange dauern und jemand bringt sie zurück zum Schloß. Bist du nicht auch meiner Meinung, Amelia?«
Die Reaktion der Baronin auf die Eröffnung Bettys war recht eigenartig gewesen. Sie zeigte keinerlei Bestürzung, im Gegenteil, etwas wie Erleichterung malte sich auf ihren ebenmäßigen Zügen, und auf die Frage ihres Gatten murmelte sie nur: »Sicher! Sicherlich wird es so sein.«
Ihre Worte klangen aber überhaupt nicht überzeugend, und Betty, die schwer an ihrer Schuld trug, kam es vor, als erlebte sie eine billige Komödie. Sie sah den ungläubigen Gesichtsausdruck des Barons, und da wußte sie, daß es ihm genauso erging.
Betty wußte, für ihr Tun gab es keine Entschuldigung, aber sie wollte wenigstens erklären, doch der Baron schnitt ihr kurz, wenn auch freundlich, das Wort ab.
»Gut, Betty, Sie haben ein Verbot überschritten, doch was besagt das schon? Wir kennen und schätzen Sie als eine überaus zuverlässige Kraft, der zudem das ganze Herz unseres Kindes gehörte. Warum also sollte ich schelten, wenn Sie einmal der Liebe gehorchten und nicht der Pflicht? Wir alle machen Fehler und wissen vorher nie, welche Konsequenzen sie nach sich ziehen werden.
Ich bin überzeugt, Ariane ist nichts passiert. Gott kann es gar nicht zulassen, daß ein unschuldiges Kind für unsere Fehler büßen muß, glauben Sie nicht auch? Beten Sie, Betty, das ist alles, was wir im Moment tun können.«
Der Baron hatte aber trotzdem die Polizei benachrichtigt, doch auch sie stand auf dem Standpunkt, daß es für eine großangelegte Suchaktion noch zu früh wäre.
Man hatte zwar ein paar Polizisten mit Suchhunden in den Stadtwald geschickt, doch schon vor einer halben Stunde waren sie zurückgekehrt, ohne daß sie eine Spur gefunden hatten.
Die Dämmerung kam und mit ihr die Unruhe. Jetzt war das Kind schon seit mehreren Stunden verschwunden, und selbst der Baron, der bisher so hoffnungsvoll gewesen war, begann die Nerven zu verlieren.
Nur die Baronin saß schön wie eine Marmorstatue und genauso leblos zwischen den verzweifelten Menschen. Ihr Gesicht war blaß, nur die Augen brannten wie im Fieber. Sie sprach kein Wort, und es schien, als hörte sie auch nicht, was um sie herum gesprochen wurde.
Hans von Wiener maß die Baronin mit einem Blick der Verachtung und laut, so daß es jeder hörte, sagte er:
»Aber bitte, wir wollen doch nicht gleich an das Schlimmste denken, solange die Mutter sich nicht sorgt. Mütter haben bekanntlich einen sechsten Sinn, wenn es sich um ihre Kinder handelt, und da die Baronin den Dingen gelassen zusieht, sollten auch wir uns nicht in eine Panikstimmung versetzen, sondern hoffen und geduldig warten…«
Alle Blicke richteten sich auf die Baronin, die plötzlich mit einer ganz kleinen, demütigen Stimme sagte:
»Ich habe nie daran geglaubt –, an die Vergeltung. Ich hätte wissen müssen, daß das Glück nur geliehen war.«
Nach diesen Worten fiel sie in sich zusammen, und ein haltloses Schluchzen erschütterte ihren schmalen Körper.
Der Hausarzt Dr. Neuhaus, den man vorsichtshalber gerufen hatte, nahm sich der Baronin an.
Nachdem er sie mit einer Spritze beruhigt hatte, sagte er zu seinem alten Freund, dem Baron:
»Bernd, ich will mich ja nicht in eure Angelegenheiten mischen, aber kannst du dir Amelias Worte erklären?«
»Nein, Rudolf«, entgegnete der Baron matt, »ich kenne die Bedeutung der Worte nicht, doch ich glaube, daß sie auf die nervliche Anspannung zurückzuführen sind und praktisch nichts zu sagen haben. Meinst du nicht auch?«
Der Arzt zuckte nur zweifelnd mit den Schultern, sagte aber nichts.
Betty, die, bevor sie Ferdi kennengelernt hatte, hoffnungslos in den stattlichen Inspektor verliebt gewesen war, beobachtete Hans von Wiener sehr genau, und sie konnte sich dessen eigenartigen Gesichtsausdruck nicht erklären. Dieser sah mit Mitleid auf den Baron, und mehrmals setzte er zum Sprechen an, ließ es dann aber doch wieder sein.
Gerade war wieder eine negative Meldung der Polizei eingelaufen, und da sagte Hans von Wiener plötzlich in einem Ton, der kaum einen Widerspruch duldete:
»Ich glaube, wir alle machen einen großen Fehler. Wir glauben, das Kind müsse sich verirrt haben oder in den Mühlenteich gefallen sein. Die Möglichkeit besteht, aber es gibt noch eine: die Zigeuner.«
Eine Weile herrschte betretenes Schweigen, dann fragte der Baron schwerfällig:
»Du… du denkst an eine Entführung?«
»Ja, Bernd. Es wäre nicht das erstemal, daß Zigeuner ein Kind entführten. Manchmal erpressen sie die Eltern, oft auch behalten sie das Kind und ziehen es auf wie ein eigenes. Zigeuner sind sehr kinderlieb…«
»Ich kenne aber auch Fälle, in denen Zigeuner blonde Kinder für ihre kriminellen Zwecke einspannten. Sie mußten betteln, stehlen und noch viel mehr«, bemerkte Dr. Neuhaus aufgeregt.
Der Kriminalkommissar, der sich bisher ruhig im Hintergrund gehalten hatte, mischte sich unerwartet in die Unterhaltung, indem er bedächtig sagte:
»Einer meiner Mitarbeiter hat mir vorhin gemeldet, daß die Zigeuner, die ja bekanntlich in jedem Jahr im Sommer am Ausgang des Stadtwaldes ihr Domizil aufschlagen, völlig unerwartet und früher denn je ihre Reise fortgesetzt haben. Das mag nichts zu bedeuten haben, oder auch sehr viel. Ich habe jedenfalls einen Polizeiwagen hinterhergeschickt, bis jetzt aber noch keine Meldung erhalten.«
Unbemerkt von den anderen verließ Hans von Wiener den Raum. Selbst Betty, die an ihre Verabredung mit Ferdi dachte, war es nicht aufgefallen.
Hans von Wiener aber ging mit schweren Schritten zu dem kleinen efeubewachsenen Haus, das ihm als Heim diente.
Ohne Licht zu machen, tastete er sich zum Schlafzimmer. Hier zog er einen großen, abgeschabten Koffer unter dem Bett hervor, entnahm ihm einen Regenmantel mit Kapuze – und einen Revolver. Warum er den einsteckte, wußte er selbst nicht zu sagen.
Inzwischen war es stockdunkel geworden, und ein leichter Nieselregen hatte eingesetzt.
Kaum zu erkennen in dem großen Kapuzenmantel, schlich Hans von Wiener in den Park.
Er verbarg sich hinter einer der großen Steinfiguren, irgendeinen König darstellend, die die ganze Auffahrt bis zum Schloß säumten.