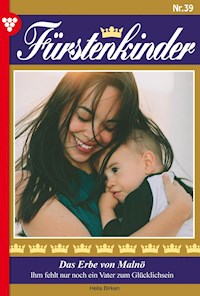Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Martin Kelter Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Fürstenkinder
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
In der völlig neuen Romanreihe "Fürstenkinder" kommt wirklich jeder auf seine Kosten, sowohl die Leserin der Adelsgeschichten als auch jene, die eigentlich die herzerwärmenden Mami-Storys bevorzugt. Ihre Lebensschicksale gehen zu Herzen, ihre erstaunliche Jugend, ihre erste Liebe – ein Leben in Reichtum, in Saus und Braus, aber oft auch in großer, verletzender Einsamkeit. Große Gefühle, zauberhafte Prinzessinnen, edle Prinzen begeistern die Leserinnen dieser einzigartigen Romane und ziehen sie in ihren Bann. Liebster Papi, Mami weiß nichts von diesem Brief, und bitte erwähne ihn nie! Du weißt, sie kann sehr zornig werden, wenn man etwas heimlich tut. Wir wissen nicht genau, warum Du so plötzlich nach der Ravensburg gefahren bist, aber Nanni sagte uns im Vertrauen, daß der Baron von Speyer daran schuld ist. Du weißt, Papi, wir mögen den Baron gar nicht leiden. Die Mami aber anscheinend sehr, denn sie sind fast den ganzen Tag zusammen. Für uns hat die Mami überhaupt keine Zeit mehr. Papi, bitte, bitte, komm zurück! Wir vermissen Dich so sehr. Kann denn nicht wieder alles wie früher sein? Wenn Du nicht kommst, kommen wir zu Dir. Nanni ist in unseren Plan eingeweiht, sie würde mit uns kommen und auch für uns das Fahrgeld bezahlen. Schöner wäre es aber, Du kämst hierher. Sicherlich würde der Baron dann nicht mehr so oft kommen, und Du und Mami, Ihr könntet wieder glücklich sein. Mit einer müden Bewegung faltete Harald Graf von Ravensburg den Brief zusammen. Seine Kinder! Was sollte aus ihnen werden, wenn Tanja wirklich auf einer Scheidung bestand? Aber warum überhaupt eine Scheidung? Waren sie nicht immer glücklich gewesen in den vierzehn Jahren ihrer Ehe? Ja, er war es, aber Tanja offenbar nicht, und doch war er bis vor wenigen Wochen der Meinung gewesen, eine Idealehe zu führen. Verwandte und Freunde hatten Tanja und ihn immer um ihr anhaltendes Glück beneidet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 162
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Fürstenkinder – 23 –
Verlass uns nicht, geliebte Mutti!
Wir wollen endlich eine glückliche Familie sein!
Hella Birken
Liebster Papi, Mami weiß nichts von diesem Brief, und bitte erwähne ihn nie! Du weißt, sie kann sehr zornig werden, wenn man etwas heimlich tut.
Wir wissen nicht genau, warum Du so plötzlich nach der Ravensburg gefahren bist, aber Nanni sagte uns im Vertrauen, daß der Baron von Speyer daran schuld ist.
Du weißt, Papi, wir mögen den Baron gar nicht leiden. Die Mami aber anscheinend sehr, denn sie sind fast den ganzen Tag zusammen. Für uns hat die Mami überhaupt keine Zeit mehr.
Papi, bitte, bitte, komm zurück! Wir vermissen Dich so sehr. Kann denn nicht wieder alles wie früher sein?
Wenn Du nicht kommst, kommen wir zu Dir. Nanni ist in unseren Plan eingeweiht, sie würde mit uns kommen und auch für uns das Fahrgeld bezahlen.
Schöner wäre es aber, Du kämst hierher. Sicherlich würde der Baron dann nicht mehr so oft kommen, und Du und Mami, Ihr könntet wieder glücklich sein.
Viele Grüße und Küsse von Deinen Dich liebenden Kindern Erika und Jochen
Mit einer müden Bewegung faltete Harald Graf von Ravensburg den Brief zusammen.
Seine Kinder! Was sollte aus ihnen werden, wenn Tanja wirklich auf einer Scheidung bestand?
Aber warum überhaupt eine Scheidung? Waren sie nicht immer glücklich gewesen in den vierzehn Jahren ihrer Ehe? Ja, er war es, aber Tanja offenbar nicht, und doch war er bis vor wenigen Wochen der Meinung gewesen, eine Idealehe zu führen. Verwandte und Freunde hatten Tanja und ihn immer um ihr anhaltendes Glück beneidet.
Er hatte daher an einen bösen Scherz geglaubt, als Tanja ihm vor acht Wochen mitteilte, daß sie sich von ihm trennen wolle, daß ihre Liebe zu ihm schon lange erloschen sei.
Und dann hatte er nachgedacht, lange nachgedacht, und da war ihm plötzlich erschreckend klargeworden, daß Tanja sich wirklich schon seit mehr als einem Jahr gewandelt hatte. Es gab keine leidenschaftlichen Umarmungen mehr, und auch die kleinen Zärtlichkeiten beschränkten sich nur mehr auf die Kinder, aber auch das nur selten.
Tanja, die früher größere Geselligkeiten nur im beschränkten Maße liebte, verpaßte jetzt keinen Ball, keine Jagd und kein Picknick –, immer aber war der Baron von Speyer an ihrer Seite.
Otto von Speyer war ein gutaussehender, etwa fünfunddreißigjähriger Mann, der vor Jahren von seiner Frau, einer französischen Prinzessin, geschieden worden war.
Vor etwa zwei Jahren hatte der Baron die ›Villa Isolda‹ gekauft und war somit ein Nachbar der Ravensburg geworden. Otto von Speyer war ein Gesellschaftsmensch, intelligent und sympathisch, und so wurde er schnell ein gerngesehener Gast in der ›Villa Miranda‹, die Harald von Ravensburg von seiner Patentante geerbt hatte.
Der Graf, der seine Frau über alles liebte und der den Baron in seiner frohen, leichten Art schätzte, wäre nie auf die Idee gekommen, diesen beiden Menschen zu mißtrauen. So fand er anfangs auch nichts dabei, daß der Baron seine Frau begleitete, wenn er selbst durch geschäftliche Verpflichtungen davon abgehalten wurde. Ja, er selbst war es sogar gewesen, der den Baron bat, seine Frau auf ihrem geliebten Morgenritt zu begleiten, da er für mehrere Wochen nach Deutschland fahren mußte, es aber nicht sehr gern sah, wenn Tanja allein ausritt.
So kam es, daß man in der Gesellschaft schon lange über die Gräfin und den Baron flüsterte, ehe der Graf selbst auch nur die leiseste Idee hatte, daß seine Frau in Otto von Speyer mehr sah als nur einen Nachbarn und Freund.
In den letzten Monaten war ihm Tanja oft befremdlich erschienen, aber in seiner unveränderten Liebe zu dieser Frau fand er immer Entschuldigungen für ihr Handeln und suchte die Schuld bei sich.
Die Eröffnung, daß sie sich scheiden lassen wollte, kam daher wie ein Blitz aus heiterem Himmel für ihn, und noch immer konnte er nicht glauben, daß sie es auch wirklich ganz ernst meinte.
Auf der Ravensburg waren einige größere Reparaturen notwendig geworden, und so benutzte er dies als Vorwand, um sich für kurze Zeit von Tanja zu trennen. Er war fest davon überzeugt, daß Tanja nun, da sie Muße zum Nachdenken hatte, ihren Scheidungswunsch bereuen und zurückziehen würde. Schließlich kann man vierzehn Jahre Ehe doch nicht einfach so auswischen, so tun, als wären sie gar nicht gewesen…
Nun aber baten ihn die Kinder, zurückzukommen. Was sollte er nur tun?
In diesem Augenblick meldete ihm Jobst, sein Kammerdiener und Vertrauter, daß ihn sein älterer Bruder Hubert zu sprechen wünsche.
Wie schön! Hubert, den er sehr liebte, wußte sicherlich Rat. Mit ausgestreckten Händen ging er ihm entgegen und war betroffen, als er des Bruders ernstes Gesicht sah.
Graf Hubert fühlte sich nicht sehr wohl in seiner Haut, und es tat ihm weh, als er sah, wie das frohe Aufleuchten in Haralds Augen erlosch. Trotzdem kam er gleich auf den Zweck seines Besuches zu sprechen, und ohne Umschweife sagte er: »Wie ich höre, hat Tanja nun tatsächlich die Absicht, sich scheiden zu lassen. Das muß natürlich auf alle Fälle verhindert werden.
In der jahrhundertealten Geschichte unserer Familie hat es noch keine Scheidungen gegeben, und so soll es auch bleiben. Viele unserer Vorfahren haben nicht aus Liebe geheiratet, und trotzdem haben sie ihr Ehegelübde bis zum Tode gehalten.
Du und Tanja aber, ihr habt aus Liebe geheiratet – gegen den Willen der Familie, wie du wohl erinnerst –, und was immer auch geschehen sein mag, kann nicht so schlimm sein, daß man es nicht wieder einrenken könnte.
Man hat mich, als Oberhaupt der Familie, gebeten, dir das zu sagen. Harald, du mußt dich mit Tanja wieder versöhnen! Wir können uns einfach keinen Skandal leisten. Es geht doch nicht nur um euch beide, du mußt doch auch an die Familie und vor allen Dingen an deine Kinder denken.
Harald, du warst mir immer mein liebster Bruder. Glaube mir, es tut mir in der Seele weh, daß du Kummer hast, und ich wünschte, ich wüßte, wie ich dir helfen kann. Soll ich noch einmal mit Tanja sprechen?«
Resigniert meinte der Bruder: »Sehr lieb von dir, Hubert, aber das dürfte nicht viel Zweck haben.
Tanja ist seine sehr schöne, leidenschaftliche, aber wie ich jetzt feststellen mußte, auch sehr egoistische Frau. Sie tut das, was ihr Freude macht, und nichts weiter. Rücksicht auf Familientradition ist ihr unbekannt. Du weißt, ihre Familie ist reich, aber der Adel noch sehr jung. Man ist modern und großzügig. Ihre beiden Schwestern sind auch geschieden, und niemand nahm Anstoß daran, nicht einmal der uralte französische Adel.
Ich liebe Tanja nach wie vor. Der Gedanke, sie zu verlieren, ist mir unerträglich. Ein Leben ohne sie kann ich mir einfach nicht vorstellen…«
Seine Stimme brach. Mit zitternden Händen versuchte er, sich eine Zigarette anzustecken, aber es gelang ihm nicht.
Lange schwiegen die Brüder. Es gab nichts mehr zu sagen. Das weitere Schicksal des Grafen Harald und seiner beiden Kinder hing nur davon ab, wie sich die Gattin und Mutter entscheiden würde.
Frühjahrsstürme umtosten die trutzige Burg, die aus dem 11. Jahrhundert stammte und der weder Kriege noch Katastrophen bisher etwas anhaben konnten. Unheimlich heulte der Wind in den Kaminen und ließ die Flammen tanzen.
Als Harald seinen Bruder bis zum Wagen begleitete, setzte ein heftiger Regen-Hagel-Schauer ein, und der Diener Jobst, der ihnen mit einer Laterne den Weg leuchtete, fragte besorgt: »Graf Hubert, wollen Sie nicht lieber auf der Ravensburg bleiben? Der Sturm ist gefährlich und der Weg nach Schloß Berneck selbst bei gutem Wetter nicht gerade harmlos…«
»Unke nicht schon wieder, lieber Jobst«, sagte der Graf lachend, »du weißt doch, Unkraut vergeht nicht, und so ein bißchen Sturm ist halb so schlimm.«
Die Brüder reichten sich fest die Hände. Hubert wollte noch etwas sagen, etwas Tröstendes, aber Worte schienen so banal, und so schlug er seinem Bruder nur freundschaftlich-verstehend auf die Schulter, dann stieg er schnell ein, und schon Sekunden später sah man von dem großen Wagen nur noch die Schlußlichter hin und wieder in den Kurven auftauchen.
Graf Harald fühlte sich plötzlich unendlich verlassen. Die entfesselten Naturgewalten entsprachen so ganz dem Sturm, der in seinem Innern tobte.
Mit schleppenden Schritten, ein wenig gebeugt wie ein alter Mann, ging er in das Schloß zurück.
*
Es war wenige Tage später, als Amanda, die Frau des Kammerdieners Jobst, das kleine Wäschegeschäft der Sophie Hartmann betrat.
Sie und Sophie waren zusammen zur Schule gegangen, und obwohl Amanda, seit sie auf der Burg wohnte, allgemein keinen Umgang mehr mit ›den Bürgern da unten‹ pflegte, war ihre alte Freundschaft zu Sophie nie ganz abgebrochen. Nun ja, schließlich mußte man ja auch einen Menschen haben, mit dem man mal über alles sprechen konnte.
Der Jobst war schließlich nur ein Mann, und mit den anderen Angestellten der Burg konnte sie, da ihr Mann eine Vertrauensstellung bekleidete, unmöglich schwatzen.
So wartete Amanda also geduldig, bis die Kundin abgefertigt war, die Sophie gerade bediente. Kaum aber hatte diese den Laden verlassen, da sagte sie in ihrer etwas überschwenglichen Art: »Ach, Sophie, wenn du wüßtest, was wir für Sorgen haben!«
Sophie Hartmann, die sich immer wieder darüber amüsierte, daß die Freundin ständig von ›wir‹ sprach, wenn sie die Herrschaft meinte, sagte ruhig: »Na, denn komm man mit nach hinten. Ich hatte mir gerade einen Kaffee aufgesetzt, und den Laden kann ich auch schließen, es wird ja doch niemand mehr kommen.«
Das Wohnzimmer der Sophie Hartmann war klein, aber urgemütlich. Als die beiden Damen eintraten, erhob sich eine jugendliche Gestalt aus einem der zierlichen, etwas unbequemen Sessel und machte Anstalten, mit einem freundlich gemurmelten Gruß den Raum zu verlassen, aber da erkannte Amanda sie, und erstaunt meinte sie: »Ja, ist denn das möglich? Die Cary ist wieder mal in Deutschland…«
Cary Hartmann sah auf die vermummte Figur der Besucherin, und in plötzlichem Erkennen sagte sie lachend: »Tante Amanda! Mein Gott, dich hätte ich aber wirklich kaum erkannt. Ist es denn so kalt draußen, daß du dich einpackst wie im strengsten Winter?«
»Nein«, sagte Amanda etwas verlegen, »aber ich wollte nicht, daß mich alle Leute im Dorf erkennen. Man wohnt nicht ungestraft auf der Burg, man muß schließlich Rücksicht nehmen…«
Sophie Hartmann und ihre Nichte warfen sich einen verständnisinnigen Blick zu, dann sagte Sophie resolut: »Dann setz dich man, Amanda, ich hole schnell den Kaffee. Derweil kannst du ja mit Cary ein wenig plaudern.«
Beim dritten Stück Streuselkuchen platzte Amanda dann mit der Neuigkeit heraus: »Stellt euch vor, unsere Gräfin will sich doch von unserem Grafen scheiden lassen!
Wir wissen ja nichts Genaues, aber der Jobst meint, da müßte ein anderer Mann dahinterstecken, obwohl man sich das kaum denken kann, wo unser Graf doch so ein fescher und netter Mann ist.
Ich habe ja immer gesagt, die Gräfin Tanja ist zwar eine schöne Frau, aber sie paßt nicht zu unserem Grafen und nicht auf die Ravensburg, aber wo die Liebe hinfällt, nicht wahr?
Der Graf hat sich nie was aus einer Frau gemacht, bis diese Tanja kam. Da war es restlos um ihn geschehen, aber um sie ja auch. Nie in meinem Leben habe ich ein so verliebtes und glückliches Paar gesehen wie diese beiden.
Direkt neidisch hat man werden können. Und nun, nach all den vielen glücklichen Jahren, solch ein Ende. Es ist einfach nicht zu fassen…«
Ehrlich erschüttert sagte Sophie Hartmann: »Das ist ja wirklich entsetzlich, und wenn es stimmt, das mit dem anderen Mann meine ich, dann ist die Gräfin ein schlechtes Frauenzimmer, das es nicht verdient, daß ein Mann wie unser Graf um sie weint. Gott, und was soll denn aus den Kindern werden?«
Die Frauen waren so in ihre ›Wenn‹ und ›Aber‹ vertieft, daß sie nicht merkten, wie Cary das Zimmer verließ. Diese ungeheuerliche Nachricht bedeutete ihr viel, sehr viel, aber wie sollte das wohl jemand ahnen, wo sie es sich selbst kaum eingestand?
Sie liebte Graf Harald, solange sie überhaupt denken konnte. Er war für sie der unerreichbare Held all ihrer Jungmädchenträume, und auch als sie älter wurde, lebte das Bild des Grafen in ihrem Herzen fort.
Cary war heute sechsundzwanzig Jahre alt und trotz ihrer aparten Schönheit immer noch nicht verheiratet. Es hatte ihr nicht etwa an Bewerbern gemangelt, o nein. Abgewiesen hatte sie alle, weil sich niemand mit dem Grafen messen konnte. Nein, das war falsch! Es hatte Männer in Carys Leben gegeben, die ebensogut, wenn nicht besser aussahen als der Graf, die alle guten Charaktereigenschaften besaßen und die zudem noch aus alten Adelsgeschlechtern stammten, sich aber nicht scheuten, Cary, das arme Waisenmädchen, um ihre Hand zu bitten.
Tatsache war, daß sie Graf Harald seit ihrer Kindheit liebte und ihn nie vergessen konnte. Cary wußte es, es war Wahnsinn, aber kann man seinem Herzen befehlen?
Sie erinnerte noch genau den Tag, an dem Graf Harald die Baronin Tanja heiratete. Von nah und fern war die weitverzweigte Familie der Ravensburg angereist. Fürsten, Herzöge und sogar ein König waren unter den Gästen gewesen.
Glück wirkt ansteckend, und alle Ravensburger vergaßen für einen Tag ihre Sorgen und waren glücklich mit ihrem Herrn. Nur die damals zwölfjährige Cary starrte mit brennenden Augen auf Gräfin Tanja, die schön wie Schneewittchen an der Seite ihres Märchenprinzen saß und einem Glück entgegenfuhr, von dem das kleine bürgerliche Waisenmädchen träumte, seit sie dem Grafen zum ersten Male begegnet war.
Ganz leise hatte sie sich davongeschlichen, und wie ein angeschossenes Wild hielt sie sich in der Klosterruine versteckt, bis dann sehr spät die fröhlichen Klänge der Hochzeitsfeier verstummten. Als das Feuerwerk wie bunte Sternschnuppen den nachtdunklen Himmel erhellte, um sich dann wie Träume in ein Nichts aufzulösen, hatte Cary ihr Versteck verlassen und war nach Hause gegangen, wo eine erregte, zornige Tante Sophie auf sie wartete. Als sie aber das verweinte, verquollene Gesicht ihrer Nichte gewahrte, hatte sie plötzlich verstehend innegehalten und Cary mit einem ungewohnt zärtlichen Gutenachtkuß ins Bett geschickt.
Vierzehn Jahre war das her…
*
Als Cary das Wohnzimmer wieder betrat, sah ihr Sophie Hartmann mit einem eigentümlich wissenden Blick entgegen, und wie unbeabsichtigt sagte sie, zu Amanda gewandt: »Der Graf wird sicherlich nicht lange allein bleiben, schon der Kinder wegen müßte er ja bald wieder heiraten. Na ja, die Ravensburger sind eine der angesehensten Familien des Landes, er kann an jede Tür klopfen und wird immer willkommen sein.«
»O ja«, bestätigte Amanda die Worte der Freundin, »doch ich glaube nicht, daß der Graf, wenn er wirklich geschieden wird, je wieder heiraten wird. Er liebt die Gräfin immer noch wie am ersten Tag, er wird nie eine andere Frau lieben können. Mein Jobst sagte erst heute noch zu mir: ›Ich habe große Angst um unseren Grafen. Wenn die Gräfin wirklich von ihm geht, dann wird er an dieser Liebe zerbrechen…‹«
Die Frauen schwiegen. Das Ticken der Wanduhr und das raschelnde Geräusch der zusammenfallenden Buchenscheite im Kamin waren die einzigen Laute im Raum.
Er wird an dieser Liebe zerbrechen… meinte Jobst, der den Grafen schon auf den Knien geschaukelt hatte und ihn wohl besser kannte als seine Eltern, die schon lange tot waren, aber er darf nicht daran zerbrechen, dachte Cary, die ihn immer noch liebte.
Laut aber sagte sie in das Schweigen hinein: »Onkel Jobst kennt den Grafen sicherlich sehr gut, und doch glaube ich nicht, daß Graf Harald so schwach ist. Wenn die Gräfin sich einem anderen Mann zugewandt hat, dann wird er sie bestimmt schnell vergessen…«
»Gott gebe es, daß du recht hast«, sagte Amanda leise. »Schon der Kinder wegen, die ihn abgöttisch lieben, darf er sich nicht in seinen Gram verrennen. Aber noch ist es ja nicht soweit«, meinte sie zuversichtlich. »Die Gräfin wird schon wieder zu ihm zurückfinden, sie hat ihn doch einmal sehr geliebt. Nun muß ich aber gehen, habe mich schon viel zu lange verschwatzt.«
Schon in der Tür drehte sie sich noch einmal um und sagte zu Cary: »Bleibst du länger hier?«
»Ja. Die Nelsons sind auf zehn Wochen nach Amerika gefahren…«
»Dann komm uns mal besuchen! Der Jobst wird sich wundern, was aus seiner kleinen Cary für eine Schönheit geworden ist…«
An diesem Abend stand Cary lange vor dem Spiegel. War sie wirklich schön?
Sie sah eine mittelgroße, schlanke, beinahe mädchenhafte Figur, mit, wie ihr schien, viel zu langen Beinen, die, genau wie ihre Arme, ruhig ein wenig voller sein durften.
Das Gesicht aber schien nur aus Augen und Mund zu bestehen. Beides war entschieden zu groß für ihren Geschmack. Wütend schnitt sie sich selbst eine Grimasse. Doch gerade als sie sich vom Spiegel abwenden wollte, hörte sie in Gedanken wieder Lord Humphreys Stimme: »Sie sind schön, Cary. Von einer eigenartig faszinierenden Schönheit.
Ihre Augen gleichen dem Himmel und dem Meer – mal grau verhangen, mal strahlend saphirblau. Ihre Haut ist so zart wie frischgefallener Schnee, und Ihre Lippen haben die satte Farbe der späten Rosen. Ihre Zähne gleichen kostbaren Perlen. Ihr Lächeln aber ist es, was einen nie wieder losläßt –, es ist so offen und doch geheimnisvoll, es verspricht alles und nichts. Man möchte immer gut zu Ihnen sein, nur um Sie lächeln zu sehen.«
Cary lächelte leise vor sich hin. Lord Humphrey war ein tüchtiger Gutsherr mit der Seele eines Romantikers. Schade, daß sie ihn nicht lieben konnte, er würde sicherlich ein wunderbarer Ehemann sein.
Ob Graf Harald sie wohl auch schön finden würde?
»Dumme Pute«, sagte sie laut zu sich selbst, »erstens wird er dich nie sehen, und wenn, wer bist du schon? Eine bürgerliche Waise, die das Glück hat, bei Lord Nelson als Erzieherin für seine Kinder angestellt zu sein und von Lady Nelson wie eine Freundin behandelt zu werden.
Nie, nie wird der Graf dich mit den Augen eines Mannes sehen, selbst dann nicht, wenn er Tanja wirklich je vergessen könnte.«
Beschämt, als hätte man sie auf unrechten Wegen ertappt, kroch sie im Dunkeln ins Bett.
*
»Mami, nimmst du uns heute mit nach Arcana?«
Gereizt sah Gräfin Tanja ihre Tochter an, die ihr äußerlich so sehr ähnelte, die aber sonst ganz das Wesen ihres Vaters hatte, und plötzlich ein wenig schuldbewußt, sagte sie: »Nein, Kind, das geht nicht. Ich habe sehr viel zu erledigen, und dabei kann ich euch wirklich nicht gebrauchen. Vielleicht klappt es ja das nächste Mal.«
Die Komteß gab sich mit dieser Antwort nicht zufrieden. Ruhig fragte sie: »Fährst du mit dem Baron von Speyer?«
»Und wenn, was geht es dich an?« sagte die Gräfin gefährlich leise.
Erika aber hatte keine Angst mehr vor der Mutter. Aufsässig gab sie zurück: »Ich glaube nicht, daß Papi sich freuen würde, wenn er wüßte, daß du jeden Tag mit dem Baron zusammen bist und für uns überhaupt keine Zeit mehr hast.«
Wütend warf die Gräfin die Haarbürste auf den Toilettentisch, so daß die Glasplatte klirrte, und herrisch fuhr sie das Mädchen an: »Wenn du dich weiterhin so unmöglich benimmst, mein Kind, dann werde ich dich in ein Internat stecken, wo man dir beibringt, wie man mit seiner Mutter zu sprechen hat.
Es ist ja unerhört, was ihr, du und dein Bruder, euch in letzter Zeit erlaubt. Der Baron ist ein guter Freund unseres Hauses. Ich weiß gar nicht, was ihr gegen ihn habt? Früher seid ihr doch gut miteinander ausgekommen.«
»Ja, früher«, sagte das Kind leise, »da waren wir auch alle noch glücklich. Papi war immer fröhlich, und ihr wart lieb zueinander, und für uns hattet ihr auch Zeit. Warum war Papi in letzter Zeit so anders, und warum ist er allein auf die Ravensburg gefahren?«
Gräfin Tanja sah die unerbittlich forschenden Augen ihrer Tochter, und sie wußte, daß Lügen keinen Zweck mehr hatten. Unerwartet sanft sagte sie daher: »Komm, Erika, du bist doch nun schon ein großes Mädchen, und ich will zu dir sprechen wie zu einer Freundin.