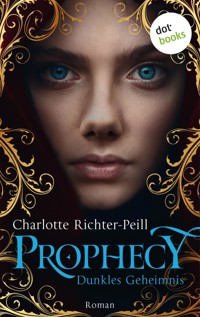Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Das Orakel von Farland
- Sprache: Deutsch
Das Böse lauert überall – auch in dir? Der dystopische Roman "Nordland" von Charlotte Richter-Peill jetzt als eBook bei dotbooks. Fenja hat es geschafft: Sie ist aus Elysium entkommen. Doch nun liegt Nordland vor ihr – ein gesetzloses Land, das von Gewalt und Misstrauen regiert wird. Auf der Flucht vor ihren Verfolgern hat Fenja nur einen Verbündeten: Merten, ihr ehemaliger Mentor, den sie lange als Feind betrachtet hat und der ihr nun, in dieser verzweifelten Lage, in einem völlig neuen Licht erscheint … Aber dann werden die beiden getrennt und Fenja ist plötzlich ganz auf sich allein gestellt. Um in Nordland zu überleben, muss sie untertauchen, Teil dieser grausamen Welt werden. Einer Welt, die auch ihre dunkelsten Seiten zu wecken droht … Jetzt als eBook kaufen und genießen: "Nordland" – Band 2 der dystopischen Trilogie "Das Orakel von Farland" von Charlotte Richter-Peill. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 469
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Fenja hat es geschafft: Sie ist aus Elysium entkommen. Doch nun liegt Nordland vor ihr – ein gesetzloses Land, das von Gewalt und Misstrauen regiert wird. Auf der Flucht vor ihren Verfolgern hat Fenja nur einen Verbündeten: Merten, ihr ehemaliger Mentor, den sie lange als Feind betrachtet hat und der ihr nun, in dieser verzweifelten Lage, in einem völlig neuen Licht erscheint … Aber dann werden die beiden getrennt und Fenja ist plötzlich ganz auf sich allein gestellt. Um in Nordland zu überleben, muss sie untertauchen, Teil dieser grausamen Welt werden. Einer Welt, die auch ihre dunkelsten Seiten zu wecken droht …
Über die Autorin:
Charlotte Richter-Peill, geboren 1969 in Nürnberg, entdeckte während ihres Studiums der Medizin, Tiermedizin und Germanistik ihre Liebe zum Schreiben. Für ihre Texte wurde sie bereits mehrfach ausgezeichnet. Heute lebt sie in der Nähe von Hamburg und genießt dort alles, was man für ein gutes Leben braucht: eine Steckdose fürs Notebook, viele Ideen, liebe Menschen, Pferde, Katzen und ein Kartoffelbeet.
Die Website der Autorin: www.charlotte-richter-peill.de
Charlotte Richter-Peills bei dotbooks erschienene Trilogie Das Orakel von Farland umfasst die folgenden Bände:
ElysiumNordlandEden
***
Originalausgabe Oktober 2016
Copyright © der Originalausgabe 2016 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Redaktion: Stefan Wendel
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock / Aleshyn_Andrei (Frau), macro-vectors (Orakel), YorkBerlin (Ruinen)
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH
ISBN 978-3-95824-785-7
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort Das Orakel von Farland an: [email protected]
Gerne informieren wir Sie über unsere aktuellen Neuerscheinungen und attraktiven Preisaktionen – melde Sie sich einfach für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter.html
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.twitter.com/dotbooks_verlag
instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Charlotte Richter-Peill
Das Orakel von FarlandNordland
Band 2
dotbooks.
Das Programm
In einer leeren Landschaft steht ein Baum. Von einem seiner Äste hängt ein Beutel voller Löcher. Aus den Löchern ragen Finger. Sie zucken schwach. »Fenja«, flüstert es aus dem Beutel. »Warum bist du gegangen? Komm zurück, hol uns raus …«
Ich schreckte aus dem Schlaf. Eingequetscht zwischen der Wand des Führerhauses und dem Gitter, das uns von den Schlachtpferden trennte, kauerte ich in einem Lkw. Meine Schulter brannte. Der Laster schlingerte, sprang über eine Bodenwelle. Ich prallte gegen Merten.
Entkommen. Aus dem Phönix-Kolleg und aus Elysium. Bisher war unsere Flucht ohne Probleme verlaufen. Die Fahrt zur Grenze, der desinteressierte Blick der Wachleute in den Laderaum, Merten und ich, zusammengekrümmt in unserem Versteck, der Ruck, mit dem sich der Transporter wieder in Bewegung gesetzt hatte, weiter, durch die Stille, das Stück Niemandsland, das Farland von Nordland trennte, dann Nordlands Grenze, an der es statt eines Kontrollpostens nur die Ruinen längst verlassener Wachtürme gab.
Wir hatten es geschafft.
Ohne ein Fenster, durch das ich hätte hinausblicken können, fehlte mir jedes Gefühl dafür, in welche Richtung oder wie schnell und weit wir fuhren. Ich horchte auf die Musik, die durch die Wand des Führerhauses drang, auf die wummernden Bässe. Irgendwann bremste der Laster, rumpelte um eine Kurve, fuhr noch ein Stück, hielt. Die Tür des Führerhauses wurde geöffnet und wieder zugeschlagen. Motorenlärm, der Gestank von Benzin.
»Dürfte eine Tankstelle sein. Dann mal los.« Merten kletterte über das Trenngitter. Benommen rappelte ich mich auf. Als er mir hinüberhalf, schoss ein scharfer Schmerz durch meine Schulter. Ich biss die Zähne zusammen. Unruhig warfen die Pferde die Köpfe hoch und drängten auf uns zu. Merten wich zurück. Ich legte meine Hand an die Kruppe eines ausgemergelten Rappen, schob ihn behutsam zur Seite und nickte Merten zu: Komm. Er deutete auf eine Luke in der Seitenwand. Wieder nickte ich, zwängte mich an zwei weiteren Pferden vorbei. Merten folgte mir. Mit vereinten Kräften gelang es uns, die Luke zu entriegeln. Wir kletterten hinaus. Meine Schulter brannte höllisch.
Menschen waren keine zu sehen, aber hinter den Zapfsäulen pulsierte in der Dunkelheit die Neonbeleuchtung eines Imbisslokals. Verkehrslärm rauschte – eine Autobahn? Meine Arme und Beine waren steif vom langen Kauern hinter dem Gitter. Eine Windbö peitschte mir Sand in die Augen. Der Krach, das grelle Blinken, die gigantischen Lkws – ich stand wie gelähmt, starrte nur. Das Wellblechdach über den Zapfsäulen hing halb herunter, ringsum türmten sich Berge aus geplatzten Plastiksäcken, aus denen sich Abfallströme ergossen. Ein bestialischer Gestank hing in der Luft. Und es war kalt. Schrecklich kalt.
Merten schob mich zwischen zwei Lastwagen. Benommen schüttelte ich den Kopf. »Nein, Merten, warte. Die Pferde, wir müssen die Rampe runterlassen.«
Er sah mich an, als hätte ich mich gerade vor seinen Augen in etwas völlig Absurdes verwandelt, einen Kartoffelkäfer zum Beispiel.
»Das sind Schlachtpferde, Merten, wir müssen …«
»Keine Zeit für Sentimentalitäten.« Er nahm mich am Arm und zog mich mit.
»Wir müssen doch nur die Rampe öffnen!«
»Und dann«, er wies mit dem Kopf zu dem Imbisslokal, Musik dröhnte aus einer halboffenen Tür, »haben wir in zwei Sekunden die Meute am Hals. Los jetzt!«
Ich wollte widersprechen, doch er zerrte mich vorwärts, zwischen den Lkws hindurch, über einen Asphaltplatz voller Container, aus denen noch mehr Müllsäcke quollen. Es sah aus, als hätte man hier die Abfälle der ganzen Welt entsorgt. Weiter, um einen Transporter herum, auf dessen Ladefläche eine Art Wohncontainer stand – dem Gestank nach eine fahrbare Toilettenanlage. Als wir an der Stiege vorbeistolperten, die dort hinaufführte, knarzte eine Stimme: »Schönen guten Abend auch!«
Neben der Treppe saß ein Mann im dünnen Mantel, so bequem gegen zwei Müllsäcke gelehnt, als habe er es sich auf einem Sofa gemütlich gemacht. Vor ihm standen ein Putzeimer, aus dem eine Klobürste ragte, und eine Schale mit ein paar Münzen. Das Lächeln des Mannes offenbarte mehr Lücken als Zähne. »Blase voll? Kein Problem. Desinfektionsmittel kostet extra …« Seine Augen verengten sich zu Schlitzen. »He«, flüsterte er.
Ich wich einen Schritt zurück.
Der Mann starrte auf unsere Kittel. Grün. Die Farbe der FIP. Leicht zu erkennen, auch in Nordland. Ächzend versuchte er, sich von seinem Sitzplatz hochzustemmen. »Lorena!«, brüllte er in Richtung Imbisslokal. »Kappi, Felten, schnell! Lorena!«
Merten machte einen Schritt nach vorn und trat ihm gegen die Schläfe. Es machte »Pock«. Wie ein Sack kippte der Mann zur Seite. Mein Herz hämmerte gegen meine Rippen. »Merten«, flüsterte ich entsetzt.
Still lag der Mann da, die Augen geschlossen, ein Blutfaden rann aus seinem linken Nasenloch. Seine Hand zuckte über den Boden wie eine Spinne. Etwas riss in meinem Kopf, und ich ging mit fliegenden Fäusten auf Merten los, schlug auf alles ein, was ich von ihm erwischte. Er schlang die Arme um mich und hob mich hoch.
»Lass mich …«
Eine Hand verschloss mir den Mund. Ohne lange zu fackeln, trug Merten mich zu dem Wald hinter der Tankstelle. Obwohl es durch dichtes Unterholz ging, verlangsamte er sein Tempo kaum. Erst als wir ein gutes Stück in dem Gehölz waren, setzte er mich ab. Der Wind riss mir die Tränen von den Wimpern. »Du hast ihn umgebracht!«
»Vielleicht.« Merten packte mein Handgelenk und zog mich weiter. »Vielleicht auch nicht.«
Ich wehrte mich gegen seinen Griff. »Warum hast du das getan?«, schrie ich.
Merten blieb stehen. Seine Worte klangen kalt wie Eis. »Hör zu. Spiel meinetwegen die Tierschützerin und Menschenretterin, aber lass mich damit in Ruhe. Ich habe es getan, weil wir FIP sind, verdammt!«
Erst dachte ich, er wollte damit sagen, dass es in uns steckte. Das Grausame, Brutale. Dann ging mir auf, was er wirklich meinte. Der Mann hatte erkannt, wer wir waren: zwei FIP auf der Flucht.
»Genau«, knurrte Merten, als hätte er meine Gedanken erraten. »Farland zahlt jedem eine fette Belohnung, der Flüchtlinge aus Elysium schnappt.« Er lachte bitter. »Unser Staat gibt niemanden auf. Schon gar nicht die, die für Eden reserviert sind.« Er stapfte ein Stück tiefer in den Wald. Nach ein paar Schritten drehte er sich um. »Was ist?«
Ich gehe allein weiter, das ist. Einfach in eine andere Richtung. Weg von dir.
Aber mir fehlte der Mut.
Die Kälte sang in den Zweigen. Doch die Kälte, die ich spürte, kam von einem anderen Ort. Der Ort war in mir. Merten hatte zugetreten. Ohne zu zögern. Weil er eine FIP war? Existierte er wirklich, dieser dunkle Kern in uns, das defekte Teil, das wie eine Zeitbombe in uns tickte, diese Funktionsstörung im Getriebe der Seele?
Mit gesenktem Kopf stolperte ich Merten nach. FIP. FörderungsIntensive Person. Hätte auch ich den Mann zu Boden treten können, hätte ich das geschafft? Gab es so etwas … Finsteres in mir, so einen dunklen Zwilling? Um das zu erfahren, müsste ich mich häuten, müsste die Hülle ablegen, die mich wie ein schützender Kokon umgab. Und dann, was würde sich zeigen? Ein Schmetterling oder eine hässliche Raupe? Wer war ich?
Ein Leben lang: helle, hübsche, fröhliche Fenja, Tochter, Schwester, Freundin, Geliebte.
Alles eine Lüge. Alles nicht wahr. Nicht mehr wahr.
Doch ich hätte den Mann nicht zu Boden getreten. Vielleicht war ich kein besonders guter Mensch, aber ein so schlechter Mensch war ich auch nicht. Ich würde den dunklen Zwilling in mir nicht gewinnen lassen. Nie, niemals würde ich mich in eine Fenja verwandeln, die zutrat und ein Menschenleben auslöschte.
Weiter, neben Merten her durch die Nacht, anfangs strauchelnd und stolpernd, bis meine Augen sich an die Finsternis gewöhnt hatten. Meine Schulter brannte noch immer, doch ich ignorierte den Schmerz, so gut es ging.
Irgendwann blieb Merten stehen.
»Was?«, fragte ich.
»Wir müssen nach Norden.«
»Und?«
»Ich bin nicht sicher, ob wir nach Norden gehen.«
Ich deutete in die Dunkelheit. »Da lang.«
Er sah mich an. »Woher weißt du das?«
Ich wies nach oben, durch die Äste, in den mit Sternen übersäten Himmel. »Der Polarstern.«
Während zahlloser Wanderritte und Campingtouren mit Chiara und Rasmus war es mir so selbstverständlich geworden, mich an den Sternen, dem Sonnenstand oder dem Moos an den Bäumen zu orientieren, dass ich nicht gleich begriff, warum Merten mich verwundert anstarrte. »Okay«, sagte er schließlich.
»Und was ist im Norden?«, fragte ich, während wir weitergingen.
»Die Grenze von Estilien.«
»Wie weit?«
»500 Kilometer, mehr oder weniger.« Er zögerte. »Es gibt einen Grenzübergang. Einen geheimen Grenzübergang. Wo genau, weiß ich nicht. Wir werden uns umhören müssen.«
Das war sicher leicht. Zwei entflohene FIP hörten sich um. Kein Problem.
In der nächsten Stunde legten wir immer wieder einen Dauerlauf ein, um schneller voranzukommen. Als ich um eine Pause bat, lehnte Merten ab. »Wir müssen aus dem Grenzgebiet raus. Hier suchen uns die Hüter zuerst.«
»Aber die brauchen doch von Nordland eine … ich weiß nicht, eine Genehmigung oder so. Bevor sie hier Jagd auf uns machen dürfen.«
Er lachte bitter. »Und wer soll ihnen diese Genehmigung erteilen?«
»Ich weiß nicht. Die Regierung?«
»Nordland hat keine Regierung mehr, Fenja.«
Ich versuchte, meinen Kopf zur Ruhe zu bringen, was nicht besonders gut funktionierte. Entweder dachte ich an die Hüter oder an den Mann im dünnen Mantel, zusammengerollt auf der Seite, die Knie angezogen, die über den Boden tastende Hand. Das Bild ließ sich nicht abschütteln, winzige Details kamen hinzu, die dunkelgraue Hose, die Kopfhaut schimmerte durch das spärliche Haar, die Stoppeln am Kinn, das Fädchen Blut …
Ich wollte, jemand wäre bei mir. Jemand anderes als Merten.
Rasmus.
Rasmus, der jetzt wieder zu Hause war und meinen Eltern erzählte, was er am Phönix-Kolleg erlebt hatte. Ob er anschließend zu Chiara ging? Ob sie ihn in die Arme nahm, ihn tröstete, wie ich ihn nicht mehr trösten konnte? Während der letzten sechs Monate hatte ein Teil von mir so getan, als wäre ich nur für eine Weile fort; als würde ich nach einem Jahr zurückkehren und Rasmus mich auf der Veranda erwarten, mich anlächeln und mir das Haar aus der Stirn streichen, mit einer Fingerspitze die Stelle zwischen meinen Augenbrauen berühren, wie er es so oft getan hatte.
Rasmus, endlich wieder bei dir, du gibst mir einen Kuss, bringst mir ein Glas Saft, wir sitzen auf der Veranda, und danach reiten wir in die Hügel, zu unserem Ort und –
Und das würde nie mehr geschehen.
Denk nicht mehr daran.
In der Ferne hörte ich ein Heulen. Meine Schritte stockten.
»Wölfe«, sagte Merten. »Oder wilde Hunde.«
Dem Heulen folgte eine Stille, die alles andere als beruhigend wirkte. Zweige brachen unter meinen Füßen. Etwas huschte vor mir durchs Laub. Ich schrie auf und sprang zurück.
»Nur eine Maus, Fenja«, sagte Merten.
Ich krächzte etwas, das ein »Ja, klar, alles gut« sein sollte, und merkte, dass ich einen völlig trockenen Mund hatte.
Merten legte mir eine Hand auf den Arm. »Bist du okay?«
»Sicher«, brachte ich heraus, »mir geht’s gut.«
Er betrachtete mich prüfend. »Möchtest du dich ausruhen?«
»Nein.«
»Dann weiter.«
Es hatte eine Zeit gegeben, in der ich in Wäldern übernachtet hatte. Mit Freunden, mit Leane und Bertil, mit Rasmus. Ich hatte gedacht, Wälder im Dunkeln zu kennen. Solange ich zurückdenken konnte, hatte ich geglaubt, die Natur sei mir freundlich gesonnen. Das Rascheln des Laubs, der Wind über dem Weiher, das Plätschern des Bachs hinter unserem Gut, das geschäftige Zwitschern der Schwalben – ich hatte mir sogar eingebildet, sie würde mit mir sprechen. Ich hatte ein bestimmtes Bild von mir und der Natur im Kopf gehabt: Sie war schön, manchmal wild, aber immer ein Teil von mir. Niemals würde sie mich bedrohen. Als die Nacht jetzt vor meinen Augen verschwamm, begriff ich, dass ich jeden Moment losweinen würde. Ich fühlte mich bedroht, erschöpft, am Ende, als hätte ich eine Woche, einen ganzen Monat nicht geschlafen. Mit aller Kraft stemmte ich mich gegen diese Schwäche, gegen die Angst. Durchhalten. Alles andere zählte nicht.
Merten war wieder stehen geblieben. »Wirklich keine Pause?«
Ich schüttelte den Kopf. »Kannst du mir was erzählen, Merten? Bitte.«
»Was willst du denn hören?«
»Irgendwas.« Ich überlegte. »Nein. Nicht irgendwas. Du hattest einen Bruder, ja?«
Er berührte sacht meinen Handrücken. »Das ist jetzt kein gutes Thema, glaube ich.« Er zögerte. »Oder doch. Vielleicht doch.«
Während wir unseren Weg durch den Wald fortsetzten, begann er.
»Mein Bruder musste auch nach Elysium gehen. Aber das weißt du wahrscheinlich. Finn. Er hieß Finn.«
Seine Stimme veränderte sich, als er diesen Namen sagte, wurde ein Nebelfaden, der sich gerade noch zwischen den Bäumen hält, bevor der nächste Wind ihn mit sich nimmt. Finn. Ich dachte an meinen ersten Arbeitstag in Elysium, den Einsatz in der Zentralen Versorgungsstelle. Siri hatte diesen Finn erwähnt, war aber nicht weiter ins Detail gegangen. Wann hatte Merten zum letzten Mal seinen Namen ausgesprochen, wann zum letzten Mal über ihn gesprochen? Hatte er es überhaupt je getan?
»Er war vier Jahre jünger als ich, und er war der Grund, weshalb ich Mentor wurde«, sagte er leise. »Weil ich ihn beschützen wollte.«
»Dann wusstest du, dass er nach Elysium kommt?«
»Das Orakel hatte mich ausgemustert. Was sollte ich wohl glauben, was meinem Bruder blüht?« Er zuckte die Schultern. »Ja, ich hielt es für mehr als wahrscheinlich, dass wir uns in Elysium wiedersehen.«
Leane. Der Name meiner Schwester zuckte wie ein Blitz durch meinen Kopf: Schickt das Orakel dich auch nach Elysium? Wer kümmert sich dort um dich?
»Meine Eltern waren nie übermäßig besorgt um uns.« Ich glaubte, einen Hauch Bitterkeit in Mertens Stimme zu hören. »Die Warnsignale, die es gab, fanden sie wohl nicht weiter beunruhigend. Vielleicht hofften sie auch, die Probleme würden sich von selbst lösen.«
»Welche Probleme?«
»Das erzähle ich dir ein andermal.«
»Okay.«
Ich hörte ein Lächeln in seiner Stimme. »Eines verrate ich dir jetzt schon. Ein kleines. Die Sache mit den Gräbern.«
»Bitte?«
»Ich war damals fünf Jahre alt und klaute anderen Kindern … Dinge. Plüschaffen. Armbanduhren. Spielzeugautos. Ich wollte diese Dinge einfach haben. Ich vergrub sie in unserem Garten. Irgendwann buddelte ich sie wieder aus. Es war schön, sie anzuschauen. Wie sie aussahen, nachdem sie lange genug in der Erde gelegen hatten.«
»Ein seltsames Hobby«, sagte ich befremdet.
Er zuckte die Schultern. Nach einer Weile fuhr er fort: »Meine Eltern hätten mir jedes Coachingprogramm finanziert. Prozentoptimierung für den Tag des Orakels. Aber sie gingen wohl davon aus, dass es gut für mich laufen würde. Das tun die meisten Eltern, denke ich. Als ich dann in meinem Zimmer im Phönix-Kolleg saß und allmählich kapierte, wie es wirklich war, bekam ich es mit der Angst. Nicht meinetwegen. Wegen Finn. Er würde das hier nicht durchhalten. Anfangs habe ich es ja selbst kaum gepackt. Aber ich war entschlossen, aus Elysium rauszukommen. Ich folgte dem Programm, gehorchte den Befehlen, widersprach nie. Ich war ein Musterschüler. Sogar als Auge gab ich mich her. Ich spionierte die anderen FIP aus, schwärzte sie an, wo ich nur konnte – ich war ein richtiges Arschloch. Genützt hat es mir nichts: Dreimal fiel ich durch die Nachprüfung. Inzwischen war ich zwar Schichtleiter in der Zentralen Versorgungsstelle, aber raus kam ich trotzdem nicht. Immerhin, die Mentoren und die Direktorin waren auf mich aufmerksam geworden. Ich hatte bewiesen, dass ich dem Programm noch im Kleinsten folgte. Sie fanden mich ›vertrauenswürdig‹, meinten, ich besäße das, was man ›Führungsqualitäten‹ nennt. Und als sie mir einen Job als Mentor anboten, griff ich zu. Auf diese Weise hätte ich zumindest eine Chance, mich um meinen Bruder zu kümmern, sollte das Orakel ihn ausmustern. Das dachte ich jedenfalls. Kurz darauf traf Finn tatsächlich auf dem Kolleg ein. Und was passierte? Sie teilten ihn einem anderen Team zu. Auf so etwas achten sie. Ich half ihm trotzdem, so gut ich konnte. Aber das reichte nicht. Ein paar Monate nach seiner Ankunft in Elysium überstellten sie ihn nach Eden. Aus demselben Grund wie Orlando. Pulsadern aufgeschnitten.«
Ein eisiges Prickeln breitete sich von meinem Nacken über meinen ganzen Körper aus. Er sah mich von der Seite an. Ich erwiderte den Blick. Seine Augäpfel glitzerten im Dunkeln.
»Du hast mich an mich selbst erinnert, Fenja, weißt du das? Wie ich damals war. Wie ich für Finn gekämpft, ihm Medikamente besorgt, wie ich versucht habe, ihn vor den anderen zu schützen. Du hast dasselbe für Orlando getan. Nur war da auch diese andere Seite von dir.«
»Welche andere Seite?«, flüsterte ich.
»Die Fenja, die unbedingt nach Hause wollte. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Ich habe so viel in dir gesehen. Aber du wolltest nur heim. Als hättest du nichts begriffen.«
Ich war mir nicht sicher, ob sich das inzwischen geändert hatte.
»Was passierte mit Finn?«, fragte ich.
»In Eden hat er es dann durchgezogen. Drei Wochen, nachdem sie ihn eingewiesen hatten, erhängte er sich.« Merten schloss die Augen, öffnete sie aber gleich wieder. »Er hat mir alles bedeutet. Ich vermisse ihn. Ich vermisse ihn so sehr, dass ich …« Er brach ab.
Vorsichtig berührte ich seine Hand. »Es tut mir so leid«, sagte ich leise.
Merten nickte stumm. Als er wieder sprechen konnte, klang seine Stimme gebrochen. »Ich hatte Elysium hingenommen. Ich hatte akzeptiert, dass es … kompatible Menschen gibt und solche, um die man sich kümmern muss. Ich gehorchte dem Programm, passte mich an, marschierte mit, scheffelte Punkte und hoffte, es würde mir helfen. Und meinem Bruder. Dann starb Finn – und in meinem Kopf begann sich etwas zu verschieben. Langsam drang zu mir durch, wie grausam das alles war. Wie gnadenlos der Umgang mit denen, die …« Er suchte nach Worten.
»Die eine Behandlung brauchen«, sagte ich leise.
Er nickte. »Leute, in denen zu viel negative Energie fließt, wie sie es nennen. Leute, die zu viele negative Gedanken haben. Gefährlich. Nichtsnutzig. Machen Ärger. Leisten keinen Beitrag.« Er lachte bitter. »Mein Bruder war der sanftmütigste Mensch, den du dir vorstellen kannst. Aber er war weich. Wenig belastbar. Ohne Schutzhaut. Das war sein Problem.«
»Wie Orlando.«
»Ja. Es trifft nicht nur die potenziellen Straftäter. Es trifft auch die, deren Seelenkostüm nicht so glatt und faltenfrei genäht ist, wie es die heutige Mode wünscht.«
»Und du, Merten?«, fragte ich nach einem langen Schweigen. »Warum hat das Orakel dich ausgemustert?«
»Tja. Warum? Die Frage kann ich zurückgeben. Was ist mit dir? Weißt du, wo dein Fehler liegt?«
»Nein.«
»Genau. Mag sein, dass es bei manchen Menschen klare Pathologien gibt. Eindeutige Persönlichkeitsdefizite. Viel häufiger ist das andere, das wir so schwer einordnen können.« Er seufzte. »Und nicht jeder akzeptiert, dass dieses Dunkle oder Böse oder Schwache, oder wie immer du es nennen willst, eine Grundkonstante des Lebens ist. Dass es dazugehört.«
»Die, die es nicht akzeptieren – haben sie das Phönix-Programm entwickelt?«
»Ach ja.« Merten lächelte zynisch. »Das Programm. Eine feine Sache. Sie haben lange daran gefeilt. Manchen Menschen hilft es sogar. Ist es damit gerechtfertigt? Legitimiert es Elysium?«
»Wahrscheinlich nicht.«
Wieder verfolgten wir schweigend unseren Weg.
»Wie ging es weiter?«, fragte ich nach einer Weile. »Nachdem du deinen Bruder verloren hattest.«
»Ich wollte etwas gegen Elysium tun. Und gegen das Orakel. Und falls ein Widerstand existierte, nun, dann wollte ich mich diesem Widerstand anschließen.«
Ich fragte mich, ob Widerstand dasselbe bedeutete wie die Guten. Wahrscheinlich etwas Ähnliches.
»Es gab Gerüchte über eine Gruppe«, fuhr Merten fort, »aber ich konnte nichts Genaues in Erfahrung bringen.«
»Warum bist du dann in Elysium geblieben? Du bist dreimal durch die Nachprüfung gefallen, du hättest nach Nordland ausreisen dürfen. Dort hättest du vielleicht mehr über den Widerstand herausgefunden.«
»Da gibt’s nur ein Problem. Als Mentor verpflichtest du dich auf fünf Jahre Dienst am Phönix-Kolleg.«
»Und du hast nie an Flucht gedacht?«
»Und ob ich an Flucht dachte. Aber …«
»Merten?«, unterbrach ich ihn. »Etwas kapiere ich nicht. Keiner von euch Mentoren hat die Nachprüfung bestanden. Ich meine – ihr wärt doch nicht freiwillig in Elysium geblieben, um dort als Mentor zu arbeiten. Wenn ihr bestanden hättet, wärt ihr doch nach Hause zurückgekehrt.«
»Das kannst du mir glauben.«
»Und ausgerechnet ihr sollt uns beibringen, wie man die Nachprüfung schafft? Das ist doch irgendwie nicht logisch.«
Er lächelte. »Doch. Es ist vollkommen logisch. Wenn man das Programm wirklich versteht. Dazu komme ich noch. Aber erst mal zum Widerstand.«
Er bog einen Ast zur Seite. Wir schlüpften durch die Lücke. Laub und Zweige raschelten unter unseren Füßen.
»Einige Wochen nach Finns Tod sprach mich jemand an. Jemand, der vom Widerstand wusste. Der selbst ein Teil davon war.«
»Wer?«
Er zögerte.
»Wer, Merten?«, fragte ich eindringlich.
»Jeff. Jeff Strecker.«
»Jeff?«
Merten lächelte. »Wir sollten ein Buch nie nach seinem Einband beurteilen.«
Und in diesem Augenblick erinnerte ich mich an ein Gespräch, das ich viele Monate zuvor belauscht hatte – und das nun einen ganz neuen Sinn ergab.
Schutzprogramm für das Computersystem … Sicherheitsleck … bevor der Widerstand weitere Informationen abgreift …
»Jeff ist Teil einer Organisation, die im Geheimen arbeitet und die das Orakel vernichten will – Männer und Frauen, die ursprünglich aus Farland kommen und die in Estilien abgetaucht sind. Soweit Jeff weiß, gibt es auch Leute aus Estilien selbst, die für den Widerstand arbeiten.«
In meinem Kopf drehte sich alles. Es gab sie. Menschen, die gegen das Orakel kämpften. Wie Orlando es gesagt hatte.
»Nachdem Jeff mich eingeweiht hatte, begann ich …« Abrupt blieb er stehen und legte eine Hand auf meine verletzte Schulter.
»Finger weg«, stöhnte ich.
»Mund halten«, hauchte er.
Motorenlärm. Weit entfernt, doch deutlich zu hören. Das Knacken und Krachen von Zweigen und Ästen. Irgendwo brach ein Fahrzeug durch den Wald. Merten straffte sich. »Okay. Die Jagd hat begonnen.«
Er zog mich mit. Wir stolperten, liefen, rannten zwischen den Bäumen hindurch. So schnell wir konnten. Nicht schnell genug. Das Fahrzeug näherte sich unerbittlich, wir sahen bereits seine Scheinwerfer aufblitzen.
»Wir müssen tiefer ins Unterholz. Wenn wir Glück haben, kommen sie nicht durch.« Merten blickte sich um. »Da hoch!«
Einen Hang hinauf, einen anderen hinunter, nach links, nach rechts, mittendurch, kreuz und quer, durch ein Bachbett, ein weiterer Hang … Inzwischen hatte ich völlig die Orientierung verloren. Norden war das jedenfalls nicht mehr. Wir krochen durch Dornendickichte, kletterten über umgestürzte Bäume, kämpften uns durch Vorhänge aus ekligen Flechten, die über unsere Gesichter streiften. Als wir endlich stehen blieben, war ich zerkratzt, mit Dreck beschmiert, in Schweiß gebadet und völlig am Ende. Merten drehte den Kopf in alle Richtungen. Auch ich lauschte. Da war nur das Keuchen unseres Atems.
Entweder sie hatten abgedreht. Oder sie machten zu Fuß weiter.
Und wieder durchs Gestrüpp. Stolpern, straucheln, hinfallen, aufrappeln, laufen, laufen … bis ich sie hörte. Stimmen. Gelächter.
Merten zog mich vorwärts. Während er wie eine Katze durch die Dunkelheit glitt, knackten unter meinen Füßen Zweige, stolperte ich über Wurzeln, trat Steine los.
»Fenja«, flüsterte Merten, »bitte, nicht so laut.«
»Tut mir leid«, flüsterte ich zurück. Mit einem Krachen brach der nächste Ast. Und sie kamen näher. Jetzt konnte ich Männer- und Frauenstimmen unterscheiden. Weiter, weiter, meine Beine wie Butter, ich strauchelte, fiel auf die Nase, wollte aufstehen, schaffte es nicht. Merten zog mich hoch, schleifte mich mit, watete mit mir durch einen Bach, schlidderte einen Hang hinunter.
Die Gegend wurde immer unwegsamer. Mehrmals rutschte ich auf Felsen aus, die sich unter dem Laub vom Vorjahr verbargen. Ich behinderte Merten, aber unsere Verfolger schienen auch nicht gerade schnell zu sein. Ihre Stimmen blieben zurück, hielten sich aber doch in Hörweite. Jemand hustete. Eine Frau lachte. Und es wurde heller. Der Morgen brach an.
Wir brauchten dringend ein Versteck. Während wir an einem weiteren Bach entlangliefen, der sich in ein Flüsschen und bald in einen schäumenden Fluss verwandelte, suchte Mertens Blick unablässig die zerklüftete Umgebung ab. Hier und da bildeten die Felsen Höhlen, die aber alle zu hoch lagen. Schließlich peilte Merten eine Spalte etwa zehn Meter oberhalb des Flusses an. Halb kletterten, halb krochen wir hinauf. Kein besonders gutes Versteck, aber uns blieb keine Wahl, die Sonne ging auf. Hintereinander zwängten wir uns in die Höhle, die kaum mehr als eine Felsnische war und nach wenigen Metern so schmal wurde, dass wir nicht weiterkamen. Wir ließen uns auf den Boden fallen, auf eine Schicht aus altem Laub. Der Fels strahlte eine eisige Kälte ab, doch wenigstens waren wir vor dem Wind geschützt – und hoffentlich vor unseren Verfolgern.
Draußen war nichts zu hören als das Rauschen des Wassers. Wir saßen so nah beieinander, dass Mertens Oberschenkel gegen meinen drückte. Er hatte den Kopf zum Höhleneingang gedreht und lauschte. Äußerlich wirkte er ruhig, doch ich spürte sein Bein an meinem zittern.
»Scheint so, als hätten sie unsere Spur verloren«, sagte er leise.
»Da kennst du die Hüter schlecht.«
Er wandte mir das Gesicht zu und lächelte schwach. »Du kennst sie schlecht. Die Hüter würden uns lautlos einkreisen, statt solchen Krach zu schlagen. Ich schätze, der Klomann hat ein paar Helfer zusammengetrommelt. Flüchtlinge aus Elysium sind immer eine fette Beute.« Er lehnte sich gegen den Fels und schloss die Augen. »Offenbar hab ich den Typ doch nicht umgebracht, oder? Der Klomann lebt. Das ist doch was.«
Auf einmal war ich mir da nicht mehr so sicher.
Und dann hörten wir die Stimmen wieder, durch das Brausen des Flusses, viel näher als zuvor. Merten legte einen Arm um mich und zog mich tiefer in den Spalt. Eng aneinandergedrückt warteten wir. Ich wagte kaum zu atmen. Meine Hand tastete in meine Hosentasche und schloss sich um das kleine Pferd aus Ton, Bertils Talisman, mein Glücksbringer, der wie durch ein Wunder die Flucht überstanden hatte.
Die Flucht. Unsere Flucht. War sie zu Ende?
Das darf nicht, darf nicht, darf nicht …
Die Stimmen, so nah, dass ich einzelne Worte verstehen konnte.
» … Schwachsinn … hätten Hunde mitbringen … auf keinen Fall … Norden …«
Das Rauschen des Wassers. Schritte. Ein Schatten strich über den Höhleneingang. Meine Finger umkrallten das Pferdchen. Mit einem Knacks brach ein Bein ab.
» … Fluss … weiter … zurück zum Wagen …«
Mein Herz hämmerte gegen meine Rippen. Die Stimmen wurden leiser, immer leiser.
Weg. Der Fluss rauschte. Eine Krähe krächzte. Wir rührten uns nicht.
Viel später flüsterte Merten: »Geschafft.«
Er ließ mich los. Mir kam es vor, als holte ich zum ersten Mal wieder Luft. Würden sie zurückkommen, die Gegend noch einmal gründlich durchkämmen, uns finden? Ich blickte zum Eingang der Höhle, in den Wald dahinter. »Sollen wir …?«
Er schüttelte den Kopf. »Solange es hell ist, sind wir hier sicherer.« Und dann, nach einer Pause: »Du hast mich noch gar nicht gefragt, warum sie mich nach Eden schicken wollten.«
Er sagte das nur, um mich abzulenken, doch ich war ihm dankbar dafür, und wissen wollte ich es ja wirklich.
»Okay. Warum?«
»Du erinnerst dich an das Sicherheitsleck im Zentralcomputer? Das war ich. Ich bin in ihr verdammtes System eingedrungen.«
»Und dafür landet man in Eden?«
»Hochverrat ist immer ein guter Grund. Ich wollte Informationen für den Widerstand beschaffen, Material über Elysium, Eden, alles, was uns im Kampf gegen das Orakel helfen konnte. Klar, anfangs hatten Jeff und ich weit größere Pläne. Spektakuläre Pläne. FIP, die für Eden vorgesehen waren, aus Elysium rausschleusen zum Beispiel. Aber gleich die erste Aktion lief komplett aus dem Ruder.«
»Der Mülltransport«, sagte ich leise. »Nuja.«
Überrascht blickte er mich an.
»Ich hab sie in Eden getroffen. Ich kannte sie von früher.«
Er nickte langsam. »Das war eine schlimme Geschichte. Zwei Tote. Weil Jeff und ich unbedingt etwas tun wollten. Danach haben wir stillgehalten. Sogar dann noch, als Romilda und Orlando eingewiesen wurden. Um wenigstens etwas in Angriff zu nehmen, hab ich mich ein wenig um das Computersystem des Kollegs gekümmert.«
»Und?«
»Ich habe nichts gefunden, was uns in Bezug auf das Orakel weiterhalf. Aber ich konnte einige hochinteressante Geheimdokumente entschlüsseln.« Er hielt inne, schaute, ob ich folgen konnte. »Wie funktioniert das Phönix-Programm, Fenja?«
Was sollte diese Frage?
»Wie funktioniert es?«, wiederholte er.
Ich zuckte die Schultern. »Wer dem Programm gehorcht und Punkte scheffelt, hat die besten Chancen, die Nachprüfung zu bestehen.«
»Ja. Genau das bringen wir euch bei. Und wofür kassiert ihr die Punkte?«
Ich zuckte wieder die Schultern. »Arbeiten.«
»Und?«
»Noch mehr arbeiten.«
»Hirn ausschalten. Mitmarschieren. Andere verraten, anschwärzen, aus dem Weg treten, fertigmachen. Das Programm belohnt deine Schattenseiten.« Er atmete tief ein. »Was wäre, wenn genau darin die Prüfung besteht?«
»Wie meinst du das?«
»Was ich dir jetzt erzähle, ist die ganze Wahrheit über das Phönix-Programm. Die Wahrheit, wie nicht einmal wir Mentoren sie kennen. Aber ich habe diese Dokumente selbst gelesen. Ich weiß jetzt, was wirklich hinter dem Programm steckt.« Seine Augen funkelten, in der Dunkelheit wirkten seine Augäpfel sehr weiß. »Die Entwickler des Programms vertreten eine Theorie. Nach dieser Theorie ist es in einem angenehmen Umfeld leicht, im Sinne der Moral von Farland zu handeln, ohne wirklich moralisch zu denken und zu fühlen. Also verpflanzen sie euch in eine Umgebung, die eure Schattenseiten stärkt und belohnt und euch vorgaukelt, das Falsche sei richtig. Sie testen, wer sich für ein paar Scheißprivilegien in die Finsternis stürzt. Sie prüfen, ob du wirklich durch und durch eine FIP bist oder ob noch etwas anderes in dir steckt. Wer folgt seiner dunklen Seite – und wer entscheidet sich gegen alle Widerstände für etwas anderes?«
In meinem Kopf begann sich ein Karussell zu drehen. »Aber … das ergibt doch keinen Sinn.«
»Und ob es einen Sinn ergibt. Es ist die härteste Prüfung von allen. Sich dem Schatten verweigern, wenn dich alle auffordern, mit dem Schatten zu tanzen. Wer von euch kooperiert mit dem Programm, gehorcht, sammelt Punkte, verweigert anderen die Hilfe?« Seine Augen wurden schmal. »Und wer von euch wendet sich gegen das Programm, handelt menschlich und mitfühlend, auch wenn ihm dafür Demütigungen, Repressalien, Einsamkeit drohen? Das sind die FIP, die bei der Nachprüfung eine Chance haben.«
Die Spendengala. Das Fernsehinterview vor zwei Jahren. »Ich habe durch das Schwere gelernt«, hatte das Elfengeschöpf mit den grünen Augen gesagt. War es das, was sie gemeint hatte? Die Verantwortung für ihre Taten zu übernehmen, mit allen Konsequenzen? Sich gegen die Forderungen der Direktorin, der Mentoren, der anderen FIP zu stellen?
Vor der Höhle brach ein kalter, sonniger Morgen an, dessen Licht kaum bis in unsere Felsspalte drang. Ich rieb mir die Stirn. »Der Schlachthof … Das Zentralklinikum …«
»Alles ein Test, ein Riesentheater. Zimmer 7, die Patienten, die angeblich abgespritzt werden? Ich hab die Dokumente gesehen: Die Sterbenskranken sind nicht krank. Sie sind Schauspieler. Niemand wird in Zimmer 7 umgebracht.«
Das, was ich in dem Todeszimmer erlebt hatte – bloß eine Show?
»Warum?«, flüsterte ich.
»Weil das Programm euch immer wieder in Situationen bringen soll, in denen ihr euch für eine Seite entscheiden müsst. Tu ich, was die Mentoren, die Direktorin, alle von mir verlangen, auch wenn es unmenschlich und falsch ist? Gehorche ich – oder weigere ich mich?«
Kalt wie Steine sanken Mertens Worte in mich ein.
»Und alle wissen Bescheid? Nur wir nicht?«, flüsterte ich.
»Die Direktorin kennt die Wahrheit über das Programm. Die angeblichen Todeskandidaten in Zimmer 7 auch. Das Führungsteam von Eden. Und natürlich die Entwickler des Programms.«
»Was ist mit den anderen FIP? Den Arbeitern im Klinikum, im Müllpark, was ist mit den Schlächtern?«
»Die nicht.«
»Und die Mentoren?«
Er schüttelte den Kopf. »Das ist interessant, nicht wahr? Wir bringen euch genau das Falsche bei – weil wir nicht wissen, wie das Programm wirklich funktioniert. Wir lehren euch, mitzumarschieren und Punkte zu scheffeln. Und das machen wir richtig gut. Denn wir sind FIP. Und keine netten Menschen, die euch nett behandeln würden. Und all das macht es euch noch schwerer, die richtigen Entscheidungen zu treffen.« Er runzelte die Stirn. »Anfangs schien genau das der Schwachpunkt des Programms zu sein. Die jungen FIP, ausgerechnet in der Obhut von Menschen, die selbst FIP sind? Aber die Erfinder des Programms ließen sich auf keine Diskussionen ein. Und das mussten sie auch nicht. Die Erfolgsquote des Programms sprach für sich. Die Zahl der FIP, die ihre Nachprüfung bestanden, stieg gegenüber früheren Programmen sprunghaft an. Kein Förderprogramm hatte je so gut funktioniert.«
Inzwischen rauchte ich vor Zorn. »Wenn das Programm so großartig ist, warum müssen sich ihm nicht alle Bürger von Farland unterziehen? Warum nur die FIP?«
»Weil nur sie gefährdet sind. Ich-schwach.«
»Ich-schwach«, fauchte ich. »Was soll denn das heißen?«
Merten zuckte die Schultern. »Manipulierbar. Außengesteuert. Aggressiv. Ohne inneren Halt. Nicht allein stehen können. Sich darum an einen Führer klammern. Andere kleinmachen. Und sich groß dabei fühlen.«
Das Karussell in meinem Kopf drehte sich immer schneller. Was Merten da erzählte, hatte eine perverse Logik. Oft genug hatte ich mich gefragt, welches Ziel sich hinter dem Programm von Elysium verbarg. Jetzt hatte ich die Antwort.
»Und kein Mentor hat je gemerkt, wie das Programm funktioniert?«
Merten zuckte die Schultern. »Wenn du mittendrin steckst, denkst du nicht über diese Dinge nach. Alles in Farland war immer wahr. So wachsen wir auf: mit etwas, von dem wir glauben, es sei wahr. Du kommst gar nicht auf die Idee, dass man in Elysium mit verdeckten Karten spielt.«
»Was ist mit Romilda? Mit Orlando? Sie wehrten sich gegen das Programm. Damit handelten sie doch ganz in seinem Sinn. Trotzdem befinden sie sich in Eden.«
»An einem bestimmten Punkt übten sie Gewalt gegen andere aus. Oder gegen sich selbst. Das akzeptiert Farland nicht.«
Verzweifelt bemühte ich mich, meine Gedanken zu ordnen. »Dann ist Eden auch so ein … Theater?«
»O nein! Eden ist bitterer Ernst. Es ist der Ort für die, die zu weit gegangen sind. Vergewaltigung. Körperverletzung. Mord. Auch der Versuch, sich selbst zu töten. Und Hochverrat.«
»Und diese Leute zerstört man dann langsam. Das ist doch mindestens genauso schlimm.«
Merten lachte freudlos. »Die Experimente? Keiner muss da mitmachen. Ist alles freiwillig. Zwei Wochen lang genießt du in Eden alle Annehmlichkeiten. Und das sind einige. Danach kannst du wählen. Auf Station C erwartet dich ein Leben, wie es früher in manchen Psychiatrien und Gefängnissen üblich war. Keine Annehmlichkeiten mehr. Kein Komfort. Einzelzellen. Einsamkeit. Isolation. Du wirst ruhiggestellt, vegetierst vor dich hin. Du darfst nicht mehr darüber entscheiden, was du tun oder lassen willst, wann du dich wäschst, was du isst, um welche Uhrzeit du aufstehst oder dich schlafen legst. Stimmst du den Versuchen zu, kommst du auf die B. Dort wandelt man deine lebenslange Haft in einen lebenslangen Aufenthalt in einer Luxusanlage um.«
»Und niemand stört sich an diesem System?«
»Es dringt nicht viel nach außen von dem, was in Eden geschieht. Aber selbst wenn es so wäre, würde es kaum einen Aufschrei in der Bevölkerung geben. Viele von denen, die in Eden sitzen, sind nicht gerade die Männer und Frauen, mit denen du dich anfreunden willst. In Eden kümmert man sich um sie. Schützt sie vor sich selbst. Und gleichzeitig können sie einen Beitrag für die medizinische, psychologische und pädagogische Wissenschaft leisten. Das ist der Deal.«
Darüber dachte ich eine Weile nach. Das alles war ziemlich schwer zu verdauen. »Was sind das für Experimente, Merten?«
»Psychologische Sachen. Versuchsreihen, bei denen Medikamente und andere Therapieformen getestet werden. Vordringlich wollen sie das Programm verbessern und arbeiten an immer neuen Konzepten, um bei der Nachprüfung noch bessere Ergebnisse zu erzielen.«
»Dann ist Eden also gar nicht so schlimm?«, fragte ich mit verhaltenem Zorn. »Oder Elysium? Ist es das, was du mir sagen willst?«
»Nein. Letztlich geht es um die Frage, wie weit andere über dich verfügen dürfen. Sobald das Orakel dich ausmustert, wird deine Person zu 100 Prozent an Farland übergeben. Keine Möglichkeit mehr zu wählen, was du mit deinem Leben anfangen willst. Für dein körperliches Wohl wird gesorgt. Alles andere …« Er zuckte die Schultern.
»Merten? Wie ist es, wenn man bleibt? In Elysium, meine ich. Was ist mit Freundschaften? Mit … mit Liebe?«
»Oh, sobald du aus dem Kolleg raus bist, sind Liebesbeziehungen erlaubt. Die wenigsten kriegen das hin. Zweckgemeinschaften gibt es einige, aber auch die sind selten von Dauer. In Elysium verlernst du, mit dem Herzen zu leben.«
Etwas fiel mir ein, das Orlando vor langer Zeit zu mir gesagt hatte. Über die Impfung, der wir uns gleich nach unserer Ankunft hatten unterziehen müssen.
Ich glaube, das war keine Impfung. Oder vielleicht doch. Eine Impfung gegen Reproduktion.
»Warum gibt es keine Kinder in Elysium?«, fragte ich stockend.
Merten schwieg lange.
»Auch darüber existiert eine Datei.« Seine Stimme klang rau. »Du erinnerst dich an die Spritze vom ersten Tag?«
Ich nickte. Am liebsten hätte ich mir die Ohren zugehalten, ich wollte nichts mehr hören.
»Sie wirkt zwölf Monate. Solange du in Elysium bleibst, wird sie dir jedes Jahr neu verabreicht. Der Ausschuss soll nicht noch mehr Ausschuss produzieren. Wahrscheinlich«, fügte er hinzu, »müsste man diese Praxis nicht einmal verheimlichen. Schließlich ist es ein offenes Geheimnis, dass es in Elysium keine Kinder gibt.«
»Hattest du eine Freundin?« In diesem Augenblick wurde mir bewusst, dass ich mir Merten immer allein vorgestellt hatte.
Er lächelte müde. »Schon.«
Die strahlend weißen Wohnblöcke auch von Paaren bewohnt. Das passte nicht zu Elysium, so wenig, wie eine Beziehung zu Merten passte.
Nicht?
Wieder sprang mir das Erinnerungsbild in den Kopf. Merten, neben mir auf meiner Pritsche im Phönix-Kolleg. Still löffelten wir den Nachtisch, den er für uns besorgt hatte, in der Nacht, in der Orlando in Eden verschwunden war und in der ich geweint hatte. Merten war bei mir geblieben. Seine Nähe hatte mich getröstet. Aber war sie nur Trost gewesen?
»Was ist jetzt mit deiner Freundin?«, fragte ich leise. »Wo ist sie?«
Er wandte mir das Gesicht zu. »Im letzten Sommer ging Janis zum dritten Mal in die Nachprüfung. Sie bestand. Das war’s dann gewesen.«
»Tut mir leid.«
»Muss es nicht«, sagte er schroff. »Wir waren uns nie besonders nah. So ist es meistens in Elysium. Du verlernst, anderen Menschen zu vertrauen.«
»Fehlt sie dir?«
Er seufzte. »Anfangs schon. Aber ich habe entschieden, dass sie auf der anderen Seite des Zauns besser aufgehoben ist.«
Ich blickte auf meine Hände. »Glaubst du, ich hätte die Nachprüfung bestanden, Merten?«
Er stocherte mit seiner Schuhspitze im Laub. Ohne mich anzusehen, sagte er: »Ja.«
Durch den Felsspalt beobachtete ich, wie es draußen immer heller wurde. Ich fühlte mich wach und gleichzeitig zu Tode erschöpft. Ja, hatte Merten gesagt. Ich schloss die Augen, schrak wieder hoch. Meine Zähne klapperten, ich schlang die Arme um die Knie, machte mich so klein wie möglich, um etwas Wärme zu finden.
Ja.
Die Gedanken rannten und rannten durch meinen Kopf, sie hämmerten auf mich ein, Rasmus, mein Zuhause, meine Eltern, meine Schwester, mein kleiner Bruder … Würde man Leane und Bertil nach Elysium schicken? Wie wahrscheinlich war das? Daria hatte zu Hause bleiben dürfen, anders als ihre ältere Schwester Nuja. Vielleicht war auch ich in unserer Familie die Ausnahme, das Missgeschick … Und wenn nicht?
Ich war erschöpft und aufgeweicht. »Sollte ich zurückgehen und es versuchen?«, fragte ich leise.
»Sprichst du von der Nachprüfung?«
Ich schüttelte den Kopf. »Sollte ich meiner Schwester und meinem Bruder helfen? Ich meine: falls sie ausgemustert werden. Du hast deinem Bruder geholfen. Du hast es wenigstens versucht. Ich haue einfach ab. Ist das nun ein Beweis für …«
»Deine Schlechtigkeit?« Merten lachte. Es war kein gemeines Lachen, es klang nur überrascht. »Deinem Bruder und deiner Schwester wird es nichts nützen, wenn du zurückgehst. Du darfst dir nicht überlegen, wie du wieder reinkommst. Wir müssen uns überlegen, wie auch die anderen rauskommen.«
Ich wusste, dass er recht hatte. Und ich wusste, dass die Aufgabe zu groß für mich war. Viel zu groß.
»Wenn wir in Estilien sind«, sagte Merten, »nehmen wir Kontakt zum Widerstand auf. Ein Schritt nach dem anderen.«
»Ja«, sagte ich. Wie aus dem Nichts begann ich zu weinen. Es war ein hohes Weinen, das Weinen eines Kindes, es erschreckte mich, und ich war völlig wehrlos dagegen.
»Fenja.« Merten legte die Arme um mich und zog mich an sich. Mein Kopf sank gegen seine Schulter. Meine Wange lag am rauen Stoff seines Kittels. Seine Arme schlossen mich in einer Höhle ein, in der ich nichts sah, nichts hörte als sein Herz, während ich mich immer tiefer in seine Umarmung weinte. So fand ich etwas Ruhe.
»Schlaf jetzt«, flüsterte er.
Langsam dämmerte ich weg, schreckte wieder hoch. Es war kalt, und ich drückte mich enger an Merten, nahm die Kälte mit in einen Traum, in dem ich durch ein Fenster in ein Haus blickte. Meine Mutter stand am Herd und dünstete Apfelschnitze. Um mich war es dunkel, aber in die Küche flutete goldenes Licht, und meine Mutter stand mitten darin. Dann war ich auf einmal in dem Haus und lief durch einen Flur mit knochenfarbenen Wänden. Zu beiden Seiten gingen Türen ab, die aussahen, als hätte man sie aus Kalbfleischstücken zusammengenäht. Ich stolperte immer weiter, der Flur nahm kein Ende, überall Türen, aber nirgends ein Knauf oder eine Klinke. Als ich erschöpft innehielt, hörte ich hinter einer Tür Stimmen murmeln. Ich legte mein Ohr an die fleischfarbene Füllung, sie fühlte sich feucht und kalt an. Ich erkannte die Stimmen. Rasmus, meine Eltern, Bertil, Leane, alle redeten sie durcheinander. Ich versuchte die Tür zu öffnen, doch sie war abgeschlossen. Ich trommelte dagegen und schrie ihre Namen. Sie redeten immer weiter. Ich lief von Tür zu Tür, überall ihre Stimmen, die langsam von mir wegdrifteten. Ich schrie nach ihnen, bis ich merkte, dass es nicht mehr ihre Namen waren, die aus meinem Mund kamen.
»Merten! Merten!«
Die nächste Tür öffnete sich. Da stand er, als hätte er die ganze Zeit auf mich gewartet. Ich warf mich in seine Arme, spürte seine Wange an meinem Haar, das voller Blätter und Zweige hing, wir waren nicht mehr in dem Haus, sondern in einem Wald. Fahles Licht sickerte durch die Zweige.
»Und?«, flüsterte er. »Was fängst du jetzt an mit deinen 100 Prozent?«
Ich blickte zu ihm auf. Um uns fielen schwarze Blätter und landeten mit einem knackenden Geräusch auf dem Boden, als würden winzige Knochen brechen. Mertens Lippen streiften mein Ohr. »Nichts wie raus hier«, flüsterte er und strich mit einem Finger über meinen Mund. Seine Hand wanderte weiter, umfasste meinen Nacken, schob sich in mein Haar. Ich spürte seinen Atem, er hob mein Kinn an und küsste mich auf den Mund, ein vorsichtiger Kuss, keine Lippen, die sich öffneten, keine Zunge, die in meinen Mund drängte, aber gerade diese Zurückhaltung erregte mich. Ich drückte mich an ihn, spürte die Härte seiner Muskeln, roch den Wald, die Erde an ihm, mein Herz schlug gegen meine Rippen, als wollte es meinen Körper verlassen und in Mertens Brust springen, mir wurde immer wärmer, jetzt öffneten sich meine Lippen doch, und als hätte er auf dieses Zeichen gewartet, wurden auch seine Lippen weich.
Licht
Mit einem Ruck fuhr ich hoch. Verwirrt saß ich im Dunkeln und hatte keinen Schimmer, wo ich war. Nur langsam dämmerte mir, dass der Traum vorbei war und ich mich jetzt mit dem Rest der Nacht auseinandersetzen musste. Mit unseren Verfolgern, die den Wald durchstreiften. Neben mir hörte ich Merten atmen. Ein Strahl Mondlicht fiel durch den Spalt auf sein Gesicht. Im Schlaf sah er älter aus. Erschöpfter. Wir mussten weiter, aber ich saß nur da und fürchtete mich vor den Stunden, die vor mir lagen, wollte mich weder bewegen noch Merten wecken. Schließlich zwang mich meine Blase aus meiner Lähmung. Als ich in die Höhle zurückkehrte, legte ich Merten eine Hand auf die Schulter und schüttelte ihn sanft. Mit einem Schrei fuhr er hoch und blickte wild um sich.
»Ich bin’s nur«, sagte ich erschrocken.
Er sah grauenvoll aus, bleich, mit dunklen Ringen unter den Augen.
Wir löschten unseren Durst an dem Fluss. Das Wasser war so kalt, dass es wie Messer in meinen Mund schnitt.
»Wo ist Norden?«, fragte Merten.
Ich blickte in den Himmel und deutete in die Dunkelheit.
»Dann müssen wir uns weiter westlich halten«, sagte er.
Fragend blickte ich ihn an.
»Sie werden uns im Norden suchen.«
Der Mond tauchte den Wald in Silbergrau. Die kahlen Baumkronen zeichneten sich gegen den Himmel ab und erinnerten mich an die Aufnahmen von Lungen, die ich in der Satorius-Klinik gesehen hatte. Ein Windstoß fuhr mir ins Gesicht. Bald waren der Wind und die Kälte überall. Atemwölkchen stiegen vor mir auf und verschwanden in der Nacht. Nebel kroch über den Boden, streckte seine Finger aus, zog sich durch den Wald und beanspruchte immer mehr Terrain, erlaubte uns kaum noch ein paar Meter Sicht. Immer wieder schaute ich über die Schulter, denn irgendwo waren die, die uns suchten, teilten den Wald, die Luft, den Nebel mit uns.
Ein Käuzchen schrie, in der Ferne antwortete ein zweites Käuzchen. Ich begann mit den Zähnen zu klappern, spürte aber gleichzeitig wieder die Wärme von Mertens Hand, die sich um meinen Nacken gelegt hatte. Bis in die kleinste Einzelheit tauchte mein Traum auf. Ich wollte diese Bilder und Gefühle nicht, ich wollte nicht so an Merten denken.
Immer mehr Nebelschwaden drängten von den Hängen herab. Mühsam bahnten wir uns zwischen Sträuchern und Felsblöcken einen Weg. Der Hungerschmerz in meinem Magen wuchs mit jedem Schritt, trotzdem war ich auch euphorisch und freute mich über diese Wanderung durch den Wald, über die Freiheit und Einsamkeit. Dabei waren gerade sie eine Illusion. Irgendwo zwischen den Bäumen steckten die Leute von der Tankstelle, und auch die Hüter hatten jetzt wohl mit der Suche begonnen.
Mir war übel vor Hunger, ich konnte mich kaum auf die nächsten Schritte konzentrieren. Mein Magen röhrte. Bilder von Pfannkuchen wirbelten durch meinen Kopf, Pfannkuchen, wie meine Mutter sie buk, mit gedünsteten Äpfeln, mit Käse oder Ahornsirup. Wenn die Pfannkuchen für ein paar Sekunden verblassten, kam mir unsere Badewanne in den Sinn, bis zum Rand gefüllt mit heißem, sauberem Wasser und Schaum, der nach Vanille und Honig duftete.
»Merten?«, fragte ich, um mich von Pfannkuchen und Seifenschaum abzulenken. »Was planst du eigentlich, wenn du in Estilien bist?«
»Kontakt zum Widerstand aufnehmen.«
»Und dann?«
Er lachte leise. »Dann ziehen wir los und sprengen das Orakel in die Luft.«
»Ich will euch ja nicht den Spaß verderben, aber das Orakel steht in der Hauptstadt und ist bestens geschützt.«
»Das ist unser Problem. Trotzdem müssen wir die Sache erledigen.« Er zögerte. »Und du? Was hast du für Pläne?«
Ich wusste nicht, was ich darauf antworten sollte. »Ich habe eigentlich keine Pläne«, sagte ich leise. »Ich dachte, ich könnte bei euch mitmachen.«
Er ließ das so stehen. Sagte nicht Ja, aber auch nicht Nein.
Das Orakel in die Luft jagen. Und dann?
Gab es ihn, diesen Keim des Unheils, den Schatten, der über manchem Leben lag? Wie sollte man damit umgehen, wenn das Orakel nicht mehr existierte?
»Was kommt danach, Merten?«, fragte ich leise. »Wie geht es weiter, wenn das Orakel weg ist? Das Schlimme verschwindet ja nicht mit ihm.«
»Das Schlimme?«
Ich atmete tief ein. »Zorn, Wut, Hass. Selbsthass. Eifersucht. Rachegefühle. Steckt das nicht in uns allen drin?«
»Schon. Die Frage ist, ob du diese Gefühle kontrollieren und in etwas anderes verwandeln kannst. Oder ob du dich der Dunkelheit überlässt.«
»Glaubst du, es gibt andere Möglichkeiten als ein Orakel, um … um …«
»Den Schatten zu bannen?« Merten zuckte die Schultern. »An dieser Frage beißt sich die Menschheit seit Jahrtausenden die Zähne aus. Wie lässt sich der Wolf zähmen, der in uns heult? Das Orakel ist nur eine von vielen Antworten. Farland wünscht sich ein Paradies. Ich glaube nicht, dass so etwas möglich ist.«
»Was ist möglich?«
»Ich weiß es nicht. Kann sein, mir fehlt die Phantasie, und es wäre anders, wenn ich in einer Zeit groß geworden wäre, in der die Menschen an die Menschen glaubten. In der sie überzeugt waren, dass jeder Mensch ein unersetzbares Individuum ist, mit einzigartigen Erinnerungen, Gefühlen, Fähigkeiten. Aber anders als in Farland. Auch mit Mängeln, mit Schwächen, mit dunklen Flecken.« Er atmete tief ein. »Ich sehne mich in eine Zeit, in der Mängel, Fehler und Unzulänglichkeiten sein dürfen, vielleicht sogar ihren eigenen Wert besitzen. Vielleicht ist so eine Zeit in Zukunft denkbar. Wenn das Orakel verschwunden ist und wir begreifen, dass wir den Schatten im Menschen akzeptieren müssen wie Krankheit und Tod.«
»Das Böse einfach geschehen lassen?«
»Nein!« Er blieb stehen. In seinen Augen glühte es. »Das meine ich überhaupt nicht! Wir müssen uns dem Bösen stellen, es benennen und etwas dagegen tun. Wenn Unrecht geschieht, müssen wir zu einem gerechten Urteil kommen. Aber erst muss die Tat geschehen.«
»Und wenn uns ein Orakel die Möglichkeit gibt, die Tat vorherzusehen?«
»Muss das Orakel abgeschafft werden.«
»Und die Opfer böser Taten? Soll man Menschen zu Opfern werden lassen, wenn man es vorher verhindern könnte?«
»Ja«, sagte er leise. »Wenn wir es konsequent zu Ende denken, ist es das, was wir in Kauf nehmen müssen. Aber das …«, fügte er hinzu, »ist nur meine bescheidene Meinung.«
Niemand schien uns zu folgen, trotzdem wagten wir nicht, uns auszuruhen. Wie zwei aufgezogene Figürchen marschierten wir immer weiter. Irgendwann stießen wir auf Reifenspuren, dann auf die Reste eines Lagerfeuers. Merten legte eine Hand an die Asche. »Noch nicht ganz kalt.«
Ängstlich blickte ich mich um. »Und was heißt das?«
»Sie waren schlau genug, sich auch nach Westen zu wenden. Aber nicht so schlau, keine Spuren zu hinterlassen.«
In der Asche lagen mehrere Klumpen. Ich hob einen davon auf, kratzte den Ruß ab und blickte entzückt auf das, was in meiner Hand lag. »Schau! Eine …«
Er schlug mir die Kartoffel aus der Hand.
»He!«
»Lass sie liegen. Sie könnte giftig sein.«
»Eine Kartoffel?«
»Möglich, dass sie eine Droge reingespritzt haben, irgendein Zeug, das uns außer Gefecht setzen soll. Damit sie uns in Ruhe einsammeln können.«
Ich starrte auf die Kartoffeln. »Wer denkt sich denn so was aus?«
»Vielleicht sind sie klüger, als ich dachte. Klüger – und in der Nähe. Machen wir, dass wir hier wegkommen.«
In den nächsten Stunden begegnete uns niemand außer einem Fuchs, der mehr Angst vor uns hatte als wir vor ihm. Einmal glaubte ich in der Ferne Schreie zu hören, aber Merten meinte, es sei nur der Wind in den Bäumen. Ich war erschöpft und so hungrig, dass mir immer wieder schwindelig wurde. Warum hatte ich auf Merten gehört? Vergiftete Kartoffeln, Schwachsinn. Ich hätte sie essen sollen und fertig.
»Da war noch etwas«, sagte Merten unvermittelt.
»Verkohltes Stockbrot?«, fragte ich bissig.
»In den Geheimdokumenten. Ich habe dort eine Datei gefunden, die sich mit einem merkwürdigen Phänomen beschäftigt. Es trat vor einigen Jahren auf, vielleicht erinnerst du dich. Damals knackten ein paar Prüflinge an ihrem Tag des Orakels fast die 100-Prozent-Marke. Und darunter waren ausgerechnet die Männer und Frauen, die in den nächsten Jahren in den Widerstand abwanderten.«
»Ach ja?« Ich konnte nur an meinen Hunger denken, an die blöden Kartoffeln.
Er lachte in sich hinein, es klang beinahe fröhlich. »Das hat doch irgendwie seinen eigenen Humor, findest du nicht? Das Orakel verpasst denen einen hohen Wert, die das Orakel abschaffen wollen.«
Ich war genervt. »Vielleicht hatten sie damals etwas falsch programmiert, und da kam dann eben für Leute wie Zoe Colien ein Wert raus, der …«
Merten war stehen geblieben. »Du kennst Zoe?«, fragte er scharf.
»Ich hab sie mal im Fernsehen gesehen.« Das Bild der schönen jungen Frau mit dem Flammenhaar stand mir noch deutlich vor Augen. »Kennst du sie denn?«
Mertens Gesicht verschloss sich. »Wir besuchten dasselbe Kolleg. Sie war im Jahrgang über mir. Was haben sie in dem Bericht erzählt?«
»Dass Zoes Bewertung ein Schlag ins Gesicht für die Typen von der Union war. Du weißt schon, die Organisation, die sich für eine stärkere Trennung von sogenannten gewöhnlichen Bürgern und Bürgern mit einerVergangenheit einsetzt.«
»Ehemalige FIP.«
Ich nickte. »Zu den Forderungen der Union gehört unter anderem der getrennte Unterricht für die Kinder der Gewöhnlichen und die Kinder der ehemaligen FIP. Kinder mit Sonderbegabung, so werden sie von den Unions-Typen genannt.«
»Sonderbegabung.« Merten lächelte schwach. »Ich hab mich immer gefragt, wer sich solche Vokabeln ausdenkt.«
»Sagt sich eben schneller als Kinder, deren Eltern mal eine Förderung in Elysium brauchten.«
Er lachte leise in sich hinein.
»In dem Bericht hieß es, Zoes Mutter sei ein Jahr in Elysium gewesen und ihr Vater sogar zwei«, fuhr ich fort. »Und was passiert? Zoe kriegt 99 Prozent! Der Wert ist schon an sich absurd, aber dann noch Eltern mit Elysium-Erfahrung – das ist schon komisch, oder?«
»Glaubst du, der Prozentwert der Eltern gibt einen Hinweis auf den Wert ihrer Kinder? Ist nicht genau das die Theorie der Union?«
»Natürlich glaube ich das nicht!«, sagte ich heftig. Wollte er mich etwa in einen Topf mit diesen Unions-Typen werfen? »Ich bin doch selbst das beste Beispiel für die Wiederlegung dieser Theorie. Meine Eltern haben um die 80 Prozent. Und was kriege ich? Unter null.«
Er ließ das so stehen.
»Kanntest du Zoe gut?«, fragte ich.
Sein Gesicht versteinerte. »Wir hatten nichts miteinander zu tun. Aber viele Leute mochten sie, schon bevor sich ganz Farland um sie riss. Nach ihrem Tag des Orakels brach in unserer Stadt die Hölle los. Alle wollten alles über Zoes Familie, ihre Hobbys, Freunde, Liebhaber wissen. Alle möglichen Organisationen versuchten, sie für sich einzuspannen, besonders die, die ein Verbot der Union forderten. Aber Zoe lehnte alles ab.«
»War wohl schon mit anderen Dingen beschäftigt. Darüber haben sie auch berichtet: dass Zoe bald aus anderen Gründen von sich reden machte. Sie forderte eine Abschaffung des Orakels. Und zwar heftig. Für die Union war das Öl ins Feuer. Und die Kritiker des Orakels nahmen Zoe als Beweis dafür, dass es eben doch eine Fehlerquote gibt und sich das Orakel irren kann. Und plötzlich – schwupp – verschwindet sie von der Bildfläche.«
Merten runzelte die Stirn. »Haben sie gesagt, was aus ihr wurde?«
»Sie haben ihre Spur nie gefunden.«
»Vielleicht hat man sie …« Er verstummte.
»Ja?«
Er zögerte. »Ausgeschaltet.«
Entsetzt starrte ich ihn an. »Merten! So was hat man früher gemacht. Die Zeiten sind doch echt vorbei!«
Er zuckte die Schultern. »Ja. Möglicherweise.«
»Könnte sie ins Ausland gegangen sein, um sich dem Widerstand anzuschließen?«
»Nein.« Jetzt klang seine Stimme eisig. »Mit Leuten wie Zoe ist es immer dasselbe. Sie machen eine Menge Wirbel – aber das Handeln überlassen sie lieber anderen.«
Je weiter die Nacht voranschritt, desto größer wurde mein Hunger. Noch schlimmer war der Durst. Meine Lippen waren gesprungen, meine Zunge klebte am Gaumen. Keine Spur von einem Bach, nirgends auch nur eine Pfütze oder ein Schlammloch. Wir kamen an einigen Häuserruinen vorbei, in denen wir weder Decken noch funktionierende Wasserleitungen fanden, nicht mal ein versteinertes Brot. In einer Zimmerecke lag ein Skelett, das mit seinen Knochenarmen ein kleineres Skelett umklammert hielt. Dieses Haus musste Merten allein durchsuchen, während ich draußen gegen das Würgen ankämpfte, das mich bei diesem Anblick erfasst hatte.
Weiter. Immer weiter. Es war ein Albtraum, der nicht endete. Ich konnte mich kaum noch auf den Beinen halten, als Merten mir eine Hand auf den Arm legte.
»Was?«, flüsterte ich und blieb stehen.
Er deutete nach links. Weit entfernt schimmerte zwischen den Bäumen ein schwaches Licht.
»Könnte ein Suchscheinwerfer sein«, hauchte Merten.
Wir krochen ins Unterholz. Das Licht veränderte sich nicht. Es kam weder näher noch entfernte es sich.
»Sehen wir es uns mal an«, murmelte Merten.