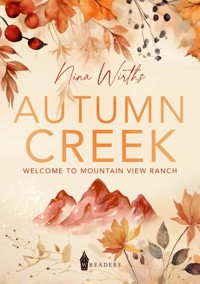5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Vajona Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Naira lebt ein friedliches, unauffälliges Leben in London. Als Elbin unter Menschen hat sie ihre Vergangenheit zurückgelassen. Doch in der Millionenstadt geschehen merkwürdige Dinge: Menschen verschwinden auf unerklärliche Weise und das magische Portal verändert sich. Gemeinsam mit Finnley, einem mysteriösen Gesandten ihres Volkes, verfolgt Naira eine Spur mitten ins Herz des Elbenreiches Caelum. Im Königreich Valoncour herrscht seit dem Verschwinden der Prinzessin eine dunkle Magierin und versetzt das Elbenreich in Angst. Naira und Finnley stellen sich den Gefahren und decken ein düsteres Geheimnis auf, welches Caelum und London auf tragische Weise verbindet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Nina Wirths
DAS PORTAL NACH CAELUM
Dieser Artikel ist auch als Taschenbuch und Hörbuch erschienen.
Das Portal nach Caelum
Copyright
© 2024 VAJONA Verlag
Alle Rechte vorbehalten.
Lektorat: Vanessa Lipinski
Korrektorat: Madeleine Seifert
Umschlaggestaltung: Julia Gröchel,
unter Verwendung von Motiven von 123rf
Satz: VAJONA Verlag, Oelsnitz
VAJONA Verlag
Carl-Wilhelm-Koch-Str. 3
08606 Oelsnitz
ISBN: 978-3-98718-152-8
Für die Träumerin, die ich einmal war, die ich bin und die ich immer sein werde.
Prolog
Tränen rannen über mein Gesicht.
Ich schluckte, um meinen schmerzenden Hals zu beruhigen. Die Tränen hinterließen salzige Spuren auf meiner Zunge. Ich fror und legte mir die Arme um die Knie, aber das brachte weder die ersehnte Wärme noch Trost. Jegliche Wirkung blieb aus. Ich unterdrückte ein Schluchzen, denn ich würde mir nicht die Blöße geben, dass mich jemand weinen hörte. Mit Sicherheit standen draußen vor dieser Tür meine Leibwachen und belauschten jedes Geräusch, welches aus meinem Gemach zu kommen drohte. In Gedanken schimpfte ich den Raum ein Gefängnis.
Weil ich damals schon, hier im Palast von Valoncour, nur eine Gefangene war. Alles wiederholte sich.
Alles hier wirkte so prächtig und majestätisch, so wunderschön und gebieterisch. Und trotzdem sehnte ich mich nach meinem kleinen Apartment in London zurück. Zurück in das Leben meiner Wahl.
Draußen wütete ein Schneesturm und die Asche, die ebenfalls vom Himmel fiel, mischte sich gefährlich unter die weißen Flocken. Das Ergebnis war eine graue Front, die vor dem Fenster lächerlich herumwirbelte und mich zu verspotten schien. Wütend betrachtete ich das Chaos und ballte die Hände zu Fäusten.
Ich verlor jegliches Zeitgefühl, während ich auf dem Himmelbett saß und traurig zur geschlossenen Tür starrte.
Als könnte ich sie mit meinem Blick dazu zwingen, mich zurück nach London zu bringen.
London. Meine Heimat.
Ich wünschte, ich hätte das Portal nie benutzt. Ich wusste, dass es ein Fehler gewesen war, als ich den alles entscheidenden Schritt gewagt hatte.
Noch nie war mir etwas so schwergefallen, wie nach diesem Türknauf zu greifen und hinaus in den Palast zu treten. Als würde ich mein eigenes Todesurteil mit diesem kalten Stück Metall besiegeln.
Ich wollte nicht nach draußen, ich strebte nicht danach, dem König unter die Augen zu treten. Bei diesem Gedanken prügelte Panik auf meine Eingeweide ein und ich schluckte bittere Galle hinunter.
Meine ersten Ausflüge in die menschliche Welt glichen einst einem faszinierenden und spannenden Abenteuer, dem ich nicht zu widerstehen vermochte. Sofort fühlte ich mich in London willkommen und frei. Ich wollte nie wieder dieses Portal nach Caelum betreten. Deswegen beanspruchte es all meine Willenskraft, zurück in diese Welt zu reisen.
London war eine Stadt, die ich hungrig in mich aufnahm und jeden Tag neu kostete. Caelum – und ganz besonders dem Königreich Valoncour – hatte ich mit vollem Bewusstsein einst den Rücken gekehrt. Ich musste frei sein. In Valoncour war alles vorherbestimmt, eintönig und ich lebte nach den strengen Regeln des Königs.
Meinem Vater.
Ich erinnerte mich an meine erste Londoner Nacht und mir schmerzte das Herz bei der Erinnerung. Nach den aufregenden Stunden war ich irgendwann mit pochendem Herzen eingeschlafen. Vielleicht war meine Aufregung mit Furcht gekoppelt. Und mit … Freiheit.
Diese Freiheit hatte ich im Palast von Valoncour nie zuvor gespürt. Die Flucht aus meinem Geburtsort in dieser Welt gehörte dabei zu meinen schönsten Erinnerungen an Caelum. Was mich einerseits mit Trauer erfüllte, andererseits hatte sich dieser Ort zu einem Albtraum entwickelt und London war für mich eine Zuflucht geworden.
Eine gewisse Zeit hatte das Untertauchen in London einwandfrei funktioniert. Ich hatte meine Vergangenheit und meine Herkunft verdrängen und hinter mir lassen wollen. Neu anfangen.
Und doch war ich jetzt wieder hier.
Denn die Vergangenheit holte einen immer ein. Mit geballter Kraft und wenn man am wenigsten damit rechnete. Ich würde nie verbergen, was oder wer ich war.
Ich war wieder hier in Caelum, als Gefangene und als Retterin zugleich.
Während ich in London ein neues Leben angefangen hatte, riss ich einen Teil Caelums mit mir. Und dieser Teil veränderte die Welt, machte aus mir eine Figur in einem Spiel, welches ich nie zu spielen gewagt hätte, wären mir die Regeln vorher bekannt gewesen.
Menschen, die in London verschwanden. Damit hatte alles angefangen.
Aber die schlimmste Wahrheit sollte mir noch bevorstehen.
Wie viele Leben hatten der König und diese Magierin – und damit auch unweigerlich ich – auf dem Gewissen?
So durfte es nicht enden. Wenn ich jetzt aufgab, wäre alles umsonst gewesen. Jedes einzelne Leben.
Ich schwor Rache für die, die gestorben waren und für die, die alles verloren hatten.
Dann wurde aus meiner Trauer nur noch gnadenlose Wut und ich ballte meine Hände zu Fäusten.
Mit neuem Mut in meinen Adern stand ich langsam von meinem Himmelbett auf und ging zu dem runden Spiegel, der auf meiner Kommode stand, und ließ nicht zu, dass man mein gebrochenes Herz und die Trauer sah. Mit dem Ärmel wischte ich mir über die Wangen und ließ die letzten Spuren meiner Tränen verschwinden. Dunkle Ringe zeichneten sich deutlich unter meinen Augen ab. Kräftig atmete ich aus. Ich klopfte mir die Wangen rosig und band mir mein langes, mittlerweile dunkelblondes Haar im Nacken zu einem Zopf. Dabei strich ich mir eine Strähne hinter die Ohren, deren Enden spitz und lang zuliefen und mich als Bewohnerin Caelums ausmachten.
Härte trat anstelle von Schmerz in meine grüne Augen.
Von neuem Mut erfasst, stand ich auf und strich mir das saphirblaue Kleid glatt, welches für mich angefertigt wurde. Das kalte Metall, das ich dabei spürte, sorgte für Zuversicht, denn mit einer Waffe wäre ich in der Lage, mich zu verteidigen. Denn das Kleid wurde nicht von irgendwem genäht, sondern von der besten Schneiderin ganz Caelums und einer meiner wenigen Verbündeten.
Dann trat ich einen Schritt in Richtung Tür. Und noch einen. Ich straffte meine Schultern. Atmete kräftig aus. In Gedanken legte ich mir einige verteidigende Worte zurecht.
Ich war zu weit gekommen, um jetzt aufzugeben. Wenn ich aufgeben würde, wäre auch sein Tod umsonst gewesen. Ich würde ihn nie wiedersehen, wenn ich nicht mutig genug bliebe. Die Niederlage rang mit dem unerträglichen Schmerz in meiner Brust und ich schloss kurz die Augen.
Draußen fiel der Schnee geräuschlos und legte sich auf das Kopfsteinpflaster. Ich wartete auf die Panik, auf den kalten Schweiß, der sich über meine Haut legte, aber ich spürte nichts davon. Nur das Hämmern meines Herzens legte sich über die Stille.
Ich streckte meinen Arm aus. Das kalte Metall berührte meine Haut und langsam drehte ich den Knauf.
Ich musste ihn retten.
Ich musste selbst gerettet werden – oder sterben.
Den Knauf fest umklammert trat ich dieser Tatsache ins Auge. Ein gefährliches Lächeln trat auf meine Lippen. Es war das Lächeln einer jungen Frau, die alles riskieren würde, weil sie bereits alles verloren hatte.
Er hatte mir geholfen und nun würde ich ihm helfen. Das war ich ihm schuldig. Es war dumm, sich in jemanden zu verlieben, der einem innerhalb kurzer Zeit wieder genommen werden würde.
»Ihr seid bereit, Prinzessin Namira?«, fragte mich die Leibwache und warf mir einen schmerzlichen Blick aus ozeanblauen Augen zu.
Heuchler, dachte ich.
Ich nickte steif, ballte die Hände zu Fäusten und spürte das scharfe Metall, welches in mein Kleid eingenäht worden war. Stumm bedankte ich mich bei Mailin und wusste, dass das niemals genug sein würde. Sollte ich das überleben, würde ich mich mehr als erkenntlich zeigen. Ich hatte einen Plan.
»Bringt mich zum König«, befahl ich mit einer ungeahnten Stärke in meiner Stimme.
Kapitel 1 London 2022
Noch vor dem Klingeln meines Weckers schlug ich langsam die Lider auf. Zwei Paar blaue Katzenaugen musterten mich voller Neugier.
»Ist ja gut, ich stehe schon auf«, murmelte ich verschlafen und bekam sogleich ein freudiges, herzerwärmendes Miauen als Antwort. Ich lächelte und schwang die Beine über den Rand des Bettes und trottete ins Badezimmer, um mir die Müdigkeit aus meinem Körper zu spülen. Während das heiße Wasser über mich floss, sah ich aus dem Fenster.
Draußen peitschte der kalte Wind über die Dächer von London und ich liebte diesen stürmischen Gesang, der bald auf mich treffen würde. Für mich bedeutete er Freiheit und Zukunft, für die meisten Londoner kündigte das Wetter nur einen weiteren verregneten Tag in der Hauptstadt Englands an. Oder den bevorstehenden Winter, was für sie nicht besser war.
Seit etwas mehr als zwei Jahren genoss ich jeden Tag hier, und da der Regenschauer nahezu ein täglicher Begleiter dieser Stadt war, hatte ich mich mit ihm schnell abgefunden. Ich erinnerte mich an eine gegenteilige Zeit zurück. Die frühen Morgenstunden waren komplett anders und … Ich schüttelte die Gedanken bei Seite.
Nach meiner Dusche setzte ich mir einen Tee auf. Das Wasser sprudelte und der Wasserkocher schaltete sich mit einem hörbaren Klicken ab. Ich umschloss die heiße Tasse mit meinen Händen und genoss die Wärme, setzte mich für einen Moment auf die Fensterbank und starrte hinaus. Von meinem Erker aus hatte ich einen wunderbaren Blick über den Regent’s Park, welcher in morgendlichen Nebel gehüllt vor mir lag. Regentropfen rannen an der Fensterscheibe hinab und reflektierten das Licht der Straßenlaternen.
Beobachte und versuche zu verstehen.
Das war mein Morgenritual und ich hatte ein paar entspannte Minuten Zeit, bevor ich in den Regen musste. Hinaus in mein neues Leben, ins stürmische und aufregende London.
Ich ahnte nicht, dass es schon bald mit dieser Ruhe vorbei sein würde. Dass mein altes Leben mich einholen würde. Dass mein Herz sich entscheiden müsste.
Nachdem ich den letzten Schluck ausgetrunken hatte, zog ich mir meinen Mantel an und platzierte den Regenschirm oben in der Tasche. Aus Gewohnheit betätigte ich den Lichtschalter im Hausflur, nur um wieder festzustellen, dass das Flurlicht auf meiner Etage immer noch defekt war.
»Verdammt«, seufzte ich, aber meine Augen sahen genug und wiesen mir zuverlässig den Weg, während ich die Stufen hinunterlief.
Ich sog den typischen Geruch von Regen, Träumen und der Underground ein. Ein Lächeln stahl sich auf meine Lippen.
Ein Kribbeln breitete sich in meinem Bauch aus und ich freute mich auf einen weiteren Tag in dieser Welt. Den Griff des Schirms hielt ich fest umklammert, da der Wind ihn mir aus den Händen zu reißen drohte. Ich wich einer Pfütze aus und setzte meinen Weg zur Underground-Station fort.
Am Regent’s Park stieg ich die Treppen zu den Bahngleisen hinab. Das Gedränge schien mir heute dichter denn je. Wie immer war das unterirdische Tunnelsystem voller täglicher Pendler, die sich in sämtliche Richtungen ausbreiteten. Die Gespräche der Mitmenschen stiegen zu einem stetigen Gemurmel an und wurden eins mit den Geräuschen der Underground. Dank meines ausgeprägten Gehörs verstand ich alles und zugleich nichts, schnappte immer wieder ein paar Wortfetzen auf und tat das Meiste als belanglos ab.
Die U-Bahn näherte sich. Der aufkommende warme Wind aus den Tunneln verriet es jedes Mal.
Ich stieg in eines der Abteile hinein. Die Türen schlossen sich hinter mir und die Underground fuhr durch die dunklen Tunnelschächte tief unterhalb der Stadt. Ein beklemmendes Gefühl kroch in mir herauf, aber das war nichts im Vergleich zu meinem alten Leben.
Als ich London zum ersten Mal betreten hatte, hatte mich diese pulsierende Stadt sofort in den Bann gezogen – und dieser Zauber blieb bis heute bestehen. Diese Stadt war so anders, als ich es in meinen Büchern und Schriftrollen gelesen hatte. Obwohl ich die Geschichten kannte, aus den Zeiten, als London noch Londinium hieß, hätte ich es nicht für möglich gehalten, dass ich mein Herz hier verlieren würde. Bei den anfänglichen Besuchen in der Hauptstadt in Begleitung meiner Leibwachen sowie meines Vaters hatte ich mich sofort in die belebte Stadt verliebt. Zum ersten Mal hatte ich das Gefühl von Freiheit empfunden. Und jedes Mal, wenn meine Zeit vorbei war, kehrte ich zurück. Zurück in meinen goldenen Käfig.
Die Abwechslung, die Vielfalt und das Gefühl, frei zu sein, hatten es mir angetan. Trotz der Menschenmassen konnte ich abtauchen, unauffällig bleiben und ein selbstbestimmtes Leben führen. Ich war unsichtbar, wurde zu eine der Millionen Einwohner und Einwohnerinnen, verschmolz im stetigen Treiben.
»Nächster Halt: Oxford Circus.« Die Ansage riss mich aus meinen Gedanken und brachte mich in die Wirklichkeit zurück. »Bitte achten Sie auf den Spalt zwischen Zug und Bahnsteigkante«, nuschelte ich den sich an jeder Haltestelle wiederholenden Warnhinweis mit.
Während der weiteren Fahrt beobachtete ich die Menschen in meinem Umkreis, nur um erneut festzustellen, dass jeder mit sich selbst beschäftigt war. Die meisten schauten in ein Buch, waren in ihr Smartphone vertieft oder lasen Zeitung. Die wenigen, die sich umschauten, blickten durch ihre Mitmenschen hindurch. Aus dem nächsten Waggon drang das klägliche Weinen eines Babys an meine Ohren und in diesem Moment verfluchte ich mein Gehör. Die anderen Pendler und Pendlerinnen schienen das Geschrei nicht wahrzunehmen. Ich unterdrückte ein genervtes Seufzten. Ein Mann im Anzug schob sich an mir vorbei und noch lange Zeit später hatte ich sein Aftershave in der Nase. Die Underground schnellte durch das unterirdische Tunnelsystem, begleitet vom donnernden Lärm.
Für die Allgemeinheit schien alles wie immer. Sie bemerkten die langsam aufkommenden Veränderungen nicht. In London braute sich etwas zusammen, das unweigerlich mit Caelum im Zusammenhang stand. Nur waren die Menschen nicht in der Lage, das zu sehen.
Am Piccadilly Circus stand eine Frau im Businessdress auf und ließ eine aktuelle Ausgabe der Daily Mail für den nächsten morgendlichen Pendler auf ihrem Sitz zurück. Ich schnappte mir die Zeitung, setzte mich und starrte auf die Überschrift des Leitartikels.
Menschen in der Gegend um den Regent’s Park, Marylebone, Fitzrovia und Camden Town verschwinden weiterhin, Ursache noch ungeklärt, lautete der Artikel. Mein Herz machte einen Satz und ich zwang mich, die aufwallenden Erinnerungen zu verdrängen. Ein ungutes Gefühl kroch mit der eisigen Kälte eines Wintermorgens in meinen Bauch und gab mir den Eindruck, nicht ausreichend vorbereitet zu sein.
Nicht jetzt.
Nicht hier.
Es war furchtbar, aber leider nichts Ungewöhnliches, dass in London Menschen verschwanden. Deren Tod oder Verschwinden waren meist ein Teil eines Gewaltverbrechens, das von grausamen Menschen ausgeführt wurde. Aber dies geschah nicht in so kurzen Abständen, wie es aktuell der Fall war. Die Häufigkeit machte mich mehr als stutzig. Die verschiedensten Medien spekulierten über dieses Mysterium.
Es gab keinerlei Hinweise und keine Spuren. Entführung? Verschleppung? Oder waren die Menschen einfach so verschwunden?
Eine Vorahnung bohrte sich seit einigen Wochen in mein Herz, obwohl es für meine Vermutungen derzeit keine Beweise gab. Nur ein paar vage Anhaltspunkte, denen ich nachging. Schnell klappte ich die Zeitung zu und legte sie beiseite. Ich glaubte nicht an Zufälle, alles war miteinander verbunden.
Ich bog in die Charing Cross Road ein und stapfte durch Pfützen, um zum Find and Read zu gelangen. Ich atmete langsam aus und sah, wie sich das nebelige Weiß meines Atems vor mir ausbreitete. Um mein neues Leben authentischer zu gestalten, verwirklichte ich das, was nahezu jeder einmal tat: Ich suchte mir einen Job.
Die Anzeige, dass das Find and Read eine Aushilfe brauchte, hatte ich auf einem Flyer gelesen, der seinen Weg damals in meinen Briefkasten gefunden hatte. Daraufhin hatte ich mich zur Buchhandlung begeben und mich auf traditionelle Art persönlich vorgestelllt. Die Besitzerin, Mrs Emily Williams, war begeistert von mir und meiner Liebe zu Büchern gewesen. Bereits am nächsten Tag hatte ich zur Probe gearbeitet und seitdem jobbte ich an drei Tagen in der Woche hier und verdiente mein eigenes Geld. Ich hätte es zwar nicht unbedingt gebraucht, da ich bei meiner Flucht mit Edelsteinen und Schmuck vorgesorgt hatte. Mein Bogen und mein Köcher sowie mein pelzbesetzter Umhang zählten zu den wenigen Erinnerungsstücken, die ich bei mir hatte. Aber ich wollte es so. Ich bestand darauf, so normal wie möglich zu sein. Zumindest wie es aufgrund meiner Vergangenheit und meiner Herkunft nur denkbar war.
Die Ladenglocke läutete beim Betreten. Gierig sog ich den Geruch der Bücher und ungelesener Geschichten ein. Eine behagliche Luft empfing mich und das dunstige Morgenlicht eines Herbsttages, das trotz des Regens durch die Scheiben fiel, verlieh dem Buchladen eine magische Atmosphäre. Ein paar Staubwolken tanzten im Licht.
Das Find and Read war ein kleiner, gemütlicher Buchladen und zwischen zahlreichen Büchern verkaufte die Besitzerin selbst gemachten Kuchen, Kaffee und Tee. Lesen war für mich schon immer mein liebster Zeitvertreib und hier, in dieser Welt, warteten unfassbar viele Geschichten auf mich. Die Vielfalt der Buchtitel war gigantisch. Im Gegensatz zu meinem alten Leben war es das Normalste der Welt, unsere Kunden bezüglich eines Buches zu beraten, mit ihnen ins Gespräch zu kommen und ein Heißgetränk zu servieren. Ich tat das komplette Gegenteil von einst.
»Guten Morgen Mrs Williams«, rief ich in die Stille hinein, um wenig später von der Eigentümerin freudig begrüßt zu werden. Sie war eine Frau Anfang vierzig, die ihren Laden mit der größten Hingabe und Sorgfalt pflegte und sich damit ihren Lebenstraum erfüllt hatte. Mrs Williams war eine der wenigen Personen, die sich durch nichts stressen ließen und mit einer ordentlichen Portion Ruhe gesegnet waren.
»Guten Morgen, Naira, der Tee ist schon aufgesetzt, nimm dir eine Tasse und häng deine nassen Sachen auf, danach kannst du mir helfen. Vorhin wurden mehrere Kartons mit den Neuerscheinungen angeliefert, die müssen sortiert und ausgestellt werden. Das Schaufenster kannst du auch gern anders dekorieren«, instruierte mich Mrs Williams mit ihrer melodischen Stimme, in der ein weit entfernter Akzent mitschwang.
Sie hob den Kopf zwischen den Kartons hervor und lächelte mir liebevoll zu. Dabei strich sie sich eine Strähne ihres dunkelblonden, schulterlangen Haars hinter die Ohren und musterte mich aus grauen Augen. Sie erhob sich, streckte ihre schlanke, groß gewachsene Gestalt und legte die Bücher zur Seite. Mit einem einfühlsamen Blick wandte sie sich mir zu.
»Bald ist Weihnachten und ich bin froh, dass du mich hier unterstützt.«
Verlegen und dankbar zugleich lächelte ich zurück. »Ich bin auch erleichtert. Das alles nur dank des Flyers in meinem Briefkasten.«
Sie schmunzelte. »Ja, manchmal geschehen die merkwürdigsten Dinge und leiten einem den Weg.« Eine Traurigkeit lag in ihrer Stimme.
Mrs Williams schätzte meine Arbeit und Hilfe. Sogar so sehr, dass ich mir regelmäßig Mängelexemplare kostenfrei mitnehmen durfte. Wobei das Wort ›Mängelexemplar‹ oft nicht aussagekräftig war. Bereits ein Buch, welches ein Eselsohr im Umschlag aufwies, war laut Definition eines dieser Exemplare, was mir nur zugutekam. Ich hängte zuerst meine nassen Sachen auf. Mrs Williams betonte immer wieder, dass Bücher und Wasser keine Freunde waren, worüber ich jedes Mal schmunzelte. Nach dem Tee packte ich die Kartons mit den Büchern aus und sortierte sie in die passenden Regale. Ich las mir ein paar Klappentexte durch und setzte direkt einige Werke auf meine mentale Wunschliste. Die Chefin und ich tauschten uns über die Neuerscheinungen aus und wetteten, welches Buch sich am meisten verkaufen würde.
Später holte ich aus dem Keller ein paar Boxen mit der Winterdekoration und schmückte das Schaufenster für die kommende Weihnachtssaison. Bei dieser Tätigkeit vergaß ich alles um mich herum, widmete mich mit voller Hingabe der Dekoration und träumte vom baldigen Weihnachtsfest.
Ich stellte einen Tisch mit Geschenkideen zusammen und hoffte, damit den Besuchern und Besucherinnen das Aussuchen von Geschenken zu vereinfachen. Dadurch hatte ich vor einem Jahr meine beste Freundin Hailey kennengelernt.
Während ich meine Arbeit an diesem Tag verrichtete, flogen die Stunden dahin. Meine Arbeitszeit verlief unspektakulär und immer wieder schaute ich hinaus auf die verregneten Straßen, nur um festzustellen, dass mir die Wärme und Gemütlichkeit des Buchladens am Herzen lagen.
Rückblickend betrachtet war das der letzte ruhige Arbeitstag, bevor sich mein Leben wieder einmal von Grund auf änderte. Bevor mich meine Vergangenheit mit geballter Kraft einholte und vor schwere Entscheidungen stellte.
Als meine Schicht vorbei war, klarte sich der Himmel etwas auf und es hörte auf zu regnen. Deshalb beschloss ich, mit Hailey in die Oxford Street zu fahren, um in den Läden zu stöbern oder die Schaufenster anzuhimmeln. Ein Besuch in meinem liebsten Laden durfte dabei nicht fehlen. Mit dem neu erstandenen Pullover von Marks & Spencer fuhr ich zurück in mein Apartment in Marylebone.
Ich klemmte mir die Post unter den Arm und beim Eintreten in meine Wohnung wurde ich direkt von meinen Katzen begrüßt, die mich schon sehnsüchtig erwarteten.
Ich setzte mich mit einem Buch und der Post in der rechten und einem Sandwich in der linken Hand in meine Leseecke an dem großen Erkerfenster. Die breite Fensterbank, die ich mit Kissen und Wolldecken dekoriert hatte, war der perfekte Ort, um zwischen zahllosen Seiten einzutauchen. Ich kaute genüsslich das Sandwich, während ich die Briefe und Flyer durchblätterte. Eine Einladung zu einem Buchclubtreffen, Eröffnungsrabatte des neuen Italieners drei Straßen weiter und … Ich hielt inne. Meine Hände zitterten unweigerlich und ich ließ die Broschüre achtlos zu Boden sinken. Mit der Ruhe war es vorbei.
Die Polizei ist weiterhin machtlos gegen das Verschwinden der Menschen und bittet um Hilfe möglicher Zeugen und Zeuginnen. Melden Sie sich unter …
Die Dämmerung setzte ein und ich beobachtete, wie der Himmel von einem wohltuenden, warmen Orange zu einem dunklen Lilablau wechselte. Die Farben spiegelten offensichtlich meine Gefühle wider. Ich beschloss, dem Regent’s Park im letzten Licht des Tages einen Besuch abzustatten. Ich musste es tun, denn ich wusste, dass ich sonst keine Ruhe finden würde. Ich spürte, dass etwas in Bewegung war und mich nicht losließ. Dort drüben im Regent’s Park hatte alles angefangen und meine Vermutung sagte mir, dass es dort weitergehen würde.
Kapitel 2
Ich überquerte die wenigen Straßen zum Park. Die untergehende Sonne vergoldete den aufkommenden Nebel, der den Stadtteil Marylebone langsam einnahm. Durch das imposante Eingangstor betrat ich den Regent’s Park und eine Gänsehaut breitete sich in mir aus. Ob vor Kälte oder dem merkwürdigen Gefühl in meinem Bauch vermochte ich nicht zu sagen. Es waren einige Spaziergänger unterwegs. Ich entdeckte einen Konstabler, der Handzettel an die Besucher austeilte.
Meine gewohnten Wege lief ich innerhalb kürzester Zeit ab und beobachtete die Umgebung genau. Ich hoffte, Anhaltspunkte zu finden, die auf das Verschwinden hindeuteten. Einen Beweis, wohin die Menschen letztlich verschwanden. Eine Spur, wer oder was dahintersteckte.
Ich wusste nicht genau, wonach ich suchte, was ich mir von meinen Besuchen hier erhoffte und warum ich mich dem überhaupt annahm, aber ich saß nicht untätig zu Hause, während sich vor meinen Augen etwas Furchtbares zusammenbraute. Das war noch nie meine Art gewesen. Obwohl ich bis jetzt keine eindeutigen Anzeichen gefunden hatte, gab ich die Hoffnung nicht auf und stattete dem Park regelmäßige Besuche ab. Dabei ließ mich das Gefühl nicht los, von irgendwo her beobachtet zu werden. Ich spürte Blicke auf mir ruhen, machte aber niemanden ausfindig. Bei Dunkelheit sahen meine Augen nahezu jede Feinheit, sie konnten sämtliche Details wahrnehmen und Veränderungen registrieren. Dennoch blieb ein entscheidendes Detail vor mir verborgen. Ein entscheidendes Detail, welches die Zusammenhänge erklärte und …
»Entschuldigen Sie, Miss? Miss?«, plötzlich riss mich eine Stimme aus meinen Gedanken und erschrocken drehte ich mich um. Einer der Konstabler kam auf mich zu. Ich blieb stehen und musterte ihn, während er in großen Schritten auf mich zueilte, das Gesicht rot vor Kälte.
»Miss, Sie haben doch sicher mitbekommen, dass es hier in letzter Zeit ein paar seltsame Vorkommnisse gab. Ich möchte Sie ungern beunruhigen, aber passen Sie auf sich auf und gehen Sie nach Möglichkeit nicht allein hinaus, vor allem nicht bei Dunkelheit.« Der Konstabler war jung, vermutlich gerade erst in den Dienst getreten und wollte vorbeugen, dass in seinem Revier eine weitere Person spurlos verschwand. Nur zu gut empfand ich seine Sorgen nach.
»Ja, Sie haben Recht, es ist leichtsinnig von mir«, flüsterte ich kleinlaut, um den Anschein einer jungen Frau zu vermitteln, die unsicher durch den Park lief.
Wenn er nur wüsste.
»Seien Sie einfach aufmerksam und falls Ihnen etwas auffällt, melden Sie sich bei der örtlichen Polizeidienststelle. Jede Kleinigkeit könnte uns dabei helfen, herauszufinden, was hier geschieht und wir könnten den Verantwortlichen endlich stellen.« Schließlich überreichte er mir eine Karte mit Notfallnummern, die ich dankend entgegennahm. Ich studierte sie und las, dass sein Name Leroy Robinson war. Dann ließ ich die Karte in meiner Manteltasche verschwinden.
»Vielen Dank, Mr Robinson.« Ich versicherte ihm, dass ich mich auf den schnellsten Weg nach Hause begeben würde. Manchmal fragte ich mich ernsthaft, was mit mir nicht stimmte, denn ich konnte binnen weniger Sekunden die glaubwürdigsten Lügen aus meinem tiefsten Inneren heraufbeschwören.
Seltsame Vorkommnisse.
Auch das war mir bereits aufgefallen.
Anfangs wurden die Fälle nicht öffentlich thematisiert, da Menschen hin und wieder nun mal verschwanden, aber nachdem sich die Ereignisse häuften, wurden Warnungen in den Nachrichten und sozialen Medien verkündet. Von den Personen fehlte einfach jede Spur. Es waren Männer, Frauen und manchmal sogar Kinder aus allen sozialen Schichten. Niemand hörte je wieder etwas von ihnen, geschweige denn, dass Leichen gefunden wurden. Diese Menschen wurden auf mysteriöse Weise von der Stadt verschluckt.
Nach dem Zusammentreffen mit dem Konstabler nahm ich mein Vorhaben wieder auf und suchte die Spazierwege und das Gebüsch unauffällig nach möglichen Spuren ab, fand aber bisher keine. Was geht hier nur vor?
Wenn ich doch nur genauer hingeschaut und hingehört hätte, dann hätte mein Leben vielleicht eine andere Wendung genommen.
Ich spürte die Anwesenheit einer weiteren Person mit einem Mal mit einer geballten Kraft. Um kein Aufsehen zu erregen, hielt ich den Blick starr zu Boden gerichtet und beobachtete meine Umgebung aus dem Augenwinkel. Den Stadtlärm, der mit der Ruhe des Parks kollidierte, blendete ich weitestgehend aus und konzentrierte mich auf das Hier und Jetzt. Meine Nerven lagen blank und die Anspannung in mir ließ jeden Schatten, der meinen Weg kreuzte, bedrohlich wirken.
»Stell dich nicht so an, Naira«, mahnte ich mich selbst. Wenn ich langsamer lief, wurden die Schritte hinter mir ebenfalls langsamer. Der aufkommende Wind wehte Laub auf, das unter meinen Stiefeln knisterte. Auch weiter hinter mir trat jemand auf trockene Blätter und blieb dann ruckartig stehen. Mein Herz setzte einen Schlag aus. Ich schluckte die auftretende Angst hinunter.
Nicht heute Nacht.
Ein lauteres Rascheln hinter mir ließ mich erneut aufhorchen. Ich warf einen Blick über meine Schulter und stellte nichts Ungewöhnliches fest. Eine Straßenlaterne malte einen Lichtkegel auf den Gehweg und ließ mich die dahinter liegende Dunkelheit nicht durchblicken. Ich strengte mich an und versuchte, auf die Geräusche zu achten: das Flattern eines Mantels im Wind, schwere Schritte oder ein Husten. Irgendetwas, das mir verriet, wer oder was mich verfolgte.
Aber es blieb still.
Der Gehweg war leer.
Ein seltsames Gefühl der Enge und Machtlosigkeit schnürte mir die Brust zu.
Ich schaute mich um und vergewisserte mich, dass der Eindruck, verfolgt zu werden, eben nur das war. »Pure Paranoia«, flüsterte ich und schüttelte den Kopf.
Bis zu meinem Ziel war es nicht mehr weit und mit einem letzten Blick in die Dunkelheit um mich herum, setzte ich den Weg fort. Sollte sich der Verfolger entschließen, mich einzuholen, würde er das früher oder später ohnehin tun. Ungern wollte ich hier auf ihn warten und eine einladende Beute abgeben. So leicht würde er oder sie es nicht haben.
Meine Sinne waren weiterhin geschärft, aber es schien, als hätte mein Verfolger von mir abgelassen. Hinter mir blieb es still. Scheinbar friedlich. Ich schaute ein letztes Mal über meine Schulter, um mich zu vergewissern, dass mir niemand gefolgt war. Egal aus welcher Welt.
Zügigen Schrittes lief ich durch den westlichen Teil des Parks, welcher so unscheinbar wirkte, dass ihm kaum Beachtung geschenkt wurde. Umso wichtiger war dieser Teil des Parks für mich.
Denn inmitten des Regent’s Parks befand sich das Ziel meiner Suche.
Groß und prächtig ragte die alte Eiche vor mir in die Höhe und obwohl ihr Laubdach im Herbst fehlte, wirkte sie majestätisch und beanspruchte mein ganzes Blickfeld. Eine gewisse Furcht stieg in mir auf, während ich die knorrigen Äste betrachtete, die sich wie ein Knochengerüst gen Himmel reckten.
Ich bemerkte, wie sich meine Nackenhaare aufstellten. Eine Gänsehaut kroch mir den Rücken hinauf. Meine Umgebung war vollkommen reglos, lediglich der Schrei einer Eule durchbrach die Stille. Meine Nerven waren angespannt. Die Kälte trieb mir Tränen in die Augen und ich spürte, wie sich meine Nase rot färbte. Instinktiv schlang ich meinen Mantel enger um mich. Die wenigen Laternen spendeten etwas Licht, aber wegen des aufsteigenden Nebels blieb meine Umgebung dunkel und verschleiert. Gegen die Natur kam selbst meine verbesserte Sicht nicht an. Neugierig schaute ich zu dem, was nur meine Augen erkannten.
Für jeden Menschen war dies bloß der Anblick einer alten, prächtigen Eiche, für mich jedoch war diese Erscheinung der Eintritt in eine andere Dimension. Durch den Stamm der Eiche führte ein Portal, dessen Umriss von ineinander geflochtenem Wurzelwerk umrandet war. Ich konnte die dahinterliegende Welt jederzeit betreten.
Es wäre nur ein Schritt. Ein Atemzug und ich wäre auf der anderen Seite.
Drüben. In Caelum.
Ehrfurcht gebietend thronte das Portal vor mir, als würde es mich rufen und zeitgleich verspotten.
Flimmernd, strahlend und in warmes Licht getaucht, bot mir das Portal den Weg nach Caelum, flehte mich an, nach Hause zu kommen. Es war, als würde man in einen Spiegel schauen, dessen Oberfläche in einem angenehmen Licht schimmerte und sich leicht auf und ab bewegte, fast schon pulsierte. Ich war gebannt von diesem Anblick und kurz überlegte ich, ob ich nicht doch meinen Heimatort betreten sollte. Zurück in mein früheres Leben.
Nur. Ein. Schritt.
Durch den großen Durchgang im Stamm der Eiche konnten nur wir hindurchtreten – das Volk der Elben. Wie gebannt stand ich da und schaute auf den Weg in meine Vergangenheit. Mein altes Dasein ließ ich mit nur wenigen Verlusten zurück. Ich wollte Entscheidungen selbst treffen und meine Existenz selbst bestimmen. Als ich nach London gekommen war, hatte ich nicht vorgehabt, je wieder nach Caelum zurückzukehren, denn ich hatte Träume, die sich nur hier in der Welt der Menschen erfüllen ließen.
Meine Arbeit in dem Buchladen, die vielen verschiedenen Menschen sowie Kulturen, die Technologien, die Vielfalt der Bücher, Filme und Mode … all das wollte ich nicht mehr missen.
Für mich war die Vorstellung, von Alter, Leben und Erfahrungen gezeichnet zu werden, nicht mehr wegzudenken. Begeistert von der Vorstellung zu altern und davon, dem Leben mit all seinen Hochs und Tiefs entgegenzutreten, hatte ich damals meinen Entschluss gefasst.
Kapitel 3 2,5 Jahre vor der Flucht Caelum, Palast von Valoncour
Es war ein weiterer kalter Morgen in Valoncour und die hohen Fenster waren mit Frost beschlagen. Ich griff nach einer Wolldecke, legte sie mir um die Schultern und trat langsam an die Fensterscheibe. Der Winter hielt im Königreich schon ewig an und ich fragte mich, wann die ersten Sonnenstrahlen den Schnee verjagten. Es gab Zeiten, in denen die Schneedecke anfing zu schmelzen, aber die Gefühle meines Vaters, dem König von Valoncour, ließen nicht zu, dass der Frühling vollends über uns hereinkam. Denn die Emotionen der Könige und Königinnen in Caelum beeinflussten das Wetter in den jeweiligen drei Königreichen. Das war Teil des Verbindungsrituals, das jede Herrscherin und jeder Herrscher mit Caelum einging. Bei der Zeremonie versprachen die zukünftigen Thronfolger, Caelum zu respektieren, die Natur zu schätzen und bestmöglich für ihr Königreich zu entscheiden. Besonders starke negative Gefühle und Emotionen wie Verzweiflung, Trauer oder Wut führten dazu, dass sich die Natur nicht richtig einpendelte und je länger die Gefühle anhielten, desto schwieriger wurde es, für den Ausgleich zu sorgen.
Und in Valoncour herrschte seit meiner Kindheit der Winter. Mal war es ein bissiger, kalter Winter, der uns Schneestürme brachte und dunkle Tage schenkte. Mal ein wunderschöner, glitzernder Wintermorgen, der Valoncour in eine atemberaubende Schönheit versetzte und die Fensterscheiben mit Schneekristallen schmückte.
Seit dem tragischen Verschwinden meiner Mutter war mein Vater in eine unbändige Verzweiflung verfallen, die mit den Jahren einer unendlichen Verbitterung gewichen war. Ich war damals zu klein gewesen, um zu verstehen, was geschehen war, und tröstete mich mit der Vorstellung, wie es wäre, eine Mutter zu haben.
Die lang anhaltende Winterzeit bereitete mir keine Sorgen, denn seit dem Verschwinden meiner Mutter war der Winter ohnehin über Valoncour hereingebrochen.
Die Asche, die neuerdings vom Himmel herabfiel, versetzte mich in Sorgen. Etwas geschah in den weiten Landen Valoncours. Die Einwohner misstrauten ihrem König und gaben ihm die Schuld, dass die Ernte verdarb oder die Kälte ihnen Krankheiten bescherte. Die frostklirrende Jahreszeit zehrte an dem Volk und solange mein Vater in tiefer Trauer wegen des Verschwindens meiner Mutter steckte, vollbrachten wir weiterhin unser Leben zwischen pudrigem Schnee und Eiseskälte.
Von einem lauten Klopfen wurde ich aus meinen Gedanken gerissen.
»Herein«, murmelte ich, als kurze Zeit später die Tür geöffnet wurde. Juna, meine Zofe, trat ein und ich freute mich, wenigstens ein herzliches Gesicht an diesem Tag zu sehen. Ihre rosigen Wangen leuchteten auf der hellen Haut und ihre grüngrauen Augen strahlten vor Freundlichkeit.
»Wie habt Ihr geschlafen, Prinzessin Namira?«, erkundigte sie sich und eilte auf mich zu.
Ich lächelte. »Nicht so förmlich, bitte. Ich fühle mich ausgeruht, danke«, gab ich zurück und bereitete mich für die morgendliche Prozedur vor. Während wir uns unterhielten, Juna mir meine Haare flocht und mich über meine heutigen Aufgaben und Anlässe informierte, sank meine Hoffnung, den Tag selbst zu bestimmen. Kaum merklich sackten meine Schultern hinab. Eigentlich sollte mich das nicht wundern, denn genau so lief es stets ab. Seit so vielen Jahren.
Dennoch gab ich diesen Hoffnungsschimmer nicht auf. Ich war wie ein Vogel, der dazu verdammt war, sein Leben in einem goldenen Käfig zu verbringen. Juna sah meine Traurigkeit, denn ich machte mir nicht mehr die Mühe, meine Gefühle zu verbergen.
»Lass den Kopf nicht hängen. Sobald du eines Tages Königin wirst …« Sie ließ den Satz unausgesprochen zwischen uns in der Luft hängen. Wir malten uns oft aus, was ich durchführen würde, sobald ich eines Tages Königin wurde. Angefangen beim Schokoladenessen über lange Ausritte durch den Aenwydd bis hin zum Frühlingseinbruch war alles dabei. Wir steigerten uns in die Fantasie, an einem warmen Frühlingstag im Garten zu lesen und den Blumen beim Wachsen zuzuschauen, ohne dass diese ständig vom Schnee bedeckt wurden. Aber ich bezweifelte, dass mir die Zeit für all die kindlichen Vorstellungen blieb.
Obwohl das mein geringstes Problem sein sollte.
Wir Elben wurden durchaus zweihundert Jahre alt, ohne dass man uns das Alter ansah. In der Zeitrechnung Caelums war ich zweiundfünfzig Jahre alt, mein Antlitz glich dem einer Anfang zwanzigjährigen, menschlichen Frau. Aber die Tatsache, dass ich jeden Tag Verpflichtungen, Ratssitzungen oder unter ständiger Bewachung stand, machte die Zeit zu meinem Feind.
»Bist du bereit?«, fragte mich Juna, nachdem ich für den heutigen Tag zurechtgemacht worden war. Wortlos gab ich ein Nicken von mir. Ich trat an die Tür und versuchte dabei, das ungute Gefühl in meiner Magengegend zu ignorieren. Das Gefühl, dass sich Valoncour verändert hatte. Dass da draußen in Caelum etwas war, das langsam näher kam, ohne dass es in meiner Macht stand, es aufzuhalten.
Meine Schritte hallten laut über den Marmorboden des Palastes wider, während ich zum Besprechungssaal schritt. Der Boden war so glatt poliert, dass ich mein Spiegelbild darin erkannte. Flankiert wurde ich dabei von meinen Leibwächtern, die mich keine Sekunde aus den Augen ließen. Wie so oft machte ich mir einen Spaß und stolzierte mal schneller und mal langsamer, lief einen kleinen Umweg oder blieb stehen, um mir eines der zahlreichen Gemälde anzuschauen, die im Palast hingen. Diese Momente waren meine persönlichen Siege. Was irgendwie traurig klang. Die Leibwachen kannten das Spiel und fügten sich meiner trüben Stimmung kommentarlos.
»Schon wieder dieses Gemälde?«, fragte mich Rian, während ich an einem Ölgemälde einer der unzähligen Verwandten, die ich nie gekannt hatte, stehen blieb und ein leichtes Zucken in seinen Mundwinkeln erkannte. Er legte den Kopf schief und musterte mich aus dunkelgrünen und mit Gold besprenkelten Augen. Eine Narbe verlief oberhalb der Augenbraue bis hinunter zu seiner Wange.
»Das ist eben ganz besonders interessant«, gab ich euphorisch zurück und tat, als interessierte es mich. Dabei kannte ich jedes einzelne Gemälde in diesen Palastmauern, sämtliche Pinselstriche – und sie waren allesamt furchtbar. Eine Monotonie aus Ölfarben und lustloser Ausdrücke. Mein Leben hier war trostlos und eintönig, genau wie diese Gemälde.
Rian trat neben mich und schaute ebenfalls zu dem Porträt. Seine blauschwarzen Haare waren an den Seiten kürzer geschnitten, sodass seine spitzen Ohren deutlich sichtbar waren und die verschnörkelten Tätowierungen präsentierten, die sich bis zu den Schläfen zogen.
»Du schaffst das, Namira«, flüsterte er mir zu.
Ich seufzte, denn es war Zeit, an meiner höfischen Aktivität teilzunehmen. Ich war die Thronfolgerin und es war meine Pflicht, bei den Ratssitzungen die neusten Nachrichten aufzunehmen und die Belange des Volkes anzuhören.
Ich betrat den Besprechungssaal und die Ratsmitglieder, Magistraten und Hochgeborenen begrüßten mich mit der gleichen nüchternen Distanziertheit wie immer. Die erste Ratssitzung langweilte mich und meine Gedanken schweiften immer wieder ab.
Die Hälfte der Zeit stieg ich durch die politischen, langatmigen Gespräche nicht durch, die andere Hälfte hörte ich nicht richtig zu. Mühsam unterdrückte ich ein Gähnen, denn die monotonen Monologe stimmten mich schläfrig. Mein Vater warf mir zwischendurch immer wieder mahnende Blicke zu und ich versuchte krampfhaft, den Besprechungen und Diskussionen zu lauschen.
Schnell gab ich auf.
»Die Ernte ist dieses Jahr schlechter ausgefallen als je zuvor. Wir müssen einsparen«, fing einer der Magistrate an und er gab sich Mühe, diese Worte nicht wie eine Anklage klingen zu lassen. Die Miene meines Vaters blieb unergründlich. Nach einer endlos hitzigen Diskussion, wie viele Bäume aus dem Aenwydd gefällt werden sollen, um zu Feuerholz verarbeitet zu werden, verlangte ein weiteres Anliegen unerwartet all meine Aufmerksamkeit. Zum ersten Mal schenkte ich dieser Ratssitzung mein volles Gehör. Ich richtete mich auf und betrachtete den Sprecher. »Der König und die Königin von Firnstáyn möchten in Erfahrung bringen, ob Ihr und Prinzessin Namira am diesjährigen Sommerball teilnehmen werdet?«, brachte Arkanos ein, der Oberkommandant der Stadtwache und gleichzeitiges Ratsmitglied von Valoncour war. Seine muskulöse Gestalt war einnehmend und der dunkle Bariton seiner Stimme bohrte sich tief in mein Gehör.
Mein Herz setzte einen Schlag lang aus und Hoffnung keimte in mir auf. Vor lauter Neugier rutschte ich auf meinem Stuhl hin und her.
Ein Sommerball.
Im Königreich Firnstáyn.
»Das ist unmöglich. Ich bin viel zu sehr in meine Arbeiten vertieft und ich kann jetzt nicht damit aufhören. Mit Bedauern müssen wir absagen«, schmetterte mein Vater die Einladung ab und somit gleichzeitig meine Aussicht, nach Firnstáyn zu reisen. Ein Schmerz stach mir tief in die Brust und ich sank in mich zusammen. Ich nahm all meinen Mut zusammen, räusperte mich und meldete mich zu Wort: »Aber vielleicht könnte ich teilnehmen. Das letzte Mal, dass wir in Firnstáyn waren, ist viel zu lang her und das würde unserem Bündnis …« Ich verstummte abrupt da sich sämtliche Augenpaare auf mich richteten. Normalerweise schwieg ich bei den Ratssitzungen, da meine Stimme kein Gewicht trug. Ich war nur die Thronerbin, nicht die Königin. Ich schluckte schwer und schaute unsicher in die Gesichter. Hoffte auf Zustimmung. Meine politische Einflussnahme war zu gering, als dass mir wirklich jemand beistehen würde.
Arkanos rieb sich über sein stoppeliges Kinn und nickte mir unauffällig zu.
Ich holte tief Luft. »Das würde unserem Bündnis die notwendige Tiefe verleihen.«
Mein Vater seufzte. »Namira, es ist nicht möglich. Was gibt es noch für Meldungen?«, richtete er das Wort wieder an Arkanos. Dieser sah kurz bekümmert zu mir und schenkte mir ein mitleidiges Lächeln.
»Aber Vater, wenn die Palastwache mich begleitet …«, setzte ich nochmals an, denn so schnell wollte ich nicht aufgeben. Nicht dieses Mal.
»Namira. Es reicht.« Zorn blitzte in den Augen des Königs auf. Meine Wut verrauchte zu Scham. Ich wünschte, ich hätte weiter für mein Vorhaben eingestanden, obwohl ich damit alles nur schlimmer gemacht hätte. Das Wort des Königs war Gesetz. Ich zitterte vor Empörung und Enttäuschung. Meine Kehle brannte, da ich die Wut zurückdrängte und hinunterschluckte.
Der Gedanke drängte sich wieder in mir auf, dass ich es leid war, bei der Ausübung meiner Macht als Prinzessin immer wieder von meinem Vater eingeschränkt zu werden. Zu meiner eigenen Sicherheit, wie er stets anmerkte. Darüber hinaus war es mir nicht einmal gestattet, einen alleinigen Ausritt zu tätigen, geschweige denn, mich an einem Markttag unter die anderen Elben zu mischen.
Meinen Blick hielt ich starr geradeaus gerichtet und vor lauter Ärger hörte ich das Rauschen meines Blutes in meinen Ohren.
Ich würde keinen fremden Himmel und kein Leben jenseits der Palastmauern haben. Es wurde mir untersagt, meinen eigenen Weg zu beschreiten. Dabei wollte ich mich frei durch Valoncour bewegen, den großen Markt besuchen oder durch den Aenwydd reiten, ohne um Erlaubnis zu betteln. An Bällen teilnehmen oder die Dörfer außerhalb der Stadtmauern besuchen. Wer nur in die Fußstapfen anderer trat, hinterließ keine eigenen.
Nach der Sitzung brachen sämtliche Ratsmitglieder in lautem Gemurmel auf und fokussierten sich auf ihr Tagesgeschäft. Nur mein Vater blieb sitzen. »Namira, du weißt, dass das nicht möglich ist. Hier bist du sicher und hier wird dir nichts passieren. Eines Tages wirst du das verstehen.« Sein Ton war sanft und bestimmend zugleich.
»Mir wird nichts passieren. Ich möchte raus, denn jeden Tag hier eingesperrt zu sein, ertrage ich nicht. Nur weil damals …«
»Es reicht. Ende der Diskussion. Ich muss wieder an die Arbeit.«
Und mir wurde klar, dass ich niemals auf Verständnis hoffen konnte. Diese Worte waren wie kaltes Wasser auf glühenden Kohlen.
Seit dem plötzlichen Verschwinden meiner Mutter wurde ich allein von meinem Vater, König Alfirin, aufgezogen. Ich erinnerte mich kaum noch an ihr Gesicht, dafür umso mehr an ihre Gutenachtgeschichten, auch wenn meine kindlichen Erinnerungen langsam verblassten.
Ich war Vaters Ein und Alles und er beschützte mich mehr, als gut für mich war.
Auf der einen Seite verstand ich diese Angst, denn eine geliebte Person zu verlieren, zerbrach einem das Herz. Auf der anderen Seite hinderte seine Furcht mich an einem freien Leben. Ich wurde ständig von der Außenwelt abgeschottet und vor einer Gefahr beschützt, die es nur im Kopf meines Vaters gab.
Zu meiner eigenen Sicherheit bekam ich Unterricht im Bogenschießen und im Schwertkampf, wobei mir diese Stunden immer wie eine willkommene Abwechslung von den Verpflichtungen als Thronerbin erschienen, die daraus bestanden, an Ratssitzungen teilzunehmen und mich den Studien Caelums zu widmen. Ein weiterer Vorteil war, dass ich mit der Zeit zu einer hervorragenden Bogenschützin ausgebildet worden war.
Auch wenn ich nie die Chance bekommen würde, an einer Jagd im Aenwydd teilnehmen zu können, war es ein Trumpf, dass ich mit Pfeil und Bogen schusssicher umgehen konnte. Vor wenigen Tagen war ich auf dem Bogenschießstand gewesen, um die Bewegungsabläufe durchzugehen, die mir mein Schützenmeister beigebracht hatte: Waffe aufnehmen, Ziel anvisieren, Atmung kontrollieren. Einatmen. Ausatmen. Schuss abfeuern. Ich traf jede einzelne Zielscheibe in der Mitte.
Seit meiner Geburt war mein Leben in Valoncour vorherbestimmt gewesen. Eines Tages würde ich Königin werden, aber bis dahin musste ich die perfekte Tochter und Prinzessin sein, schöne Kleider tragen und an höfischen Aktivitäten teilnehmen, die mich meistens langweilten. Alles natürlich in Begleitung meiner treuen Leibwache.
Kapitel 4
Bis zu meiner nächsten Verpflichtung am Abend blieb mir etwas Zeit, und diese wenigen Stunden der Freiheit verbrachte ich in unserer Bibliothek. Diese umfasste zwei Stockwerke. Das obere beherbergte zusätzlich einen Laubengang, von dem man auf die untere Etage sah. Eine aufwendig gestaltete Glaskuppel zierte das Dach und durchflutete die Bibliothek mit Tageslicht. Efeu rankte an den unzähligen Bücherregalen und Säulen. Dieser Ort zählte zu meinen liebsten im Palast, denn beim Lesen war ich frei. An meinem Lieblingsort mischte sich der hell glänzende Marmorboden, der mit Goldintarsien geschmückt war, mit dem Geruch von alten Schriftrollen und staubigen Einbänden.
»Willkommen Prinzessin«, begrüßte mich der blinde Bibliothekar, welcher dabei war, in Leder gebundene Bücher zu sortieren.
»Was dürfen wir heute für Euch heraussuchen?«, stellte er die Frage aller Fragen.
Ich ignorierte die Leibwachen in meinem Rücken und überlegte. »Etwas von John Milton. Und die Berichte des Ordens, die ich noch nicht kenne«, verkündete ich und freute mich schon sehnsüchtig.
»Gewiss, wie Ihr wünscht«, sagte der alte Bibliothekar und schenkte mir ein wissendes Lächeln. Ich vermutete, dass er mindestens so alt wie die Bibliothek selbst war. Er kannte jedes Buch und wusste genau, wo welche Schriftrolle zu finden war.
»Es wird uns eine Freude sein. Wir bringen Euch die Werke.«
Und mit ›wir‹ meinte der Bibliothekar seinen treuen Gehilfen. Flüsternd wandte er das Wort an Muril, sein geflügeltes, schneeweißes Frettchen, welches sofort voller Neugier den Blick von seiner Schulter hob und an ihm hinabkletterte. Es rümpfte die Nase und nahm die Witterung auf. Ich sah Muril in das Labyrinth der Bibliothek verschwinden und wusste, dass ich bald mit neuem Lesestoff versorgt werden würde.
»Nehmt schon einmal Platz, Muril wird Euch die gewünschten Werke bringen.« Er nickte mir zu und richtete seine blinden, milchigen Augen wieder auf den Stapel Bücher vor sich.
Ich ließ mich an einem der ausladenden Schreibtische nieder, die Leibwachen platzierten sich in einiger Entfernung hinter mir und gewährten mir Privatsphäre beim Lesen und Studieren der Schriften, die bereits auf dem Tisch lagen. Ich fragte mich, wie Muril so schnell und flink die Werke fand. Mit Rian traf ich ein stilles Übereinkommen, um wenigstens zwischen all den Büchern eine Ruhe auszukosten. Ich bekam die Möglichkeit, ungestört in wundersame Geschichten einzutauchen und meine Leibwachen wurden von ihrer Pflicht erlöst. Was sollte mir schon inmitten all der staubigen Schriften passieren? Das Schlimmste wäre vermutlich ein Papierschnitt.
Vorsichtig, um die alten Seiten nicht zu zerreißen, blätterte ich in einem Werk von John Milton, das ein Entdecker des Ordens zu seiner Zeit in England erstanden hatte. Dann schaute ich zu den Berichten, die meine Aufmerksamkeit auf sich zogen. Gespannt las ich die Aufzeichnungen, die meine Vorfahren und der Orden der Entdecker angefertigt hatten, als sie den Globus der Menschen bereisten und erkundeten. Zu den Zeiten, als die Portale in Caelum aktiv waren. Die Portale ermöglichten dem Orden der Entdecker, Wissen über die Menschheit und ihre Errungenschaften zu sammeln und dazu Schriften anzufertigen. Natürlich lebten sie in Einklang mit den Menschen, wenn sie ihre Welt betraten. Ihre Mission diente der Lehre.
Seitdem mein Vater mir die ersten Berichte gezeigt hatte, verlor ich mich sofort in der menschlichen Welt und wollte sie unbedingt eines Tages selbst betreten. Angezogen wurde ich von den Geschichten der alten Ägypter. Mich faszinierten die Vorstellungen, dass Pyramiden für einen Pharao gebaut, die Grabkammern mit Schätzen gefüllt und mit Hieroglyphen bemalt worden waren. Die Skizzen und Mythen der Sphinx beeindruckten mich und ich träumte sogar des Nachts von ihr. Denn das war das Mächtige an Büchern und Schriften: Ich träumte mich in ferne Welten, während ich hinter den Palastmauern eingesperrt war.
Der Bericht, der vor mir lag, stammte aus London aus dem Jahr 1600.
Um von London aus weiter in die Welt der Menschen zu reisen, gründete der Orden der Entdecker in England im Jahre 1600 die britische Ostindien-Kompanie. Damit bescherte er nicht nur den stolzen und hochgewachsenen Elben einen großen Fortschritt, sondern auch der englischen Nation.
Die Portale minderten die sichtbaren Merkmale der Elben, was meinen Vorfahren ermöglichte, unter den Menschen zu leben. Das offensichtlichste Merkmal, die spitzen, langen Ohren verkleinerten sich. Unter den Menschen galten wir als überdurchschnittlich groß. Die würdevolle Ausstrahlung sowie die geschärften Sinne blieben, was nicht selten als Arroganz abgetan wurde.
Bei Reiseberichten aus dem Fernen Osten schmeckte ich förmlich die verschiedensten Gewürze, die dort beschrieben wurden. Ich las zwei Berichte über das Mittelmeer und die Schönheit der Buchten und Strände. Ich stellte mir die glitzernden Schaumkronen vor, die vom Meer her aufgewühlt wurden.
Mein Blick glitt zu dem Standglobus, der ein Geschenk des Ordens gewesen war. Ich erhob mich und bewegte nachdenklich die Weltkugel. Beobachtete, wie Länder und Kontinente in meinem Blickfeld auftauchten und schnell wieder verschwanden.
Europa. Amerika. Asien
Finnland.
Schottland.
Die Kugel wurde langsamer.
Meine Finger strichen über diverse Länder und Seen, während sich die Kugel ausdrehte, und tippten am südlichen Wendekreis unterhalb des Äquators auf Argentinien.
Ein Lächeln zupfte an meinen Mundwinkeln. In der Geografie war ich unschlagbar.
Wie es aber aktuell auf dem Globus der Menschen aussah, wusste ich nicht, denn es waren über einhundert Jahre vergangen, seit der letzte Bericht verfasst worden war. Die Portale in Caelum wurden von den mächtigsten Magiern und Magierinnen ihrer Zeit verschlossen. Die Rede war von Kriegen, Bosheit und Waffen, die ich mir nicht einmal vorzustellen vermochte.
Der Orden der Entdecker beschloss wegen dieses Wandels, die Portale zu unserer eigenen Sicherheit zu verschließen. Deshalb bestand die Arbeit meines Vaters darin, das Portal im Aenwydd zu finden und wieder zu aktivieren. Bis jetzt war er jedoch erfolglos geblieben.
Ich schritt zurück zum Schreibtisch und las noch zwei weitere Stunden in den Werken.
Seufzend legte ich die Berichte aus den verschiedenen Jahren zusammen, als mein Augenmerk auf eine Stadtkarte fiel, die zwischen den Seiten herausglitt.
London 1920.
Mein Zeigefinger fuhr die Linien der Themse nach. Ich wusste nicht genau, was es war, aber diese Karte zog mich in ihren Bann. All die Details, Straßennamen, Parks und Gebäude … So eine Karte hatte ich nie zuvor gesehen und die Zeit reichte nicht mehr aus, sie gründlich zu studieren. Mein Atem beschleunigte sich.
Ein innerer Drang kam in mir hoch, die Stadtkarte während meiner einsamen Zeit genauestens zu erforschen. Meine Neugier wurde entfacht.
Ich schaute mich unauffällig um. Muril war zwischen den Bücherregalen verschwunden, die Leibwachen standen in einiger Entfernung und unterhielten sich leise flüsternd. Mit nervösen Fingern faltete ich die Karte zusammen und schob sie schnell in meinen Ärmel. Mein Herz klopfte, denn ich hatte noch nie etwas aus der Bibliothek gestohlen. Ausgeliehen ja, aber meine Neugier verleitete mich dazu, mir diese Karte anzueignen. Mit klopfendem Herzen stand ich auf und wollte mich zum Gehen abwenden, als ich in meinem Augenwinkel etwas Weißes sah.
Ein Fauchen erschreckte mich und Muril kletterte am Schreibtisch hoch. Polternd ließ ich einen Stapel Bücher fallen und die Leibwachen drehten sich alarmierend zu mir.
»Es ist alles in Ordnung«, rief ich.
Obwohl es nur ein geflügeltes Frettchen war, sah es mich eindringlich und wissend an. Es fletschte die Zähne und ich wich zurück. Ich drückte die Hände an meine Brust und fragte mich, ob es wirklich beißen würde. Es kam noch einen Schritt auf mich zu und unweigerlich stieß ich den Stuhl um. Erneut drehten sich die Wachen zu mir und musterten mich. Innerlich flehte ich Muril an, mich nicht auffliegen zu lassen. Muril keckerte mich streng an, als es wieder grummelnd und kopfschüttelnd verschwand.
»Prinzessin, ist wirklich alles in Ordnung?« Rian war zu mir gekommen und musterte mich verwirrt. Seine dunkelgrünen Augen waren unergründlich.
»Ja, Muril hat mich nur erschrocken«, murmelte ich und konnte die Aufregung in meiner Stimme nicht verbergen. Rian fuhr sich durch die blauschwarzen Haare und sah sich um. Die beiden anderen Wachen stießen zu uns.
»Ihr solltet nun aufbrechen, um rechtzeitig an der nächsten Sitzung teilzunehmen«, riss mich Rian aus meinen Gedanken und ich schreckte erneut zusammen. Die nächste langweilige Sitzung hatte ich völlig verdrängt.
»Ich wollte Euch nicht erschrecken«, stammelte Rian sichtlich über meine Reaktion verwirrt.
»Es gibt nichts zu entschuldigen«, erwiderte ich und schämte mich. Hastig und mit klopfenden Herzen schritt ich zum Ausgang. Ich verabschiedete mich von dem blinden Bibliothekar, der seine milchig-weißen Augen wissend zusammenkniff. Sein Blick heftete sich auf mich und er schien mich zu durchschauen.
Die gestohlene Karte drückte sich bleischwer in meine Haut und schien mich daran zu erinnern, dass ich etwas Unrechtes verrichtete. In meinem eigenen Palast wurde ich zu einer Diebin.
Kapitel 5
Nach der zweiten langweiligen Ratssitzung verstaute ich die Stadtkarte von London in einem Schmuckkästchen. Unruhig lief ich in meinem Zimmer auf und ab und mich überkam das Verlangen, hinaus zu treten. Der Winter war an diesem Abend angenehmer, wenn auch kalt. Vom Himmel fiel kein neuer Schnee. Die erste Schneeschicht des Morgens war bereits gefroren und fest. Ich lächelte, denn genau das hatte ich erhofft. Das Kleid, welches ich trug, tauschte ich schnell gegen eine dicke Leinenhose und Stiefel, denn diese würde ich für mein Vorhaben brauchen. Ich zog mir einen pelzbesetzten Umhang über, um mich vor der Kälte zu schützen. Noch einmal drehte ich mich zu der Zimmertür und lauschte. Rian und eine zweite Wache standen gewissenhaft davor. Kein Mucks war zu hören, also schritt ich leisen Fußes zu dem Fenster und öffnete es geräuschlos. Unter mir lagen der Palast und die Stadt Valoncour in dem ersten Schatten des Abends, was mir erlaubte, mich in der Dunkelheit zu verstecken. Ich stieg lautlos aus dem Fenster, fand Halt an der überstehenden Fensterbank und zog mich mit Schwung auf eine Überdachung. Ich kletterte an einer Mauer entlang, um den Gebäudeteil zu überqueren, bis ich einen geeigneten Punkt gefunden hatte, um über die Dächer zu balancieren. Oft kam ich bei Einbruch der Nacht zum Nachdenken hierher. Die kalte Nachtluft und der Sternenhimmel hoch über mir halfen dabei, meine Gedanken zu ordnen, um nicht vollends den Verstand zu verlieren. Die Spitzdächer der Palasttürme zeichneten sich gegen den Mond ab. Ich bahnte mir einen Weg, bis ich einen kleinen Hof unter mir erspähte, in dem die Dienstboten ihre Arbeit verrichteten.
Mein Interesse war geweckt. Ich kroch still und heimlich bis zum Rand und lugte von Neugier erfüllt auf den Hof hinab. Dann ertönten Stimmen, was mich sofort innehalten ließ. Mein Puls beschleunigte sich, während ich mich im Dunkeln gegen eine Mauer lehnte und vorsichtig über das Dach nach unten schaute. Unter mir wurde der Hof von Fackeln beleuchtet und drei Gestalten verrichteten ihre Arbeit. »Sie sollte sich wirklich glücklich schätzen. Jeden Tag im Warmen, immer frisches Essen auf dem Tisch«, schnatterte eine Botin, während sie Küchenabfälle auf einen Komposthaufen warf.
»Und der ewige Winter. Was kann König Alfirin so verbittert haben, dass wir nie auch nur den Hauch von Frühling zu Gesicht bekommen?«, wütete sie weiter, die Stimme beinahe zu einem Flüstern gesenkt. Aber ich verstand jedes Wort. Mein Magen verkrampfte sich. Diese Anschuldigungen hätten ein Todesurteil für sie bedeutet und ich schüttelte den Kopf wegen ihres Leichtsinns.
»Vielleicht rächt er sich an uns«, überlegte eine männliche Stimme. Der Bedienstete war ihr mit einem weiteren Eimer gefolgt.
»Halt den Mund, du Narr. Wofür denn rächen? Wir haben seine Frau nicht entführt, weggezaubert oder umgebracht. Wir schuften jeden Tag, damit die feinen Herrschaften mehrere warme Mahlzeiten bekommen, während unsere Ernte immer schlechter wird«, zischte die Frauenstimme wieder und sie zog geräuschvoll die Nase hoch.
»Dieser Palast fühlt sich Tag für Tag dunkler an. Kälter. Ich für meinen Teil bin froh, wenn ich genug Geld gespart habe, um mit meiner Familie nach Westen zu wandern. In Firnstáyn feiern sie einen Sommerball. Stell dir die wohlige Wärme nur einmal vor. Und die Ernte erst. Ich werde eines Tages dorthin aufbrechen auch wenn es sich um eine törichte Idee handelt. Aber dort würde es meiner Familie besser gehen«, säuselte die Dienstbotin weiter und ich hörte eine Sehnsucht aus ihr sprechen.
»Schluss jetzt«, mischte sich eine dritte Stimme in das Gespräch ein und klatschte in die Hände, sodass ich zusammenzuckte. Ich erkannte sie sofort.
Juna.
Sie trat mit den Armen in die Hüfte gestemmt in den Schein einer Fackel.
»Wir können uns nicht beklagen. Uns mangelt es nicht an Lebensmitteln, wir bekommen hier warme Mahlzeiten und dürfen uns glücklich schätzen, dem König und der Prinzessin zu dienen«, sprach Juna laut.
»Du kannst dich auch nicht beklagen, Elbchen, die Prinzessin mag dich. Auch wenn sie sonst immer verschlossen und traurig ist«, gab der männliche Dienstbote zu bedenken.
Ich hörte Juna schnauben. Die Stimmen verhallten, als die drei den Hof zurück in die Küche verließen, dann lag der Palast wieder still da.
Ich hatte genug gehört. Ich war wütend auf die harten Worte, mich selbst und meinem Vater. Erschöpft ließ ich den Kopf gegen die Mauer sinken und atmete tief aus.
»Hast du genug gehört?«, erkundigte sich eine Stimme über mir und ich zuckte zusammen. Rian blickte traurig durch eines der Fenster. Er war einer der wenigen im Palast, dem ich vertraute und der mir bei meinen nächtlichen Ausbrüchen den Rücken freihielt.
»Ich denke schon«, gab ich gedankenverloren zurück und schloss die Augen.
»Es ist nur …«, fing ich an und überlegte. »Ich habe das Gefühl, dass ich in meinem eigenen Palast nicht willkommen bin. Während der Ratssitzungen bin ich nur eine stille Zuhörerin und ich bekomme nicht einmal die Chance, den Elben von Valoncour etwas Gutes zu tun. Wahrscheinlich kennen sie mich nicht einmal. Mich plagt der Gedanke, dass meine Mutter verschwunden ist ebenfalls, aber …«, ich holte tief Luft, »was kann ich tun, damit mein Vater über diesen Verlust hinwegkommt?« Die Sorgen platzten aus mir heraus. »Und egal was ich möchte, ich kann an meiner Situation oder an der meines Vaters nichts ändern.«
Rian schaute mich lange aus seinen unergründlichen Augen an, ehe er den Blick abwandte und in den Nachthimmel sah. Sein Haar verschmolz mit der Farbe der Nacht und die Narbe zeichnete sich hell auf seiner Haut ab.
»Jedes Herz besitzt eine ganz eigene Macht und es ist nicht deine Aufgabe, die Herzen zu heilen. Ich weiß, dass es schwierig ist, mit den Vorwürfen der Bewohner zurechtzukommen, aber …« Unbewusst glitt seine Hand zu seinen tätowierten Ohren. Zum ersten Mal klang seine Stimme unsicher. Zittrig.
»Ich bin der Sohn einer Magierin und eines Elben und meine Mutter dachte, wenn sie die Runen direkt sichtbar auf meine Ohren und Schläfen tätowierte, könnte sie die Magie damit erwecken. Aber die Magie blieb aus und täglich wuchs ihre Abscheu mir gegenüber. Bis ich eines Tages fortgelaufen bin und mich der Palastwache anschloss. Selbst hier treten mir einige Einwohner und Einwohnerinnen misstrauisch gegenüber, dabei flammt nicht einmal der kleinste Funke Magie in meinen Adern.«
Ich hing an seinen Lippen, lauschte seiner Geschichte – auch wenn sie noch so traurig war. »Ich bin mir ziemlich sicher, Namira: Wenn deine Zeit als Königin gekommen ist, machst du Valoncour zu dem schönsten Königreich.«
Ich wischte mir eine Träne aus dem Augenwinkel.
»Soll … soll ich irgendetwas unternehmen?«, erkundigte sich Rian vorsichtig und nickte in Richtung des Hofes, denn er hatte das Gespräch mitbekommen. Schwer seufzte ich.
»Nein, das würde nur noch mehr Missstimmung erzeugen und außerdem käme dann wahrscheinlich heraus, dass ich mich nicht dort befunden habe, wo ich eigentlich sein sollte«, gab ich kleinlaut zu.
Rian grinste aufmunternd und seine Augen strahlten.
»Wahrscheinlich hast du recht. Kann ich mich also darauf verlassen, dass du nun zurück in deine Gemächer kehrst? Bevor wir beide noch im Kerker landen«, fügte Rian hinzu.
»In Ordnung«, versprach ich ihm und setzte zum Rückweg an.
Ich kletterte flink zurück, schlüpfte durch das offene Fenster und befand mich wenige Augenblicke später in meinem Palastzimmer.
Am folgenden Mittag öffnete Rian mir die Tür zum Besprechungssaal und ich ließ mich neben meinem Vater nieder. Er nickte mir zu und ich bemerkte, dass er aufgebracht wirkte. Die nächste Ratssitzung folgte, an der ich stillschweigend teilnahm. Meine Gedanken waren überall, nur nicht hier.
Ich dachte, dass es einfacher werden würde.