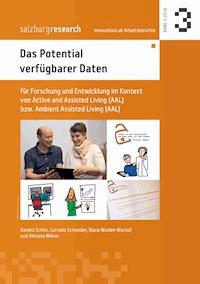
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Serie: InnovationLab Arbeitsbericht
- Sprache: Deutsch
Der Bestand frei verfügbarer Daten (z.B. Open Data, Big Data, Forschungsdatensätze) verdoppelt sich Schätzungen zufolge etwa alle zwei Jahre. Dies wird als große Chance für Forschung und Entwicklung gesehen, auch im Feld des Ambient (Active) Assisted Living (AAL). Welche konkreten Möglichkeiten es gibt und welchen Mehrwert verfügbare Daten für die Forschung und die Entwicklung von AAL-Lösungen darstellen, ist dabei unklar. Für diesen Band wurde das bestehende Angebot an frei verfügbaren Daten (u.a. Public Government Data und Open Data) aus Österreich und relevanten internationalen Vergleichsregionen zusammengetragen und beschrieben und die Relevanz für AAL-Forschungszwecke und -themen diskutiert. Vor dem Hintergrund einer Zusammenschau über aktuelle Auswertungsmöglichkeiten von verfügbaren Daten werden zudem mögliche innovative Zugangsweisen der Nutzung verfügbarer Daten für die österreichische AAL-Community vorgestellt. Der Band beruht dabei auf Forschungsarbeiten der sechsmonatigen „Studie zu den Potentialen von Open Data (und anderen verfügbare Daten) zu AAL-Fragestellungen” (ODAAL 09/2015-02/2016, Projektnummer 850814), die im Rahmen des Programms „benefit – Intelligente Technologien für ältere Menschen“ durch das österreichische Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (BMVIT) sowie die FFG – Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft beauftragt wurde. Gleichzeitig ist der Band der dritte in der Schriftenreihe des Forschungsbereichs InnovationLab mit dem Titel „InnovationLab Arbeitsberichte“ der Salzburg Research Forschungsgesellschaft mbH mit Sitz in Österreich. Die Schriftenreihe dokumentiert Ergebnisse aus Forschungs- und Innovationsprojekten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 123
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Vorwort
Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
die vorliegende Auftragsstudie wurde im Frühjahr 2015 ausgeschrieben, rund ein Jahr später liegt das Ergebnis in Form dieser Veröffentlichung vor. In nur sechs Monaten wurden drei Workshops mit Expertinnen und Experten durchgeführt, ein Katalog für verfügbare Daten entworfen, gefüllt und auch kreative Möglichkeiten der Nutzung von verfügbaren Daten im Kontext von AAL erdacht und diskutiert.
Damit uns dies gelingen konnte, war Unterstützung notwendig, für die wir uns bedanken möchten. Unser herzlicher Dank gilt zunächst allen Expertinnen und Experten, die diese Studie durch ihre Teilnahme bei unseren drei Workshops unterstützten, namentlich in alphabetischer Reihenfolge:
Georg Aumayr (Johanniter Österreich Ausbildung und Forschung gemeinnützige GmbH), Fabio Batz (Vidatio, FH Salzburg), Hans Demski (Helmholtz Zentrum München), Andreas Diensthuber (Geschäftsführer SOLGENIUM OG), Alexander Eder (Fonds Soziales Wien), Georg Eschbacher (Vidatio, FH, Salzburg), Julia Himmelsbach (AIT), Harald Hochreiter (FFG), Daniela Krainer (FH Kärnten), Johannes Oberzaucher (Ambient Assisted Living, Medizintechnik/Medical Engineering, Fachhochschule Kärnten), Walter Prinz (BMVIT), Christian Stingl (FH Kärnten), Harry Timons (Amt der Salzburger Landesregierung), Birgit Trukeschitz (Forschungsinstitut für Altersökonomie der WU Wien), Jürgen Umbrich (WU Vienna, Institute for Information Business), Lukas Wanko (Vidatio, FH Salzburg), Rupert Westenthaler (RedLink GmbH) und Markus Wiedhölzel (Salzburg AG).
Zudem möchten wir uns auch herzlich bei beiden Verantwortlichen des benefits-Programm Gerda Geyer (FFG) und Kerstin Zimmermann (BMVIT) für die unkomplizierte und kooperative Zusammenarbeit bedanken.
Schließlich gilt unser Dank auch unseren Kolleginnen und Kollegen bei der Salzburg Research Forschungsgesellschaft, die im Studienverlauf als Expertinnen und Experten sowohl bei den Vorbereitungen der Workshops geholfen als auch durch ihre Teilnahme unterstützt haben (in alphabetischer Reihenfolge): Richard Brunauer, Daniela Gnad, Georg Güntner, Werner Moser und Siegfried Reich.
Sandra Schön für das ODAAL-StudienteamSalzburg Research ForschungsgesellschaftMärz 2016
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung und Hintergrund
1.1 Ambient Assisted Living bzw. Active and Assisted Living (AAL)
1.2 Problemstellung
1.3 Zielsetzung und Vorgehen der Studie im Überblick
2. Verfügbare Daten und unterschiedliche Perspektiven im Kontext von AAL
2.1 Unterschiedliche Formen der Verfügbarkeit von Daten
2.2 Verfügbare Daten nach dem Grad ihrer Aufbereitung bzw. Aggregation
2.3 Datenformate von verfügbaren Daten
2.4 Verfügbare Daten nach Umfang - der Sonderfall Big Data
2.5 Anbieter/innen und Quellen verfügbarer Daten
2.6 Perspektiven auf die verfügbaren Daten im Bereich von AAL
2.7 Anforderungen an Daten aus Perspektive der AAL-Community
3. Verfügbare Daten mit Relevanz für die österreichische AAL-Community
3.1 Vorgehen bei der Sammlung und Auswahl der Daten
3.2 Vorgehen bei der Beschreibung und Erfassung der Daten
3.3 Der ODAAL-Katalog
3.4 Die beschriebenen Datenquellen
3.5 Übersicht über verfügbare Daten mit Hinblick auf Themen
3.6 Nutzbarkeit im Hinblick auf unterschiedliche Eigenschaften der Daten
3.7 Verfügbare Daten, die nicht im Katalog erfasst wurden
4. Unterschiedliche Verfahren der Auswertung von verfügbaren Daten
4.1 Überblick und Vorgehensweise bei der Recherche und Darstellung
4.2 Aufereitung von verfügbaren Daten
4.3 Verfahren der statistischen Analyse
4.4 Verfahren des Webmonitoring und der Informationsextraktion
4.5 Qualitative Zugänge der Text- und Bildanalysen
4.6 Soziale Netzwerkanalyse
4.7 Verfahren der künstlichen Intelligenz
4.8 Data Mining
4.9 Mash-Ups und Verknüpfung von Datenquellen
4.10 Auswertung von Floating/Big Data
4.11 Visualisieren und interaktive Darstellungen
4.12 (Integriertes) Auswertungstool auf Webplattformen
4.13 Zusammenschau: Allgemeine Chancen und Herausforderungen
5. Mögliche Nutzungsszenarien verfügbarer Daten im Kontext von AAL – Ergebnisse des Kreativ-Workshops
5.1 Vorgehen
5.2 Überblick
5.3 Entwicklung der Nachfrage nach Rollatoren – Google Trends
5.4 Marktforschung: Kommunikation mit älteren Familienmitgliedern
5.5 Mehr Bewegung! – Eine Bewegungsmotivations-App
5.6 Service-App für beeinträchtigte Nutzer/innen im öffentlichen Verkehr
5.7 Wiener Kartenservice für mobilitätseingeschränkte Personen
5.8 Ambulanzfinder
5.9 Hotelrezensionen von älteren Reisender und deren Bedürfnisse
5.10 Bedarfsanalysen zur AAL-Zielgruppe durch Analyse von Fotos
5.11 Was die Expertinnen und Experten interessant und herausfordernd finden
6. Chancen und Herausforderungen der Nutzung von verfügbaren Daten im Kontext von Active and Assisted Living bzw. Ambient Assisted Living (AAL)
6.1 Vorgehen
6.2 Publikationen zu Chancen und Herausforderungen im Kontext von AAL
6.3 Das Thema „Kosten“
6.4 Das Thema „Qualität“
6.5 Das Thema „Datenschutz“
6.6 Die Themen „Innovation und Transparenz“
7. Chancen und Herausforderungen der Nutzung von verfügbaren Daten in AAL aus unterschiedlichen Perspektiven
7.1 Perspektive der Datenanbieter/innen
7.2 Perspektive der Forschung im Kontext von AAL
7.3 Perspektive der Policy Maker
7.4 Perspektive der Datennutzung in AAL-Services
7.5 Perspektive der End-Anwender/innen
7.6 Perspektive der Marktforschung und Innovationsentwicklung
8. Zusammenschau und Ausblick
8.1 Zusammenschau: Daten und Potential sind vorhanden – aber ausbaufähig
8.2 Erwartung: Ein Zuwachs an verfügbaren Daten
8.3 Der große Spielraum als Chance
8.4 Mögliche unterstützende Maßnahmen für die Nutzung
9. Anhang
9.1 Literaturverzeichnis
9.2 Materialien
1 EINLEITUNG UND HINTERGRUND
1.1Ambient Assisted Living bzw. Active and Assisted Living (AAL)
Die Zielsetzung im Arbeits- und Forschungsbereich des sog. „Ambient Assisted Living“ bzw. seit einiger Zeit oft auch als „Active and Assisted Living“ bezeichnete Feld (beide: kurz AAL) ist es, die Lebensqualität bei Älteren zu Hause durch die Entwicklung und Nutzung innovativer Technik und Assistenzsysteme zu erhalten und zu steigern. Dabei umfasst AAL „als ein hybrides Produkt eine technische Basisinfrastruktur im häuslichen Umfeld und Dienstleistungen durch Dritte mit dem Ziel des selbstständigen Lebens zuhause“ (VDE, 2012, S. 9).
Die wichtigen Domänen von AAL sind dem VDE (2012) zufolge Kommunikation, Mobilität, Selbstversorgung und häusliches Leben (ebd., S. 14). In den letzten Jahren hat es sich zu einem bedeutenden Forschungsgebiet in Europa entwickelt, was sich u. a. an der Einführung von Joint Programming Initiativen zeigen lässt12. Im Programm „Ambient Assisted Living“ wird mit dem Punkt „Living actively and independently at home“ eine Verschiebung des thematischen AAL-Bezugs auf Aspekte wie Lifestyle, Lebensqualität, soziale Inklusion und Prävention deutlich.
Um hier gezielte Aktivitäten und Services für AAL zu entwickeln, bedarf es nicht nur der passenden Technologie, sondern eben auch ausreichender Informationen über die Lebenssituation und Bedürfnisse der Zielgruppe. Um umgebungsunterstütztes Leben zu erleichtern und zu optimieren, werden Studien unterschiedlicher Art durchgeführt. Häufig handelt es sich dabei um Befragungen; wobei sowohl standardisierte als auch qualitativ-partizipative Verfahren zum Einsatz kommen. Letztere finden häufig bei Entwicklungsprojekten mit enger Einbindung der Zielgruppe statt3.
Die Verschiebung des AAL-Fokus und der Zielgruppen wirkt sich dabei ebenso auf Informationsbedürfnisse und -gewinnungsmethoden aus: Es werden Daten für Bewegungs-, Verhaltens- und Interaktionsanalysen notwendig. Da AAL-Lösungen zukünftig auch vermehrt über private Zahler/innen finanziert werden, werden auch andere Informationen wie beispielsweise regionale/überregionale Kaufkraft oder Marktstatistiken wichtiger. Es stellt sich die Frage, ob es hilfreich ist, alternativ oder ergänzend existierende Daten, insbesondere solche, die mithilfe des Internets zur Verfügung stehen, auszuwerten, um neue relevante und hilfreiche
Informationen zu AAL-Themen zu erhalten. Allgemein lässt sich der Prozess der Verwendung existierender Daten folgendermaßen darstellen (s. Abbildung 1).
Prototypischer Forschungsprozess mithilfe existierender Daten
Abbildung 1: Prototypischer Forschungsprozess mithilte existierender Daten
Während bei der eigenen Datenerhebung die Forschungsfrage klar definiert ist, wird diese bei der Verwendung von existierenden Datensätzen häufig erst im Nachhinein bestimmt bzw. konkretisiert (vgl. Pfeil von der Interpretation zur Forschungsfrage in Abbildung 1). Darüber hinaus bestimmen die Datenformate und der Umfang der Daten auch die Datenverarbeitung und -auswertung (vgl. Wechselwirkungspfeil in Abbildung 1). Beim herkömmlichen Verfahren sind hingegen das Datenformat und -auswertung eine (auch, aber nicht allein durch praktische Aspekte beeinflusste) Folge der Forschungsfrage.
1.2Problemstellung
Auch wenn es Beispiele für die Nutzung von verfügbaren Daten für AAL-relevante Informationen gibt, fehlt eine systematische Darstellung für die konkreten Möglichkeiten und das damit verbundene Potential. Offene Fragestellungen in diesem Zusammenhang sind beispielsweise die Fragen nach den relevanten verfügbaren Daten, den notwendigen oder möglichen Analysetechniken (vgl. Abbildung 2) sowie (zukünftige) Realisierungen und Erfahrungen damit.
Forschungsleitende Fragestellungen im Projekt
Abbildung 2: Forschungsleitende Fragestellungen im Projekt
Als erste Herausforderung ist also zu klären, welche Daten prinzipiell zugänglich sind, um für den österreichischen Kontext relevante Informationen der Generation 60+ und AAL-Themen zu erhalten. Hier ist es notwendig, eine Übersicht der Angebote, insbesondere, aber nicht nur, von Open Government Data zu geben. In der herkömmlichen sozialwissenschaftlichen Forschung wird zunächst eine Forschungsfrage gestellt, dann werden die Konzepte entsprechend operationalisiert und in einer Befragung umgesetzt. Die Antworten werden wiederum hinsichtlich der Eingangs gestellten Forschungsfragen und ggf. Hypothesen ausgewertet und interpretiert. In der Nutzung vorhandener Daten, und insbesondere bei Daten die eben nicht gesondert durch Befragungen erhoben wurden (z. B. Big Data), stellen sich andere Herausforderungen an die Analyseverfahren. So ist es hier durchaus üblich und sinnvoll, explorativ vorzugehen und auch kreative Auswertungsverfahren einzusetzen.
Insbesondere ergeben sich bei bestimmten Datenformaten und -strukturen auch eine Reihe notwendiger oder möglicher Arbeitsschritte zur Datenaufbereitung oder -auswertung (Bitkom, 2012). Zur Bewältigung der Anforderungen umfangreicher Datenmengen (Big Data) sind Verfahren der künstlichen Intelligenz (Machine Learning, Reasoning) notwendig, es können Verfahren wie soziale Netzwerkanalysen von Interesse sein oder auch explorative Data-Mining-Verfahren oder Visualisierungen.
Eine Herausforderung besteht also darin, dass es notwendig erscheint, nicht nur den Status quo von verfügbaren Daten und Verfahren zu beschreiben, sondern auch kreativ-innovative Ideen für Analysemöglichkeiten zu entwickeln.
Von besonderem Interesse sind dabei
Kombinationen von Daten bzw. Methoden (z. B. mit Linked-Data-Technologien);
neue Methoden und Verfahren (z. B. Data Mining, Verfahren für Big Data) und
kreative Nutzung von Daten(-sätzen), die nicht auf den ersten Blick geeignet erscheinen, z. B. die Verzeichnisse von Patenten, Fotos auf einer Plattform.
Neben der Entwicklung innovativer Analyseansätze zur Informationsgewinnung im Themenfeld AAL ist es übrigens durchaus möglich, dass auch (Ideen für) neuartige Business- und Service-Modelle entstehen können (vgl. Bitkom, 2015).
Das Potential wird allgemein als vorhandene bzw. noch nicht genutzte Möglichkeiten beschrieben (z. B. Mackensen, 1991, S. 828). Wie lässt sich das Potential vorhandener Daten für AAL-Entwicklung und -Forschung einschätzen? Diese Frage zu beantworten hat auch gesellschaftliche Relevanz. Die Möglichkeit, mehr über die Nutzung von offenen Daten zu AAL-relevanten Aspekten zu erfahren, stärkt mittelbar insgesamt die Bemühungen und Zielsetzungen der AAL-Aktiven und ihre gesellschaftlich relevanten Absichten. Aufbauend auf den Ergebnissen solcher zukünftigen (Sekundär-)Analysen lassen sich Verbesserungen im Hinblick auf die Zielgruppe erwarten: Auswertungen des Mobilitätsverhalten können dazu führen, dass öffentliche Verkehrsangebote verbessert werden, indem sie an die Bedürfnisse älterer Menschen angepasst werden (und so die gesellschaftliche Teilhabe gefördert werden kann). Ebenso kann die Auswertung geografischer Daten dazu führen, dass medizinische oder andere Versorgungsstrukturen verbessert werden können, indem geografische Versorgungslücken identifiziert werden. Problematische Aspekte dieser Entwicklung, insbesondere wenn Big-Data-Entwicklungen angesprochen sind, können dabei Auswirkungen auf schutzwürdige Aspekte wie Datenschutz und Persönlichkeitssphäre berühren. Die unmittelbaren Projektergebnisse sind von dieser Herausforderung jedoch nicht betroffen; das Thema wird dabei zudem kritisch im Rahmen der Möglichkeiten adressiert.
1.3Zielsetzung und Vorgehen der Studie im Überblick
Ziel der vorliegenden Studie ist das Potential der verfügbaren Daten (hier in einem weiten Sinne als „Open Data“ bezeichnet) für die AAL-Community zu untersuchen, und dabei auch innovative Zugangsweisen zu explorieren. Teilziele sind dabei:
das bestehende Angebot an frei verfügbaren Daten (aus Österreich bzw. relevanten internationalen Vergleichsregionen) systematisch zu identifizieren und kriterienbasiert zu beschreiben (Ergebnis: Bestandsaufnahme Teil 1);
die Relevanz für AAL-Forschungszwecke und -themen basierend auf klassischen Auswerteverfahren zu analysieren (Ergebnis: Bestandsaufnahme Teil 2), und
exemplarisch das Potential für neue AAL-Fragestellungen und Lösungen durch innovative Zugangsweisen, z. B. neu kombinierbare offene Datensätze unter Einbezug neuer und komplexer Auswertungsverfahren, aufzuzeigen (Ergebnis: Potentialanalyse).
Im Projekt werden dabei drei Zugänge gewählt: (a) eine Sammlung der aktuell verfügbaren Daten (u. a. Public Government Data und Open Data), (b) ihre Analyse im Hinblick u. a. AAL-relevanter Fragestellungen für die österreichische Community sowie (c) die kreativ-kritische Diskussion neuartiger Ansätze für die Kombination und/oder Analyse der Daten. Dabei wird methodisch u. a. auf Recherchen unterschiedlicher Art, systematische Sammlung und kriterienorientierte Analyse sowie auch die Validierung und den Transfer der Ergebnisse im Rahmen von Workshops mit Expertinnen und Experten in interdisziplinärer Zusammenstellung gesetzt.
Abbildung 3: Eindrücke vom 3. ODAAL-Workshop am 20. Jänner 2016
1 (JPI) "More Years, Better Lives – The Potential and Challenges of Demographic Change", URL: http://www.jp-demographic.eu/ (2015-02-15)
2 http://www.aal-europe.eu/ (2015-02-15)
3 exemplarisch ist hier z. B. folgende Zusammenstellung aufzuführen: http://partner.vde.com/bmbf-aal/publikationen/pages/publikationen.aspx (2015-02-15)
2 VERFÜGBARE DATEN UND UNTERSCHIEDLICHE PERSPEKTIVEN IM KONTEXT VON AAL
In diesem Kapitel wird ein allgemeiner Überblick über unterschiedliche Anbieter, Formen und Formate von verfügbaren Daten gegeben.
2.1Unterschiedliche Formen der Verfügbarkeit von Daten
Daten werden auf unterschiedliche Weise zur Verfügung gestellt (s. Tabelle 1).
Tabelle 1: Unterschiedliche Formen der Verfügbarkeit der Daten
Daten, die im Web schrankenlos zugänglich sind dürfen nicht ohne weiteres genutzt werden; auch nicht, wenn es sich dabei um wissenschaftliche Zwecke handelt. Damit Daten genutzt werden können, müssen sie (s. Open Data in Tabelle 1) mit offenen Lizenzen eindeutig zur entsprechenden Nutzung, inkl. Modifikation und Wiederveröffentlichung freigegeben sein. Zur Lizenzierung von Open Data kommen so häufig die Creative-Commons-Lizenzoptionen „CC BY“ bzw. „CC BY-SA“ oder auch das Äquivalent zur US-amerikanischen Public Domain (CC 0) zum Einsatz4. Exemplarische, nutzergenerierte Open-Data-Projekte sind u. a. die Open-StreetMap-Initiative (Haklay & Weber, 2008) und DBPedia (Bizer u. a., 2009).
2.2Verfügbare Daten nach dem Grad ihrer Aufbereitung bzw. Aggregation
Zunächst lassen sich die Daten danach unterscheiden, inwieweit sie bereits aufbereitet zur Verfügung gestellt werden. Hierzu erweiterten wir in Tabelle 2 eine Darstellung von Stockinger (2013, S. 30) und unterscheiden Rohdaten, strukturierte Daten und aggregierte Daten.
Gerade in den Open-Government-Verzeichnissen finden sich in der Regel strukturierte Daten (z. B. CSV-Daten; s. Köhler & Meir-Huber, 2014). Ob die Strukturierung der Daten selbsterklärend ist, ist dabei offen – semantisch eindeutige Bezeichnungen sind dazu z. B. notwendig und Informationen zur Datenerhebung hilfreich. Daneben gibt es auch eine Reihe von (schwerer auszuwertenden) unstrukturierten Daten, z. B. in Form von PDF- oder DOC-Dateien oder auch Bewertungen in Online-Portalen.





























