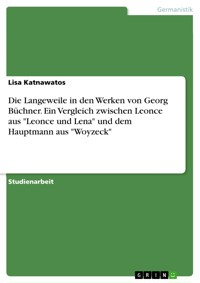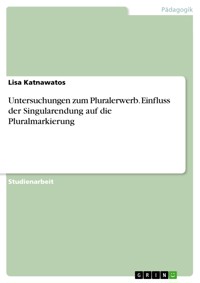36,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Studylab
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Bislang lassen sich nur wenige Studien ausfindig machen, die sich mit dem Belastungsempfinden im Referendariat auseinandersetzen. Noch dazu zielen diese meist darauf ab, aufzuzeigen, dass Prävention und Beratung schon früh in der beruflichen Laufbahn von Lehrkräften notwendig sind, jedoch nicht, wo genau diese anzusetzen sind. Aber welche Bereiche beziehungsweise Faktoren belasten Referendare besonders? Wie entwickelt sich das Belastungsempfinden im Laufe des Referendariats? Sind einige Personen besser geeignet als andere, um dem Druck im Referendariat standzuhalten? Fühlen sich Referendare vielleicht sogar stärker belastet als erfahrene Lehrkräfte? Das vorliegende Buch soll Antworten auf diese Fragen finden und Anstöße für die zukünftige Forschung geben, indem die erwähnten Studien, die sich mit dem Referendariat als belastende Phase der Lehrerausbildung beschäftigen, unter diesen Fragestellungen neu betrachtet werden. Die Entwicklung des Belastungsempfindens steht dabei im Mittelpunkt, da sich vor allem mit dieser Thematik bisher nur sehr wenig beschäftigt wurde. Wie dieses Buch jedoch noch zeigen wird, ist sie nicht unerheblich für die Entwicklung von Präventions- und Beratungsangeboten. Aus dem Inhalt: – Belastung im Referendariat; – Prävention und Beratung; – Beispiel Schweiz; – Persönlichkeitsmerkmale; – Empirische Untersuchung;
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 124
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2015 GRIN Verlag / Open Publishing GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt beiwww.grin.com
Inhaltsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Zusammenfassung
1 Einleitung
2 Theoretische Grundlagen
2.1 Das Referendariat
2.1.1 Allgemeine Bemerkungen
2.1.2 Das Referendariat in Rheinland-Pfalz
2.2 Probleme der Lehrerausbildung
2.2.1 Kritik an der Lehrerausbildung
2.2.2 Der Praxisschock
2.3 Die Lehrerausbildung in der Schweiz
2.4 Das Belastungsempfinden
2.4.1 Zur Definition einiger Begriffe
2.4.2 Die Transaktionale Stresstheorie
2.5 Belastung von Referendaren
2.5.1 Belastungsfaktoren im Lehrerberuf
2.5.2 Zusätzliche Belastungsfaktoren im Referendariat
2.5.3 Folgen der Belastung
2.6 Zur Bedeutung von Persönlichkeitsmerkmalen
2.6.1 Das Fünf-Faktoren-Modell
2.6.2 Einfluss von Persönlichkeitsmerkmalen auf das Belastungsempfinden von Lehrkräften
2.7 Die Kompetenzentwicklung angehender Lehrkräfte
2.8 Fragestellungen und Hypothesen
3 Methode
3.1 Ein- und Ausschlusskriterien für Literatur
3.2 Literaturrecherche und -selektion
3.3 Beschreibung der selektierten Studien
4 Ergebnisse
4.1 Hypothese 2
4.1.1 Referendare
4.1.2 Schweizerische Berufseinsteiger
4.2 Hypothese 3
4.2.1 Referendare
4.2.2 Schweizerische Berufseinsteiger
4.3 Hypothese 4
4.3.1 Referendare
4.3.2 Schweizerische Berufseinsteiger
4.4 Hypothese 1
4.4.1 Referendare
4.4.2 Schweizerische Berufseinsteiger
5 Diskussion
5.1 Hypothese 2
5.2 Hypothese 3
5.3 Hypothese 4
5.4 Hypothese 1
5.5 Grenzen dieser Arbeit und Vorschläge für zukünftige Forschung
5.6 Theoretische und praktische Implikationen
6 Literaturverzeichnis
7 Anhang
7.1 Anhang A
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Übersicht der ausgewählten Studien
Tabelle 2: Gegenüberstellung der Regressionskoeffizienten für die jeweiligen Persönlichkeitsmerkmale und Komponenten des Belastungsempfindens aus den Studien von Klusmann et al. (2012) und Tönjes-von Platen (2010)
Zusammenfassung
1 Einleitung
Es wird von der Öffentlichkeit zumeist angezweifelt, dass der Lehrberuf einen der anstrengendsten Berufe darstellt. Schüler[1] haben oft den Eindruck, dass der Lehrer lediglich vor der Klasse steht, Fragen stellt und darüber hinaus nichts Großartiges zu leisten hat. Zu diesem Eindruck tragen meist auch noch die Eltern der Schüler bei, die den Lehrkräften belastende Aufgaben absprechen sowie die kurze Arbeitszeit und die langen Ferien betonen. Tatsächlich sind es jedoch vor allem die Berufe aus dem Gesundheits- und Sozialwesen sowie aus den Bereichen Erziehung und Unterricht, die von einem Burnout betroffen sind (Meyer, Stallauke & Weirauch, 2011, S. 267). Lediglich 4% aller Pflichtschullehrer erreichen die normale Dienstaltersgrenze (Sieland, 2001, S. 36), wobei zahlreiche Frühpensionierungen aufgrund von Dienstunfähigkeit einhergehen. Deren Anteil lag 2001 im Lehrberuf mit 54% bundesweit sogar deutlich höher als in anderen verbeamteten Berufsgruppen (Lehr, 2004; zitiert nach Schmitz & Voreck, 2011, S. 241).
Diese drastischen Werte geben zu denken, wenn man sich vor Augen führt, dass diese starke Belastung nicht erst mit dem Berufseinstieg einhergeht. Wenn schon für erfahrene Lehrkräfte solche Ausmaße psychischer Belastung festgestellt werden, wie hoch müssen sie dann für Referendare sein, die neben den gewöhnlichen Anforderungen des Lehrberufs auch noch Prüfungen, Unterrichtsbesuche und den sogenannten Praxisschock zu bewältigen haben? Die folgenden Artikelausschnitte geben eine vorläufige Antwort auf diese Frage.
Müller erzählt von seinem Referendariat wie andere von einer Lebenskrise. „Ich bin ein belastbarer Mensch, aber das hat mich wirklich an die Grenze gebracht“, sagt er. Das größte Problem bei der Umstellung des Referendariats sei die Verkürzung, über die er sich am Anfang so gefreut hatte. „Es herrscht ein wahnsinniger Organisations- und Zeitdruck. Das ist furchtbar. Ich kenne keinen Kollegen, der darüber nicht gestöhnt hätte.“ […] Das Referendariat wurde verkürzt, die Zahl der Lehrproben blieb aber die gleiche. Lehrproben, so war das auch früher schon, werden von Referendaren als eine Art Schauspiel erlebt, das mit normalem Unterricht nichts zu tun hat. „Die Vorbereitung darauf ist unglaublich intensiv. 30 Zeitstunden muss man einplanen, es ist absurd“, erzählt der ehemalige Referendar Müller. (Beer, 2014)
Man betritt ein völlig neues soziales Umfeld und muss zugleich die Schüler kompetent unterrichten sowie erziehen und sich zusätzlich mit den Lehrerkollegen gut stellen. Hinzu kommt ein großer Leistungsdruck: Niemand verlangt von einem Lehrer einen perfekten Unterricht, aber ein Referendar wird hieran gemessen. Er darf keinen Schüler vernachlässigen, soll den Unterricht spannend aber auch didaktisch wertvoll gestalten und zugleich ein guter und kompetenter Kollege werden. Hinzu kommen Nachmittagstermine, wie Klassenkonferenzen und Besprechungen bzgl. der eigenen Ausbildung. Hierbei sind die Kandidaten unter ständiger Begutachtung und Bewertung. (Voltz, 2012)
Herauszuhören ist immer wieder der enorme Leistungsdruck, unter dem die Referendare stehen. Sie müssen unrealistische und zeitaufwändige Unterrichtsstunden planen, anhand derer ihre Eignung zum Lehrberuf beurteilt wird, und dabei unzählige weitere Anforderungen bewältigen. Dass das Referendariat von Betroffenen als „persönliche Krise“ (Schedensack, 1995) oder sogar als die schlimmste Phase ihres Lebens (Gerstenberg, 2010) bezeichnet wird, erscheint unter diesen Umständen nachvollziehbar. Dies schlägt sich auch in der hohen Abbruchquote von 20% (Sieland, 2004; zitiert nach Drüge et al., 2014, S. 370) und dem Vergleich mit anderen Akademikergruppen nieder, in dem sich die Lehramtsanwärter hinsichtlich der Anfangsschwierigkeiten im Beruf an der Spitze befinden (Beiner & Müller, 1982, S. 13).
Dennoch lassen sich bislang nur wenige Studien ausfindig machen, die sich mit dem Belastungsempfinden im Referendariat auseinandersetzen. Noch dazu zielen diese meist darauf ab, aufzuzeigen, dass Prävention und Beratung schon früh in der beruflichen Laufbahn von Lehrkräften notwendig sind, jedoch nicht, wo genau diese anzusetzen sind. Aber welche Bereiche bzw. Faktoren belasten Referendare besonders? Wie entwickelt sich das Belastungsempfinden im Laufe des Referendariats? Sind einige Personen besser geeignet als andere, um dem Druck im Referendariat standzuhalten? Fühlen sich Referendare vielleicht sogar stärker belastet als erfahrene Lehrkräfte?
Das vorliegende systematische Review soll Antworten auf diese Fragen finden und Anstöße für die zukünftige Forschung geben, indem die erwähnten Studien, die sich mit dem Referendariat als belastende Phase der Lehrerausbildung beschäftigen, unter diesen Fragestellungen neu betrachtet werden. Die Entwicklung des Belastungsempfindens steht dabei im Mittelpunkt, da sich vor allem mit dieser Thematik bisher nur sehr wenig beschäftigt wurde. Wie diese Arbeit jedoch noch zeigen wird, ist sie nicht unerheblich für die Entwicklung von Präventions- und Beratungsangeboten.
Im Folgenden werden zunächst theoretische Grundlagen thematisiert, um wichtiges Hintergrundwissen zur Betrachtung der Forschungsfragen bereitzustellen. Dafür wird anfangs ein grober Überblick über das Referendariat als zweite Phase der Lehrerausbildung vermittelt, auf das erst allgemein und dann spezifisch für das Bundesland Rheinland-Pfalz[2] eingegangen wird. Anschließend sollen Probleme der Lehrerausbildung dargelegt werden, die erste Anhaltspunkte für die Formulierung der Hypothesen und auch die spätere Interpretation der Ergebnisse liefern. Eingegangen wird dabei auf die Kritik, die die einzelnen Phasen der Lehrerausbildung erfahren, und den sogenannten Praxisschock, der viele Referendare beim Übergang in die Praxis erwartet.
Da an späterer Stelle ein Vergleich zwischen deutschen Referendaren und schweizerischen Berufseinsteigern vorgenommen werden soll, um eventuelle Unterschiede hinsichtlich des Belastungsempfindens dieser Personengruppen festzustellen, wird in einem Kapitel die Lehrerausbildung in der Schweiz skizziert. Diese weist einige Unterschiede zu der Ausbildung in Deutschland auf, weshalb dementsprechend unterschiedliche Ergebnisse im Hinblick auf die Forschungsfragen und Hypothesen erwartet werden können.
Bevor sich überhaupt mit dem Begriff Belastungsempfinden auseinandergesetzt werden kann, müssen dieser und weitere Begriffe wie Belastung, Beanspruchung und Stress erläutert werden, da diese Definitionen nicht so selbstverständlich sind, wie sie auf den ersten Blick erscheinen. In diesem Zusammenhang soll auch die Transaktionale Stresstheorie nach Lazarus Erwähnung finden, in der deutlich wird, dass gerade die subjektive Bewertung einer Situation für die Stress- bzw. Belastungswahrnehmung entscheidend ist.
In einem weiteren Kapitel werden potentielle Belastungsfaktoren angeführt, die allgemein mit dem Lehrberuf als auch spezifisch mit dem Referendariat einhergehen, um einen Überblick über die Fülle an Anforderungen zu schaffen, die Referendare zu bewältigen haben. Daran anschließend werden die Folgen von Belastung thematisiert, insbesondere das Burnout-Syndrom. Sie zeigen auf, dass Hilfe früh angesetzt werden sollte.
Um zu überprüfen, ob einige Personen besser geeignet sind als andere, um dem Druck im Referendariat standzuhalten, wird der Einfluss von Persönlichkeitsmerkmalen auf das Belastungsempfinden in den Blick genommen. Dafür werden im theoretischen Teil die fünf stabilen Persönlichkeitsmerkmale, die in den Studien untersucht werden, näher erläutert, ehe auf Untersuchungen eingegangen wird, die sich mit dem Einfluss dieser Merkmale auf das Belastungsempfinden von Lehrkräften beschäftigen. Die jeweiligen Ergebnisse bilden die Grundlage für die Formulierung der Hypothese im Hinblick auf die Referendare.
Im letzten theoretischen Kapitel steht die für die Entwicklung des Belastungsempfindens entscheidende Kompetenzentwicklung innerhalb des Berufseinstiegs im Mittelpunkt, ehe aus dem Theorieteil Hypothesen hergeleitet werden.
Die nachfolgenden Kapitel beschäftigen sich mit der Überprüfung dieser Hypothesen, indem verschiedene Studien dafür herangezogen werden. In einem ersten Schritt werden die Ein- und Ausschlusskriterien für die Studien dargelegt, ehe ein kurzer Überblick darüber gegeben wird, wie bei der Literaturrecherche und -auswahl vorgegangen wurde. Ein weiteres Kapitel widmet sich der Beschreibung der ausgewählten Studien. Daran anschließend werden die Ergebnisse der verschiedenen Studien in Bezug auf die Hypothesen ausgewertet und interpretiert. Hierbei wird jeweils zusätzlich ein Vergleich mit einer Studie aus der Schweiz vorgenommen.
2 Theoretische Grundlagen
Dieser Abschnitt der Arbeit schafft einen Überblick über wichtige theoretische Grundlagen, die im Zusammenhang mit dem Thema stehen. Gleichzeitig bildet er die Grundlage für die spätere Formulierung der Hypothesen, denen sich diese Arbeit widmet.
2.1 Das Referendariat
Die Lehrerausbildung in Deutschland setzt sich aus zwei Phasen zusammen: die universitäre Ausbildung, die die wissenschaftliche Grundlage in zwei Fächern und Erziehungswissenschaften legen soll, und das daran anschließende Referendariat im Kontext des späteren Berufsfeldes (Terhart, 2000, S. 23). Dabei erfährt vor allem die erste Phase der Lehrerausbildung von vielerlei Seiten Kritik, die hauptsächlich den fehlenden Praxisbezug betrifft. Nicht selten fühlen sich angehende Lehrer aufgrund dessen im Referendariat ins kalte Wasser gestoßen, wenn sie dort mit eben dieser Praxis konfrontiert werden.
Da exakt diese Phase der Lehrerausbildung in der vorliegenden Arbeit in den Blick genommen werden soll, wird im Folgenden zunächst ein grober Überblick über das Referendariat im Allgemeinen vorgenommen, ehe durch Konzentration auf das Bundesland Rheinland-Pfalz ein tieferer Einblick gewährt werden soll.
2.1.1 Allgemeine Bemerkungen
Das Referendariat, auch pädagogischer Vorbereitungsdienst genannt, stellt die zweite Ausbildungsphase des Lehrerberufs dar und unterscheidet sich in den verschiedenen Bundesländern formal nur geringfügig, obgleich auch eine allgemeine Beschreibung dieser Phase unter Umständen nicht jedem Bundesland gerecht werden kann. In der Dauer des Vorbereitungsdienstes lassen sich beispielsweise nur geringe Unterschiede finden, da beinahe alle Bundesländer 18 Monate dafür vorsehen. Ausnahmen stellen dabei Sachsen-Anhalt mit 16 Monaten, Hessen mit 21 Monaten und Bayern mit 24 Monaten dar. Thüringen unterscheidet noch einmal hinsichtlich der verschiedenen Lehrämter: Für das Lehramt an Grundschulen sind 18 Monate und für die anderen Lehrämter 24 Monate zu absolvieren, dabei ist bei letzteren jedoch eine Verkürzung möglich (GEW Berlin, 2015). Die Ausbildung findet in allen Bundesländern sowohl an Studienseminaren als auch an den entsprechenden Ausbildungsschulen statt. Dabei setzt sie sich in allen Bundesländern aus Einführungsveranstaltungen, Hospitationen, begleitetem Unterricht, selbstständigem Unterricht (KMK, 2012, S. 3), der je nach Bundesland quantitativ unterschiedlich angesetzt ist (Lenhard, 2004, S. 277), und einer Ausbildung in seminaristischen Veranstaltungsformen zusammen (KMK, 2012, S. 3). Zusätzlich sollen die Referendare, im Folgenden auch Lehramtsanwärter oder Anwärter genannt, an schulischen Konferenzen, Sprechtagen und anderen Veranstaltungen teilnehmen, um aktiv an der Gestaltung des Schullebens mitzuwirken und einen tieferen Einblick in ihr späteres Berufsleben zu erhalten (Lenhard, 2004, S. 277).
In den Seminaren steht die Reflexion der praktischen Erfahrungen in den Ausbildungsschulen im Vordergrund, denen dort auf theoretischer Ebene, unter anderem auch durch die Diskussion von Handlungsalternativen in Konflikt- und Problemsituationen in Schule und Unterricht, begegnet werden soll (Lenhard, 2004, S. 279f.). Darüber hinaus werden in den Seminaren auch didaktische und fachdidaktische Inhalte sowie die Differenz zwischen Theorie und Praxis thematisiert. Dabei sollen sowohl allgemeine als auch spezielle Fragen in den Bereichen von Unterricht und Erziehung geklärt werden, beispielsweise die Didaktik und Methodik der Unterrichtsfächer, rechtliche und organisatorische Rahmenbedingungen und die Variation von Unterrichtsmethoden (Terhart, 2000, S. 116f.).
In den Ausbildungsschulen sind die Referendare Teil eines Kollegiums, in dem sie Anleitung und Unterstützung durch ihre Ausbildungslehrer erhalten. Es unterscheidet sich meist nach Schultyp, ob ihnen dabei feste Mentoren zur Seite gestellt werden. Dies ist beispielsweise oft an Hauptschulen der Fall. Am Gymnasium dagegen ist häufig die Lehrkraft Ausbildungslehrer, die ihren Unterricht für Lehramtswärter öffnet und ihnen entsprechende Unterstützung und Beratung bietet. Da die Studienseminare in der Regel mit den jeweiligen Ausbildungsschulen zusammenarbeiten, sind den Ausbildern an den Studienseminaren die Ausbildungslehrer sowie die Situationen an den Schulen meist bekannt, sodass sie auch im Hinblick darauf Unterstützung bieten können (Lenhard, 2004, S. 278ff.).