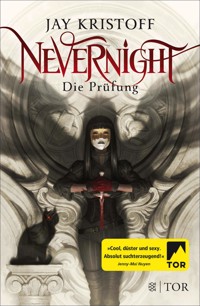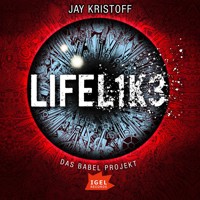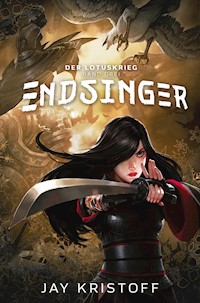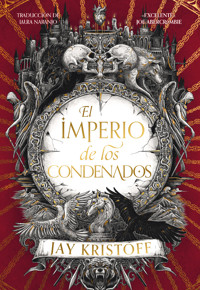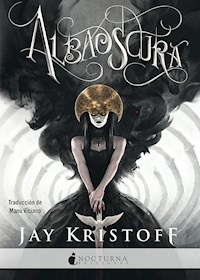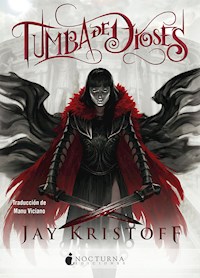16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Das Reich der Vampire
- Sprache: Deutsch
Der "Name des Windes" meets "Interview mit einem Vampir" - "Das Reich der Vampire" ist der Auftaktband der neuen, epischen Fantasy-Serie von Bestseller-Autor Jay Kristoff. Vor 27 Jahren ging die Sonne unter – und seitdem sind die Armeen der Vampire auf dem Vormarsch. Stück für Stück haben sie ihr ewiges Reich ausgedehnt und den Menschen den Boden streitig gemacht, bis nur noch an wenigen Orten ein unbeschwertes Leben möglich ist. Kleine Inseln des Lichts in einem Meer aus ewiger Finsternis. Als der junge Gabriel de León sein Heimatdorf verlassen muss, führt ihn sein Weg nach San Michon, zum Orden der Silberwächter, einer heiligen Bruderschaft, die das Reich und die Kirche gegen den Ansturm der Bestien verteidigt. Und noch ahnt er nicht, dass er zur größten Legende des Ordens werden wird – und zur letzten Hoffnung einer sterbenden Welt. Mit zahlreichen Illustrationen von Bon Orthwick. Für Leser*innen von Sarah J. Maas, V.E. Schwab, Leigh Bardugo und Fans von Vampire – The Masquerade oder Castlevania und The Last of Us.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1371
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Jay Kristoff
Das Reich der Vampire
A Tale of Blood and Darkness
Über dieses Buch
Vor 27 Jahren ging die Sonne unter – und seitdem sind die Armeen der Vampire auf dem Vormarsch. Stück für Stück haben sie ihr ewiges Reich ausgedehnt und den Menschen den Boden streitig gemacht, bis nur noch an wenigen Orten ein unbeschwertes Leben möglich ist. Kleine Inseln des Lichts in einem Meer aus ewiger Finsternis.
Als der junge Gabriel de León sein Heimatdorf verlassen muss, führt ihn sein Weg nach San Michon, zum Orden der Silberwächter, einer heiligen Bruderschaft, die das Reich und die Kirche gegen den Ansturm der Bestien verteidigt. Und noch ahnt er nicht, dass er zur größten Legende des Ordens werden wird – und zur letzten Hoffnung einer sterbenden Welt.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Jay Kristoff verbrachte den Großteil seiner Jugend mit einem Haufen Bücher und zwanzigseitiger Würfel in seinem spärlich beleuchteten Zimmer. Als Master of Arts verfügt er über keine nennenswerte Bildung. Er ist zwei Meter groß und hat laut Statistik noch 13.020 Tage zu leben. Zusammen mit seiner Frau und dem faulsten Jack-Russell-Terrier der Welt lebt er in Melbourne. Jay Kristoff glaubt nicht an Happy Ends.
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
Die Originalausgabe erschien 2021 unter dem Titel »Empire of the Vampire« bei St. Martin’s Press, New York.
Copyright © 2021 by Neverafter PTY LTD.
Copyright © 2021 Illustrationen: Bon Orthwick
Copyright © 2021 Karten: Virginia Allyn
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2021 S. Fischer Verlage GmbH, Hedderichstr. 114, D-60569 Frankfurt
Covergestaltung: Guter Punkt, München, nach dem Originalumschlag von HarperCollins UK
Illustrationen: © Bon Orthwick
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-491253-0
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Take hold of my hand,
For you are no longer alone.
Walk with me in hell.
Mark Morton
Und im Angesicht Gottes und seiner Sieben Märtyrer
Schwöre ich an dieser Stelle:
Verzweiflung soll das Dunkel packen, sobald es meinen Namen vernimmt.
Solange es brennt, bin ich die Flamme.
Solange es blutet, bin ich die Klinge.
Solange es sündigt, bin ich der Wächter.
Und ich bin silbern.
Der Eid von San Michon
Fragt mich nicht, ob Gott existiert, fragt mich lieber, wieso er so ein Arschloch ist.
Selbst der größte Narr kann die Existenz des Bösen nicht verleugnen. Wir leben tagtäglich in seinem Schatten. Die Besten von uns können sich darüber erheben, die Schlimmsten von uns werden mit Haut und Haaren von ihm verschlungen, aber wir alle sind in jedem Augenblick unseres Lebens von ihm umgeben. Fluch und Segen werden den Grausamen und den Gerechten in gleichem Maße zuteil. Auf jedes erhörte Gebet kommen zehntausend, die nicht erhört wurden. Und die Wächter leiden an der Seite der Sünder und beten für Ungeheuer, die aus den Tiefen der Hölle gespien wurden.
Aber wenn es eine Hölle gibt, muss es dann nicht auch einen Himmel geben?
Und wenn es einen Himmel gibt, können wir diesen Himmel dann nicht nach dem Warum fragen?
Denn wenn der Allmächtige all dem Bösen ein Ende setzen wollte, aber aus irgendeinem Grund nicht dazu in der Lage wäre, dann ist er nicht so allmächtig, wie die Priester euch einreden wollen. Wenn er aber dazu willens und in der Lage wäre, wie kann es dann sein, dass all dieses Böse überhaupt existiert? Und wenn er weder willens noch fähig wäre, damit aufzuräumen, dann ist er überhaupt kein Gott.
Die einzige Möglichkeit, die dann noch bleibt, ist die: Er kann es beenden. Er entscheidet sich lediglich dagegen.
Die Kinder, die den Armen ihrer Eltern entrissen werden. Die endlosen Flächen namenloser Gräber. Die untoten Toten, die uns im Licht einer verdunkelten Sonne jagen.
Wir sind jetzt Beute, mon ami.
Wir sind Nahrung.
Und er hat nie auch nur einen verdammten Finger krummgemacht, um diese Scheiße zu beenden.
Er hätte es tun können.
Er tat es nur einfach nicht.
Hast du dich je gefragt, was wir verbrochen haben, dass er uns so hasst?
Abenddämmerung
Man schrieb das 27. Jahr des Tagestods im Reich des Ewigen Königs, und sein Mörder wartete darauf zu sterben.
Er hielt an einem schmalen Fenster Wache und wartete ungeduldig auf sein Ende. Die tätowierten Hände, befleckt mit getrocknetem Blut und Asche so bleich wie Sternenlicht, hielt er hinter dem Rücken ineinander verschränkt. Sein Zimmer befand sich hoch oben in einem einsamen Turm, von schlaflosen Bergwinden geküsst. Die Tür war eisenbeschlagen, schwer, geheimnisgleich verschlossen. Von seinem Ausguck beobachtete der Königsmörder, wie die Sonne ihrer unverdienten Ruhe entgegensank, und fragte sich, wie die Hölle schmecken mochte.
Das Kopfsteinpflaster unten auf dem Hof versprach nach tiefem Sturz und hartem Aufprall den schnellen Weg in ein traumloses Dunkel. Aber das Fenster war zu schmal, als dass er sich hätte hindurchzwängen können, und seine Wärter hatten ihm nichts gelassen, was ihm sonst dabei hätte helfen können, sich ein Ende zu setzen. Nur Stroh als Nachtlager, einen Eimer zum Reinkacken und das schwache Licht des Sonnenuntergangs, um ihn zu foltern, bevor es mit der echten Folter losging. Er trug einen schweren Mantel, alte Stiefel und Lederhosen, fleckig von Ruß und langen Reisen. Seine blasse Haut war feucht vor Schweiß, obschon sein Atem weiß in die Luft stieg und im Kamin hinter ihm kein Feuer brannte. Die Eisblüter wollten es nicht einmal in ihren Gefängniszellen riskieren, eine Flamme zu entzünden.
Sie würden schon bald kommen.
Das Château erwachte allmählich. Ungeheuer erhoben sich von ihren Lagern an der kalten Erde und taten ihr Bestes, um beinahe menschlich zu wirken. Draußen vibrierte die Luft vom Lied der Fledermausflügel. Hörige Soldaten, in dunklen Stahl gehüllt, die schwarzen Mäntel mit den Emblemen der Zwillingswölfe und Zwillingsmonde geschmückt, patrouillierten über die Zinnen unter ihm. Der Mörder verzog verächtlich den Mund bei ihrem Anblick; kein Hund hätte sich dazu erniedrigt, an diesem Ort Wache zu stehen.
Der Himmel über ihnen war dunkel wie die Sünde.
Der Horizont so rot wie die Lippen seiner Lady, als er sie zum letzten Mal geküsst hatte.
Er fuhr sich mit dem Daumen über die mittleren Finger, über die kurz unterhalb der Knöchel eintätowierten Buchstaben.
»Patience«, flüsterte er. Geduld.
»Darf ich hereinkommen?«
Der Mörder blieb ganz ruhig – er wusste, dass sich das Eisblut an seinem Erschrecken ergötzt hätte. Stattdessen starrte er weiter aus dem Fenster zu den geborstenen Knöcheln der Berge, deren Spitzen von aschgrauem Schnee bedeckt waren. Jetzt fühlte er, dass das Wesen hinter ihm stand und dass dessen Blick über seinen Nacken wanderte. Er wusste, was es wollte, wieso es hier war. Und er hoffte, dass es schnell ginge. In seinem Inneren wusste er: Jeder Schrei wäre ihnen ein Genuss gewesen.
Dann endlich drehte er sich um und spürte, wie Feuer in ihm aufloderte, als er das Ding vor sich sah. Der Zorn war ein alter Freund, warm und willkommen. Er ließ ihn das Ziehen in den Adern vergessen, die Last der Narben und der Jahre, die an seinen Knochen zehrten. Beim Anblick des Ungeheuers, das vor ihm stand, fühlte er sich direkt wieder jung. Von den Flügeln eines reinen und perfekten Hasses der Ewigkeit entgegengetragen.
»Guten Abend, Chevalier«, sagte das Eisblut.
Es war noch jung gewesen, als es gestorben war. Ein Junge von fünfzehn oder vielleicht sechzehn, gezeichnet von jener androgynen Zierlichkeit, wie sie für die Zeit kurz vor dem Erreichen des Mannesalters typisch ist. Gott allein mochte wissen, wie alt es wirklich war. Ein Hauch von Farbe lag auf seinen Wangen, die großen braunen Augen waren von dichtem Goldhaar eingerahmt, die Stirn zierte eine kunstvoll arrangierte winzige Locke. Seine Haut war porenfrei und alabasterweiß, seine Lippen jedoch von einem obszönen Rot, und das Weiße seiner Augen zeigte dieselbe Farbe. Frisch gesättigt.
Hätte der Mörder es nicht besser gewusst, er hätte gesagt, dass es beinahe lebendig wirkte.
Sein Gehrock war aus dunklem Samt, bestickt mit goldenen Schnörkeln. Um seine Schultern lag ein Mantel aus Rabenfedern, und der Kragen war so umgeschlagen, dass er wie eine Reihe glänzend schwarzer Klingen aussah. Das Wappen seines Blutes war auf der Brust eingestickt – Zwillingswölfe über Zwillingsmonden. Dunkle Hosen, Krawatte und Strümpfe aus Seide sowie polierte Schuhe komplettierten das Porträt. Ein Ungeheuer in Gestalt eines Aristokraten.
Es stand in der Mitte seiner Zelle, obwohl die Tür noch immer geheimnisgleich verschlossen war. Zwischen den knochenweißen Handflächen hielt es ein dickes Buch, und seine Stimme war so sanft wie ein Wiegenlied.
»Ich bin Marquis Jean-François vom Blut Chastain, Geschichtsschreiber ihrer Gnaden Margot Chastain, Erste und Letzte ihres Namens, unsterbliche Herrscherin über Wölfe und Menschen.«
Der Mörder sagte nichts.
»Ihr seid Gabriel de León, der Letzte der Silberwächter.«
Der Mörder namens Gabriel gab noch immer keinen Ton von sich. Der Blick des Wesens flackerte wie Kerzenflammen in der Stille; die Luft hatte etwas klebrig Schwarzes, Gehaltvolles. Kurz wollte es Gabriel erscheinen, als stünde er am Rand einer Klippe, und nur die kalte Berührung dieser tiefroten Lippen an seiner Kehle könne ihn vor dem Sturz bewahren. Er spürte, wie seine Haut kribbelte, als sich sein Blut bei dieser Vorstellung unwillkürlich rührte. Die Sehnsucht der Motte nach der Flamme, nach dem Vergehen.
»Darf ich hereinkommen?«, wiederholte das Ungeheuer.
»Ihr seid schon drin, Eisblut«, gab Gabriel zurück.
Das Geschöpf ließ seinen Blick kurz unterhalb von Gabriels Gürtel entlangschweifen und schenkte ihm ein wissendes Lächeln. »Es ist immer höflicher zu fragen, Chevalier.«
Es schnippte mit den Fingern, und die eisenbeschlagene Tür schwang weit auf. Eine hübsche Hörige in einem langen schwarzen Kleid mit Korsage schlüpfte zu ihnen hinein. Das Gewand war aus Knittersamt-Damast und zu einer Wespentaille geschnürt, und sie trug ein Kropfband aus dunkler Spitze um den Hals. Ihr langes rotes Haar war zu Zöpfen geflochten, die wie Ketten aus gewalztem Kupfer über ihre Augen hingen. Sie war vielleicht Mitte dreißig, so alt wie Gabriel. Alt genug, um die Mutter des Ungeheuers zu sein, wenn das Wesen nur ein normaler Junge und sie nur eine normale Frau gewesen wären. Aber sie trug mühelos einen Ledersessel, der ebenso schwer war wie sie selbst, und schlug die Augen nieder, als sie ihn neben dem Eisblut abstellte.
Das Ungeheuer löste seinen Blick keinen Augenblick von Gabriel. Und er den seinen auch nicht von ihm.
Die Frau brachte einen weiteren Sessel und einen kleinen Eichentisch. Den Sessel stellte sie neben Gabriel, den Tisch zwischen die beiden, und stand dann da, die Hände verschränkt wie eine Priorin beim Gebet.
Jetzt konnte Gabriel Narben an ihrer Kehle sehen, die verräterischen Pünktchen unter dem Kropfband. Er fühlte, wie er vor Verachtung eine Gänsehaut bekam. Sie hatte diesen Sessel getragen, als ob er federleicht sei, aber nun, in Gegenwart des Eisbluts, war die Frau beinahe atemlos, und ihr bleicher Busen hob sich über dem Korsett wie der einer Jungfrau in ihrer Hochzeitsnacht.
»Merci«, sagte Jean-François vom Blut Chastain.
»Ich bin Eure Dienerin, Herr«, hauchte die Frau.
»Lass uns jetzt allein, meine Liebe.«
Die Hörige sah dem Ungeheuer in die Augen. Ihre Fingerspitzen fuhren langsam über die Rundung ihres Busens zur milchweißen Linie ihres Halses und …
»Bald«, sagte das Eisblut.
Die Frau öffnete leicht den Mund. Gabriel sah, dass ihr Herz vor Erwartung schneller schlug.
»Euer Wille wird geschehen, Herr«, flüsterte sie.
Und ohne Gabriel auch nur eines Blickes zu würdigen, knickste sie und glitt aus dem Zimmer, so dass Mörder und Monster allein zurückblieben.
»Wollen wir uns setzen?«, fragte das Geschöpf.
»Ich sterbe lieber im Stehen, wenn es nichts ausmacht«, erwiderte Gabriel.
»Ich bin nicht hier, um Euch zu töten, Chevalier.«
»Was wollt Ihr dann, Eisblut?«
Das Dunkel flüsterte. Das Ungeheuer bewegte sich scheinbar ohne eine Regung; eben noch hatte es neben dem Sessel gestanden, nun saß es schon darin. Gabriel sah, wie es ein nicht vorhandenes Stäubchen vom Brokatstoff strich und sich dann das Buch auf den Schoß legte. Es war eine winzige Machtdemonstration, die nur die Möglichkeiten andeuten sollte, um ihn von irgendwelchen mutigen Verzweiflungstaten zurückzuhalten. Aber Gabriel de Léon hatte Wesen wie dieses Geschöpf getötet, seit er sechzehn Jahre alt war, und er wusste genau, wann ihm jemand überlegen war.
Er war unbewaffnet. Nach drei schlaflosen Nächten völlig übermüdet. Hungrig und umzingelt und schwitzend vom Entzug. Aus der Vergangenheit hallte Grauhands Stimme durch seinen Kopf, und ihm war, als hörte er den Schritt der silberbeschlagenen Stiefel seines Meisters auf den Steinplatten von San Michon.
Gesetz Nummer Eins: Tote töten keine Toten.
»Ihr müsst durstig sein.«
Das Ungeheuer zog ein kristallenes Fläschchen aus seinem Mantel, und das Licht funkelte auf den hineingeschliffenen Facetten. Gabriel verengte die Augen.
»Es ist nur Wasser, Chevalier. Trinkt.«
Gabriel kannte diese Mechanismen; die Freundlichkeit diente als Vorspiel für die Versuchung. Dennoch, seine Zunge schabte wie Sandpapier über seine Zähne. Und obwohl Wasser den Durst, der in ihm wütete, nicht stillen konnte, riss er dem Ungeheuer das Fläschchen aus den gespenstisch bleichen Fingern und goss sich einen Schluck auf die Handfläche. Kristallklar. Geruchlos. Keine Spur von Blut.
Er trank und schämte sich seiner Erleichterung, schüttelte aber trotzdem jeden Tropfen heraus. Für jenen Teil von ihm, der menschlich war, erschien dieses Wasser süßer als jeder Wein oder jede Frau, die er einmal geschmeckt hatte.
»Bitte.« Der Blick des Eisbluts war scharf wie gesplittertes Glas. »Setzt Euch.«
Gabriel blieb stehen.
»Setzt Euch.«
Gabriel fühlte, wie das Ungeheuer ihm seinen Willen aufzwingen wollte, und die dunklen Augen schienen größer zu werden, bis er nichts anderes mehr wahrnehmen konnte. Es lag eine gewisse Süße darin. Die Verlockung, wie eine Blüte sie für eine Hummel besaß, der Geschmack offener, frischer Blütenblätter, feucht von Tau. Wieder spürte Gabriel, wie sein Blut sich regte, unkontrollierbar. Aber wieder hörte er Grauhands Stimme in seinem Kopf.
Gesetz Nummer Zwei: Wer toten Zungen lauscht, wird tote Zungen schmecken.
Und daher blieb Gabriel weiter stehen. Hocherhobenen Hauptes, auch wenn seine Knie zitterten wie die eines Fohlens. Der Hauch eines Lächelns ging über die Lippen des Ungeheuers. Spitz zulaufende Finger strichen die goldene Locke zurück, die über diese verdammten Schokoladenaugen gefallen war, und trommelten dann auf dem Buch, das auf seinem Schoß lag.
»Beeindruckend«, sagte es.
»Wenn ich doch nur dasselbe sagen könnte«, gab Gabriel zurück.
»Seid vorsichtig, Chevalier. Vielleicht verletzt Ihr meine Gefühle.«
»Die Toten empfinden wie Tiere, erscheinen wie Menschen, sterben wie Teufel.«
»Ah.« Das Eisblut lächelte, und jetzt lag etwas Rasiermesserscharfes darin. »Gesetz Nummer Vier.«
Gabriel versuchte, seine Überraschung zu verbergen, fühlte aber noch immer, wie sich ihm der Magen umdrehte.
»Oui.« Das Eisblut nickte. »Ich bin mit den Grundsätzen Eures Ordens vertraut, de León. Wer nicht aus der Vergangenheit lernt, erleidet die Zukunft. Und wie Ihr Euch denken könnt, sind zukünftige Nächte für die Unsterblichen von einigem Interesse.«
»Gebt mir mein Schwert zurück, Blutsauger. Dann zeige ich Euch, wie unsterblich Ihr tatsächlich seid.«
»Wie kurios.« Das Ungeheuer betrachtete sinnend seine langen Fingernägel. »Eine Drohung.«
»Ein Schwur.«
»Und im Angesicht Gottes und seiner Sieben Märtyrer«, zitierte das Ungeheuer, »schwöre ich an dieser Stelle: Verzweiflung soll das Dunkel packen, sobald es meinen Namen vernimmt. Solange es brennt, bin ich die Flamme. Solange es blutet, bin ich die Klinge. Solange es sündigt, bin ich der Wächter. Und ich bin silbern.«
Gabriel überkam eine Welle sanfter und vergifteter Nostalgie. Es kam ihm vor, als läge es ein Lebensalter zurück, dass er diese Worte zuletzt gehört hatte, wie sie im buntglasfleckigen Licht von San Michon erklungen waren. Ein Gebet für Rache und Gewalt. Ein Versprechen an einen Gott, der nie wirklich zugehört hatte. Aber es hier zu hören, an einem solchen Ort, wiederholt von einem von ihnen …
»Um der Liebe zum Allmächtigen willen, setzt Euch«, seufzte das Eisblut. »Bevor Sie stürzen.«
Gabriel fühlte, wie ihn der Wille des Ungeheuers bedrängte. Alles Licht im Raum schien sich in dessen Augen zu sammeln. Beinahe konnte er es flüstern hören, so nah, dass die Zähne sein Ohr kitzelten, wie es ihm Schlaf versprach nach der längsten aller Reisen, kühles Wasser, um das Blut von seinen Händen zu waschen, und eine warme, stille Dunkelheit, in der er all das vergessen könnte, was er gegeben und verloren hatte.
Aber er dachte an das Gesicht seiner Lady. An die Farbe ihrer Lippen, als er sie zum letzten Mal geküsst hatte.
Und er blieb stehen.
»Was wollt Ihr, Eisblut?«
Der letzte Hauch des Sonnenuntergangs war vom Himmel geflohen, und der Geruch lange schon verrotteten Laubs umfing Gabriels Zunge. Jetzt war das Verlangen wirklich da, und das tiefe Bedürfnis, die Sucht zu stillen, kündigte sich bereits an. Der Durst fuhr ihm mit kalten Fingern über das Rückgrat und breitete schwarze Flügel über seine Schultern aus. Wie lange war es her, dass er geraucht hatte? Zwei Tage? Drei?
Gott im Himmel, er hätte seine eigene verdammte Mutter umgebracht, nur um ein wenig …
»Wie ich Euch bereits sagte«, antwortete das Eisblut, »bin ich der Geschichtsschreiber ihrer Gnaden. Der Bewahrer ihrer Abstammung und der Meister ihrer Bibliothek. Fabién Voss ist tot, dank Eurer zarten Bemühungen. Jetzt, da die anderen Blutshöfe nach und nach das Knie beugen, hat meine Herrin begonnen, über Erhalt und Bewahren nachzudenken. Und bevor daher der letzte Silberwächter stirbt und bevor alles Wissen um Euren Orden in einem namenlosen Grab vergeht, bietet Euch meine bleiche Herrscherin Margot in ihrer unendlichen Güte die Gelegenheit, davon zu erzählen.«
Jean-François lächelte mit weinfleckigen Lippen.
»Sie möchte Eure Geschichte hören, Chevalier.«
»Eure Sorte hat absolut kein Gespür für Scherze, oder?«, fragte Gabriel. »Das lasst Ihr wohl in der Nacht Eures Todes im Dreck zurück. Mit dem, was bei Euch Gesindel einmal als Seele durchging.«
»Wieso sollte ich scherzen, de León?«
»Tiere spielen doch oft mit ihrer Beute.«
»Wenn meine Herrscherin zu spielen beliebte, dann würde man Eure Schreie von hier bis nach Alethe hören.«
»Wie kurios.« Gabriel betrachtete sinnend seine abgebrochenen Fingernägel. »Eine Drohung.«
Das Ungeheuer neigte den Kopf. »Touché.«
»Wieso sollte ich meine letzten Stunden damit verschwenden, eine Geschichte zu erzählen, die niemanden auf der Welt einen Scheiß interessiert? Ich bin keiner von Euch. Nichts.«
»Ach, kommt schon.« Das Ding hob eine Augenbraue. »Der Schwarze Löwe? Der Mann, der die blutroten Schneefälle von Augustin überlebte? Der Tausende unseresgleichen zu Asche verbrannte und die Verrückte Klinge an die Kehle des Ewigen Königs persönlich legte?« Jean-François schnalzte tadelnd mit der Zunge wie eine Lehrerin angesichts eines ungebärdigen Schülers. »Ihr wart der größte Eures Ordens. Und seid der Einzige, der noch lebt. Diese ach so breiten Schultern sind für das Mäntelchen der Bescheidenheit nicht geschaffen, Chevalier.«
Gabriel beobachtete, wie das Eisblut von Lügen zu Schmeichelei wechselte wie ein Wolf, der die Witterung von Blut aufgenommen hat. Die ganze Zeit fragte er sich, was das Geschöpf tatsächlich wollte und wieso er noch nicht tot war. Und dann endlich …
»Es geht hier um den Gral«, erkannte Gabriel.
Das Gesicht des Ungeheuers war so bewegungslos, als sei es aus Marmor gehauen. Aber Gabriel glaubte ein leichtes Erzittern in seinem starrdunklen Blick wahrzunehmen.
»Der Gral wurde zerstört«, sagte es. »Warum sollten wir uns für diesen Kelch interessieren?«
Gabriel neigte den Kopf und rezitierte aus dem Gedächtnis:
»Aus heil’gem Kelch scheint heil’ger Glanz,
Durch treue Hand wird die Welt wieder ganz.
Vor der Sieben Märtyrer Angesicht
Ein bloßer Mensch die Nacht vernicht’.«
Ein leises kaltes Lachen schallte von den nackten Steinmauern zurück. »Ich bin Chronist, de León. Mich interessiert der Verlauf der Geschichte, nicht die Mythologie. Bewahrt Euch Euren unausgegorenen Aberglauben für das Vieh auf.«
»Ihr lügt, Eisblut. Wer toten Zungen lauscht, wird tote Zungen schmecken. Und wenn Ihr auch nur einen Augenblick glaubt, dass ich Verrat an …«
Seine Stimme verklang und erstarb dann ganz. Obwohl das Ungeheuer sich nie auch nur im Geringsten zu bewegen schien, hielt es plötzlich eine Hand ausgestreckt. Und da, auf der schneeweißen Fläche seiner Hand lag eine Glasphiole mit rötlich braunem Staub. Wie ein Pulver aus Schokolade und zerstoßenen Rosenblättern. Die Versuchung, von der er gewusst hatte, dass sie kommen würde.
»Ein Geschenk«, sagte das Ungeheuer und zog den Stopfen aus dem kleinen Glasbehälter.
Gabriel konnte dort, wo er stand, das zu Pulver zermahlene Blut riechen. Dick und gehaltvoll und kupfersüß. Seine Haut kribbelte bei diesem Duft. Seine Lippen öffneten sich und entließen einen Seufzer.
Er wusste, was die Ungeheuer wollten. Er wusste, dass er nur nach mehr dürsten würde, wenn er es jetzt nahm. Dennoch hörte er seine eigene Stimme, als ob sie von weither erklang. Und wenn die langen Jahre und das ganze Blut sein Herz nicht schon vor langer Zeit gebrochen hätten, dann wäre es sicherlich in diesem Augenblick geschehen.
»Ich habe meine Pfeife verloren … In der Charbourg, als ich …«
Das Eisblut zog eine schöne Knochenpfeife aus der Tasche seines Gehrocks und legte sie zusammen mit der Phiole auf den kleinen Tisch. Und dann deutete es mit grimmigem Blick auf den Sessel gegenüber.
»Setzt Euch.«
Und nun endlich, erschöpft, wie er war, gehorchte Gabriel de León.
»Bedient Euch, Chevalier.«
Er hatte die Pfeife in der Hand, bevor es ihm selbst bewusst wurde, und er füllte eine Portion des klebrigen Pulvers in den Pfeifenkopf, wobei er so heftig zitterte, dass er das Objekt seiner Begierde beinahe fallen ließ. Die Augen des Eisbluts waren währenddessen auf Gabriels Hände gerichtet: auf die Narben und Schwielen und die herrlichen Tätowierungen. Den rechten Handrücken des Silberwächters zierte ein Kranz aus Totenschädeln, den linken ein Kranz aus Rosen. Unterhalb der Knöchel zog sich das Wort PATIENCE, Geduld, über die Finger. Die Tinte hob sich dunkel von der blassen Haut ab und war mit einem metallischen Schimmer versehen.
Der Silberwächter strich sich eine Strähne seines langen schwarzen Haars aus den Augen und klopfte dann die Taschen seines Mantels und seiner Lederhosen ab. Aber natürlich hatte man ihm das Flintsteinfeuerzeug abgenommen.
»Ich brauche eine Flamme. Eine Laterne.«
»Braucht Ihr das?«
Das Eisblut legte die Spitzen seiner schlanken Finger geradezu quälend langsam aneinander und hob sie an die Lippen. Es gab in diesem Augenblick nichts und niemand anderen. Nur sie beide, Mörder und Monster, und die bleischwere Pfeife in Gabriels zitternden Händen.
»Dann wollen wir von dem sprechen, was wir brauchen, Silberwächter. Das Warum spielt keine Rolle. Auch die Mittel nicht. Meine Herrscherin verlangt, dass Eure Geschichte erzählt wird. Und von daher können wir entweder wie wohlerzogene Leute hier sitzen, während Ihr Eurer erbärmlichen kleinen Sucht frönt, oder wir können uns in andere Räume in den Tiefen dieses Châteaus zurückziehen, in die sich nicht einmal Teufel hineintrauen. So oder so, meine Herrscherin Margot soll ihre Geschichte bekommen. Die Frage ist nur, ob Ihr sie leise seufzend berichten oder gequält herausschreien wollt.«
Es hatte ihn. Jetzt, da er die Pfeife in der Hand hielt, war er bereits gestrauchelt.
Spürte Heimweh nach der Hölle, und gleichzeitig grauste es ihn vor der Rückkehr.
»Jetzt gebt mir die verdammte Flamme, Eisblut.«
Jean-François vom Blut Chastain schnippte wieder mit den Fingern, und die Zellentür schwang knarrend auf. Draußen wartete dieselbe Hörige wie vorhin, und sie hielt eine Laterne mit einem hohen Glaszylinder in den Händen. Sie hob sich als Silhouette vor dem Licht ab: schwarzes Kleid, schwarze Korsage, schwarzes Kropfband. Jetzt hätte sie Gabriels Tochter sein können. Seine Mutter, seine Frau – es machte keinen Unterschied. Alles, was zählte, war die Flamme, die sie trug.
Gabriel war gespannt wie zwei Bogensehnen und nahm daher nur am Rande wahr, wie unwohl sich das Eisblut in der Gegenwart des Feuers fühlte; Jean-François’ Atem fuhr mit seidenweichem Zischen über die scharfen Zähne. Aber jetzt war ihm alles egal, abgesehen von der Flamme und der düsterdunklen Magik, die ihr folgen würde, von Blut zu Pulver zu Rauch zu Glückseligkeit.
»Bring sie her«, befahl er der Frau. »Und schnell.«
Sie stellte die Lampe auf den Tisch und sah ihm zum ersten Mal in die Augen. Und ihr blassblauer Blick sprach zu ihm, ohne dass sie auch nur ein Wort verlor.
Und du hieltest mich für eine Sklavin?
Ihm war es egal. Vollkommen. Mit erfahrenen Händen trimmte er den Docht, drehte die Flamme bis zur perfekten Höhe. Ölgeruch stieg in die Luft. Er spürte die Wärme, die nun die Kälte im Turm durchdrang, während er den Pfeifenkopf gerade nahe genug ans Feuer hielt, um das Pulver in Dampf zu verwandeln. Es kribbelte ihm im Magen, als es begann, die hohe Alchemie, die dunkle Chymistrie. Das Blutpulver blubberte jetzt, die Farbe schmolz zu Duft, zum Aroma von Ilexwurzel und Kupfer. Und dann legte Gabriel seine Lippen mit größerer Leidenschaft an diese Pfeife, als er je für den Kuss einer Geliebten empfunden hatte … o süßer Gott im Himmel … und sog den Rauch tief ein.
Das vertraute blendende Feuer erfüllte seine Lungen. Die altbekannte himmlische Unruhe flutete seinen Verstand. Es kristallisierte und zerlegte ihn in seine Bestandteile, als er den blutigen Dampf inhalierte und spürte, wie sein Herz gegen seine Rippen schlug wie ein Vogel in einem Knochenbauer und wie sich sein Schwanz gegen die Lederhosen stemmte und das Angesicht Gottes höchstpersönlich nur noch einen Pfeifenkopf weit entfernt war.
Er sah der Hörigen in die Augen und entdeckte, dass sie ein Engel war, ein Engel in sterblicher Gestalt. Er wollte sie küssen, sie leer saugen, in ihr sterben, sie in seine Arme ziehen, mit den Lippen über ihre Haut streichen, während seine Zähne an ihren Wurzeln ruckten, denn sie spürten die Verlockung, die gleich unter ihrem geschwungenen Kiefer wartete, der hämmernde Puls, der gegen seine Zunge schlug, lebendig, lebendig …
»Chevalier.«
Gabriel schlug die Augen auf.
Er war neben dem Tisch auf die Knie gesunken, und die Lampe zeichnete einen zuckenden Schatten um ihn. Er hatte keine Vorstellung, wie viel Zeit verstrichen sein mochte. Die Frau war verschwunden, als wäre sie nie da gewesen.
Er konnte den Wind draußen hören, eine Stimme oder Dutzende, die Geheimnisse über die Schindeln seufzten und Flüche in die Traufen heulten und seinen Namen zwischen den Stämmen der schwarzen und nackten Bäume flüsterten. Er konnte jeden einzelnen Halm des Strohs auf dem Boden zählen, spürte, dass sich jedes Haar an seinem Körper aufgestellt hatte, roch alten Staub und frischen Tod und die Wege, die er beschritten hatte, an den Sohlen seiner Stiefel. Jeder seiner Sinne war scharf wie eine Klinge, die geborsten und blutig in seinen tätowierten Händen lag.
»Wes…«
Gabriel schüttelte den Kopf, als er nach den Worten suchte, die ihm entglitten wie Sirup, der durch seine Finger floss. Das Weiße seiner Augen war blutrot. Er sah die Phiole an, die jetzt wieder auf der Handfläche des Ungeheuers lag.
»Wessen Blut … ist das?«
»Das unserer gesegneten hohen Frau«, antwortete das Monster. »Das unserer dunklen Mutter und bleichen Herrin, Margot Chastain, Erste und Letzte ihres Namens, unsterbliche Herrscherin über Wölfe und Menschen.«
Das Eisblut sah mit weichem sehnsuchtsvollem Blick in die Flamme der Laterne. Aus einer düsteren Ecke der Zelle hatte sich eine knochenweiße Motte erhoben, die jetzt zum Licht flatterte. Porzellanblasse Finger schlossen sich um die Phiole und verbargen sie.
»Aber es soll Euch kein einziger Tropfen mehr von ihr gegönnt sein, bevor nicht Eure Geschichte mir gehört. Also sprecht, und zwar so, als würdet Ihr es einem Kind berichten. Nehmt einmal an, dass jene, die es lesen, viele Zeitalter später, nichts von diesem Ort hier wissen. Denn die Worte, die ich nun aufs Pergament banne, sollen so lange bestehen wie dieses unsterbliche Reich. Und diese Chronik soll die einzige Unsterblichkeit sein, die Euch jemals zuteilwerden wird.«
Aus seinem Mantel zog das Eisblut ein hölzernes Kistchen, in das zwei Wölfe und zwei Monde hineingeschnitzt waren. Aus seinem Innern nahm er eine lange Feder, schwarz wie der Federnstrang, der um seine Kehle lag, und stellte ein kleines Tintenfass auf die Armlehne seines Sessels. Dann tunkte er die Feder ein und blickte ihn mit dunklen erwartungsvollen Augen an.
Gabriel holte tief Luft. Der Geschmack des roten Rauchs lag auf seinen Lippen.
»Fangt an«, sagte der Vampir.
· Erstes Buch ·Tagestod
Und so geschah es, dass im Jahr des Reichs 651 ein entsetzliches Omen über das Land kam. Denn obgleich die Sonne sich weiterhin des Morgens hob und des Abends senkte, hatte ihr Licht doch alle Leuchtkraft verloren, und ihr Schein vermochte weder die Wärme noch die gewohnte Helligkeit zu spenden. Und seit jener Zeit, da dieses grimme Vorzeichen vom Himmel Besitz ergriff, waren die Menschen nicht mehr frei von Hungersnot oder Krieg oder jeglichem anderen Unglück, das zum Tode führte.
Luis Bettencourt
Die Geschichte des Landes Elidaen
· I ·Von Äpfeln und Bäumen
»Es fing alles mit einem Kaninchenloch an«, sagte Gabriel.
Der Letzte der Silberwächter senkte den Blick auf die flackernde Flamme der Laterne, als sähe er lang schon verblichene Gesichter darin. Ein Hauch roten Rauchs hing noch immer in der Luft, und er konnte jeden Faden des Lampendochts mit einer anderen Melodie brennen hören. Die Jahre, die zwischen dem Damals und Heute vergangen waren, erschienen ihm in seinen Gedanken wie Minuten, vom Gesang des rauschenden Blutes entzündet.
»Es kommt mir komisch vor«, sagte er mit einem Seufzer, »wenn ich auf all das zurückblicke. Hinter mir türmt sich ein Berg aus Asche, der bis zum Himmel aufragt. Kathedralen, die in Flammen aufgingen, und Städte, die in Trümmern lagen, und Gräber, die vor Gläubigen und Böswilligen überquollen, und dennoch war das der Zeitpunkt, an dem es wirklich begann.« Er schüttelte ungläubig den Kopf. »Mit einem kleinen Loch im Boden.
Viele Leute erinnern sich natürlich anders daran. Die Wahrsänger werden auf der Prophezeiung herumreiten, und die Priester werden vom Plan des Allmächtigen salbadern. Aber ich habe noch nie einen Minnesänger getroffen, der kein Lügner gewesen wäre, Eisblut. Und auch keinen heiligen Mann, der nicht ein Wichser gewesen wäre.«
»Allem Anschein nach seid Ihr ein heiliger Mann, Silberwächter«, sagte Jean-François.
Gabriel de León sah dem Ungeheuer in die Augen und lächelte leise.
»Es war noch gut zwei Stunden bis zum Einbruch der Nacht, als Gott beschloss, mir ins Bier zu pissen. Die Dorfbewohner hatten die Brücke über den Keff zerstört, und daher war ich gezwungen, auf die Furt nahe Dhahaeth auszuweichen. Es war ein raues Land, aber Justus hatte …«
»Moment, Chevalier.« Marquis Jean-François vom Blut Chastain hob eine Hand und legte die Feder zwischen die Buchseiten. »So geht das nicht.«
Gabriel hob verwundert den Kopf. »Nein?«
»Nein«, erwiderte der Vampir. »Ich sagte Euch doch, diese Geschichte soll davon berichten, wer Ihr seid. Wie sich all das entwickelte. Geschichten beginnen nicht mittendrin. Geschichten werden von Anfang an erzählt.«
»Ihr wollt doch was über den Gral erfahren. Und diese Geschichte fängt mit einem Kaninchenloch an.«
»Wie ich schon sagte, ich zeichne die Geschichte für jene auf, die zu einer Zeit leben werden, wenn Ihr schon lange Futter für die Würmer geworden seid. Fangt ganz langsam an.« Jean-François machte eine nachlässige Bewegung mit seiner schlanken Hand. »Ich wurde geboren … Ich wuchs auf …«
»Geboren wurde ich in einem Schlammloch namens Lorson. Dort wuchs ich als Sohn eines Schmieds auf. Als ältestes von drei Kindern. Ich war nichts Besonderes.«
Der Vampir betrachtete ihn von oben bis unten. »Wir wissen beide, dass das nicht stimmt.«
»Was meint Ihr, wie viel Ihr über mich wisst, Eisblut? Wenn Ihr all das, was Ihr zu wissen glaubt, zusammenfegt und auspresst, dann füllt es vielleicht einen scheißverdammten Fingerhut.«
Das Wesen, das sich Jean-François nannte, tat so, als würde es gähnen. »Dann erzählt. Eure Eltern. Waren sie gläubig?«
Gabriel hatte schon den Mund geöffnet, um ihn zurechtzuweisen, aber die Worte erstarben auf seinen Lippen, als er einen Blick auf das Buch warf, das auf Jean-François’ Knien lag. Wie er feststellte, schrieb das Eisblut nicht nur alles mit, was er sagte, sondern zeichnete nebenbei; er benutzte seine übernatürliche Schnelligkeit, um in den kurzen Pausen, während Gabriel Luft holte, ein paar Striche zu tun. Jetzt verbanden sich die Linien zu einem Bild, das einen Mann in Dreiviertelansicht zeigte. Graue Augen, die zu viel gesehen hatten. Breite Schultern und langes Haar, schwarz wie die Nacht. Ein ausgeprägtes Kinn mit leichtem Bartschatten, fleckig von getrocknetem Blut. Zwei Narben lagen unter dem rechten Auge, eine lang, die andere kurz, beinahe wie Tränenspuren. Es war ein Gesicht, das Gabriel so gut kannte wie sein eigenes.
Weil es natürlich sein eigenes war.
»Sehr gut getroffen«, bemerkte er.
»Merci«, murmelte das Ungeheuer.
»Zeichnet Ihr für die anderen Blutsauger auch Porträts? Muss ja schwierig sein, sich an das eigene Aussehen zu erinnern, weil sich ja nicht einmal ein Spiegel mit Eurem Bild abgeben mag.«
»Ihr verschwendet Euer Gift an mich, Chevalier. Wenn dieses Wasser denn überhaupt Gift wäre.«
Gabriel starrte den Vampir an und fuhr sich mit einer Fingerspitze über die Lippen. Unter dem überwältigenden Einfluss der Bluthymne – diesem aufwallenden, pulsierenden Geschenk, das ihm die eben gerauchte Pfeife gemacht hatte – wurde jede Empfindung tausendfach verstärkt. Die Macht von Jahrhunderten in seinen Adern.
Er konnte die Kraft fühlen, die es ihm verlieh, den Mut, der mit dieser Kraft einherging. Dieser Mut hatte ihn durch die Hölle von Augustin getragen, hatte ihn in den Türmen der Charbourg und in den Reihen der Endlosen Legion gerettet. Und obwohl er wusste, dass es nur allzu schnell wieder damit vorbei sein würde, war Gabriel de León im Augenblick völlig furchtlos.
»Ich werde Euch zum Schreien bringen, Blutsauger. Ich werde Euch ausbluten lassen wie ein Schwein, Euer Bestes für später in eine Pfeife stopfen und Euch dann zeigen, was Eure Unsterblichkeit in Wirklichkeit wert ist.« Er starrte in die leeren Augen des Ungeheuers. »Giftig genug?«
Ein Lächeln ging über Jean-François’ Lippen. »Ich hatte schon davon gehört, dass Ihr ein Heißsporn seid.«
»Interessant. Ich hingegen hatte von Euch noch gar nichts gehört.«
Das Lächeln verging langsam.
Es dauerte eine ganze Weile, bis das Ungeheuer wieder sprach.
»Euer Vater. Der Schmied. War er ein gläubiger Mensch?«
»Er war ein hoffnungsloser Trinker, der jedoch ein Lächeln besaß, mit dem er selbst Nonnen ihre Unaussprechlichen abluchsen konnte, und Fäuste, vor denen sich selbst Engel fürchteten.«
»Aus irgendeinem Grund fallen mir gerade Äpfel ein und die Entfernung, mit der sie meist vom Stamm fallen.«
»Ich habe Euch nicht nach Eurer Einschätzung meiner Person gefragt, Eisblut.«
Das Ungeheuer skizzierte die Schatten um Gabriels Augen, während es weitersprach. »Erzählt mir von ihm. Von diesem Mann, der eine Legende aufzog. Wie lautete sein Name?«
»Raphael.«
»Also benannt nach jenen Engeln, die ihn so fürchteten. Genau wie Ihr.«
»Und ich habe keinen Zweifel daran, dass sie das mächtig ankotzt.«
»Kamt ihr gut miteinander zurecht, Ihr und Euer Vater?«
»Kommen Väter und Söhne jemals gut miteinander zurecht? Erst wenn man selbst zum Mann geworden ist, kann man ermessen, was für ein Mensch derjenige, der einen aufzog, wirklich ist.«
»Das kann ich nicht beurteilen.«
»Nein. Ihr seid kein Mann.«
Die Augen des toten Wesens blinzelten, als es aufsah. »Mit Schmeichelei kann man ja so viel erreichen.«
»Diese lilienweißen Händchen. Diese goldenen Löckchen.« Gabriel musterte den Vampir von Kopf bis Fuß. »Ihr seid ein geborener Elidaeni?«
»Wenn Ihr meint«, gab Jean-François zurück.
Gabriel nickte. »Eins müsst Ihr über ma famille wissen, Vampir, bevor wir ans Eingemachte gehen, nämlich dass wir Nordlunder waren. Bei Euch im Osten wachsen hübsche Menschen heran, keine Frage. Aber im Nordlund? Da werden wir wild und entschlossen. Die Winde jenseits der Gottesend-Berge fahren schneidend wie Schwerter durch meine Heimat. Es ist ein ungezähmtes Land. Ein brutales Land. Vor dem Augustinischen Frieden wurde das Nordlund öfter überfallen als jedes andere Gebiet in der Geschichte des Großreichs. Kennt Ihr die Legende von Matteo und Elaina?«
»Natürlich.« Jean-François nickte. »Von dem Nordling-Kriegerfürsten aus der Zeit vor dem Großreich, der eine Königin der Elidaeni heiratete. Es heißt, Matteo hätte seine Elaina so leidenschaftlich geliebt, dass es für vier normale Menschen gereicht hätte. Und als sie starben, machte der Allmächtige sie zu Sternen am Himmel, damit sie auf ewig zusammen sein konnten.«
»Das ist eine Version der Geschichte«, sagte Gabriel lächelnd. »Matteo liebte seine Elaina tatsächlich mit größter Leidenschaft, insoweit stimmt es. Aber in Nordlund erzählen wir diese Sage anders. Ihr müsst wissen, dass Elainas Schönheit in allen fünf Königreichen berühmt war, und auch jeder der vier anderen Herrscher sandte einen Prinzen aus, der um ihre Hand anhalten sollte. Am ersten Tag bot ihr der Prinz von Talhost eine Herde herrlicher Tundrapferdchen, so schlau wie Füchse und so weiß wie der Schnee seiner Heimat. Am zweiten Tag brachte der Prinz von Sūdhaem Elaina eine Krone aus schimmerndem Goldglas, wie man es in den Bergen seines Reiches schürfte. Am dritten gab ihr der Prinz aus Ossway ein Schiff, das aus unbezahlbarem Treuholz gebaut war, damit sie mit ihm über das Ewige Meer segeln konnte. Aber Prinz Matteo war arm. Seit dem Jahr seiner Geburt war sein Heimatland von Talhost und Sūdhaem und Ossway überfallen worden. Er konnte ihr keine Pferdchen, kein Goldglas und keine Treuschiffe schenken. Stattdessen schwor er Elaina, sie so leidenschaftlich zu lieben wie vier normale Männer. Und um das zu beweisen, legte ihr Matteo, als er vor ihrem Thron stand und ihr sein Herz anbot, die Herzen der anderen Brautwerber zu Füßen. Die Herzen jener Prinzen, die das Land, aus dem er stammte, immer wieder überfallen hatten. Vier Herzen insgesamt.«
Der Vampir schnaubte. »Dann wollt Ihr also sagen, alle Nordlinge seien wahnsinnige Mörder?«
»Ich will sagen, dass wir Menschen voller Leidenschaft sind«, erwiderte Gabriel. »Im Guten wie im Schlechten. Um ma famille zu verstehen, um mich zu verstehen, muss Euch das klar sein. Unsere Herzen sprechen lauter als unsere Köpfe.«
»Wie war es dann also mit Eurem Vater?«, fragte Jean-François. »War er auch ein Mann voller Leidenschaften?«
»Oui. Aber er war es nicht im Guten. Er nicht. Er war schlecht, durch und durch.«
Der Silberwächter beugte sich nun vor und stützte die Ellenbogen auf die Knie. In der Zelle war es still, sah man von den kratzenden Strichen ab, mit denen das Eisblut an seinem Porträt arbeitete, und vom vielstimmigen Flüstern des Windes.
»Er war nicht so hochgewachsen wie ich, aber gebaut wie ein Kleiderschrank. Er hatte drei Jahre lang als Kundschafter in der Armee Philippes IV. gedient, bevor der alte Herrscher starb. Aber dann wurde er bei einem Feldzug im Hochland von Ossway von einer Lawine mitgerissen. Er brach sich das Bein, und es verheilte nie wieder richtig, daher wurde er anschließend Schmied. Und bei der Arbeit in der Festung des örtlichen Freiherrn traf er meine Mamá. Eine Schönheit mit rabenschwarzem Haar, stattlich und stolz. Er konnte gar nicht anders, als sich in sie zu verlieben. Da ging es ihm wie allen anderen Männern. Sie war die Tochter des Freiherrn. La demoiselle de León.«
»De León war der Name Eurer Mutter? Ich war der Auffassung, dass Familiennamen bei Euresgleichen vom Vater weitergegeben würden, Silberwächter. Und dass Frauen ihren Namen aufgeben, wenn sie heiraten.«
»Meine Eltern waren nicht verheiratet, als meine Saat gepflanzt wurde.«
Der Vampir schlug sich die spitz zulaufenden Finger vor den Mund. »Wie skandalös.«
»Das dachte jedenfalls mein Großvater. Kaum dass ihr Zustand sich zeigte, verlangte er von Mamá, mich wegmachen zu lassen, aber sie weigerte sich. Mein Großvater verstieß sie daraufhin und bedachte sie mit allen Flüchen, die ihm einfallen wollten. Aber sie war ein Fels, meine Mamá. Sie beugte sich niemandem.«
»Wie lautete ihr Name?«
»Auriél.«
»Wie schön.«
»Genau wie sie. Und diese Schönheit blieb unverdunkelt, selbst in einem Dreckloch wie Lorson. Als sie und Papá dorthin zogen, hatten sie nichts außer den Kleidern, die sie am Leib trugen. Sie brachte mich in der Dorfkirche zur Welt, weil ihr Haus noch kein Dach hatte. Ein Jahr später wurde meine Schwester Amélie geboren. Und dann meine kleine Schwester Celene. Zu dieser Zeit waren Mamá und Papá bereits verheiratet, und meine Schwestern bekamen daher den Namen Castia. Ich fragte Papá, ob ich denselben Namen tragen dürfte, aber er sagte nein. Das hätte mir schon ein erster Hinweis sein sollen. Abgesehen davon, wie er mich behandelte.«
Gabriels Finger strichen über eine dünne Narbe am Kinn, seine Augen blickten in die Ferne.
»Die Fäuste, die selbst die Engel fürchteten?«, fragte Jean-François leise.
Gabriel nickte. »Wie ich schon sagte, Raphael Castia war ein Mann voller Leidenschaften. Und schließlich beherrschten sie ihn. Mamá war eine gottesfürchtige Frau. Sie erzog uns im Einen Glauben und der gesegneten Liebe des Allmächtigen und der Muttermaid. Aber seine Liebe sah anders aus.
In ihm wucherte eine Krankheit. Heute weiß ich das. Zwar kämpfte er nur drei Jahre lang im Krieg, aber er trug ihn für den Rest seines Lebens in sich. Ihm konnte keine Flasche begegnen, ohne dass er ihrem Grund entgegensehen wollte. Und er konnte auch keiner schönen Frau widerstehen. Das war uns allen wesentlich lieber, ehrlich gesagt. Wenn er herumhurte, dann verschwand er einfach für ein oder zwei Tage. Aber wenn er zu Hause war und trank … das war, als ob man mit einem Fass Schwarzpulver zusammenlebte. Das nur auf einen Funken wartete.
Er schlug mir einmal eine Axt so heftig über den Rücken, dass der Stiel zerbrach, weil ich nicht genug Holz gehackt hatte. Er prügelte mich, bis mir die Rippen brachen, weil ich vergessen hatte, Wasser vom Brunnen zu holen. Mamá oder Amélie oder Celene rührte er nicht an, nicht ein Mal. Aber mir waren seine Fäuste so vertraut wie sein Name. Und ich hielt es für Liebe.
Am Tag danach war es jedes Mal dasselbe Lied. Mamá tobte, und Papá schwor bei Gott und allen Sieben Märtyrern, dass er sich ändern würde, o ja. Dann hörte er für eine Weile auf zu trinken, und wir waren glücklich. Er nahm mich mit zum Jagen oder zum Fischen, unterwies mich in der Schwertkunst, die er in seiner Zeit als Kundschafter gelernt hatte, und im Leben draußen in der Wildnis. Wie man es schafft, feuchtem Holz eine Flamme zu entlocken. Wie man durch trockenes Laub geht, ohne dabei ein Geräusch zu machen. Wie man eine Schlinge legt, in der das Wild, das man fangen will, nicht getötet wird. Aber vor allem brachte er mir alles übers Eis bei. Über Schnee. Wie er fällt. Wie er tötet. Er tippte auf sein verletztes Bein und lehrte mich alles über Schneestürme, über Schneeblindheit, über Lawinen, so wie ein echter Vater es getan haben würde. Wir schliefen unter den Sternen in den Bergen.
Aber es hielt nie lange an.
›Der Krieg ist es nicht, der dich das Töten lehrt‹, sagte er mir einmal. ›Er ist nur ein Schlüssel, der etwas in dir öffnet. In allen Menschen lebt eine Bestie, Gabriel. Man kann sie aushungern. Sie einsperren. Sie verfluchen. Aber am Ende zahlt man der Bestie ihren Tribut, oder sie holt ihn sich.‹
Ich erinnere mich, wie ich an meinem achten Heiligentag am Tisch saß und Mamá das Blut von meinem Gesicht wusch. Sie betete mich an, trotz allem, was meine Geburt sie gekostet hatte. Ich spürte das genauso, wie die Sonne meine Haut wärmte. Und ich fragte sie, warum Papá mich so hasste, wenn sie mich doch so lieben konnte. Sie sah mir an jenem Tag in die Augen und seufzte aus tiefstem Herzen.
›Du siehst genauso aus wie er. Gott helfe mir, du siehst ganz genauso aus wie er, Gabriel.‹«
Der Letzte der Silberwächter streckte die Beine aus und betrachtete die Skizze, die der Vampir von ihm gefertigt hatte.
»Dabei war mein Papá breit und untersetzt gebaut, und ich war damals schon hochaufgeschossen. Seine Haut war gebräunt, meine geisterbleich. Ich konnte Mamá im Schwung meiner Lippen und dem Grau meiner Augen erkennen. Aber mein Papá und ich sahen uns überhaupt nicht ähnlich.
Sie zog ihren Ring ab – der einzige Schatz, den sie aus dem Haus ihres Vaters mitgebracht hatte. Er war aus Silber und mit dem Wappen des Hauses de León versehen: zwei Löwen, die einen Schild und zwei gekreuzte Schwerter flankierten. Und sie steckte ihn mir an den Finger und drückte fest meine Hand.
›Das Blut der Löwen fließt durch deine Adern‹, sagte sie mir an jenem Tag. ›Und ein Tag als Löwe zählt mehr als zehntausend Tage als Lamm. Vergiss niemals, dass du mein Sohn bist. Aber da ist eine Begierde in dir. Eine, vor der du dich hüten musst, mein süßer Gabriel. Sonst könnte sie dich mit Haut und Haaren verschlingen.‹«
»Sie scheint eine bemerkenswerte Frau gewesen zu sein«, sagte Jean-François.
»Das war sie. Sie schritt über die schlammigen Straßen von Lorson wie eine hochwohlgeborene Lady durch die goldgeschmückten Säle am Hof des Herrschers. Obwohl ich unehelich zur Welt kam, sagte sie mir, ich solle meinen noblen Namen wie eine Krone tragen. Und jeden mit Gift überschütten, der behauptete, ich hätte nicht das Recht dazu. Meine Mamá kannte sich selbst, und darin liegt eine beängstigende Macht. Wenn man genau weiß, wer man ist, und ganz genau, wozu man in der Lage ist. Die meisten Leute würden das vermutlich arrogant nennen. Aber die meisten Leute sind verdammte Vollidioten.«
»Predigen Eure Priester nicht von ihren Kanzeln von der Tugend der Bescheidenheit?«, fragte Jean-François. »Versprechen sie nicht den Sanftmütigen, dass ihnen einst die Erde gehören soll?«
»Ich habe fünfunddreißig Jahre mit dem Namen gelebt, den meine Mutter mir gegeben hat, Eisblut, und nicht ein Mal habe ich erlebt, dass die Sanftmütigen irgendetwas anderes bekommen hätten als die Abfälle von den Tischen der Starken.«
Gabriel blickte aus dem Fenster zu den fernen Bergen. In die Dunkelheit, die herabsank wie ein Sünder auf die Knie. In der Schrecken wüteten, ohne dass ihnen jemand Einhalt gebot. In der winzige Funken Menschlichkeit flackerten wie Kerzenflammen in einem hungrigen Wind, um schon bald auf ewig zu verlöschen.
»Davon abgesehen, welcher Arsch würde eine Erde wie diese überhaupt haben wollen?«
· II ·Der Anfang vom Ende
Stille stahl sich auf leisen Sohlen in das Zimmer. Gabriel blickte starr vor sich hin, verlor sich in Erinnerungen an Chorgesang und Silberglocke und schwarzen Stoff, der sich teilte, um glatte bleiche Kurven zu offenbaren, bis das sanfte Tippen einer Feder auf Papier seine Gedanken unterbrach.
»Vielleicht sollten wir mit dem Tagestod beginnen«, sagte das Ungeheuer. »Ihr wart vermutlich noch ein Kind, als der Schatten erstmals die Sonne verdunkelte.«
»Oui. Noch ein Junge.«
»Erzählt mir davon.«
Gabriel zuckte die Achseln. »Es war ein Tag wie alle anderen. Ich erinnere mich, dass ich ein paar Nächte zuvor davon aufwachte, dass der Boden bebte. Als ob die Erde sich im Schlaf rührte. Aber an dem Tag selbst erschien zunächst nichts ungewöhnlich. Ich arbeitete mit Papá in der Schmiede, als es losging. Ein Schatten erhob sich über den Himmel wie Sirup, verwandelte leuchtendes Blau in dumpfes Grau, und die Sonne schien dunkel wie Kohle. Alles Volk versammelte sich auf dem Dorfplatz und sah zu, wie das Tageslicht schwand und die Luft sich abkühlte. Wir befürchteten natürlich Hexerei. Fayenmagik. Teufelei. Aber wir glaubten, dass es, wie alle anderen Dinge, bald wieder vergehen würde.
Als aber dann Wochen und Monate verstrichen, ohne dass die Dunkelheit sich wieder hob, breitete sich allmählich Entsetzen aus. Wir hatten zunächst viele Namen dafür: Verdunkelung, Verschleierung, Erste Offenbarung. Aber die Astrologen und Philosophen am Hof des Herrschers Alexandre III. nannten es ›Tagestod‹, und das taten wir am Ende auch. Bei der Messe predigte Père Louis von der Kanzel, dass wir nur fest genug an den Allmächtigen glauben müssten, um diese Zeit zu überstehen. Aber es fällt schwer, an den Allmächtigen zu glauben, wenn das Licht der Sonne nicht mehr heller strahlt als eine verlöschende Kerze und das Frühjahr so kalt bleibt wie der tiefste Winter.«
»Wie alt wart Ihr?«
»Acht. Fast neun.«
»Und wie alt wart Ihr, als Euch klarwurde, dass die Blutsippen begonnen hatten, bei Tag umzugehen?«
»Ich war dreizehn, als ich zum ersten Mal einen Elenden zu Gesicht bekam.«
Der Geschichtsschreiber neigte den Kopf. »Wir bevorzugen den Ausdruck Schmutzblut.«
»Entschuldigung, Herr Vampir«, sagte der Silberwächter mit leichtem Lächeln. »Habe ich irgendwie den Eindruck erweckt, dass es mich auch nur den kleinsten Scheißdreck interessiert, was Ihr bevorzugt?«
Jean-François starrte ihn nur an. Wieder hatte es für Gabriel den Anschein, als ob dieses Ungeheuer aus Marmor und nicht aus Fleisch und Blut bestand. Die schwarze Ausstrahlung des Willens, den der Vampir ausübte, der Schrecken, den er darstellte, und die Lüge seiner Erscheinung – schön, jung, sinnlich –, bildeten einen deutlichen Widerspruch. In einem nur schwach erleuchteten Winkel seines Verstands war sich Gabriel bewusst, wie leicht seine Gegner ihn verletzen konnten. Wie schnell sie die Illusion, er habe hier alles im Griff, zerstören konnten.
Aber das ist das Problem, wenn man einem Menschen alles nimmt, was er hat, nicht wahr?
Wer nichts hat, hat auch nichts mehr zu verlieren.
»Ihr wart dreizehn«, sagte Jean-François.
»Als ich meinen ersten Elenden sah«, bestätigte Gabriel. »Fünf Jahre waren seit dem Tagestod vergangen. In den hellsten Augenblicken war die Sonne immer noch nicht mehr als ein dunkler Fleck hinter der Schmutzschicht, die den Himmel überzog. Es fiel grauer Schnee, kein weißer mehr, und er roch nach Schwefel. Hungersnöte fuhren wie Sensen durch das Land – in jenen Jahren verloren wir die Hälfte der Dorfbewohner durch Hunger oder Kälte. Ich war noch ein Kind, hatte aber schon mehr Leichen gesehen, als ich hätte zählen können. Zur Mittagszeit war es bei uns dämmrig wie am Abend, und am Abend war es finster wie um Mitternacht, und zu essen gab es nichts außer Pilzen oder den verdammten Kartoffeln, und niemand, weder die Priester noch die Philosophen oder irgendwelche sich im Dreck wälzenden Irren, konnte erklären, wie lange das noch so weitergehen sollte. Père Louis predigte, es sei eine Prüfung unseres Glaubens. Blöd, wie wir waren, kauften wir ihm das ab.
Und dann verschwanden plötzlich Amélie und Julieta.«
Gabriel hielt kurz inne, überwältigt von der Dunkelheit in seinem Innern. In seinem Kopf hallte ein Lachen wider, ein hübsches Lächeln, langes schwarzes Haar und Augen, so grau wie seine eigenen.
»Amélie?«, fragte Jean-François. »Julieta?«
»Amélie war meine mittlere Schwester. Celene war die Jüngste von uns dreien, ich der Älteste. Und ich liebte sie beide, sie waren mir so lieb und teuer wie meine süße Mamá. Ami hatte langes dunkles Haar und bleiche Haut wie ich, aber in unserem Temperament waren wir so unterschiedlich wie Morgengrau und Abendrot. Sie befeuchtete sich den Daumen mit der Zunge, rieb damit über die Falte zwischen meinen Augenbrauen und sagte mir, ich solle nicht immer so grimmig dreinblicken. Manchmal sah ich sie tanzen, zu Musik, die sie allein hören konnte. Sie erzählte uns Abendgeschichten, wenn Celene und ich uns schlafen legten. Ami gefielen die gruseligen immer am besten. Von grausamen Fayelingen, dunklen Hexenkünsten und Prinzessinnen, auf die ein schlimmes Schicksal wartete.
Julietas famille wohnte nebenan. Sie war zwölf, genau wie Amélie. Wenn sie zusammen waren, machten die beiden mir das Leben schwer. Aber eines Tages, als wir allein im Wald waren und Weißköpfchen sammelten, stieß ich mir den Zeh und verging mich am Namen des Allmächtigen, und Julieta drohte mir Père Louis von meinem lästerlichen Fluch zu erzählen, wenn ich sie nicht küsste.
Natürlich protestierte ich. Mädchen jagten mir damals noch Angst ein. Aber Père Louis stand jeden prièdi auf seiner Kanzel und wetterte von Hölle und Verdammnis, und ein kleiner Kuss erschien mir das kleinere Übel verglichen mit der Strafe, die mich erwartete, wenn Julieta ihm von meiner Sünde erzählte.
Sie war größer als ich, und so musste ich mich auf die Zehenspitzen stellen. Ich weiß noch, dass sich unsere Nasen ins Gehege kamen, aber dann gelang es doch, und ich drückte meine Lippen auf ihre, die warm waren wie die lang verlorene Sonne. Weich und seufzend. Anschließend lächelte sie mich an. Und sagte, ich sollte öfter gotteslästerlich fluchen. Das war mein erster Kuss, Eisblut. Erpresst unter sterbenden Bäumen mit der Furcht vor dem Allmächtigen.
Es war Spätsommer, als die beiden verschwanden. Eines Tages, als sie Pfifferlinge hatten sammeln wollen. Es war nicht ungewöhnlich, dass Amélie länger wegblieb, als sie ursprünglich gesagt hatte. Mamá schalt sie oft, dass sie mit dem Kopf in den Wolken durchs Leben tanzte, und meine Schwester sagte dann: ›Immerhin kann ich da oben die Sonne spüren.‹ Aber als die Abenddämmerung hereinbrach, ohne dass sie zurückgekommen war, da wussten wir, dass etwas nicht stimmte.
Ich machte mich mit den Männern des Dorfes auf die Suche. Meine kleine Schwester Celene kam auch mit – sie war zwar erst elf, hatte aber die Entschlossenheit einer Löwin, und niemand hätte gewagt, sie daran hindern zu wollen. Nach einer Woche war Papá heiser vom vielen Rufen. Mamá aß nicht und konnte nicht mehr schlafen. Die Leichen der beiden Mädchen konnten wir nicht finden. Aber zehn Tage später fanden sie uns.«
Gabriel fuhr sich mit der Fingerspitze über ein Augenlid und fühlte, wie sich jede einzelne Wimper unter der Berührung bog. Ein kühler Wind fuhr in das lange Haar, das ihm um die Schultern lag.
»Ich schichtete mit Celene Feuerholz für die Schmiede auf, als Amélie und Julieta nach Hause kamen. Das Eisblut, das über sie hergefallen war, hatte ihre Leichen anschließend in einen Sumpf geworfen, und sie waren verdreckt vom Moorwasser, ihre Kleider voller Schlamm. Sie standen vor unserem Haus auf der Straße und hielten sich an der Hand, die Finger verschränkt. Julietas Augen waren tödlich weiß geworden, und die einst so sonnenwarmen Lippen waren schwarz und gaben scharfe kleine Zähne frei, als sie mich anlächelte.
Julietas Mutter kam weinend vor Freude aus dem Haus gerannt. Sie schloss ihre Tochter in die Arme und dankte Gott und allen Sieben Märtyrern dafür, die Mädchen wieder nach Hause geführt zu haben. Und Julieta riss ihr vor unser aller Augen die Kehle heraus. Sie … brach sie einfach auf wie eine verdammte reife Frucht. Ami fiel ebenfalls über Julietas Mutter her, grapschte nach ihrem Fleisch und zischte in einer Stimme, die nicht ihre war.« Gabriel schluckte schwer. »Das Geräusch, das sie machte, als sie zu trinken begann, werde ich niemals vergessen.
Wegen dem, was dann geschah, lobten mich die Männer des Dorfes für meinen Mut. Und ich wünschte, ich könnte sagen, ich hätte Mut empfunden, als meine Schwester ihr Gesicht in das strömende Rot tauchte, das ihre Wangen und Lippen färbte. Aber wenn ich heute daran zurückdenke, dann weiß ich, dass ich nur deswegen so standhaft blieb, weil die kleine Celene schreiend davonrannte.«
»Liebe?«, fragte das Eisblut.
Der Letzte der Silberwächter schüttelte den Kopf, den Blick auf die Flamme der Lampe gerichtet.
»Hass«, sagte er dann. »Hass auf das, was aus meiner Schwester und Julieta geworden war. Auf das Ding, das ihnen so etwas angetan hatte. Aber vor allem darauf, dass dies der Anblick sein würde, den ich von den beiden Mädchen von nun an in Erinnerung behalten würde. Nicht Julietas geraubten Kuss unter den sterbenden Bäumen. Nicht Amélies abendliche Geschichten. Sondern das. Die beiden, auf allen vieren, wie sie Blut vom Boden aufleckten, als seien sie verhungerte Hunde. Hass war alles, was ich in diesem Augenblick empfand. Hass mit all der ihm innewohnenden Verheißung und Kraft. An jenem kühlen Sommertag begann er, in mir zu wurzeln, und ich glaube, er hat mich bis heute nicht mehr losgelassen.«
Jean-François wandte seinen Blick der Motte zu, deren Flügel noch immer erfolglos gegen das Glas der Laterne schlugen. »Zu viel Hass lässt einen Menschen zu Asche verbrennen, Chevalier.«
»Oui. Aber wenigstens ist es ein warmer Tod.«
Der Letzte der Silberwächter sah nun seine tätowierten Hände an, die sich langsam zu Fäusten ballten.
»Ich hätte meine Schwester nicht verletzen können. Selbst in diesem Augenblick liebte ich sie noch. Daher nahm ich die Spaltaxt und schlug mit aller Kraft nach Julietas Hals. Es war ein ziemlich ordentlicher Hieb. Aber ich war erst dreizehn, und selbst für einen ausgewachsenen Mann ist es nicht leicht, einem Menschen den Kopf abzuschlagen, von einem Eisblut ganz zu schweigen. Das Wesen, das einmal Julieta gewesen war, stürzte in den Dreck und grapschte nach der Axt, die in seinem Schädel steckte. Amélie hob den Kopf, und ihr hing der blutige Sabber vom Kinn. Als ich in ihre Augen sah, war es, als starrte ich in das Angesicht der Hölle. Und erblickte darin nicht Feuer und Schwefel, wie Père Louis es stets auf der Kanzel verkündet hatte, sondern nur … Leere.
Verdammte, beschissene Leere.
Meine Schwester öffnete den Mund, und ich sah, dass ihre Zähne lang und schimmernd wie Messer waren. Und das Mädchen, das mir abends vor dem Einschlafen Geschichten erzählt, das zu Musik getanzt hatte, die sie allein hören konnte, federte in die Höhe und griff mich an.
Gott im Himmel, sie war stark. Ich fühlte nichts, bis ich der Länge nach hinschlug. Sie sprang rittlings auf meine Brust, so dass ich die Fäulnis und das frische Blut in ihrem Atem roch, und als ihre Fangzähne über meine Kehle strichen, da wusste ich, dass ich sterben würde. Als ich in diese leeren Augen sah, da hasste und fürchtete ich den Tod zwar, aber ich wollte ihn.
Ich hieß ihn willkommen.
Doch dann rührte sich etwas in mir. Wie ein Bär, der nach dem Winterschlaf hungrig erwacht. Und als meine Schwester ihren verfaulten Mund aufriss, packte ich sie an der Kehle. Bei Gott, sie war kräftig genug, um Knochen zu Staub zu zermahlen, aber ich stieß sie trotzdem zurück. Und während sie mit blutigen Fingerspitzen nach meinem Gesicht grapschte, spürte ich, wie Hitze meinen Arm durchströmte und meine Haut kribbeln ließ. Da war etwas Dunkles. Etwas Tiefes. Und mit einem Kreischen, bei dem sich mir der Magen umdrehte, machte Amélie einen Satz zurück und presste sich die Hände gegen das blubbernde Fleisch an ihrem Hals.
Roter Dampf stieg von ihrer Haut auf, als ob das Blut in ihren Adern kochte. Rote Tränen flossen aus ihren Augen, während sie kreischte. Inzwischen hatten aber Celenes Schreie das ganze Dorf alarmiert. Amélie wurde von kräftigen Händen gepackt und auf den Rücken geworfen, während der Dorfälteste eine Fackel an ihr Kleid hielt und sie wie ein Feuerstoß zu Erstmess in Flammen aufging. Julieta kroch noch mit meiner Axt in ihren Locken durch den Dreck, als man auch sie anzündete, und die Geräusche, die sie machte, als sie verbrannte … bei Gott, es war … entsetzlich. Ich hockte im Dreck, Celene niedergeduckt neben mir, und wir sahen zu, wie unsere Schwester wie eine lebende Fackel hin und her zuckte und sich drehte. Ein letzter, schrecklicher Tanz. Papá musste Mamá zurückhalten, die sich dem brennenden Ding entgegenstürzen wollte. Ihre Schreie waren lauter als Amélies.
Meine Kehle wurde dann ein Dutzend Mal untersucht, aber ich hatte nicht einmal einen Kratzer abbekommen. Celene drückte meine Hand und wollte wissen, ob es mir gut ging. Manche Leute warfen mir komische Blicke zu und fragten sich wohl, wie ich hatte überleben können. Aber Père Louis erklärte, es sei ein Wunder gewesen. Gott habe mich verschont, da ich zu Höherem geboren sei.
Trotzdem weigerte er sich, die beiden Mädchen zu beerdigen, der Dreckskerl. Sie seien gestorben, ohne zuvor die Beichte abzulegen, sagte er. Daher wurden ihre Überreste zu einer Wegkreuzung gebracht und dort verstreut, damit sie niemals mehr den Weg zurück nach Hause finden sollten. Das Grab meiner Schwester blieb auf ewig leer und auf ungeweihtem Boden, ihre Seele verdammt für alle Ewigkeit. Sosehr mich Louis auch mit Lob überhäuft hatte, dafür hasste ich ihn.
Noch tagelang konnte ich Amélies Asche an mir riechen. Ich träumte jahrelang von ihr. Manchmal war auch Julieta dabei. Die beiden saßen dann auf mir und küssten mich überall mit furchtbar schwarzen Lippen. Aber obwohl ich keine Ahnung hatte, was mit mir geschehen war oder wie in Gottes Namen ich hatte überleben können, eins wusste ich genau.«
»Dass es die Blutsippen wirklich gab«, sagte Jean-François.