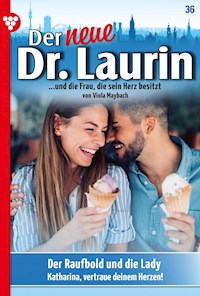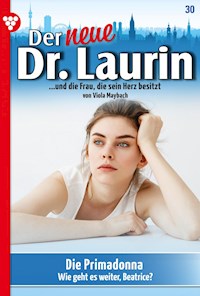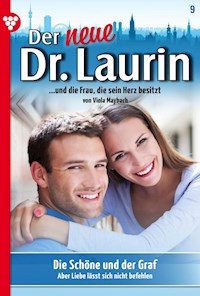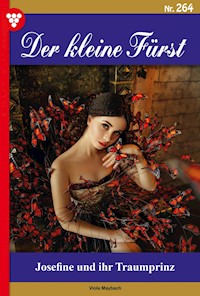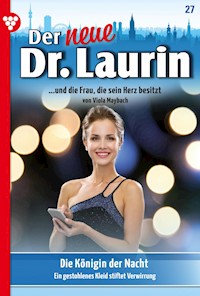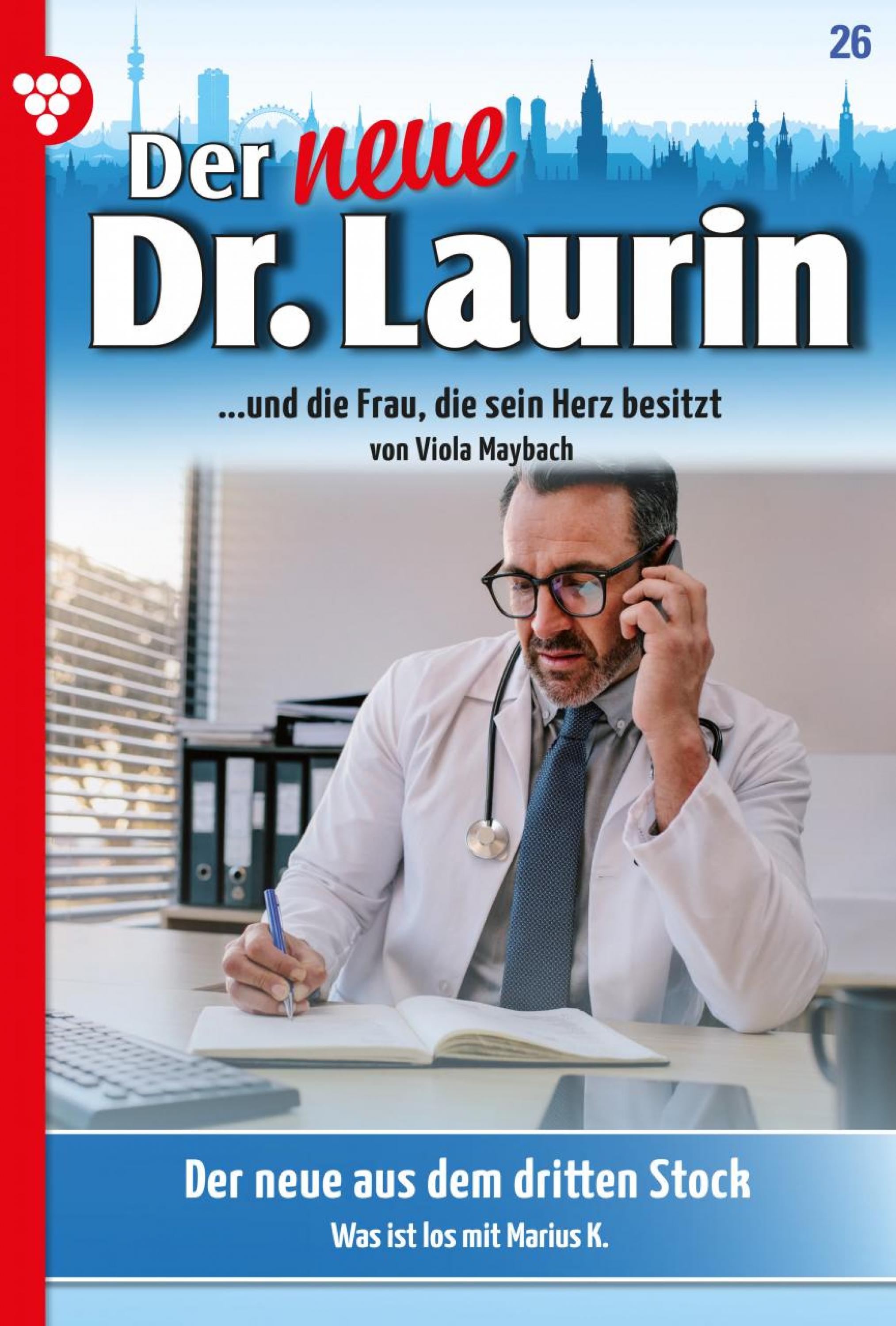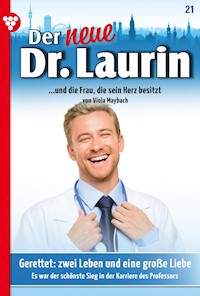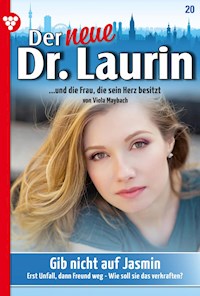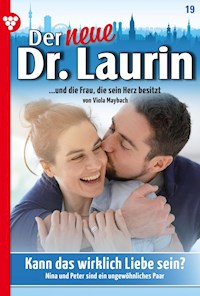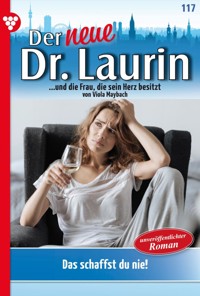
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blattwerk Handel GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Der neue Dr. Laurin
- Sprache: Deutsch
Diese Serie von der Erfolgsschriftstellerin Viola Maybach knüpft an die bereits erschienenen Dr. Laurin-Romane von Patricia Vandenberg an. Die Familiengeschichte des Klinikchefs Dr. Leon Laurin tritt in eine neue Phase, die in die heutige moderne Lebenswelt passt. Da die vier Kinder der Familie Laurin langsam heranwachsen, möchte Dr. Laurins Frau, Dr. Antonia Laurin, endlich wieder als Kinderärztin arbeiten. Somit wird Antonia in der Privatklinik ihres Mannes eine Praxis als Kinderärztin aufmachen. Damit ist der Boden bereitet für eine große, faszinierende Arztserie, die das Spektrum um den charismatischen Dr. Laurin entscheidend erweitert. »Danke, mein Großer«, sagte Maren Mühlberg und gab ihrem ältesten Sohn Jonas einen Kuss auf die Wange. »Wenn ich dich nicht hätte!« »Du hast doch noch fünf weitere Kinder, helfen die dir nicht?«, fragte er, als er sich zu ihr hinunterbeugte – sie war deutlich kleiner als er. Um genau zu sein: fünfundzwanzig Zentimeter. Er gab ihr nun seinerseits einen Kuss. »Hab ich gern gemacht, Mama.« »Die anderen helfen mir auch, aber niemand so wie du«, erwiderte sie mit einem Lächeln. Sie sagte einer Kollegin Bescheid, dass sie ein paar Sachen in ihrem Spind verstauen müsse, und so schnappte sich Jonas die beiden schweren Einkaufstaschen, die er gerade erst abgestellt hatte, und folgte ihr. In den Aufenthaltsraum durfte er nicht mit, also wartete er vor der Tür, bis seine Mutter wieder herauskam. Sie war erst achtundvierzig Jahre alt, aber zum ersten Mal ging ihm auf, dass sie älter aussah, als sie war – und wenn er jetzt so darüber nachdachte, wunderte ihn das nicht. Sie hatte, wie er, blonde, etwas störrische Haare und blaue Augen. Sie waren die einzigen in der Familie, die so aussahen. Sein Vater war dunkelhaarig und braunäugig, und seine fünf Geschwister waren es auch. Vielleicht, dachte er, hängen wir deshalb so aneinander, Mama und ich, weil sie mir ihre Haare und ihre Augen vererbt hat. Nur die Größe nicht, die hatte er von seinem Vater. »Du hast viel mehr gekauft, als wir brauchen!«, sagte sie.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 117
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der neue Dr. Laurin – 117 –Das schaffst du nie!
Unveröffentlichter Roman
Viola Maybach
»Danke, mein Großer«, sagte Maren Mühlberg und gab ihrem ältesten Sohn Jonas einen Kuss auf die Wange. »Wenn ich dich nicht hätte!«
»Du hast doch noch fünf weitere Kinder, helfen die dir nicht?«, fragte er, als er sich zu ihr hinunterbeugte – sie war deutlich kleiner als er. Um genau zu sein: fünfundzwanzig Zentimeter. Er gab ihr nun seinerseits einen Kuss. »Hab ich gern gemacht, Mama.«
»Die anderen helfen mir auch, aber niemand so wie du«, erwiderte sie mit einem Lächeln. Sie sagte einer Kollegin Bescheid, dass sie ein paar Sachen in ihrem Spind verstauen müsse, und so schnappte sich Jonas die beiden schweren Einkaufstaschen, die er gerade erst abgestellt hatte, und folgte ihr. In den Aufenthaltsraum durfte er nicht mit, also wartete er vor der Tür, bis seine Mutter wieder herauskam.
Sie war erst achtundvierzig Jahre alt, aber zum ersten Mal ging ihm auf, dass sie älter aussah, als sie war – und wenn er jetzt so darüber nachdachte, wunderte ihn das nicht. Sie hatte, wie er, blonde, etwas störrische Haare und blaue Augen. Sie waren die einzigen in der Familie, die so aussahen. Sein Vater war dunkelhaarig und braunäugig, und seine fünf Geschwister waren es auch. Vielleicht, dachte er, hängen wir deshalb so aneinander, Mama und ich, weil sie mir ihre Haare und ihre Augen vererbt hat. Nur die Größe nicht, die hatte er von seinem Vater.
»Du hast viel mehr gekauft, als wir brauchen!«, sagte sie.
»Hab ich nicht«, behauptete Jonas, obwohl es natürlich stimmte, aber so war die Regel: Sie tadelte ihn, obwohl sie natürlich froh war über alles, was er gekauft hatte, und er war froh, dass er seinen Eltern auf diese Weise wenigstens etwas von dem zurückgeben konnte, was sie für ihn taten. Sie ließen ihn studieren, obwohl ihr Leben sehr viel einfacher gewesen wäre, wenn er die Schule schon vor Jahren abgeschlossen, eine Lehre begonnen und zu Hause einen Teil des verdienten Geldes abgegeben hätte. So, wie es in seiner Familie seit Generationen üblich war.
Sein Vater arbeitete bei den städtischen Entsorgungsbetrieben, genauer: bei der Müllabfuhr, und seine Mutter war Verkäuferin in diesem Kaufhaus, das immerhin zu der Sorte gehörte, die man ›gehoben‹ nannte. Es war kein Billigmarkt, wo etwa Kleidung verramscht wurde, die irgendwo in Asien unter menschenunwürdigen Bedingungen hergestellt worden war. Hier gab es ordentlich gefertigte Markenware. Seine Mutter arbeitete gern hier, sie war Textilfachverkäuferin, und wenn sie Kundinnen oder Kunden bedienen konnte, die sich eine Beratung von ihr wünschten, war sie glücklich.
Auch sein Vater schätzte seinen Job, den er zu Beginn als Übergangslösung angesehen hatte, mittlerweile sehr. Nicht, dass die Müllabfuhr sein Traum gewesen war, aber er und seine Kollegen waren ein gutes Team und wurden anständig bezahlt, sie arbeiteten schnell und zuverlässig zusammen, und er konnte sich den Wechsel auf einen Arbeitsplatz, der vielleicht ruhiger und gemütlicher gewesen wäre, längst nicht mehr vorstellen. Natürlich, wenn es kalt und nass war, aber auch bei großer Hitze, stöhnte er schon mal, aber im Großen und Ganzen fühlte er sich wohl an seinem Platz. Und er machte seit einiger Zeit Sport, weil ihm sein Hausarzt dazu geraten hatte. Seitdem ging er in ein Fitnessstudio, und tatsächlich traten seine Rückenschmerzen, unter denen wegen der harten körperlichen Arbeit mehr oder weniger alle seine Kollegen litten, viel seltener auf.
Da Jonas‘ Eltern sechs Kinder hatten, war das Geld, so lange Jonas denken konnte, mehr als knapp gewesen, dabei hatte seine Mutter nie aufgehört zu arbeiten. Ihm war es ein Rätsel, wie sie das geschafft hatte: den Haushalt, die Kinder, die Arbeit. Natürlich hatte sie eine Weile nicht Vollzeit arbeiten können, aber trotzdem … Er erinnerte sich freilich, dass sie eine Zeit lang immer nur müde und erschöpft ausgesehen hatte, bis ihr Hausarzt eingeschritten war: Er hatte dafür gesorgt, dass ihr eine Kur bewilligt worden war, und so war seine Mutter einmal für vier Wochen im Schwarzwald gewesen.
Im Einzelnen wusste er nicht mehr, wie sie sich zu Hause durchgewurstelt hatten, aber irgendwie war es gegangen. Er selbst war sechzehn gewesen, Nina, seine jüngste Schwester, gerade sechs. Er lächelte unwillkürlich, als ihm wieder einfiel, wie erwachsen er sich damals vorgekommen war, denn sein Vater hatte zu ihm gesagt: »Du wirst mir helfen müssen, Jonas, allein schaffe ich das nicht. Ich konnte eine Woche Urlaub nehmen, aber deine Mutter bleibt ja vier Wochen weg. Wir werden uns alle anstrengen müssen, damit das hier nicht im Chaos endet.«
Sie hatten es hingekriegt, ziemlich gut sogar nach den ersten Tagen, an denen so gut wie gar nichts geklappt hatte. Aber dann hatten sich alle zusammengerissen, und am Ende der vier Wochen waren sie ein sehr gut aufeinander eingespieltes Team gewesen. Vor allem: Sie waren es geblieben, denn sie hatten darauf geachtet, dass ihre Mutter sich nie wieder überanstrengen musste, und so war es bis heute geblieben. Nicht, dass Maren Mühlberg besonders zart oder anfällig gewesen wäre, aber es war natürlich immer noch so, dass ihr Leben vor allem aus Arbeit bestand.
»Frau Mühlberg, kannst du mal kommen?«, rief eine Kollegin.
Jonas hatte seine Mutter mal gefragt, warum sich im Kaufhaus die Angestellten alle duzten, sich aber trotzdem mit den Familiennamen anredeten. »Weil die einmalig sind – wenn nicht gerade drei Müllers oder Meiers dabei sind. Bei den Vornamen gibt es dagegen immer Verwechslungsgefahr«, hatte Maren geantwortet, aber sie hatte dabei gelacht und mit den Schultern gezuckt, was heißen sollte, dass sie es selbst nicht so genau wusste.
Er nutzte die Gelegenheit, sich zu verabschieden, zumal er sah, dass es zwei Kundinnen gab, die offensichtlich nach einer Verkäuferin Ausschau hielten. »Bis bald, Mama«, sagte er, küsste sie noch einmal auf die Wange und verließ das Kaufhaus.
Er atmete auf, sobald er draußen war. Die Luft da drin fand er zum Schneiden, während seine Mutter immer behauptete, er übertreibe, sie merke davon nichts. »Da musst du mal in so einen Billigladen gehen – da wird dir richtig schlecht, so riecht es da überall nach Chemie. Bei uns haben sie ein sehr gutes Belüftungssystem, glaub mir.«
Er glaubte ihr, trotzdem war auch die Luft des gehobenen Kaufhauses ›Lindemayer‹ nichts für ihn. Er sah auf die Uhr und setzte sich eilig in Bewegung, um rechtzeitig zu seinem Seminar an der Uni zu kommen. Er studierte Jura, bald würde er sein erstes Examen machen – ein Examen, bei dem ein großer Teil der Studierenden erfahrungsgemäß durchfiel. So war es offenbar schon immer gewesen, und so würde es wohl auch bleiben. Er machte sich keine großen Sorgen, bislang war er gut durch das Studium gekommen. Nicht, dass er sich einbildete, besser als die anderen zu sein, aber er war härter im Nehmen: Er arbeitete mehr, weil er seine Eltern so bald wie möglich finanziell unterstützen wollte. Da er einen Job als wissenschaftliche Hilfskraft an der Uni hatte, tat er das auch jetzt schon, aber natürlich nur in sehr bescheidenem Umfang. Von den Geschwistern war er bislang der Einzige.
Nina und Flora, seine beiden jüngsten Schwestern, gingen noch zur Schule, auch sie würden Abitur machen. Sie waren ›superschlau‹, wie Martin, der Neunzehnjährige, einmal festgestellt hatte, und da war etwas dran: Flora wollte Ärztin werden, Nina eine möglichst berühmte Chemikerin. Martin machte eine Ausbildung bei der Bundesbahn, sein Bruder Michael war Schreiner geworden. Da er aber mit seinen einundzwanzig Jahren bereits verlobt war und bald heiraten wollte, brauchte er das Geld, das er verdiente, für sich selbst und seinen bald zu gründenden Hausstand. Und Stefanie, die älteste Schwester, war das Sorgenkind der Familie. Sie war unstet, wusste nicht, was sie wollte und hatte schon drei abgebrochene Ausbildungen hinter sich. Derzeit wohnte sie bei einem Freund, doch in der Familie ging niemand davon aus, dass das von Dauer sein würde. Jonas hatte sich schon als Kind nicht gut mit ihr verstanden, und das war bis heute so geblieben. Stefanie machte einfach ständig Ärger. Und sie bereitete ihren Eltern großen Kummer, das war es, was Jonas ihr am meisten verübelte. Aber vermutlich würde sie sich nicht mehr ändern.
Er legte zwischendurch einen kleinen Spurt ein, und so kam er gerade noch rechtzeitig im Seminarraum an, den er knapp vor seinem Professor betrat. Zum Glück war er gut vorbereitet, wie eigentlich immer. Er hasste es, sich kurz vor Seminarbeginn schnell noch etwas durchzulesen, was sie zu Hause hätten erarbeiten sollen.
Der Platz neben James Unger war noch frei, er ließ sich darauf fallen. »Hab ich dir freigehalten«, sagte James mit breitem Grinsen, während der Professor nach vorne eilte.
James hieß eigentlich Hans, hatte er Jonas neulich erzählt, weil sein Patenonkel Hans hieß. »Aber den kann ich nicht leiden, weil er so ein verbohrter Mann ist, der an einer Meinung, die er sich einmal gebildet hat, für immer festhält, deshalb habe ich mich in James umgetauft. Meine Eltern finden das unmöglich und weigern sich, mich so zu nennen, aber alle anderen kennen mich nur als James.«
Jonas hatte die Geschichte interessant gefunden, vor allem, weil er selbst nie im Leben auf die Idee gekommen wäre, sich einen anderen Namen zu geben. Wäre das nicht auch eine Beleidigung seiner Eltern gewesen? Aber ein bisschen bewunderte er James auch für seinen Mut.
Sie saßen seit ein paar Wochen im Seminar häufig nebeneinander. Zuerst hatten sie nur hin und wieder ein paar Worte gewechselt, aber bald festgestellt, dass sie zahlreiche Gemeinsamkeiten hatten – und, vor allem, dass sie sich sympathisch fanden.
James hatte Jonas‘ Test, von dem James natürlich nichts ahnte, mit Bravour bestanden, was nicht selbstverständlich war. Der Test bestand darin, dass Jonas erzählte, was seine Eltern beruflich machten – und dass er nur dank eines Stipendiums studieren konnte.
»Wahnsinn!«, hatte Jonas gesagt. »Wie haben deine Eltern das denn geschafft? Ich meine, sechs Kinder, zwei sehr anstrengende Berufe, wenig Geld – und trotzdem sitzt du jetzt hier. Das ist eine wahnsinnige Leistung.«
So sah Jonas das auch, und danach hatte seine Freundschaft mit James begonnen, der, das begriff Jonas, noch bevor James es ihm erzählte, einen völlig anderen Hintergrund hatte. Sein Vater war ein hohes Tier in einer Bank, seine Mutter war zu Beginn der Ehe Buchhändlerin gewesen, hatte dann aber wegen der Kinder – James hatte noch eine Schwester – aufgehört zu arbeiten. »Es lohnte sich für sie auch einfach nicht«, hatte James nüchtern berichtet, »weil mein Vater so viel verdient hat, dass wir sowieso mehr als genug Geld hatten. Also arbeitet sie ehrenamtlich, und das macht sie mit großer Begeisterung. Meine Eltern sind toll, ehrlich. Meine Schwester und ich haben schon immer gewusst, dass wir mit ihnen richtig großes Glück gehabt haben.«
So wie ich mit meinen, dachte Jonas, und ihm wurde bei diesem Gedanken ganz warm ums Herz.
Der Professor begann zu reden, und Jonas lenkte seine Gedanken endlich ins Hier und Jetzt. Er brauchte auch in diesem Seminar eine gute Note, also galt es, sich anzustrengen und die Gedanken nicht länger umherschweifen zu lassen.
Nach dem Seminar, in dem Jonas zweimal hatte glänzen können, verließen James und er gemeinsam den Raum. »Ich habe übrigens übernächstes Wochenende Geburtstag und wollte ein bisschen feiern«, sagte James. »Bei mir zu Hause. Hast du Lust zu kommen? Ich weiß, das ist immer blöd, wenn man niemanden kennt, aber eigentlich habe ich nur nette Freundinnen und Freunde. Gut, einige sind netter als andere, aber du kannst dir ja die netteren herauspicken. Es gibt zu essen und zu trinken, für Musik ist auch gesorgt, meine Eltern werden sich am Anfang mal kurz blicken lassen, sich dann aber diskret verziehen, das haben sie mir versprochen.«
»Du wohnst noch zu Hause?«, fragte Jonas verblüfft.
»In einem Anbau, der eigentlich für meine Großeltern gedacht war, aber die sind noch so fit, dass sie da gar nicht einziehen wollen. Für mich ist das praktisch, ich kann dort für mich sein, wann immer ich will. Und meine Mutter ist auch sehr froh über diese Lösung, weil sie so einfach mal zu mir rüberkommen kann, wenn sie sich einsam fühlt. Meine Schwester wohnt nicht mehr im München, und mein Vater arbeitet manchmal sehr lange abends, da fällt ihr schon mal die Decke auf den Kopf.«
Jonas sah ein kleines Appartement vor sich, das an ein größeres Haus angebaut worden war – er stellte sich James‘ Behausung klein, aber praktisch eingerichtet vor, mit allem, was man brauchte, also auch noch einer winzigen Küche und einem Bad. Immerhin, James hatte eine eigene Wohnung, während er zwar eine Dusche für sich allein hatte, sich die Küche aber mit vielen anderen teilen musste, was manchmal eine echte Katastrophe war.
Jonas wohnte seit einiger Zeit im Studentenheim, sodass es in der Wohnung seiner Eltern etwas mehr Platz gab, demnächst würde auch Michael ausziehen. Das war auch nötig, die fünf Zimmer, die sie hatten, waren eigentlich immer zu eng gewesen für acht Personen. Aber irgendwie war es ja trotzdem gegangen.
»Ich komme gern«, sagte er, »wenn du mir sagst, was ich dir schenken soll.«
»Geschenke sind verboten«, sagte James. »Wenn du unbedingt was mitbringen willst, bring was zu trinken mit, egal was. Es wird immer viel getrunken auf unseren Partys, obwohl wir alle wissen, wie ungesund das ist.«
Bei diesen Worten grinste er wieder von einem Ohr zum anderen. Er hatte braune Locken und viele Sommersprossen, die sich über das ganze runde Gesicht verteilten, und seine braunen Augen blitzten übermütig.
Jonas lachte und stellte fest, dass er sich über die Einladung mehr freute, als er sagen konnte: Sie bedeutete ja wohl, dass sie allmählich richtige Freunde wurden, James und er.
*
Carina Fahrenbach steuerte den Laden von Teresa Kayser zielstrebig an. Sie kaufte öfter hier ein, wenn sie nach etwas Besonderem suchte. Zwar es ein Geschäft, das sich vorwiegend an Frauen wandte, die älter waren als sie – sie war einundzwanzig – aber sie hatte bislang noch jedes Mal etwas Passendes gefunden. Sie war wählerisch und nicht leicht zufriedenzustellen, das wusste Frau Kayser, mit der sie sich gelegentlich unterhielt. Teresa Kayser war schon über sechzig, aber in Carinas Augen eine der elegantesten Frauen, die sie kannte. Noch nie hatte sie sie unpassend gekleidet gesehen. Sie ging mit der Mode, ohne deren extremste Ausprägungen mitzumachen, was in Carinas Augen eine hohe Kunst war.