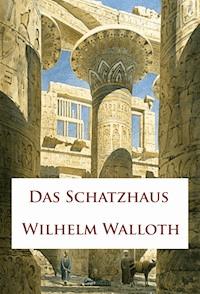
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: idb
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der junge Mann versuchte die Weinende zu beruhigen, er gab ihr die zärtlichsten Namen, versicherte sie, daß er jeden Abend in ihr Haus schleichen wolle, daß er ihr einen ergebenen Diener täglich senden wolle, ihr Nahrung zu bringen, sie aber wehrte heftig alle seine Liebkosungen ab, suchte ihr tränenüberströmtes Gesicht zu verbergen und rief ein über das andere Mal: »Gehe! Oh, hätte ich dir nicht dein Leben gerettet, hätten sie dich und mich getötet.« Nach vielen vergeblichen Versuchen, sich ihr verständlich zu machen, stand Menes auf. »Du willst, daß ich gehe! Gut denn, ich gehorche dir,« sprach er mit schmerzlichem Trotz. »So will ich dich denn nie mehr wiedersehen. Lebe wohl und vergiß mich, wie ich dich zu vergessen suche.« Schon hatte er die Türe erreicht, da sprang Myrrah auf, als ob sie ihn zurückhalten, sich an seine Brust werfen wollte, aber sie faßte sich gewaltsam, indem sie auf ihren Sitz zurücksank, die Arme und den Kopf erschlafft herabhängen lassend. Menes ging. ..
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 434
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wilhelm Walloth
Das Schatzhaus des Königs
Roman aus dem alten Ägypten
Und die Ägypter zwangen die Kinder Israels mit Unbarmherzigkeit.
2. Mose, 1, 13
Erster Teil
Erstes Kapitel
Die Wüste! Wie ein Leichenhemd bleicht sie im Westen. Leer, öde, wie der Tod, liegt sie dort; ihre gelblichweißen Sandkörner dürsten unter der sengenden Sonnenglut bis an den Himmel; bis dahin, wo sich sein schönes Blau in gelbroten Duft verwandelt, stößt die arme, menschenverlassene, löwenbewohnte Wüste. Dort weiter im Westen liegt die Oase Amun, wie ein verlorner Smaragd, grün, blühend, üppig. Aber im Osten blinkt der Nil durch goldene Ähren. Welcher Gegensatz. Hier Tod, da Leben. Hier Trauer, dort Freude; denn haarscharf grenzt an den Sand das Gras, unmittelbar an den Garten Ägyptens stößt die Wüste; nur so weit die Überschwemmung des Nils reicht, gedeiht das Land. Und welches Land! Dort die nackten Arbeiter auf der Pyramide, wenn sie erschöpft die Werkzeuge sinken lassen, erquicken sich oft an dem Anblick dieses Landstrichs, der sich mit seinen Auen, Ährenfeldern, Kanälen, Häfen, Tempeln und rötlichen Steingöttern vor ihnen ausbreitet; dicht an die Wellen des Flusses geschmiegt, wie der goldschimmernde Prachtmantel eines Königs. Es sind jüdische Arbeiter, verachtete Ebräer, die dort unter dem Geißelhieb ägyptischer Bauaufseher, vom Glutwind der Wüste angehaucht, im Schweiße ihres Angesichts dem König Ramses das Grabmal bauen. Der Bau naht seiner Vollendung; Stufe türmt sich auf Stufe; bis zur höchsten Spitze schwindeln die Treppen empor, dort aber soll die Kolossalstatue des Königs ihren Platz finden. Dies schwierige Werk auszuführen, ist man im Augenblick beschäftigt. Eine schiefe Ebene führt über die menschenwimmelnden Treppen empor bis zum Gipfel des Riesengrabes. Auf diesem schiefen Weg steht das Steinbildnis des Königs. Die Arme dicht am Leib, die Hände auf den Knien, starrt es mit feierlicher Ruhe die zahllosen Arbeiter an, die bemüht sind, an Walzen und Stricken das granitene Ungetüm in die Höhe zu rollen. Auf den Knien des Bildes steht ein Oberaufseher, mit den Händen den Rhythmus angebend, unter welchem die Männer zu ziehen haben; ein vor ihm stehender Gehilfe markiert den Takt durch aneinandergeschlagene Stäbe. Zur Seite wandeln Wasserträger, von welchen der vorderste den schiefen Weg übergießt, die Bahn glatt und kühl zu halten. So bewegt sich das Bild des Königs langsam seinem Bestimmungsort entgegen. Unten hält der König in eigner Person und schaut von seinem Streitwagen aus dem Werke zu. Er ist im Begriff sich mit dem kriegslustigen Volk der Chetas in einen Kampf einzulassen, aber bevor er sein Ägypten verläßt, will er sein Bild auf den Gipfel seines Grabes gehoben sehen. Des Königs Züge blicken ernst. Seine Umgebung teilt die ernste Stimmung, denn das Werk, das sie anstaunen, ist ebenso wichtig als dasjenige, das sie im Begriffe sind, zu unternehmen; beide kosten Menschenleben.
»Macht eine Pause,« befiehlt Ramses. »Laßt die Arbeiter einige Sekunden ruhen, reicht ihnen Wasser, laßt die Weiber Erfrischungen herbeitragen.«
Dies geschieht. Der Koloß wird inmitten seines Weges eingehalten, die Stricke werden befestigt, der Koloß liegt vor Anker. Auch die Peitsche der Aufseher ruht. Aller Augen ruhen auf dem König, der wortkarg sein Bild mustert, wie es dort verderbenbringend zwischen Himmel und Erde schwebt. Verderbenbringend! Denn das geringste Versehen, ein falscher Zug, ein falscher Takt kann das Steingewicht der Statue zermalmend herabschleudern, Tausenden den Tod bringend. Und welch unglückliche Vorbedeutung, wenn das Bild des Königs herniedersänke von seinem Sitz? Alle Zuschauer, selbst die arbeitenden Ebräer sind sich der Wichtigkeit des Moments bewußt; sie sprechen wenig, Winke und Andeutungen ersetzen jetzt die Worte. Überall Schweigen der Erwartung, nur auf einer der obersten Stufen hat sich ein lebhafter Wortwechsel entsponnen. Dort liegt ein alter, weißhaariger Jude, schweißtriefend auf den glühenden Steinen der Treppe, neben ihm kniet ein jüngerer Mann von dunkler Gesichtsfarbe und scheublickenden Augen, die verstohlen unter den Wimpern hervorblitzen.
»Vater,« flüstert die Stimme des jungen Mannes, »erhebe dich, der Aufseher bemerkt deine Ermattung. Du weißt, wir dürfen nicht ermüden, selbst das Alter nicht.«
»Mein Sohn Isaak –,« mehr vermag die trockne Zunge des Alten nicht hervorzustottern. Der Sohn reicht ihm einen Wasserkrug und netzt die welken Lippen des Vaters. Lächelnd streicht der Ermattete nun über die Hand des Jüngeren, in seinem Auge glüht Dankbarkeit.
»Nun aber raffe dich auf, Vater,« flüstert Isaak aufs neue, »willst du die Peitsche des elenden Ägypters kosten? Mache nicht, daß der Sohn sehen muß, wie der Rücken des Vaters blutet. Oh! mir kocht der Zorn im Herzen, wenn ich dich mißhandelt sehe.«
»Laß mich hier liegen, bekümmere dich nicht um mich, mein Sohn,« erwidert ihm der Erschöpfte. »Verbeiße deinen Grimm zwischen den Lippen, dein Zorn kann mir nichts helfen, du erschwerst nur dadurch unser Elend. Mich werden sie bald zum Leichnam gepeitscht haben, aber dir, Isaak, wird die Pflicht, dich zu schonen. Was soll deine Schwester Rebekka beginnen ohne dich? Tue, was dir die Vögte sagen, widersprich ihnen nicht – gib mir die Hand darauf, Isaak, daß du geduldig die Beschimpfungen tragen, dich nicht widersetzen willst, bis sich der Herr dein Gott, gelobt sei er, vielleicht später über dich erbarmt.«
Unwillig reichte der Jüngling dem Vater die Hand. Trotz lagerte sich in seinen Zügen, als aber der Vater bittend zu ihm empor sah, versuchte er zu lächeln.
»Nun sind es vierzig Jahre, daß ich den Ägyptern die Steine zu ihren Bauten fahre,« murmelte der alte Jude. »Wann wird Jehova, gelobt sei er, das Leiden seinem Kinder enden und es genug sein lassen der Qual? O armes Volk der Ebräer! Deine Weiber gebären Sklaven, deine Männer erziehen gekrümmte Nacken. Dein Blut dient den stolzen Unterdrückern zum Mörtel, deine Kraft baut ihnen unsterbliche Monumente, Aussatz und Verdummung erniedrigen dich, dein Stamm ist ein Rudel Hunde geworden. Wie waren wir angesehen, als Abraham einzog in dies Land und der Vater Josephs seine Herde weidete im Lande Gosen! Gott unserer Väter, hast du keine Helden mehr, die dein Volk erlösen?«
Bis hierher hatte der Alte vor sich hin gesprochen, als das Signal zum Weiterziehen des Kolosses ertönte. Die Aufseher riefen, ihre Peitsche klatschen lassend. Die Volksmasse erhob sich von den Stufen, um nach dem Seile zu greifen. Da bemerkte einer der Aufseher, ein nackter, wildaussehender Ägypter, wie der alte Jude das Seil, an welchem er zu ziehen hatte, kraftlos sinken ließ, der Sohn jedoch das entfallende hastig verstohlen aufhob, um zu seiner Last noch die des müden Vaters zu fügen. Rasch sprang Set der Aufseher hinzu. Ergrimmt packte er den Alten an der Gurgel und schrie ihm zu, augenblicklich selbst zu ziehen.
»Herr, habt Erbarmen,« wimmerte der Hilflose, »ihr mutet alten Knochen zu, was kaum junge vermögen. Ich kann nicht weiter ziehen, meinen schwachen Händen entsinkt das Seil.«
»Das werden wir sehen,« höhnte der Ägypter, den zu Boden Gesunkenen aufreißend, »und du ziehst, alte Mumie, so lange als dein Odem es aushält, in deinem elenden, aussätzigen Leib. Nimm das Seil zur Hand.«
Nochmals versuchte der Greis das Seil festzuhalten, vergebens, es glitt zu Boden. Zähnefletschend schwang der Aufseher die Peitsche, denn schon begann der Koloß sich unter der Anstrengung von tausend Armen zu bewegen. Aber noch ehe der Riemen der Geißel niedersauste, sprang Isaak zwischen den Vater und den Aufseher, so daß er mit seinem Rücken die dem Hingesunkenen geltenden Hiebe auffing.
»Willst du dich widersetzen, elendes Judengesicht,« rief nun der Wütende, dem bleichen, zitternden Isaak entgegen. Schon hatte er den jungen Ebräer am Arm ergriffen, um in grausamer Lust seine Rache an ihm zu befriedigen, als ihm ein lautes, vom Streitwagen des Königs hertönendes Rufen den Arm sinken machte. Auch Isaak wandte sich um. Dieses Rufen hatte seinen Grund, denn die Statue stand zum Schrecken aller schief auf ihrem Wege. Es war ungleichmäßig gezogen worden, und nun kam es darauf an, den Fehler vorsichtig wieder zu verbessern. Der Oberaufseher auf den Knien des Steinbildes rief und winkte, der König und sein Gefolge kamen in die heftigste Erregung. Die Aufseher gaben den Arbeitern die Schuld an dem Versehen, die Arbeiter den Aufsehern. Ein allgemeines Zanken begann, die Peitsche knallte allerorten, so daß für Augenblicke das Werk unterbrochen wurde. Endlich befahl der König Ruhe, man solle versuchen, das Bild auf den richtigen Weg zurückzuziehen. Mit großer Vorsicht begann nun die eine Hälfte der Männer unter der Anleitung ihrer Beamten den Koloß zu drehen. Kaum bemerkbar wendete er sich auf seinem Platze nach der richtigen Seite hin, mit atemloser Spannung folgten alle dem gefahrvollen Experimente. Plötzlich geschah ein Ruck, die Drehung geriet ins Stocken. Der Oberaufseher war der Ansicht, es müsse sich ein Splitter aus dem Boden der schiefen Ebene durch das Umdrehen der wuchtigen Masse losgerissen haben. Daraufhin wurde das Werk von neuem eingestellt. Dem Beamten auf den Knien der Statue ward eine scharfe Rüge vom Könige überbracht, Ramses sei äußerst ungehalten über die schlechte Ausführung des Planes. Dem armen Oberbeamten schwindelten die Sinne, Schweiß bedeckte seine Glieder, er versuchte ein letztes Aushilfsmittel. Mit dem Mut der Verzweiflung gab er den Befehl, alle Arbeiter sollten zu gleicher Zeit mit der Anstrengung aller Kräfte das Bild von seinem Platze bewegen, auch, wenn dabei der Boden des schiefen Weges Not litte, es käme jetzt nur darauf an, der Statue über diese eine unglückliche Stelle wegzuhelfen. Das Ziehen begann, aber der steinerne Ramses blieb unbeweglich. Die Vögte suchten die Kraft der Ebräer mittels der Geißel zu erhöhen, alle Muskeln schwellten an, dumpfes Ächzen entrang sich dem Busen Tausender, die Stricke spannten sich an bis zum Zerreißen, Fluchen und Beten ertönte in wunderlichem Gemisch – da – bewegte sich das Bild? Ja, es bewegte sich wohl, das heißt, es erbebte von oben bis unten, darauf erscholl ein dumpfer Krach, der Boden des schiefen Weges war zerrissen.
»Weiter, rasch weiter,« schrie der Mann auf den Knien des Bildes. Jedoch, als dieser dumpfe Knall ertönt war, hatten die Juden, bis ins Innerste erschreckt, mit den Stricken nachgegeben. Nun erst bemerkten sie das Gefährliche dieses Nachlassens, denn die ungeheuere Masse begann sich langsam nach rückwärts zu bewegen. Bestürzt riß nun jede Faust, um das drohende Hinabrollen aufzuhalten, heftig nach oben; dadurch entstand in der Verwirrung eine solche Ungleichartigkeit des Ziehens, daß die Steinmasse in Schwankung kam und ihr hölzerner Weg knirschte und bebte. Nun aber verloren die Ebräer völlig den Mut, ein betäubendes Toben und Durcheinanderschreien machte jeden Befehl des Oberbeamten unverständlich. Einige ließen vom Ziehen ab, andere zogen, der Oberbeamte faßte sich verzweiflungsvoll an die Stirn – da – ein sinnlähmender Donner, ein einziger, gewaltiger Aufschrei aus tausend Kehlen, und die hölzerne Ebene sank samt ihrem Steinkoloß in sich selbst zusammen. Bis nach Memphis hin hatten sie den Donner vernommen; der Spaziergänger blieb stehen, seinen Nachbar zu fragen, was dies Rollen bedeutete; dem Sänftenträger stockte der Atem, dem Fischer am Ufer des Nil entsank seine Angel, der Brettspieler hielt im Zug inne, als dies Dröhnen in sein Zimmer drang; die Toten in ihren unterirdischen Wohnungen mußten emporfahren aus ihrem tausendjährigen Schlummer, der alte Nil schlug Wellen, gerüttelt von der erschrockenen Erde. Die mit dem Leben Davongekommenen standen zu Bildsäulen erstarrt ratlos da und sahen auf den Ort der Verwüstung. Einige Augenblicke hindurch war die ganze Szene bedeckt von einen. riesig aufwirbelnden Staubvorhang, erst als dieser gesunken, konnte man die Größe des Unglücks ermessen. Die mit rasender Schnelligkeit hinabgeschnellten Stricke hatten Hunderte von Menschen von den Stufen geschleudert; die Walzen und Rollen, umpackt von Ketten, zertrümmerten bei ihrem Sturze, was ihnen in den Weg kam; die schiefe Brücke zerquetschte alles Lebende, das sich über oder unter ihr befand; die ganze Pyramide glich einem Berg von Trümmern, zerschmetterten Leibern und Blut. Hilferufe, Todesröcheln, Befehle zerrissen die Luft. Die Unbeschädigten versuchten die Verwundeten unter den Trümmern hervorzuwühlen, was ihnen jedoch selten gelang. Der König schickte sofort einen Boten nach Memphis, Ärzte und Sänften zu holen, denn obgleich die Zerstörung hauptsächlich das verachtete Volk der Ebräer getroffen, fühlte Ramses in diesem Augenblick, als Zeuge des ungeheuren Vorfalls, Mitleid mit dem Leben seiner Arbeiter, die von seinem eigenen Bild getroffen sich blutend im Staube oder auf der Treppe wälzten. –
Isaak hatte sogleich, nachdem der Donner des stürzenden Bildes verhallt war, seinen Vater neben sich vermißt. Mit Gewalt schüttelte er sich die Schauer des Entsetzens, die ihn überrieselten, von den Schultern, sprang die Stufen der Pyramiden hinab und wühlte verzweiflungsvoll, den Namen seines Vaters vor sich hinrufend, in dem Trümmersand und den Leichenmassen, die sich am Fuße des Gebäudes aufgetürmt hatten. Endlich nach langem Suchen gab seinem Weheruf eine schwache Stimme, die unter einem zerbrochenen Rollwerk hervorzukommen schien, Antwort. Mit Anstrengung aller seiner Kräfte gelang es ihm, sich durch die Pfähle, die Splitter, der zerstörten Maschine durchzuarbeiten, denn er gewahrte mit Schrecken, wie mitten in den Speichen der zerschlagenen Räder der Körper seines Vaters hing. Rascher, als er es selbst für möglich gehalten, gelangte er in die Nähe des Bejammernswerten, hob ihn sanft aus dem Gewirr der Trümmer und trug ihn sorgsam ins Freie. Hier angekommen, überzeugte ihn eine Untersuchung des bewegungslosen Körpers, daß zwar das Haupt des Vaters, getroffen von Balkenwerk, blutete, daß sich aber immer noch ein wenn auch mattes Fünkchen von Leben in dem verwundeten Leib regte. Behutsam schlich sich Isaak, den Körper des alten Mannes auf den Schultern, durch die Trümmer; unbeobachtet gelangte er auf den Weg, der nach Memphis führte. Die Aufseher waren zu beschäftigt, um sich um den einzelnen zu bekümmern; diesem Umstand hatte es der junge Ebräer zu verdanken, daß er ohne Anruf oder gar Aufenthalt weiterziehen konnte. Er floh von dannen, so rasch es seine arme Last erlaubte, scheue, angstvolle Blicke hinter sich werfend, ob man ihn nicht etwa verfolgte. Er war entschlossen, sich auf Tod und Leben zu verteidigen, sollte man ihn zum Stillstand zwingen. Es war ihm heilige Pflicht, den Vater in Sicherheit zu bringen. Da aber niemand an Verfolgung dachte, verlangsamte er seine Schritte, um dem Verwundeten, dessen leises Stöhnen ihm durch die kindliche Seele schnitt, keine Schmerzen zu bereiten. Er hatte die Hälfte des Weges zurückgelegt, als ihm eine von der Oase Amun nach Memphis ziehende Karawane begegnete. Der Anführer der Karawane, ein stämmiger Ägypter, schien mit dem unglücklichen Alten Mitleid zu fühlen.
»Wohin, wohin?« rief er von seinem Kamel herab den beiden zu.
Isaak erklärte in kurzen Worten, er trüge einen sterbenden Vater; der Weg nach Memphis werde ihm immer länger, kaum könne er sich noch auf den Beinen erhalten. Der Anführer brachte die Karawane zum Stehen.
»Der Weg ist nicht mehr weit, tritt näher, Freund,« rief er, »du magst deinen Vater hier auf eines der ledigen Kamele heben. Wir verweigern keinem Sterbenden die letzte Ruhestätte.«
Isaak schleppte sich heran. Kaum aber ward der Führer des Näherkommenden genauer ansichtig, als er erschrocken Befehl zum Weiterziehen gab.
»Bleibt nur, wo ihr steht,« rief er zurück, »ihr seid Juden. Dein Vater mag sterben, wo es ihm beliebt, bei uns findet er keinen Ort dazu!« – Und sie trabten weiter.
Tränen der Wut und Scham perlten über Isaaks Wangen.
»Armes Volk, armer Vater,« flüsterte er. »Oh! wann kommt die Stunde der Rache, wann werden wir als Menschen behandelt werden?«
Er schleppte sich mühsam noch einige hundert Schritte weiter, schon sah man die Tempeldächer von Memphis gelbrötlich herüberleuchten, dann aber machte er, um sich, wie dem Alten, die nötigste Erholung zu gönnen, am Rande eines palmenumstandenen Brunnens halt. Das Haupt des Vaters hatte er sorgsam im Schatten auf schwellendes Moos gebettet; jetzt suchte er nach einem frischen Trunk für die zuckenden Lippen des Greises, da gewahrte er ein Tongefäß auf der Steineinfassung der Zisterne. Eben wollte er die Stirne des Vaters mit dem Inhalt des Gefäßes kühlen, als aus dem kleinen Palmenhain, der den Brunnen nach der östlichen Seite hin umgab, schreiend eine ägyptische Dienerin trat.
»Ein Jude! Willst du mein Gefäß unberührt lassen, du Aussätziger,« zeterte das Weib und riß es dem Jüngling aus den Händen.
»Hab' Erbarmen mit einem Sterbenden,« wollte der junge Ebräer einwenden, aber das Weib ließ nicht nach zu toben. Sie betrachtete das Gefäß von allen Seiten, wusch es an der Stelle, wo Isaaks Hände es berührt, unter fortwährendem Schmähen. Isaaks Inneres empörte sich.
»Gönne mir einen Tropfen Wasser, du Unbarmherzige, mein Vater ist dem Sterben nahe, ein Tropfen könnte ihn retten, er und ich sind keine Tiere. Auch wir haben ein Recht, zu leben.«
»Es wäre am besten,« keifte sie, »man ließ euch alle verdursten, ihr Fremdlinge, die ihr uns den fruchtbarsten Landstrich wegnahmt. Unser nun zu Osiris eingegangener König hat euch verwöhnt; wir aber wollen euch beweisen, daß ihr kein Recht habt, den Nil mit eurem Schmutz zu trüben.«
»Warum,« entgegnete der Arme mit zitternder Stimme, »behandelst du uns Hilflose so geringschätzig, die wir dir nichts zuleid getan? Gib mir Wasser!«
»Da nimm!« höhnte das Weib und spie dem Flehenden vor die Füße.
Länger vermochte sich Isaak nicht zu beherrschen. Ein Sprung, ein Schlag und das Tongefäß lag zerschmettert am sandigen Boden. Schreiend jagte die Ägypterin davon. Der Brunnen war in dieser Jahreszeit fast ausgetrocknet; der Ebräer versuchte deshalb, das Wasser, das noch in den Scherben des zerbrochenen Gefäßes haftete, seinem Vater auf die Lippen zu träufeln. Kaum hatte er es so weit gebracht, daß der Ohnmächtige matt die Augen aufzuschlagen vermochte, um sie sofort unter leisem Wimmern wieder zu schließen, als allmählich näherkommender Hufschlag sein Herz in Schrecken setzte, Häscher möchten ihn verfolgen. Er sprang auf. Richtig, ein Zug nahte dem Brunnen, einige Sänften voraneilend. Erwartungsvoll beobachtet unser Freund den Zug. Schon dachte er daran, rasch mit seiner Bürde davonzueilen; allmählich bei schärferem Hinblicken jedoch schien es ihm, als wenn die Herankommenden nicht an Verfolgung dachten. Er beschloß, ruhig den Verlauf der Dinge abzuwarten. Bald entdeckte er, daß er umsonst Befürchtungen gehegt; die Männer näherten sich friedlich dem Brunnen, in ihren Sänften lagen einige durch den Sturz des Kolosses getroffene ägyptische Aufseher, die sie nach Memphis zu tragen den Befehl hatten. Der Anführer des Zuges wendete sich an Isaak.
»Noch viele Verwundete warten auf unsere Hilfe,« begann er, »wir dürfen nicht rasten; unter den Trümmermassen liegt noch mancher Brave verborgen, der des Ausgrabens mit Verzweiflung harrt. Wir vertrauen deinem Schutz einstweilen diese drei Männer an, bis wir hierher zurückkehren. Überwache die Unglücklichen, es sind Aufseher, alle drei dem Tode nahe!«
Man setzte die Sänften im Schatten der Palmen zu Boden. Isaak, des Gehorsams gewöhnt, nickte stumm vor sich hin; die Ägypter kehrten zur Pyramide zurück, bald machte sie gelb aufwirbelnder Sand unsichtbar. Gleichgültig schweiften die Augen des Ebräers über die drei Sänften – es waren ja ägyptische Aufseher, die dort mit dem Tode rangen, es waren ja seine Peiniger, seine Feinde – sollte er Mitleid mit ihnen fühlen? Sie waren ja nun kraftlos, die Geißel konnten sie nicht mehr schwingen, keine Befehle mehr geben! Alle lagen sie regungslos, wie Leichen unter dem grünen Baldachin der Palmen, Blutflecken auf den Gewändern, die Mienen ausdruckslos nach den Blättern gerichtet, die Augen glanzlos. Zuweilen huschte ein schmerzhafter Zug über eines der Gesichter. Isaak sah, wie sich eine große Fliege, deren Stich äußerst schmerzhaft, dem einen der Aufseher auf die Stirne setzte, um das Blut seiner Wunde, welches unter der Binde hervorquoll, zu schlürfen; der Hilflose versuchte das Tier zu verscheuchen; sein Stich verursachte ihm, wie es schien, unnennbare Qual. Der Jude aber sah teilnahmlos zu, wie sich der Elende abmühte. Dem anderen war der Verband von dem Arme gesunken, sein tropfendes Blut rötete das Gras; der Ebräer tat, als bemerke er nichts davon. Nun arbeitete sich der dritte Verwundete unter einer Last von Binden und Kissen hervor, schlug die geröteten Augen auf und stammelte ermattet: »Wasser!«
Isaak sah gleichmütig zu ihm hinüber; da verwandelten sich seine bis dahin starren Züge. In seinem Auge leuchtete eine dämonische Lust, er lachte dem keuchend sich Abmühenden höhnisch zu.
»Wasser,« lallte dieser noch einmal.
Isaak sprang auf.
»Du bist's,« rief er hinüber. »Du! Set! der meinen Vater schlug! Gott gab dich in meine Hände! O wie gütig ist Gott! Sieh her, elender Ägypter, hier liegt der, den du schlugst – erkennst du uns?«
»Isaak,« hauchte Set, »reiche mir Wasser, ich werde dir's vergelten. Mein Kopf brennt, mein Eingeweide steht in Flammen, hab' Erbarmen.«
»Erbarmen? Hattest du Erbarmen mit mir und meinem Vater?«
»Ich befehle es dir, reiche mir Wasser!«
»Befiehl so lange du willst und sieh zu, wer dir gehorcht.«
Isaak wandte sich ab. Einige Minuten verstrichen lautlos. Endlich streckte der Aufseher noch einmal seine Arme aus.
»Verzeihe mir, Isaak,« wimmerte er, »es ist wahr, ich bin euch ein strenger Herr gewesen, doch es soll besser werden. Ich verspreche es dir. Ich bin nun machtlos in deine Hände gegeben, wirst du deine Gewalt mißbrauchen? Bedenke, daß man dich zur Rechenschaft ziehen wird, tust du mir Übles.«
»Was kümmert's mich,« murmelte der Ebräer, »kann ich nur meinen Rachedurst für diesen Augenblick befriedigen, später mögen sie mit mir anfangen, was sie wollen. Ich reiche dir kein Wasser. Leide Qual, wie wir sie litten.«
Der Ägypter sank stöhnend zurück. Isaak war im Begriff, den Körper seines Vaters von neuem auf die Schultern zu laden, als ihn der Anblick des verschmachtenden Set zum Mitleid zu bewegen schien. Er schritt zum Brunnen, sammelte mühsam die letzten Wasserreste des zerbrochenen Gefäßes in einer Scherbe und hielt sie dem Ägypter vor die brennenden Lippen. Dieser erhob sich.
»Beim großen Osiris,« sagte er, »ich will dir's lohnen, wenn ich genese! Du handelst schön an mir, Jude.«
Eben beugte er seine lechzenden Lippen nach der feuchten Scherbe, als der Ebräer ein heiseres Gelächter hören ließ und, statt ihn trinken zu lassen, die Scherbe in den Sand schleuderte. Darauf überließ er den Sterbenden seinem Schicksal und wendete sich mit seiner lebendigen Last auf dem Rücken Memphis zu. Bald hatte er das Tor erreicht. Da lag es vor ihm, das gewaltige Memphis! Wie ein riesiges Gebirge von Türmen, Dächern und Hallen wölbte es sich in den Himmel, der sich erschrocken in sich selbst zu flüchten schien, befürchtend, dieser wogende Häuser-Ozean dränge bis in seine sonnigen Geheimnisse hinauf und belästige die ewigen Götter. Das war sie, die Stadt der Pyramiden, die Stadt des Apis mit ihren Göttern und Tempeln, ihrem Hafen, ihren stolzen Straßen! Er aber, der arme Jude, schlich sich furchtsam an den Posten vorbei, dem engen Schmutzviertel seines verachteten Stammes zu.
Zweites Kapitel
Im nördlichen Teil von Memphis war den Ebräern gestattet, zu existieren. Hier hausten sie ängstlich, wie die Mäuse in ihren Löchern, flohen das Licht und dienten ihrem Gott. Ein Jude, der sich in die anderen Stadtteile wagte, war fast immer schlimmen Mißhandlungen ausgesetzt, so daß sich die armen Geknechteten nur in ihren engen, schmutzigen Straßen behaglich fühlten. Manchen von ihnen zwang freilich ihr Gewerbe, auch die übrige Stadt aufzusuchen; dann schwebten die zu Hause zurückgebliebenen Angehörigen so lange in Angst, bis der Weggegangene wieder innerhalb der Grenzen seines Bezirkes gesehen wurde. Draußen im ägyptischen Stadtteil wogte, sobald die Abendkühle es erlaubte, eine dichte, bunte Menschenmenge. Sobald die Sonne sich zum Scheiden rüstete, sobald ihre letzten Strahlen die Gipfel der Pyramiden mit Purpur übergossen, ward es lebendig auf den Straßen von Memphis. Da ließen sie sich aus ihren Portalen tragen in prächtig bemalten Sänften, getragen von glänzend-schwarzen Sklaven, die vornehmen Beamten, die reichen Frauen, vielleicht um ein Bad im Nil zu nehmen. Da bot der Bäcker sein Brett, belegt mit kleinen Kühen oder Krokodilen aus Backwerk, schreiend an; da konnte man die zierlichsten Töpferwaren, die durchsichtigsten Glasschalen bewundern. Die Krieger schritten klirrend auf und nieder, die Priester ließen ihre Instrumente rasseln, wenn sie in den Tempel zogen oder eine von Klageweibern umheulte, grellfarbige Mumie zur ewigen Ruhe trugen. Da kehrten die Gespanne der Ackerbauer, beladen mit riesigen Kornähren, vom Felde nach Hause; die kleinen rotbraunen Kinder wälzten sich im rauschenden Gold des Getreides und der schlanke, nackte Jüngling lenkte, träge an ihren glatten Leib hingelehnt, die breiten Stiere. Da glänzten Fackeln auf den versteckteren Plätzen; ihr unheimlich düsteres Licht rötete den geschmeidigen Leib der Tänzerin, die, von Harfenspielerinnen und entzückten Zuschauern umgeben, Liebe in die Herzen der jungen Männer wirft. Einer solchen Gruppe sah ein kaum zwanzigjähriger Jüngling zu. Träumerisch, selbstvergessen stützte er sich an den Eckpfeiler eines Palastes, sein großer Blick hing teilnahmlos an der nackten Schönen, deren Zehen im Purpurschimmer der Fackeln über einen kostbaren Teppich zitterten. Er erkannte an ihrer helleren Hautfarbe sofort die Jüdin. Sie warf ihm, der ihr ohne Zweifel von allen ihren Zuschauern am meisten wohlgefiel, zuweilen einen brennenden Blick zu, aber der junge Mann beachtete solches nicht. Als das Rauschen der Harfen sich nun lauter erhob, die Bewegungen der Zügellosen heftiger wurden, so daß ihre großen Ohrringe klirrend mitzutanzen begannen, nährte sie sich ihm durch einen kühnen Seitensprung und streifte dabei absichtlich mit ihrem schönen Arm den seinen. Der Jüngling, durch die heiße Berührung aufgeschreckt, sah ihr erstaunt in die lächelnden Züge, in das von Goldflittern überhangene Auge.
»Rebekka heiße ich,« flüsterte sie ihm zu, er aber wandte ihr verachtungsvoll den Rücken. Sie durchbrach den Kreis ihrer Zuschauer und rief ihm nach: »Fliehst du mich, weil ich eine Jüdin bin? Oh! ihr Ägypter haßt zwar die ebräischen Männer, aber ihre Frauen liebt ihr, wenn sie schön sind.«
Der junge Mann gab den lachenden Zuschauern durch eine unwillige Bewegung der Hand zu verstehen, daß er das Weib nicht kenne.
»Ich kenne dich, glaub' mir!« lachte sie, ihre blendenden Zähne blinken lassend, »du heißest Menes und bist der Sohn der reichen Aso, der Witwe des verstorbenen Oberhofmeisters unseres zu den Göttern eingegangenen Königs Seti I. Euer Palast liegt am Nilkanal, am südlichen Ende der Stadt, da, wo der Weg nach dem Mörissee führt. Willst du nicht bei uns bleiben, Menes? Ich liebe dich!«
Menes schritt, ohne die Jüdin noch eines Blickes zu würdigen, davon; ihm nach erscholl das Gelächter der Spottenden. Der unangenehme Eindruck dieser Szene war in der Seele des jungen Mannes, sobald ihn der volksbelebte Teil der Stadt aufgenommen hatte, verwischt. Aber andere Schatten stiegen in seinem weichen, zu träumerischer Schwärmerei neigenden Gemüte auf. Er war der Sohn einer vornehmen Frau, deren Gatte am Hofe des verstorbenen Königs zu Theben eine hohe Stellung bekleidet. Seine Mutter, an Glanz und königliche Pracht gewohnt, hielt auf äußeren Rang. Sie ging mit dem ehrgeizigen Gedanken um, ihrem einzigen Sohne die Stufen zu den höchsten Ämtern zu bahnen, sie wollte ihn in der Stellung des Vaters sehen, dem Herzen des Königs am nächsten; zu diesem Zweck hatte sie beschlossen, daß Menes nach Ablauf seiner Studien, deren er in Memphis bei mehreren Priestern oblag, sich zum König nach Theben verfügen solle, um dort einstweilen als niederer Hofbeamter in die Reihen der fürstlichen Diener einzutreten, bis ihm allmählich der Rang seines verstorbenen Vaters zuteil würde. Daß dieser ihm zuteil würde, daran war kein Zweifel; nur liebte es Ramses II., seine Großen zuvor zu prüfen, ehe sie die höchsten Würden bekleideten. Die vornehme Ägypterin war übrigens mit dem Betragen ihres Sohnes keineswegs zufrieden. Wie oft mußte sie die schmucklose Einfachheit seines Anzugs tadeln, die einem künftigen Höfling nicht zieme; wie oft beklagte sie sich über die Farblosigkeit seines Kopftuchs, das sie gerne buntgestreift gesehen hätte; wie oft ermahnte sie ihn, Ringe mit kostbaren Steinen zu tragen, die sie ihm schenkte; er stieß sie verdrießlich von sich, die Kostbarkeiten und ging am liebsten halbnackt, nicht etwa um die Blicke der Frauenwelt auf seinen tadellosen Wuchs, seinen zartgeschmeidigen Muskelbau zu lenken, sondern weil er, wie er sagte, nicht gerne in seinen Bewegungen gehemmt sei. Allerdings schmückte ihn sein bräunlich angehauchter Körper mehr, als jedes Kleidungsstück; darauf aber achtete er ebensowenig, als seine Mutter; sie wollte Farben sehen. Wie oft erwähnte sie mit einem tadelnden Seitenblick, er ginge mit Musikanten, Malern und Bildhauern (in ihrem Auge Gesindel) lieber um, als mit hochgestellten Männern von vornehmer Erziehung und wohlgesetztem Betragen. Schon als Knabe war es die Lieblingsbeschäftigung ihres Sohnes, seiner Phantasie durch Zeichnen Ausdruck zu geben. Papyrusrollen und Wände mußten seinem Stifte herhalten; oft hatte ihn der Priester dabei ertappt, daß er auf die heiligen Rollen, die er ihm zum Studieren vorgelegt, Osirisköpfe, kleine Nilpferde, Mumien u. dgl. mit flüchtiger Hand gemalt. Zwar von seiner Handschrift waren alle seine Lehrer hingerissen, denn die Hieroglyphen schienen unter seinen Fingern zu leben, jedoch über seinen Glaubenseifer in bezug auf heilige Dinge hatten sie eine weniger günstige Meinung. Der Knabe frug ihnen zu viel. Die priesterliche Weisheit mußte oftmals verstummen vor diesen scharf eindringenden Fragen, welche schonungslos Irrtümer und Unmöglichkeiten der Religion aufdeckten, diese sogar manchmal leisem Spott preisgaben. Allen war es klar, Menes sei dazu bestimmt, die Tempel der Könige mit Wandmalereien zu bedecken, aber wie durfte solches geschehen? War doch der Vater des Kindes Hofbeamter gewesen! Wie konnte der Sohn einen anderen Beruf ergreifen! Dieser Zwang nährte einen verbitternden Groll im Herzen des Kindes und steigerte ihn zur Verzweiflung in der Brust des Jünglings. Verzweiflung im Busen schritt unser Held weiter, immer weiter von Straße zu Straße. Wenn er irgendwo eine schön bemalte Wand, eine hübsche Säule erblickte, konnte er lange betrachtend davor stehen bleiben, dieses tadelnd, jenes lobend in seinem heißen Inneren. Er fühlte, wie er vor manchem Bilde Hochachtung empfinden mußte, wie er aber im ganzen alles, was er bis jetzt gesehen, übertreffen zu können sich wohl bewußt sein durfte. Schon waren die Straßen in nächtliches Dunkel gehüllt, schon sickerte der Goldstrahl des Mondes um die Säulen der Paläste, ihren riesigen Leibern eine unheimliche Majestät verleihend. Der kühle Wind, der vom Nil herüber zu wehen begann, zeigte Menes an, daß er sich dem Hafen von Memphis näherte. Er umschritt den pylonartigen Vorsprung eines großen Handelshauses, ging eine kleine, enge Straße entlang und stand nun sogleich den Schiffen des Hafens gegenüber. Da lag der alte Nil und trug geduldig seine Last. Außer ägyptischen Fahrzeugen waren es hauptsächlich phönizische, die hier vor Anker lagen. Töpferwaren, Getreide und Haustiere an das Land zu schaffen, waren die Sklaven vornehmlich beschäftigt; auch Öl oder Gold aus den Bergwerken Äthiopiens war zu sehen. Doch näherte sich der Betrieb des Handels seinem Ende. Nur hier und da schritt noch gravitätisch ein reicher Kaufherr, nachdem er die Seetüchtigkeit seines Schiffes, den Wert seiner Ladung geprüft, der inneren Stadt zu. Bald trat Ruhe ein auf dem sonst so belebten Platze; kleine Lichter erglänzten auf den Schiffen, kleine Rauchsäulen schlängelten sich aus den Kajüten, wo die Familie des Schiffers sich ihr Abendmahl bereitete. Zuweilen ließ sich vom Maste herab die Stimme eines fremden Vogels, der dem inneren Afrika entstammte, vernehmen; zuweilen streckte eine Antilope, die für den Ziergarten irgendeines hohen Beamten bestimmt war, ihren zierlichen Kopf durch die Luke, oder es landete das letzte Boot eines größeren Schiffes, seine Ladung Papyrusballen oder an Seilen hängende Fische ans Land befördernd. Alles schwieg, nur der alte Nil rollte seine kostbaren Wellen durch die Ufer, die ihr reiches Kleid von Blumen und Ähren heiter in seinen heiligen Fluten wuschen. Menes schritt dicht an den Fluß heran, tauchte seine Hand in das heilige Wasser und kühlte sich seine heiße Stirne mit der Flut, die kostbarer denn Gold ist. Vor ihm erhob sich der Bauch eines phönizischen Kauffahrers. Auf demselben spielten mehrere Matrosen das Fingerspiel, worunter auch ein schwarzer Äthiopier. Anfangs wurde das Spiel schweigend fortgesetzt, allmählich aber, als die Finger heftiger flogen, entspann sich ein lebhafter Zank zwischen den Spielenden. Eben wollte sich Menes, angeekelt von dem kindischen Gezänke der Matrosen, abwenden, als einer derselben ihn aufforderte, als Schiedsrichter aufzutreten. Menes lehnte bescheiden ab, er verstehe das Spiel kaum, er kenne den Zusammenhang der Streitigkeit nicht. Der derbe Phönizier sprang die Schiffstreppe hinab, packte ihn am Arm und setzte ihm mit lauter Stimme auseinander, er habe die Zahl der Finger richtig geraten, die ihm sein Nachbar entgegengestreckt, dieser aber leugne nun, wolle ihn betrügen.
»Zwei Finger hielt ich empor,« beteuerte der andere, »du aber sprachst: drei!«
»Nein,« tobte der erste, »du hieltest drei empor. Nicht wahr, Herr, es waren drei! Ihr saht es?« – Dabei warf er Menes einen Blick schlauen Einverständnisses zu.
»Meinetwegen hieltet ihr tausend Finger und die Fußzehen dazu empor,« lachte Menes ärgerlich, »ich sah und hörte nichts!«
Er entwand sich der Hand des Phöniziers und ging. Kaum aber hatte er den Ort des Zankes verlassen, als er neben sich eine weiche Stimme vernahm. Erschrocken sah er sich um; die Dunkelheit, die bereits eingebrochen war, ließ ihn zwei weiße, weibliche Gestalten undeutlich erkennen, von welchen eine, die andere mit sich fortziehend, auf ihn zu schritt.
»Myrrah,« lachte das Mädchen, »tritt näher, fürchte dich nicht, du darfst nicht so bescheiden tun, Kleine. Biete deine Blumen dem jungen Herrn an, er kauft dir gewiß einen Strauß ab – weil – nun, weil du hübsch bist!«
Menes sah, wie die Angeredete, ein zierliches Judenmädchen, ihm verlegen ein Sträußchen entgegenhielt.
Die andere drängte sich an ihn heran. Kaum hörbar flüsterte sie ihm in die Ohren:
»Sie ist jung, unerfahren, Herr! laßt die Gelegenheit nicht vorübergehen, ich werde Euch unterstützen.«
Dann lachte sie laut, sich zu der Verschämten wendend.
»Ei wie! ei was!« polterte sie grämlich, »stecke es dem Herrn an die Verzierungen seines Halskragens, er nimmt es dann gewiß! Nun! näher! komm! tritt dicht zu ihm!«
Wieder flüsterte sie Menes ein paar Aufforderungen ins Ohr, die diesen entrüsteten.
»Schweige mir,« sagte er ernst, »tückische Verführerin dieser Unschuldigen. Dich aber warne ich, die du dieser Wilden so willig folgst! Hüte dich vor ihren Lockungen.«
»Ei beim Apis und allen heiligen Krokodilen,« lachte die Begleiterin auf, »ich erkenne ihn jetzt erst? Er ist es! Es ist unser frommer Menes! Seht nur den sittenfesten Jüngling! Mit zwanzig Schilden hat er seine Tugend umgürtet!«
Lachend sprang sie an die Seite des Jünglings, nahm, ohne zu fragen, ihrer furchtsamen Freundin den Strauß ab und nestelte ihn an des jungen Mannes Kleidung. Dieser aber fuhr betroffen zurück, denn Rebekka, die Tänzerin, stand vor ihm. Er schleuderte unwillig die Blumen von sich; als jedoch zufällig sein erzürnter Blick auf das andere der beiden Mädchen fiel, stockte ihm das heftige Wort auf der Zunge, das er in Bereitschaft hatte. Er sah, wie das flehende, schwarze Auge Myrrahs ihn um Verzeihung bat, er sah, wie sie vorsichtig die gemißhandelten Blumen vom Erdboden aufhob, und wie sie sich dann bescheiden zum Gehen wendete. Ein gewisses Mitleid überkam ihn, er faßte das Mädchen bei der Hand.
»Dir zürne ich nicht,« sprach er mit weicher Stimme, »du scheinst sittsam und sanft, mein Zorn galt deiner Freundin.«
»Sie ist meine Freundin nicht,« fiel ihm das Mädchen hastig ins Wort.
»Nicht deine Freundin?«
»Nein, o nein.«
»Ich kann dich versichern, Jüdin, du erfreust mein Herz durch dies Bekenntnis. Aber warum gehst du mit ihr?«
»Wir wohnen in demselben Hause zusammen, Herr,« flüsterte sie, ihre ovalen, großen Augenlider niederschlagend. »Ich suche ihren Umgang nicht, sie drängt sich mir auf! Ich verkaufe Blumen an reiche Leute, Herr, da ich arm bin, wie alle Juden, und geschmäht werde, wie alle Juden. Rebekka gefällt mir gar nicht, sie will mich zu Bösem verleiten, denn dadurch, sagt sie, könne ich, wie sie es tut, viel erwerben.«
»Du aber gehst auf ihre Verlockungen nicht ein?«
»Lieber will ich verhungern,« entgegnete sie voll Abscheu, indem ein tiefes Rot ihre weiße Stirne überflutete. »Öffentlich tanzen, wie niedrig. O Herr! Doch es ziemt sich nicht, daß Ihr mit der Jüdin sprecht. Zwar es ist dunkel, man gewahrt uns nicht, doch es gibt so schlimme Menschen. Ihr bringt mich und Euch in Gefahr! Erlaubt Ihr, daß ich gehe?«
»Ich habe dir nichts zu erlauben,« sprach Menes befangen.
»So lebt wohl!«
»Darf ich dich – des Schutzes wegen, begleiten bis an dein Haus?« rief er der Gehenden nach.
»Es ist besser, ich gehe allein,« tönte es ihm aus der Dunkelheit zurück.
Sie verlor sich mit flüchtigen Schritten in den Straßen, Menes in einem eigenen Zustand träumerischen Hinbrütens zurücklassend. Noch klang ihm ihr weicher Flüsterton in der Seele nach, sein Auge suchte der Davoneilenden nachzuspähen; einige Zeit hindurch stand er regungslos auf demselben Ort. Da berührte ein warmer Hauch sein Ohr. »Nun, des frommen Jünglings Tugend fängt an, die Farbe zu verlieren,« kicherte es neben ihm. Ein rasches Umdrehen zeigte ihm Rebekkas listiges Gesicht, wie es hinter einer Mauer verschwand.
»Ich hasse dies Weib,« murmelte er vor sich hin, indem er sich zum Nachhausegehen anschickte. »Sie ist ein freches, widerwärtiges Geschöpf, und immer finde ich sie da, wo ich sie am wenigsten suche, wo sie mich am meisten belästigt. Gewiß sinnt sie mir Schlimmes, ihr Gelächter klang verräterisch.«
Im Weiterschreiten mußte er unwillkürlich wieder an Myrrah denken, wie sie so bescheiden die Augen vor ihm niederschlug und ihn fragte: »Ob sie nun gehen dürfe?« Wunderlich bestrickend klangen ihm diese Worte im Ohr. Ihr Herr zu sein, sie zum lieblichen Spielzeug zu haben, wie süß! Ein Lächeln spielte dabei um seine Lippen, das er aber sogleich mit Strenge unterdrückte. Er wollte sich auf andere Gedanken bringen, er dachte an seine Mutter, an die Stille der Nacht, an den Mond – vergeblich! das Bild der lieblichen Kleinen verfolgte ihn bis in sein geheimstes Empfinden. Wie töricht, ihn zu fragen: ob sie nun gehen dürfe? Aber sie ist eine Jüdin, ich muß sie aus meinen Gedanken verbannen, es ist nicht gut, sich mit Ebräern in Verkehr einzulassen. Wahrlich, hätte mich einer meiner Bekanntschaft mit dem Weibe plaudern sehen, mir würde Spott zuteil oder Strafe von der Mutter. So murmelte er vor sich hin, prüfende Blicke im Weiterschreiten um sich werfend. Die Nacht war nun völlig hereingebrochen, Straßen und Plätze lagen vom blassen Schimmer des Mondes kaum erhellt, die Volksmasse hatte sich ganz in das Innere der Stadt zurückgezogen. Menes hatte, verloren in seine Empfindungen, die bei seiner Naturanlage alle sofort mit einer tiefen, phantasievollen Heftigkeit auftraten, nicht auf den Weg geachtet. Bei der enormen Ausdehnung der Stadt waren ihm manche, besonders die jüdischen Stadtteile, fast völlig unbekannt, und ehe er sich's versah, geriet er in Unsicherheit, welche Straße ihn in den Palast seiner Mutter zurückführe. Wie ihm schien, näherte er sich dem am Nil gelegenen Teil des Judenviertels. Die Häuser waren niedrig, die Straßen enge und leer. Oft hatte es sich ereignet, daß Ägypter, die sich die Nacht hindurch in diesem Stadtteil aufgehalten oder ihn durchwandelt hatten, von keinem sterblichen Auge mehr gesehen wurden; sie waren habsüchtiger, rachsüchtiger Juden Beute geworden, ohne daß man je – selbst die Spur ihres Leichnams aufgefunden. Das Gewinkel der Straßen begünstigte dieses unsaubere Treiben, denn oftmals stießen die baufälligen Häuser so nahe aneinander, daß der Streitwagen eines Kriegers unfehlbar in dem Engpaß zerquetscht worden wäre, hätte er sich den Durchgang erzwingen wollen. Die aus rohen (mit Stroh untermischten) Backsteinen aufgeführten Wände dunsteten die am Tage eingesogenen Sonnenstrahlen glühend wieder aus; die kleinen blinzelnden Fenster berührten sich beinahe; der Mond wagte es kaum, in diese schwarzen, dem Laster, dem Schmutz und der Nacht geweihten Schachte hinabzulugen. Unserem Freund kam es in seiner Unbehaglichkeit vor, als wollten sich die Giebel über seinem Haupte schließen, wie Wellen. Immer weiter verlor er sich in den öden Windungen von Gäßchen; der Mond leuchtete ihm nicht, nur die kleine Lampe, welche die Buhlerin dicht an den Vorhang ihres Fensters gerückt, warf zuweilen einen traurigen Schimmer auf seinen einsamen Pfad.
»Ist es mir doch, als sei ich in das Labyrinth geraten und könne nie mehr den Ausweg finden,« murmelte er vor sich hin. Es schien ihm gefährlich, in einem der Häuser anzufragen, wo er sich befinde; einen Vorübergehenden hatte er bis jetzt noch nicht wahrgenommen, denn die Nacht war allmählich weit vorgerückt; es war ihm, als müsse er die Nacht in diesem Gewinkel statt in seinem Bette zubringen. Bald wandte er sich rechts, bald links, bald ging er die Gasse hinab, dann wieder herauf; schließlich wirbelte ihm der Kopf; dieses Kriechen durch endlose Schneckengänge brachte in seinem Hirn ein schwindelndes Gefühl hervor; alle seine Gedanken begannen sich im Kreise zu bewegen; die Häuser mit ihren Fenstern tanzten vor seinen Augen; er mußte sich erschöpft an den Pfosten einer Türe lehnen, um zu überlegen, ob er hier bis zum Morgengrauen warten solle. Kaum hatte sich sein ermüdeter Geist erholt, seine Verwirrung sich gelegt, als ein leiser Pfiff ganz in seiner Nähe ihm das Herz rascher schlagen machte. Gleich darauf wurden in der nächsten Gasse schlürfende Schritte laut. Sollte man ihn belauscht haben? Sollte man ihn verfolgen? Seine aufgeregte Phantasie begann zu schwärmen; was brachten ihm die nächsten Sekunden? Gespannt lauschte er auf das näherkommende Geschlürfe, das von den behutsam auftretenden Füßen mehrerer Männer herzurühren schien. Nun hielten die Schritte inne; dicht neben ihm, da, wo das Haus in die andere Gasse einbog, wurde geflüstert. Noch konnte er die Flüsternden nicht sehen, aber ihre Worte verstand er.
»Er ist ein Ägypter,« begann es neben ihm, »er ist vornehmer Leute Kind, laßt ihn unbehelligt weiterziehen; man wird uns verfolgen, tun wir ihm ein Leids.«
»Wenn er vornehmer Leute Kind ist,« hörte der Lauschende eine andere Stimme, die ihm sogleich als diejenige des phönizischen Matrosen auffiel, mit welchem er vor ein paar Stunden gestritten, »wenn er vornehmer Leute Kind ist, überlaßt ihn mir. Unser Schiff segelt morgen nach Äthiopien; wenn wir ihn im untersten Kajütenraum unterbringen, wird kein Gott von seinem Vorhandensein Kunde nehmen. Ihr sollt reichlich dafür belohnt werden, ihr Juden, und wir werden, wenn wir ihn in Äthiopien zum Sklaven machen, ebenfalls unseren Vorteil daraus ziehen.«
Menes erhob sich leise von seinem Stein, um der Gefahr, die bereits über ihm schwebte, zu entfliehen, denn an ein Verteidigen des Waffenlosen war bei solcher Übermacht nicht zu denken. Er hörte, wie seine Feinde leise miteinander stritten, augenscheinlich berieten sie die Art ihres Überfalls. Menes fühlte zum erstenmal in seinem Leben, daß der Mensch des Menschen ewiger Feind ist. Das Gefühl von Beklemmung machte in seiner Brust einer tiefen Entrüstung Platz; fast schämte er sich, daß er den Rückzug ergreifen mußte; er ballte die Fäuste, und wer ihm in diesem Augenblick ein Schwert in die Hände gedrückt, er hätte ihm verziehen, und wäre es sein Todfeind gewesen.
»Wenn es den Schurken gelingt, mich zu knebeln,« sagte er sich selbst, »bin ich verloren; sie führen aus, was sie beschlossen. Ich muß mich im Schatten der Häuser davonschleichen.«
Er hatte bereits den ersten Schritt getan, als er hinter sich ein Geräusch vernahm; gleich darauf fühlte er, wie sich ein Netz über sein Haupt senkte, welches man eifrigst bemüht war, ihm um den ganzen Körper zu schlingen. Eine gewandte Armbewegung befreite ihn von dieser Umschlingung.
»Tretet aus dem Dunkel, ihr Schurken,« rief er zurück, den schwarzen Gestalten entgegen, die sich um die Straßenecke drückten, »ich sage euch, es wird euch schlecht zustatten kommen, wenn ihr mit mir verfahrt, wie ihr beschloßt. Morgen bin ich zum Mittagsmahl bei dem Nomarchen von Memphis geladen, dem mächtigen Metro, welchen Ramses an seiner Stelle zurückließ; glaubt mir, sobald man mich bei diesem Mahle vermißt, bietet mein mächtiger Freund alle seine Bewaffneten auf, mich aus euren schmachvollen Schlingen zu erlösen.«
Diese rasch ersonnene Kriegslist verfehlte ihre Wirkung nicht gänzlich, die Gestalten flüsterten angelegentlich; sie schienen zu wanken. Vor Entrüstung und Aufregung zitternd, stand ihnen der verlassene Jüngling gegenüber, wohl fühlend, daß sein Leben unter einer Herde Panther weniger bedroht wäre, als unter diesen Habgierigen.
»Ist es dein Wille, großer Osiris,« hauchte er, »soll meine Laufbahn enden, eh' sie begonnen? Oh! als ich heute morgen erfrischt, glücklich in dein strahlendes Angesicht sah, großer Sonnengott, da lächeltest du mir gnädig zu und verbargst mir, welches Unheil mir der Gott der Nacht jetzt bereitet. Weh mir! wie trügerisch sind die Götter!«
Er tat ein paar Schritte, aber sofort war er von vier Gegnern umringt, die ihm jedes Entnommen unmöglich machten.
»Warum besucht Ihr den Stadtteil der Ebräer?« knirschte ihm die schneidende Stimme eines kleinen, schwarzen, adlernasigen Mannes entgegen, »was suchst du in diesen Gassen?«
»Ich verirrte mich vom rechten Wege,« sagte Menes trotzig.
»Glaubt ihm nicht, Freunde,« lachte der andere. »Er ist ein ägyptischer Spion, er will uns arme Ebräer belauschen, um uns bei Gericht zu verklagen.«
»Er stellt, wie alle, unseren Töchtern und Weibern nach,« beteuerte sein Nachbar, »tötet den Verführer.«
»Was hat er überhaupt in dieser Nachtzeit in unserem Viertel zu tun?«
»Er ist einer unserer Unterdrücker, den Gott – gelobt sei er – in unsere Gewalt gab!«
»Mache dich bereit,« hörte der Bedrängte den phönizischen Matrosen flüstern, »in die Gefilde der Seligen zu wandern. Sein Halskragen ist mit Perlen durchwirkt, goldene Schnallen zieren seine Sandalen, an seiner Hand sehe ich einen Smaragden glänzen. Wenn wir ihn in den Fluß werfen, wer ahnt etwas von seinem Dasein.«
Der Jüngling sah, wie der Matrose einen blitzenden Stahl aus seinem Gürtel löste. Die Genossen des Blutgierigen wechselten bedeutungsvolle Blicke.
»Gib mir das Messer,« keuchte der kleine Jude, »ich stoße es ihm von hinten in den Nacken.«
Das Messer ging in die Hände des Juden über, der sich anschickte, sich wie eine Katze zwischen die Hauswand und Menes zu schieben. Der junge Mann, der diese Bewegung bemerkte, drückte sich nun, um sich wenigstens den Rücken zu decken, fest in die verschlossene Türe des Hauses. So stand er bebend, zu allem bereit, starr in die gierig leuchtenden Augen des sich ihm nähernden Ebräers blickend. In dieser Lage verharren, das sah er ein, hieße, dem sichern Tod entgegengehen. Er faßte deshalb den verzweifelten Entschluß, über den Juden herzufallen, um sodann eiligst das Weite zu suchen. Näher, immer näher drängte sich der Ebräer. Schon fühlte Menes deutlich seine heißen Atemzüge; es war ihm, als müsse er die Türe, an die er sich lehnte, mit dem Rücken eindrücken, oder als könne er mit einem gewaltigen Satz über die Köpfe seiner Angreifer hinwegfliegen. Eben erhob der Jude sein Messer, als ihm Menes, ohne recht zu wissen, was er tat, einen furchtbaren Faustschlag auf den Mund versetzte. Mit blutenden Lippen, stöhnend, taumelte der Getroffene zu Boden. Seine Genossen unterdrückten einen Schrei der Wut und Menes sah ein, daß es jetzt um ihn geschehen sei; denn der Matrose bückte sich fluchend nach dem entfallenen Messer, während die übrigen zurücktraten, um sich durch einen Anlauf für den Überfall vorzubereiten. Schon machte sich der Jüngling, fest den Rücken an das Haustor stemmend, bereit, sein Leben wenigstens bis zum letzten Atemzuge zu verteidigen; schon hatte er die zitternden Fäuste zu wuchtigem Schlage erhoben, um die Zurückgetretenen zu empfangen, da kam es ihm vor, als gäbe die Türe, an welcher sein Rücken Schutz und Stütze fand, leise seinem Drucke nach. Noch hielten seine Angreifer mit ihrem Sturm zurück, noch war Rettung möglich. Ja! es war keine Täuschung – Menes ließ den Arm erstaunt sinken – die Türe erknarrte fast unhörbar in ihren Angeln, ein Riegel rollte leise zurück, eine kleine, weiße Hand schlüpfte aus dem kaum drei Zoll breiten Spalt, faßte unseren hilfsbedürftigen Freund am Kleide und zog ihn zwischen den Pfosten und die geöffnete Türe.
»Rasch herein,« hörte er flüstern. Willenlos folgte er der Hand, denn jede Minute war kostbar. So behutsam, wie sie sich geöffnet, schloß sich die Türe wieder; Menes stand nicht mehr auf der Straße, sondern auf einem dunkeln Hausflur. Das Öffnen, Hereinziehen und Schließen war so lautlos, so rasch vollführt worden, daß die Habgierigen draußen auf der Straße sich nicht zu erklären vermochten, nach welcher Seite ihr Raub entwischt sei. Menes wachte wie aus einem schweren Traume auf, als ihm eine bekannte Mädchenstimme zuflüsterte: »Folge mir, du bist gerettet. Sobald der Morgen anbricht, kannst du nach Hause kehren; bis dahin muß ich dich in meinem Zimmer vor Verfolgung schützen.«
»Myrrah?« hauchte Menes atemlos, »du – meine Retterin? Ich bin in deiner Wohnung? Ihr Götter, was beginnt ihr mit mir,« setzte er leise hinzu, »macht ihr mich elend, um mich im nächsten Augenblick glückselig zu machen?«
»Stille,« beschwichtigte das Mädchen, während sie auf den Zehen in ihr Zimmer schlich, ein mageres Öllämpchen am Kohlenbecken anzündete und ihren Schützling bat, ihr zu folgen, »stille, damit die übrigen Hausbewohner nichts von dem Abenteuer bemerken. Komm, laß mich die Türe verriegeln. Tritt leise auf, setze dich hierher und beruhige dich, du bist noch ganz verstört.«
Ihr Benehmen zeigte nicht die geringste Befangenheit, sie drückte den Zitternden, dessen Auge glühte, auf einen Stuhl.
»Deute mein Benehmen nicht übel, guter Jüngling,« fuhr sie darauf mit holder Bescheidenheit fort, »ich hörte, als ich mich eben zu Bette legen wollte, unter meinem Fenster flüstern; als ich den Vorhang hob, übersah ich sofort deine unglückliche Lage und dankte Jehova, daß er mir vergönnt, dir behilflich zu sein. O, unser Volk ist verbittert, zürne ihm nicht, wenn es zuweilen in die Ketten beißt, die ihnen das Blut aus den Adern pressen; Verzeihe uns, wir sind nicht alle so. Nein, gewiß nicht.«
Ihre Äugen füllten sich mit Tränen.
»Daß nicht alle so sind, fühle ich es nicht an dir?« lispelte der erschöpfte Jüngling, dem Mädchen die Hand reichend, indem er ihr dabei einen Blick zärtlichster Dankbarkeit zuwarf.
»Du sprachst sanft mit mir,« erwiderte sie, in sich versunken, »du verachtest mich doch nicht wie die anderen?«
»Du tust mir weh, Myrrah, wenn du also fragst? Warum soll ich dich verachten?«
»Ich wußte es,« rief sie, ihren Schützling mit freudigleuchtenden Blicken betrachtend, »deshalb rettete ich dir das Leben.«
»Einem dir völlig Fremden würdest du es nicht gerettet haben?« frug er, um ihren Charakter zu ergründen.
»Ich weiß es nicht,« sagte das Mädchen nachsinnend, »wenn er mich geschmäht, mich mißhandelt, wie die anderen Ägypter – oh! warum hätte ich ihm das Leben retten sollen?« setzte sie dann fast wild hinzu. Gleich darauf fuhr sie weicher fort:
»Aber dir, der du sanft und gut bist, hätte ich es bewahrt dein Leben, selbst wenn du mich nicht geachtet, denn dein Leben« – sie zögerte, ein Lächeln erblühte dann auf ihren Lippen, als sie fortfuhr, »dein Leben ist mir kostbar, ich wollte, es wäre eine seltene Blume, die ich unter Glas hüten und pflegen dürfte! Aber ich weiß nicht, warum ich das alles sage.« Sie ward ernst. Sie zürnte sich selbst. Hierauf nahm sie die Lampe und leuchtete ihrem Freund hastig in die erblaßten Züge.
»Dein Auge ist tief und edel, es blickt wie euer Sonnengott,« sprach sie träumerisch mehr zu sich selbst, als zu ihm, »dir würde ich in allen Stücken trauen, du kannst nicht betrügen. Sprichst du zu mir: lege dich vor den Rachen des hungernden Krokodils, ich würde es tun; würdest du mir zürnen, würdest du diese meine Brust schlagen oder bespeien, ich würde stolz darauf sein, von dir mißhandelt zu werden! Aber auch nur von dir – deine Grausamkeit wäre nur Wollust – jeden anderen aber, der dasselbe wagte, würde ich« – – in ihrem Auge brannte edler Zorn, sie hatte unwillkürlich die schöne, kleine Hand geballt. Da fiel ihr Auge auf seine Hand.
»Aber du blutest,« rief sie erbleichend aus, nach dieser Hand fassend. Ihr vorher so stolz blickendes Auge verdunkelte sich, als das feuchte Rot an ihren Fingern haften blieb; ein schmerzvoller Ton entrang sich ihrer Brust.
»Es ist nichts, Mädchen,« flüsterte Menes mit Anstrengung, denn das Benehmen Myrrahs hatte ihn, wie in einen süßen Halbschlaf gewiegt, »ich schlug meinem Angreifer auf den Mund; seine Zähne ritzten mir das Fleisch.«
»Das ist gut,« lächelte sie unter Tränen zu ihm empor, »du bist mutig.«
Diese Freudigkeit verwandelte sich sogleich wieder in die besorgteste Unruhe. Wasser war bald zur Hand, ein Tuch ebenfalls. Nun kniete sie nieder und streifte den Ärmel vom Gewand des Jünglings zurück, um sein Blut, das bis an den Ellbogen hinabgeflossen, aufzuwaschen. Als ihr dabei die schön gerundeten Muskeln seines Armes entgegenblühten, überzog ein ängstliches Rot ihre weißen Züge; nun erst schien ihr das Bedenkliche der ganzen Lage klar zu werden. Rasch strich sie das Gewand wieder über den Arm, stand auf, eilte an die Türe und sagte abgewendet:
»Bleibe du hier, ich will heute nacht auf der Matte des Hausflurs zubringen.«
»Eben erst sagten mir deine Lippen, Myrrah,« erwiderte ihr der errötende junge Mann, »daß du mir in allen Stücken trautest – es scheint, du traust mir dennoch nicht?«
»Das ist wahr,« lächelte sie nun, »ich war recht töricht.«
Menes, durch den Blutverlust geschwächt, stützte sich müde auf den Tisch, indem seine Glieder schlaff herabhingen.
»Armer Mann, leidest du Schmerzen?« frug sie besorgt. Er lächelte ermattet. Darauf schritt sie vertraulich zu Menes heran, setzte die Lampe auf den Tisch, holte aus einer Holztruhe ein altes kleines Brot hervor und stellte daneben ein Gefäß mit Milch nebst einigen Datteln.
»Dies ist meine Feiertagsmahlzeit,« sagte sie, »nimm, was dir die Armut bieten kann, du wirst hungern.«
Obgleich anfangs Menes, gerührt von der Einfachheit des Mahles und der Gutmütigkeit des Mädchens, dankend die Berührung der Speisen ablehnte, mußte er schließlich, um seine nötigende Wirtin nicht zu beleidigen, von der Milch etwas zu sich nehmen.





























