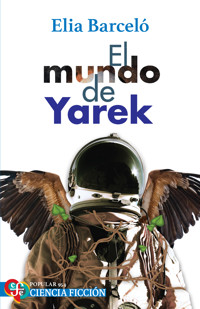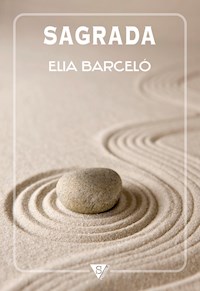8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Bei einer Tangoveranstaltung verführt eine Frau, schön und gespenstisch, einen Mann mit ihrem Tanz. Doch am Ende des Abends verschwindet sie – und hinterlässt eine Spur. Eine Spur, die nach Buenos Aires und in die Vergangenheit führt – zu einer leidenschaftlichen Liebe, die nicht sein durfte …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Allen Männern und Frauen, die einmal die Magie des Tango erfahren haben. Allen Männern und Frauen, die auf der Suche nach der Liebe sind.
Für Klaus, den Mann meines Lebens, den ich vor mehr als einem Vierteljahrhundert beim Walzertanzen kennengelernt habe.
Übersetzung aus dem Spanischen von Stefanie Gerhold
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe
1. Auflage 2011
ISBN 978-3-492-96043-4
© 2007 Elia Barceló
Titel der spanischen Originalausgabe:
»Corazon de Tango«, 451 Editores, Madrid 2007
Deutschsprachige Ausgabe:
© 2011 Piper Verlag GmbH, München
Umschlaggestaltung: Cornelia Niere, München
Umschlagmotiv: Ayal Ardon/Trevillion Images
Datenkonvertierung E-Book: Kösel, Krugzell
Das Akkordeon erklingt, wozu noch Licht;
es ist Nacht auf dem Tanzboden, ob sie wollen oder nicht,
die Schatten versammeln sich, rufen:
Griseta, Malena, Mariester …
Die Schatten, vom Tango gelockt,
rufen sie mir in den Sinn,
lasst uns tanzen, ich sehne mich so
nach ihrem glänzenden Kleid aus Satin.
Wem gehört das Klagen der Geige?
Welche sehnsüchtige Stimme,
müde zu leiden,
kann so schluchzen und wimmern?
Vielleicht ihre Stimme,
die so jäh
verstummte …
Vielleicht der Alkohol,
vielleicht …!
Ihre Stimme wohl kaum,
ihre Stimme lebt nur noch im Traum;
es sind, ich weiß es wohl,
die Gespenster des Alkohols.
Sie war wie du, blass und entrückt,
schwarz das Haar, die Augen grün.
Im ersten Morgenlicht war auch ihr Mund
eine traurige rote Blume.
Eines Tages kam sie nicht …
Ich habe gewartet mit Blick auf die Uhr …
bis ich von ihrem Ende erfuhr …
Drum versinke ich mit den Schatten der Tangos
vergeblich in meiner Erinnerung an sie.
Der Tango Vielleicht ist es der Alkohol wurde später in Vielleicht ist es ihre Stimme umbenannt. Der Text ist von Homero Manzi (Homero Nicolás Manzione Prestera), die Musik von Lucio Demare. Die älteste Aufnahme stammt vom 6. Mai 1943. Später hat Libertad Lamarque den Tango in einer leicht veränderten Fassung gesungen, in der sich eine Frau an einen Mann erinnert:
Er war wie du, blass und entrückt,
schwarz das Haar, die Augen grün.
Seine Hände waren sanft, und traurig seine Weise
wie der Gesang der Geige …
Eins
Ich lernte sie bei der Milonga kennen, während der Sturm in jener Aprilnacht den Geruch des Flusses und der feuchten Wälder in die von Bergen umgebene Stadt trug, in der ich wieder einmal beruflich unterwegs war.
Als ich ankam, war es schon nach elf und die Stimmung so kläglich, dass ich fast kehrtgemacht hätte. Eigentlich hätte ich mich im Hotel ausruhen sollen, nachdem ich so viele Stunden vor dem Bildschirm gesessen und mich damit abgemüht hatte, in das Chaos dieser Firma ein wenig Ordnung zu bringen. Aber die Leidenschaft siegte, ich war noch nicht zur Tür herein, als Gardels Stimme zu den ersten Liebesschwüren anhob – »Si supieras que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti« –, und im selben Augenblick wusste ich, dass ich bleiben würde, zumindest solange er sang, solange sich eine Frau schweigend an mich schmiegte und vom Zauber des Tangos forttragen ließ.
Die Frauen waren wie immer in der Überzahl, sie lehnten verträumt oder sehnsüchtig an der Wand oder standen rauchend in einer Ecke des Saals, im sanften Licht von ein paar mit rosa Stoff verhangenen Glühbirnen. In der Mitte, auf der runden Fläche zwischen den Tischen, tanzten einige Paare in Straßenkleidung, ernst und mit geschlossenen Augen.
Ich war nicht zum ersten Mal auf so einer Veranstaltung, es war ein typischer Gemeindesaal mit an die Wände gerückten Tischen, Pappbechern und Thermoskannen mit Erfrischungsgetränken irgendwo in einer Ecke und hohen Fenstern, die im nächtlichen Wind klapperten. Es rührte mich jedes Mal wieder von Neuem, dass sich in einer mitteleuropäischen Kleinstadt an einem Werktag Leute wie ich fanden, die wertvollen Schlaf opferten, um ihre Tanzleidenschaft auszuleben, und sei es in einem hässlichen, seelenlosen Saal mit einem Gettoblaster und einem Stapel CDs.
Ich hatte Innsbruck immer als trist empfunden, vielleicht weil ich die Stadt nur abends kannte, wenn die Sonne schon untergegangen war, oder frühmorgens, bevor sie aufging. Eine graue Stadt voller grauer Menschen, als würde die jahrhundertealte Geschichte mitsamt ihren Toten wie eine Steinplatte auf ihnen lasten und ihre Blicke, ihr Gemüt und ihre Stimmen dämpfen. Für einen kurzen Moment kam ich mir vor wie in einer Gespensterrunde, aber das lag am Tango, der eine ähnlich benebelnde Wirkung hat wie der Alkohol. Und dennoch war der Gedanke an Gespenster nicht verkehrt, denn nachts bei der Milonga kam eine Seite von mir zum Vorschein, die mich tagsüber nicht weiter beschäftigte, und mit meinem nächtlichen Ich die Sehnsucht nach einer Zeit, die ich nicht erlebt hatte, und nach einer Frau, die auch nie in La Boca auf mich gewartet hatte.
Niemand begrüßte mich. Als ich den Mantel ablegte und mir im Sitzen die Tanzschuhe anzog, taxierten mich mehrere Frauen und schlossen von meinen langsamen, gezielten Bewegungen auf mein Können, voller Erwartung, wie gewandt meine Schritte über die Tanzfläche gleiten, wie sicher meine Arme sie führen würden.
Bei keiner anderen zivilisierten menschlichen Tätigkeit ist es möglich, dass ein Mann eine Frau so führt und sie sich ihm so bedingungslos fügt. Der argentinische Tango ist der einzige Pakt, der nicht gebrochen werden kann. Vielleicht war ich ihm deshalb so leidenschaftlich verfallen, seit ich ihn vor langer Zeit bei einem Aufenthalt in Buenos Aires entdeckt hatte.
Mein nächtliches Ich, der Tangobesessene, der Milonguero, den niemand aus meinem Tagleben kannte, stand auf, es war immer das gleiche Spiel, mein Körper war wie verwandelt, hatte auf einmal ein sicheres Gespür für sein Gewicht, die Balance, die leichte Reibung der Ledersohle über dem glattem Parkett, die Drehung in den Hüften, die Brust, die sich zur Frau öffnet.
Da erblickte ich sie. Sie stand ganz hinten im Saal, mit der Schulter an eine Tür gelehnt, die einen Spalt offen stand, sodass der hereinfegende Wind einen Zipfel ihres engen, seitlich geschlitzten Satinrocks hob und ein von schwarzer Seide umspieltes Bein entblößte. In ihrer feinen Hand lag eine Zigarette, die neben ihrem Schenkel vor sich hin qualmte. Sie trug hohe Tanzschuhe mit gekreuzten Riemchen.
In dem schwachen Licht konnte ich ihr Gesicht nicht ausmachen, das zudem nach draußen gewandt war, als blickte sie auf etwas jenseits der Tür, ich sah kaum mehr als ihre langen schwarzen Haare, die mit einem altmodischen, mit funkelnden Strasssteinchen besetzten Kamm hochgesteckt waren, und die goldenen Ohrringe.
Sie war einem alten Album entschlüpft, ein Foto in Sepia, eine Frau, wie es sie nur in den Geschichten gab, die ich mir, angeregt von den Tangotexten, abends vor dem Einschlafen erzählte. Neben ihr erschienen mir auf einmal alle anderen Frauen blass, überflüssig, was, bitte schön, war leidenschaftlich an diesen Mitteleuropäerinnen, die in dem abgedunkelten Saal für ein paar Stunden ihren Alltag als Zahnärztinnen, Sekretärinnen, Hausfrauen vergaßen; von dieser mir allzu bekannten Möchtegernleidenschaft wollte ich nichts mehr wissen, das war passé, nichts im Vergleich zu der betörenden, unmöglichen Wirklichkeit dieser Frau, die auf mich zu warten schien, auf niemand anderen als diesen Unbekannten, der wie in einem Film von anno dazumal plötzlich da war, als hätte ihn der Wind hergeweht.
Sie sah mich nicht kommen. Eigentlich konnte sie mich auch nicht gehört haben, dennoch ließ sie bei den ersten Takten von Volver die Zigarette fallen, drehte sich zu mir um, und ihre Augen verschlangen mich. Schwarze, wie Spiegel glänzende Augen zwischen langen Wimpern. Eine Sekunde später tanzten wir.
Es war wie Fliegen, wie Schweben in einem tiefen, warmen Gewässer, durch das sich der schleppende Rhythmus eines alten, süßen Schmerzes zieht, einer vagen, in der Zeit verlorenen Erinnerung. Es war, als hätte ich etwas wiedergefunden, das ich hatte vergessen müssen, um weiterleben zu können – jetzt war es in seiner ganzen überwältigenden Unermesslichkeit wieder da. Ich hatte geglaubt, ich hätte mir das alles nur über die Jahre zusammenphantasiert, doch es war so intensiv, so betörend, so unerhört echt.
Sie umhüllte mich wie ein Seidentuch, und bei jeder molinete, die sie um mich herum drehte, stieg mir ihr Duft in die Nase, der Hauch eines Parfüms, und ihre ernsten Augen funkelten zwischen ihren lustschweren Lidern wie Juwelen. Es war, als läse sie meine Gedanken, als wüsste sie, noch bevor ich eine Bewegung andeutete, was ich von ihr wollte, als wären wir eins, ein einziger Körper, der in zwei Hälften getrennt gewesen und von der Musik wieder vereint worden war.
Wir sprachen kein Wort. Es war nicht nötig. Was hatten wir uns zu sagen, was nicht schon unsere Füße mit ihren Figuren ausdrückten, unsere sich dem ewigen Rhythmus hingebenden Körper. Hätte ich sie auf Deutsch angesprochen, wäre der Zauber zerstört worden, aber nicht weniger schreckte mich die Vorstellung, ich würde sie auf Spanisch ansprechen und sie mich nicht verstehen oder mir mit deutschem Akzent ein paar in Abendkursen erlernte Standardsätze antworten.
Im ersten Moment hielt ich sie für eine Spanierin oder Lateinamerikanerin und erwog, mit ihr durch die Tür, an der sie gelehnt hatte, in den verlassenen Garten zu schlüpfen, wo wir eine Zigarette hätten rauchen und uns in unserer Sprache unterhalten können. Aber dann wären unweigerlich die Fragen nach Namen und Beruf gekommen und damit der ernüchternde Moment, an dem sich diese bildschöne, göttlich tanzende Frau, die aus einem Gemälde von Quinquela Martín hätte stammen können, als eine im Exil lebende argentinische Psychologin oder dominikanische Unterwäscheverkäuferin entpuppt hätte.
Ihre Lippen streiften meine unrasierte Wange, und ich wusste, dass wir das Gleiche dachten: dass wir zum Tanzen gekommen waren, dass die Nacht uns gehörte, dass wir uns wie durch ein Wunder zu dieser späten Stunde in Mitteleuropa getroffen hatten, um uns von der Magie des Tangos forttragen zu lassen. Das genügte.
Wir tanzten ohne Pause ein Stück nach dem anderen, Milongas, bei denen sie ihre Anmut spielen ließ, einige Tangos von Piazzolla, deren schrill tönender Schmerz sie kurz zu überraschen schien.
Ich weiß nicht, wie lange wir blieben, denn die Zeit, die die Uhren messen, ist nicht die wahre Zeit.
Irgendwann tauchte ein junger Afrikaner auf, einer dieser fliegenden Händler, die plötzlich mit einem gewaltigen Strauß langstieliger roter Rosen im Arm dastehen und ein weißes Lächeln aufsetzen, ein Riss in dem Gesicht, das müde ist von den vielen Ablehnungen, von den vielen ausweichenden Blicken in teuren Restaurants und Lokalen.
Verzückt sah sie die Blumen an, und ein vorsichtiges Lächeln erschien auf ihren Lippen, dunkelrot wie die Rosen, die der junge Mann anbot. Ohne meinen Arm von ihrer Taille zu nehmen, zog ich ein paar Scheine aus der Hosentasche und gab sie ihm lächelnd. Er begutachtete den Strauß, als fiele ihm die Wahl schwer, dann zog er eine makellose Rose mit fast noch geschlossener Blüte heraus und reichte sie ihr. Sie sah mich an, berührte die Rose mit den Lippen, brach den überlangen Stiel ab, steckte sie sich in den Ausschnitt, schloss die Augen und gab sich meiner Umarmung hin.
Wir tanzten. Wir tanzten und vergaßen den erbärmlichen Gemeindesaal, die gewöhnlichen Paare, die die Schritte zählten oder sich leise die Figuren vorsagten, als könnten sie ohne das Hilfsmittel der Worte die Musik nicht in Tanz verwandeln, wir vergaßen die beleidigten Blicke der umstehenden Frauen, die Uhr, die irgendwo die Sekunden dieser Nacht zählte und meinen Wunsch zunichtemachte, diese Nacht möge nie zu Ende gehen.
Irgendwann merkte ich, dass um uns herum Möbel gerückt wurden und alle wie aufgeschreckte Tauben umherliefen, und tatsächlich, die Milonga ging zu Ende. Die Paare halfen sich in die Mäntel, Getränke wurden weggeräumt, die übervollen Aschenbecher geleert. Die Freundinnenpaare sahen sich noch einmal frustriert nach mir um, bevor sie in dem dunklen Vorraum verschwanden. Dann brach die Musik ab.
Einen Moment lang spürte ich mit aller Deutlichkeit das Gewicht ihrer Arme, ihren Kopf auf meiner Schulter, ihr um mich geschlungenes Bein. Dann, wir hatten noch immer nichts gesagt, lösten wir uns voneinander. Sie sah zur Tür, eine Aufforderung, die ich nicht gleich begriff, blickte auf die Rose in ihrem Dekolleté, drückte mir einen flüchtigen Kuss auf die Wange und bewegte sich mit unbeschreiblicher Anmut auf die Dunkelheit zu. Ihr schmerzliches, sanftes Lächeln blieb in der Stille hängen, dann brach die Einsamkeit über mich herein.
Ich ging die Schuhe wechseln, zog mir den Trenchcoat an und wartete in dem vom perlweißen Licht der Straßenlaternen erhellten Vorraum, bis die Letzten herauskamen. Das zweifache Umdrehen des Schlüssels, mit dem sie den Saal absperrten, klang für mich nach Endgültigkeit.
Ich zündete mir eine Zigarette an und wartete, starrte auf die Lichtreflexe auf meinen Schuhspitzen und warf immer wieder einen Blick auf die Tür der Damentoilette, wo sie sich vermutlich zurechtmachte, um mit mir, dem Unbekannten, in die Nacht zu entschwinden. Wohin?
Wahrscheinlich hatte sie die gleichen Hemmungen wie ich, darum dauerte es so lange; sie wollte fliehen, verschwinden, jetzt, da kein Tango mehr erklang.
Ein Auto fuhr die leere Straße entlang, und das nasse Rauschen zog mich vor die Tür. Es regnete. In dem sanften Nieseln hatten die Straßenlaternen einen schillernden Hof bekommen, und die Fahrbahn glänzte wie lackiert. Weit und breit war kein Mensch.
Ich ging wieder hinein, und mit plötzlicher Entschlossenheit klopfte ich an die Toilettentür. Stille. Ich zog sie vorsichtig auf, Dunkelheit empfing mich. Die Toiletten waren leer. Nicht nur leer, ausgestorben, verlassen, wie ein abgetriebenes Schiff. So fühlte ich mich auch.
Zurück im Vorraum, setzte ich mich auf die gemauerten Stufen und zündete mir eine neue Zigarette an, obwohl ich wusste, dass es keinen Sinn hatte, weiter zu warten. Sie war gegangen.
Hatte sie gar keinen Mantel dabei gehabt, keine Handtasche, keinen Schirm? Ich versuchte mich zu erinnern, wie der Saal zuletzt, bevor ich hinausgegangen war, ausgesehen hatte. Er war leer gewesen. Bis auf einige CDs, die wahrscheinlich das Paar mit dem Saalschlüssel eingesteckt hatte. Und die Treppe führte nirgendwo hin außer zu den Toiletten und dem Vorraum, in dem ich die ganze Zeit neben der Eingangstür rauchend ausgeharrt hatte.
Ich ging auf die Straße in den müde vor sich hin plätschernden Regen, der nun, da der Wind sich gelegt hatte, schnurgerade fiel, und eilte mit eingezogenem Kopf und den Händen in den Manteltaschen in die Altstadt. Der Nachtportier gab mir den Schlüssel zu meinem Zimmer, dort angekommen leerte ich wie immer die Mantel- und Sakkotaschen und legte alles auf den Nachttisch: Brieftasche, Papiere, Schlüssel, Visitenkarten, ein paar Rechnungen und einen gefalteten Zettel, an den ich mich nicht erinnern konnte.
Mit zitternden Händen faltete ich ihn auseinander. Darauf standen eine Adresse in La Boca, Buenos Aires, und ein Frauenname: Natalia.
Mitte August kam ich endlich nach Buenos Aires, in den Winter am Río de la Plata. Gleich nachdem ich ein Hotel im Zentrum bezogen hatte, suchte ich im Straßenverzeichnis die Adresse, die ich mir eingeprägt hatte, unnötigerweise, da ich den Zettel, den ich unzählige Male auseinander- und wieder zusammengefaltet hatte, immer bei mir trug. Tatsächlich, es war eine Adresse im La-Boca-Viertel, nur ein paar Gässchen von der Touristenattraktion Caminito entfernt.
Das Taxi ließ mich an der Ecke raus, in einer schlecht beleuchteten Gegend, die ich, hätte ich sie nicht von früheren Besuchen gekannt, für gefährlich gehalten hätte. Trotz der Kälte trug ich die Tanzschuhe, denn falls ich sie nicht zu Hause antreffen würde, wusste ich, wo ich sie suchen musste. Ich hatte immer wieder davon geträumt, in Dutzenden Hotelbetten, in allen Städten, die ich in den letzten vier Monaten seit jener Aprilnacht besucht hatte: Das Taxi würde mich an der Ecke rauslassen, ich würde die Straße überqueren, zu der auf dem Zettel stehenden Hausnummer eilen und klingeln, denn es war abends und die Haustür verschlossen. Ich würde hochsehen, ob in ihrem Fenster Licht wäre, und dann den um diese Uhrzeit von allen Touristen verlassenen Caminito hinuntergehen, von wo aus meine glänzenden Schuhspitzen mir den Schleichweg zu Los Gitanos weisen würden, einem winzigen Lokal mit ein paar Tischen, wo ein vorstädtischer, wollüstiger Tango getanzt wird. Dort würde sie stehen, an die Tür gelehnt wie damals, der Rauch ihrer Zigarette würde ihr Handgelenk umspielen, und endlich würden mich ihre wie dunkle Sterne funkelnden Augen zum Tanzen auffordern.
Mich überraschte nicht, dass die Haustür verschlossen war und im oberen Stockwerk kein Licht brannte. Beunruhigend fand ich, dass alles so verlassen und tot wirkte, die geschlossenen Fensterläden, die verrostete Klingel, das Unkraut, das zwischen den Platten am Eingang spross.
Bedrückt ging ich zu dem Tanzschuppen und vermisste den Hut, den ich im Hotel gelassen hatte, da die Luftfeuchtigkeit sich in meinem hochgestellten Mantelkragen und meinen pomadigen Haaren niederschlug.
Tangotakte überschwemmten die Straße mit Nostalgie, ein paar Kerzen flackerten auf den leeren Tischen des Lokals, ein einziges älteres Paar, dessen unangestrengte Sehnsucht wahre Könner verriet, tanzte neben der verlassenen Theke.
Ich konnte nicht glauben, dass sie nicht da war, und starrte durchs Fenster. Lange Zeit stand ich im Bann des zitternden Kerzenlichts da, jede Tangonote war wie ein Stich, bis der Wirt meinen Schatten entdeckte und mich hereinwinkte. Ich schüttelte den Kopf und verzog mich, rannte vor meinem Irrtum davon, und nachdem ich stundenlang durch unbekannte Straßen gelaufen war, fand ich ein Taxi, das mich ins Hotel zurückbrachte.
Am nächsten Tag kam ich wieder, nachdem ich eine Nacht voller Albträume und Schrecken durchlitten und eine halbe Stunde lang telefoniert hatte, um meine Auftraggeber davon zu überzeugen, dass ich, die Zeitverschiebung sei schuld, aus meinem Jetlag nicht hochkam.
Am Hafen von La Boca, einem verwahrlosten, vor sich hingammelnden Gelände, war es kalt und neblig. Vereinzelte Touristen spazierten verloren an den Fassaden falscher Fröhlichkeit vorbei; es herrschte eine feuchte, heimtückische Kälte.
Unversehens fand ich mich in dem Museum wieder, in dem ich bereits während früherer Reisen gewesen war, eines der traurigsten, die ich kenne, mit kaum besuchten, übergroßen und schlecht beleuchteten Sälen, an deren in unsäglichem Gallegrün, Schmutziggelb und Blassblau gestrichenen Wänden Bilder aller möglichen Stile und Epochen in einem nicht nachvollziehbaren Durcheinander hingen, als hätte man sie hierher verbannt, um sie besser vergessen zu können.
Da ich schon mal da war, könnte ich mir im oberen Stockwerk noch einmal die Bilder Quinquelas ansehen, deren Ausdruck von Schmerz und Zerrissenheit so gut zum Tango passte, zu meiner Bedrücktheit, zur Friedhofsatmosphäre, die über La Boca lag; mit diesem vagen Plan durchschritt ich einen riesigen Saal, den nichts belebte außer der flüsternde Hall meiner über den Boden schleifenden Sohlen.
Da erblickte ich sie. Hinten links zwischen einer grauenvollen Pampalandschaft und einem überhaupt nicht dazu passenden Kirchgang – Frauen samt Schleier und Spitze und Männer mit Zylinderhüten – blickte sie mich von einem dunklen, mit einem wuchtigen vergoldeten Holzrahmen eingefassten Ölgemälde aus an. Ihre Augen glitzerten wie bei der Milonga, die Lider lustschwer, als lauschte sie einem Tango, der in der Einsamkeit des verstaubten Museums allein für sie erklang; ihre tiefroten Lippen wölbten sich schwach, wie damals, zu einem ebenso schmerzlichen wie provokanten Lächeln; ihr schwarzes Haar war von einem Hornkamm zu einem Knoten gesteckt. Auf der blassen Haut ihres von einer schwarzen Seidenkorsage gestützten Dekolletés prangte eine rote, nicht mehr ganz geschlossene Rosenknospe. Es war eine Sorte Treibhausrosen, die es zu der Zeit, als das Porträt entstanden war, noch nicht gegeben hatte.
Auf dem Rahmen, direkt unter ihren sich vor der Taille treffenden Händen – denselben, die mich angefasst und auf meiner Schulter gelegen hatten –, befand sich ein Schildchen, auf dem stand: »Der Tango ist ein leiser Schrei. Unbekannter Künstler. Um 1920.«
Zwei
Es waren noch zwei Tage bis zu meiner Hochzeit und drei bis zu meinem Geburtstag. Ich hatte es so gewollt. Mir gefiel die Aussicht, schon vor meinem zwanzigsten Lebensjahr zur Frau zu werden und den Rest meines Lebens erzählen zu können, ich hätte mit neunzehn geheiratet. Im Monat Januar. Mitten im Sommer.
Ich gewöhnte mich nur langsam daran, dass um mich herum alles Kopfstand, dass es so heiß war, obwohl es hätte kalt sein müssen, dass wir auf einmal so arm waren, dass ich von Leuten aus aller Herren Länder umgeben war, von denen viele noch nicht einmal richtig Spanisch konnten.
Wir waren vor fast zwei Jahren nach Argentinien gekommen, nur Papa und ich, und dank Rojo, so nannten sie Berstein, meinen zukünftigen Mann, hatten wir in La Boca ein Zuhause gefunden, und Papa hatte mit den wenigen Ersparnissen, die wir aus Spanien mitgebracht hatten, eine kleine Tischlerei eröffnet, wo er gelegentlich wie früher Leisten herstellte.
Mein Großvater hatte in Valencia eine Leistenfabrik besessen, die Papa in seinen letzten Jahren geleitet hatte, doch wenige Monate nach Großvaters Tod hatten sich meine Onkel die Fabrik unter den Nagel gerissen und uns auf die Straße gesetzt. Damals beschloss Papa, der seit einigen Jahren verwitwet war, Valencia zu verlassen, wo ihm nichts mehr geblieben war außer Mamas Grab, und nach Argentinien zu gehen.
Für mich war es nicht leicht gewesen. Ich war in einem Dorf in der Nähe von Vitoria aufgewachsen, mein Vater war Baske, meine Mutter Valencianerin; mit acht zog ich nach Valencia um, denn nach Großmutter Begoñas Tod vergaß Großvater Francesc allen Groll auf seinen Schwiegersohn, der seine Tochter »entführt« hatte, und bot ihm eine Stelle in der Fabrik an, und mit siebzehn musste ich mich erneut von allem verabschieden, um mit meinem Vater nach Buenos Aires zu gehen.
Zuerst hatte ich in Valencia bleiben wollen, aber ich hätte entweder bei Onkel und Tante und meinen dämlichen Cousinen wohnen oder bald einen der jungen Schnösel heiraten müssen, die mir ständig Anträge machten; ich hatte sie noch nie gemocht, aber seit man uns die Fabrik genommen hatte, mochte ich sie noch weniger, weil es auf einmal so ausgesehen hätte, als würden sie mir einen Gefallen tun, wenn sie mich vor den Altar führten.
Also kam ich mit, um noch einmal von vorn anzufangen.
Dass ich mich auf Rojo eingelassen hatte, war ein wenig gedankenlos gewesen. Aber ich gefiel ihm und war im heiratsfähigen Alter, außerdem schuldeten wir ihm viel, er war ein herzensguter Mann, und da hat Papa mich ihm versprochen, denn aufgrund seiner gesundheitlichen Probleme quälte ihn der Gedanke, er könnte bald sterben und mich allein zurücklassen.
Und eigentlich war ich an diesem heißen Januarmorgen, während ich für Papa zur Kneipe ging und mir der brackige Gestank des Flusses in die Nase stieg, glücklich. Wie alle Mädchen in meinem Alter dachte ich an nichts lieber als an meine Hochzeit, an die Aussteuer, die bereits komplett war und in der guten Truhe lagerte, an das Kleid, das in dem Spiegelschrank aus Valencia hing, daran, dass man mich mit »Señora« ansprechen würde, an das Fest, das wir für unsere wenigen Freunde hier ausrichten würden, und … klar, keine Hochzeit ohne Bräutigam.
Der meine war groß, kräftig, mit Vollbart und langen rotblonden Haaren, fünfzehn Jahre älter als ich, Obermaat auf einem Frachtschiff und Deutscher, wobei er recht gut Spanisch sprach. Er war ein grundanständiger Mann, nicht wie die blässlichen Jüngelchen mit Parfüm und Krawatte damals in Valencia, die uns nach dem Kirchgang begleitet hatten, wenn wir mit meiner Tante und meinen Cousinen mit der Kutsche über den Paseo de Alameda und durch die Viverosgärten gefahren waren.
Rojo hatte ich noch nie mit Krawatte gesehen. Bei seinen Sonntagsbesuchen, wenn er nicht auf See war, trug er ein schwarzes Seidenband, das ihm bis zur Brust reichte, und ein bockiges Leinenjackett, das beim Hinsetzen knitterte und unter den Armen feuchte Flecken bekam.
Ende der Leseprobe