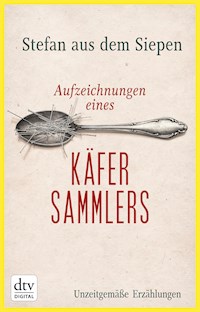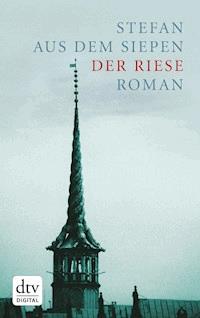8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Auf dem Boden lag ein Seil – nichts weiter.« Ein abgelegenes Dorf, von Wäldern umschlossen. Einige Bauern führen hier ein einsames und zufriedenes Dasein, das von Ereignissen kaum berührt wird. Eines Tages geschieht etwas vermeintlich Belangloses: Einer der Bauern findet auf einer Wiese am Dorfrand ein Seil. Er geht ihm nach, ein Stück in den Wald hinein, kann jedoch sein Ende nicht finden. Neu-gier verbreitet sich im Dorf, ein Dutzend Männer beschließt, in den Wald aufzubrechen, um das Rätsel des Seils zu lösen. Ihre Wanderung verwandelt sich in ein ebenso gefährliches wie bizarres Abenteuer: Das Ende des Seils kommt nicht in Sicht – die Existenz des Dorfes steht auf dem Spiel.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 163
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Ein abgelegenes, von Wäldern umschlossenes Dorf. Einige Bauern führen hier ein zufriedenes Dasein, das von Ereignissen kaum berührt wird. Eines Tages findet Bernhardt, einer der Bauern, auf einer Wiese am Dorfrand ein Seil. Er geht ihm nach, ein Stück in den Wald hinein, kann jedoch sein Ende nicht finden. Neugier verbreitet sich im Dorf, und ein Dutzend Männer beschließt, in den Wald aufzubrechen, um das Rätsel des Seils zu lösen. Ihre Wanderung verwandelte sich in ein bizarres Abenteuer – auch nach Stunden kommt das Ende des Seils nicht in Sicht. Während die im Dorf gebliebenen Frauen und Kinder darauf warten, dass die Suchenden zurückkehren, geraten die Männer immer stärker in den Bann des Seils. Bald überschlagen sich die Ereignisse, und die Existenz des ganzen Dorfes steht auf dem Spiel.
In einer glänzend geschriebenen Parabel schildert Stefan aus dem Siepen den Einbruch des Unbegreiflichen und Chaotischen in eine wohlgeordnete Welt. Spannend erzählt er von menschlicher Obsession und dem Verhängnis des Nicht-Aufhören-Könnens.
Von Stefan aus dem Siepen sind bei dtv außerdem erschienen:
Die Entzifferung der Schmetterlinge
Luftschiff
Der Riese
Das Buch der Zumutungen
Aufzeichnungen eines Käfersammlers
Stefan aus dem Siepen
Das Seil
Roman
Erster Teil
1 Die Entdeckung
Als Bernhardt, die Pfeife zwischen den Zähnen, seinen Abendgang machte, lagen die kleinen Holzhäuser des Dorfes im Dunkeln, die Läden vor den Fenstern waren geschlossen, hier und dort schlängelte sich Rauch von einem strohgedeckten Dach dem Himmel entgegen, an dem das gelbweiße Mondlicht die Sterne verscheuchte. Die umzäunten Weiden standen leer, denn die Bauern hatten das Vieh, um es gegen Angriffe von Wölfen zu schützen, in die Ställe getrieben. Fledermäuse waren in der Luft, drängten sich störend in das Bild des Friedens, das sonst ohne Flecken gewesen wäre: Lautlos flatternd zogen sie ihre Figuren durch die Nacht, schnelle Schatten, die sich taumelnd aus der Schwärze lösten und, ehe der Blick sie fassen konnte, taumelnd wieder verschwanden.
Bernhardt blickte zu den Kornfeldern hinüber, die an die Weiden grenzten. Das Getreide stand hoch, in wenigen Tagen würde die Ernte beginnen: Es schien ihm, als hielten sich die Halme nur noch mit Mühe unter ihrer Last aufrecht und als müsste bereits der kleinste Zuwachs an Fülle genügen, um sie zu Boden sinken zu lassen. Ein sanfter Wind, der kaum zu spüren oder zu hören war, strich über die Ähren, die im Mondlicht ihren Goldton verloren hatten, ein hartes und totes Grau zeigten. Er erinnerte sich, wie er einmal als kleiner Junge mit seinem Vater gerade hier, vor diesem Feld, gestanden hatte.
– Die Ähren sind wie das Glück, hatte der Vater gesagt. Wenn das Glück zu groß wird, wird es zu einem Leid.
Bernhardt war erstaunt gewesen, denn selten einmal hatte er seinen Vater – oder irgendjemanden sonst im Dorf – etwas sagen hören, das über das Einfachste, ganz und gar Naheliegende hinausgegangen wäre. So hatten sich die Worte ihm eingeprägt, ragten als etwas Seltsames und Ehrfurchtgebietendes aus dem harmlosen Einerlei seiner Erinnerungen. Seit damals hatte er nie mehr einen Blick auf reifende Felder werfen können, ohne sich irgendetwas von »Leid« und »Glück« und »Ähren« vorzumurmeln und einen Anlauf zu philosophischem Nachdenken zu unternehmen, der freilich, kaum dass er begonnen hatte, immer gleich wieder verebbte.
Bernhardt ging an dem blauschwarzen Wald entlang, der sich in weit gespanntem Bogen um die zwei Dutzend Häuser, um die Felder und Weiden zog. Wie öfters schon hatte er den Eindruck, dass die Bäume im Finstern um ein Stück näher an die Häuser heranrückten – als wollten sie den Kreis enger ziehen und einen Teil des Bodens, welchen die Vorfahren der heutigen Dörfler mit ihren Äxten aus der Wildnis herausgeschlagen hatten, sich im Schutze der Nacht wieder einverleiben. Die Wälder in dieser Gegend waren noch beinahe urwüchsig, dehnten sich so unzugänglich aus wie vor Jahrtausenden, viele Tage konnte man in ihnen wandern, ohne auf die Spur eines Menschen zu treffen, nur selten waren Weiler eingesprengt wie Inseln in einem gewaltigen Meer.
Auf der Wiese, die an den Rand des Tannenwaldes stieß, bemerkte Bernhardt etwas, das ihn stutzen ließ. Eine dunkle gewundene Linie zog sich durch das Gras, im Licht des Mondes nur schwach zu sehen, ähnlich einer Schlange – was mochte es sein? Mit leicht verzögertem Schritt, die Stirn in Falten, ging er darauf zu. Auf dem Boden lag ein Seil – nichts weiter. Einer der Bauern musste es hier vergessen haben, oder vielleicht hatten Kinder damit gespielt. Mehr enttäuscht als neugierig beugte er sich herab, um von Nahem einen Blick zu werfen, und geriet sogleich ins Staunen, konnte nicht anders, als die Pfeife aus dem Mund zu nehmen und einen leisen Pfiff auszustoßen: Ein gutes Stück, alle Achtung! Fest geflochten! Und dick wie ein Daumen! Ein solches Seil besaß niemand im Dorf, das stand fest – aber wem konnte es gehören?
Er setzte seinen Weg fort, umflattert von den grauen Schatten, und dachte über das Seil nach, nicht nur weil es ihn verwirrte, sondern auch weil es sonst nichts gab, über das sich nachdenken ließ. In der Nähe hörte er ein mahlendes Geräusch, rau in der Stille, das ihn ablenkte. An einem der Häuser, die dem Wald am nächsten lagen, leuchtete ein Fensterviereck gelb im Dunkeln; Raimund, der Hausherr, schloss von innen die Läden.
– Guten Abend, rief Bernhardt ihm zu, und er staunte, wie laut seine Stimme durch die Dunkelheit hallte, sie musste in vielen Häusern, ja im ganzen Dorf überklar zu hören sein wie ein Schrei.
– Grüß dich, Bernhardt. So spät noch draußen?
Raimund stand regungslos, seine Schultern füllten, vom Licht umgrenzt, den größten Teil des Fensters aus. Im Herankommen sah Bernhardt ihn nur als schwarze Fläche vor sich, wie einen Scherenschnitt, der an der Hauswand hing.
– Ich geh’ spazieren, wie immer.
– Ach? So? … Eben hab’ ich dich am Wald stehen sehen, da drüben. Du hast dich nach irgendwas gebückt. Was gibt’s denn da?
Seine Stimme klang leicht schläfrig, zugleich aber auch forschend, als wolle er Bernhardt für etwas, das ihm verdächtig vorkam, zur Rede stellen. Der Geruch des schwarzen Bieres, das sich die Bauern in ihren Häusern brauten, wehte aus seinem unsichtbaren Mund und vermischte sich mit dem tauigen Duft der Abendwiese.
– Ich hab’ ein Seil gefunden.
– Ein Seil?
– Ja. Es liegt dort hinten im Gras. Ziemlich dick ist es, du würd’st dich wundern. Bei uns gibt’s niemanden, der so ein Seil hat.
– Ach! Und bloß deswegen gehst du hier draußen rum?
Es schien Raimund unwirsch zu machen, dass Bernhardt ihm nicht mehr zu sagen habe, ihn wegen einer läppischen und langweiligen Kleinigkeit wie dieser davon abhalte, sich der wichtigen Arbeit des Lädenschließens zu widmen. Kein Wort fiel mehr – Raimunds Arme fuhren ruckhaft aus dem Fenster heraus, griffen nach rechts und links, wobei kurz die prankenhaften, mit blondem Fell bedeckten Hände sichtbar wurden, dann flogen unter Krachen und Quietschen die Läden zu.
Bernhardt beschloss, ins Haus zurückzukehren. Als er durch die Tür trat, fand er die Wohnstube leer vor. Der warm-säuerliche Duft des Abendessens schwebte noch in der Luft, und die Kienspan-Lampe unter der Decke leuchtete so ruhig und geduldig, als warte sie auf etwas. Agnes, seine Frau, musste bereits in der Schlafkammer sein, und wirklich hörte er, durch die Holztür hindurch, wie sie nebenan über die knarzenden Dielen ging. Und noch ein Geräusch war da, ein feines Glucksen, mehr zu ahnen als zu hören, es drang aus einer Nische neben der Tür, die mit einem weißleinenen Vorhang abgetrennt war. Bernhardt lächelte ein zartes Lächeln, das sich in seinem herben und vierschrötigen Gesicht ausnahm, als habe es sich auf unerklärliche Weise darein verirrt und müsse im nächsten Augenblick wieder verschwinden.
– Eli–sa–beth …, Eli–sa–beth …, sagte er vor sich hin, so leise, dass er den Schlaf des Kindes nicht stören würde, und doch auch klar genug, um an dem Klang der Silben seine Freude zu haben. Er schob langsam den Vorhang beiseite und beugte sich über die Wiege: Elisabeths braunes Haar, das in den letzten Wochen, zur Freude der Eltern, kräftiger gewachsen war, stach von dem Weiß des Kissens ab; in ihren Mundwinkeln hatte sich, niedlich anzusehen, ein wenig Speichel gesammelt. Bernhardt zog sein Sacktuch aus der Tasche und tupfte den farblosen Schaum behutsam fort. Diese kleine Geste war es, die ihn erst recht glücklich machte, denn immer musste er etwas tun, musste seinem Glück durch irgendeine, wenn auch noch so winzige Tat nachhelfen, um es genießen zu können; hätte er einfach nur das schlafende Gesichtchen betrachtet, wäre gleich eine Unruhe in ihm wach geworden – jene unheimliche, nicht zu erklärende, immer wieder, und manchmal gerade in den besten Augenblicken, durch seinen Kopf huschende Furcht, das schöne und geborgene Leben, das er mit den Seinen führte, könne nicht von Dauer sein.
2 Das Seil ist lang
Im Morgengrauen kleidete Bernhardt sich an. Das frühe Erwachen lag ihm im Blut, und heute war er noch zeitiger auf den Beinen als gewöhnlich, denn die bevorstehende Ernte machte ihn unruhig. Während er sich das Wams zuknöpfte, warf er einen Blick aus dem Fenster, nach der Richtung hin, wo das Seil lag. Überrascht hielt er inne: Im trüben Licht zeichneten sich am Wald dunkle Gestalten ab, sechs oder sieben Männer mussten es sein, beinahe die Hälfte des Dorfs; was hatten sie so früh dort zu tun?
Als Bernhardt nach draußen trat, wehte ihm ein frischer, beinahe kühler Hauch entgegen, der ihn verwirrte. Am Himmel trieben zähe Wolkenschlieren, auch sie passten nicht recht zum Erntemonat, wirkten wie unzeitige Boten des Herbstes. Es schien ihm, als hätten selbst die Blätter der Bäume über Nacht ihr durchsättigtes Grün verloren, als mische sich ein feiner Gelbton, etwas von Mürbe-Sein und Überreife in das Laub – doch nein, das konnte nicht sein; das Frühlicht veränderte die Farben.
Die Bauern standen mit morgendlich abweisenden Gesichtern um das Seil.
– Grüß euch, rief Bernhardt im Näherkommen. Ich hab’ das Seil gestern Abend schon gesehen. Wisst ihr, wem es gehört?
Niemand gab ihm eine Antwort, alle starrten auf den Boden oder ins Leere, nur einer murmelte etwas, das nicht zu verstehen war und keineswegs freundlich klang. Zum ersten Mal konnte Bernhardt das Seil jetzt deutlich sehen: Es zog sich sieben oder acht Schritt weit über die Wiese zum Waldrand hin, dort verschwand es zwischen den Stämmen im Dickicht. Er beugte sich herab, betrachtete das Seil mit bäuerlichem Kennerblick, ließ die Fingerkuppen drüberhingleiten. Dann schlang er es kurzentschlossen um seine Hand, machte einen Schritt zurück und begann kräftig zu ziehen. Das Seil hob sich aus dem Gras, schwebte in der Luft, zum Wald hin eine schräge Linie bildend, zitterte und schwankte, ohne nachzugeben – es musste im Unterholz festgebunden sein.
Bernhardt warf den anderen einen Blick zu, der munter und aufgeräumt sein sollte.
– Vielleicht wollen uns die Kinder einen Streich spielen?, sagte er. Na, das wäre ihnen wohl gelungen. Acht Männer haben nichts Besseres zu tun, als am frühen Morgen ein Seil anzustarren!
Die Bauern bohrten die Hände in die Taschen und sagten noch immer kein Wort. Bernhardt machte eine ärgerlich abwinkende Geste und ging auf die Bäume zu. Den Kopf gesenkt, drückte er einen Ast beiseite und schob sich zwischen die Stämme. Dunkelheit nahm ihn auf, denn das Licht der Sonne, das sich eben erst mit ungewissem Schimmern in den Kronen umtat, drang noch nicht so tief herab. Das Seil zog sich, soweit er sehen konnte, in gerader Linie in den Wald hinein. Einen Arm nach vorn gestreckt, den anderen schützend vor den Augen, arbeitete er sich Baum um Baum voran, feuchte Zweige streiften ihm übers Gesicht und Sträucher mit Dornen zerrten an seinen Hosenbeinen. Alle paar Schritt blieb er stehen, spähte vor sich ins Dickicht, ob das Seil nicht irgendwo angebunden sei, und ging murmelnd und kopfschüttelnd weiter. Mit jedem Meter wuchs in ihm das Gefühl, sich lächerlich zu machen: Noch nie war er so früh und mit nüchternem Magen in den Wald aufgebrochen. Und schon gar nicht, um einem Seil nachzugehen! Sicher würden die anderen schon über ihn grinsen, denn offenkundig hatte er beschlossen, den Hanswurst des Dorfes zu spielen …
Seine Augen begannen, sich an das spärliche Licht zu gewöhnen, immer klarer sah er auf dem nadelbestreuten Boden das Seil, das in sanften Windungen zwischen den Stämmen hinlief. Wie weit mochte er schon gegangen sein? Fünfzig, sechzig Schritt? Plötzlich fuhr ihm ein Zweig ins Gesicht, ein scharfer Schmerz ließ ihn aufstöhnen, er lehnte sich mit der Schulter gegen einen Stamm, stieß ächzend die Luft aus. Vorsichtig tastete er über seine Wangen: Die Haut unter dem Auge fühlte sich nass an, sie musste aufgeschürft sein. Er legte den Kopf in den Nacken, atmete mit aufgesperrtem Mund, als habe er einen anstrengenden Weg hinter sich, von dem er verschnaufen müsse. Dann stieß er ein pruschendes Lachen aus, das in der Stille des morgendlichen Waldes einen unheimlichen Klang gewann, fast als sei nicht er es, der da lachte, sondern ein anderer – und machte kehrt.
Als er wieder auf die Wiese trat, bot sich ihm das gleiche Bild wie eben, nur dass noch drei weitere Bauern hinzugekommen waren, auch eine junge Frau, die nichts als ihr Nachthemd und ein übergeworfenes Schultertuch trug, als sei sie, um sich das Spektakel nicht entgehen zu lassen, Hals über Kopf aus dem Bett gesprungen; dazu ein barfüßiges Mädchen mit blonden Flechten, das eine Katze im Arm hielt, und ein Greis mit stark qualmender Pfeife im zahnlosen Mund. Alle blickten ihm gespannt und schweigend entgegen.
– Das Seil ist lang! Ihr könnt mir’s glauben! Ich bin ein weites Stück gegangen, aber das Ende hab’ ich nicht gefunden.
Die Bauern hielten den Blick auf den blutigen Strich geheftet, der sich, vom Augenlid abwärts, quer über seine Wange zog. Bernhardt klopfte sich mit der flachen Hand auf die Brust, um die Tautropfen abzuschütteln, die wie ein durchscheinendes Hemd sein Wams bedeckten.
– Mir reicht es, sagte er im Ton sich entwickelnder Wut. Ich hab’ Wichtigeres zu tun, als mich im Wald rumzutreiben! Verdammt noch mal, was soll das Ganze? Das dumme Seil stiehlt mir nur die Zeit – und euch auch!
Mit zügigem Schritt ging er mitten durch die Gruppe davon.
3 Sie beraten sich und haben einen Einfall
In der Mitte des Dorfes stand eine Eiche, über deren Alter die Bauern ebenso ehrfürchtige wie haltlose Mutmaßungen anstellten: Ihr Stamm war so dick, dass vier bis fünf Männer ihn mit ausgestreckten Armen nicht umfassen konnten, und die eckig durcheinander wuchernden Äste bildeten eine Kuppel, die an sonnigen Tagen über zahlreiche Dächer einen Schatten legte. Um den Stamm waren Tische und Bänke für die geselligen Zusammenkünfte aufgestellt, die sich in der schönen Jahreszeit stark häuften: Jeder Bauer, der hier seinen Bierhumpen an die Lippen führte, durfte sich dem bergenden Gefühl überlassen, dass man unter diesem Dach aus Zweigen vor Jahren seine Geburt gefeiert hatte und dereinst auch seinen Tod mit einem traurig-ausgiebigen Schmaus begehen würde.
An diesem Abend hielten die Männer an den Tischen Rat ab, wann die Ernte beginnen sollte. Alle waren beunruhigt wegen der morgendlichen Kühle, die sich zur Unzeit einstellte, es war ja nicht einmal Mitte August, und auch wegen ein paar anderer Zeichen, die darauf deuteten, dass vielleicht schon bald, der Jahreszeit voraus, das Wetter umschlagen könnte. Der Boden auf den Feldern des Dorfes war mager, gab selbst in guten Jahren nicht viel her, und so pflegten die Bauern die Ernte lange hinauszuzögern, manchmal bis in den frühen September hinein. Heute jedoch war keine Rede davon: Alle stimmten überein, dass nicht mehr länger abgewartet werden dürfe; morgen sollten die letzten Vorbereitungen getroffen werden und Tags darauf die Ernte beginnnen.
Kaum war der Entschluss gefasst, geriet die Versammlung zum Gelage. Die Männer rollten ein Bierfass heran, gepökelte Würste, Fladenbrote mit Schmalz, Krüge voll Most wurden über die Tische verteilt, alle entzündeten ihre langhalsigen Pfeifen und redeten über das Seil. Sie hatten es kaum abwarten können, ja manchem wäre es lieb gewesen, von Anfang an nur darüber zu sprechen, aber die Ernte musste dann doch, der guten Ordnung halber, als Erstes abgehandelt werden.
Seit dem Morgen war niemand mehr im Wald gewesen, andere Dinge hatten die Bauern über den Tag hin beschäftigt gehalten. Nur drei kleine Jungen waren auf Bernhardts Spuren losgezogen; doch hatten sie, wenn man ihnen Glauben schenken durfte, bald wieder kehrtgemacht und jedenfalls das Ende des Seils nicht gefunden. Ihre Väter waren über diesen Ausflug in Zorn geraten und hatten sie mit Ohrfeigen und Stockschlägen bestraft, wofür sie einen triftigen Grund besaßen: Seit einiger Zeit schon zog ein Wolfsrudel in der Nähe umher, und den Kleinen war es streng verboten, auch nur einen einzigen Schritt in den Wald zu tun. Noch vor zwei Tagen war am Abend nicht weit entfernt ein Heulen zu hören gewesen: Die Kinder standen lauschend an den Fenstern, blickten mit Augen, die vor Angst gebührend geweitet waren, in die Finsternis und wurden von ihren Müttern, die sich die gute Gelegenheit nicht entgehen ließen, mit schrecklichen Warnungen überzogen. Beinahe noch mehr als die Wölfe waren bei den Dörflern die Wildschweine gefürchtet: Sie konnten in dieser Gegend groß wie junge Kälber werden und gingen in ihrem Ungestüm leicht auf Menschen los. An Geschichten über Jäger, die tot oder übel zugerichtet aus dem Wald getragen wurden, herrschte kein Mangel – und nicht jede davon hatten Mütter erfunden, um in die Seelen ihrer Kinder nützliche Angst einzugraben.
Der Lärm unter den Zweigen nahm einen Grad an, der selbst für die Verhältnisse des Dorfes ungewöhnlich war, niemand wollte darauf verzichten, durch Reden, Schlürfen und Schmatzen seinen Beitrag zum Getöse zu leisten.
– Jemand hat das Seil hingelegt, um uns zum Narren zu halten.
– Jawohl, du sagst es. Und wir alle fallen drauf rein!
– Aber wer war es? Das möcht’ ich gern wissen.
– Vielleicht sitzt er hier am Tisch und lacht sich ins Fäustchen?
(Anhaltendes Gröhlen, Zuprosten mit Bierkrügen)
– Ich sag’ euch: Wir sollten das Seil kappen und unter uns aufteilen. Es scheint ja lang genug zu sein! Da bleibt für jeden ein gutes Stück.
– Aber irgendwem muss es doch gehören – der wird sich bedanken, wenn du’s ihm in Stücke schneidest.
– Na und – selber schuld! Was lässt er sein Seil im Wald rumliegen?
– Genau! Das wird ihm eine Lehre sein.
– Und obendrein muss er uns ein Bier ausgeben.
– Jawohl! Und ich geb’ ihm noch einen Tritt dazu!
Michael, ein Mann mit besonders blonden Haaren, der immer ein unternehmendes Strahlen in den Augen hatte, auch wenn es gerade beim besten Willen nichts zu unternehmen gab, führte das große Wort. Er war bei den Bauern beliebt, sie schätzten seine dauerhaft fröhliche Stimmung und konnten sogar seinen Schwächen etwas abgewinnen: Zum Beispiel liebte er rasche Entschlüsse, die nie besonders klug waren, ihm auch häufig Schwierigkeiten einbrachten, dabei aber seiner Fröhlichkeit nicht schadeten. Nach seinem Gehabe zu urteilen, hätte er gut und gern der Dorfvorsteher sein können – wäre das Dorf nicht so klein gewesen, dass es keinen Vorsteher nötig hatte.
Seine Pfeife schwenkend und mit johlender Stimme erklärte er, dass er morgen früh in den Wald aufbrechen und nicht eher zurückkehren werde, als bis er das Ende des Seils gefunden habe – »und wenn ich zwei Stunden marschieren muss!« – »Ich komme mit!«, brüllte Raimund und schlug mit beiden Fäusten so hart auf die Tischplatte, dass die umstehenden Krüge ins Hüpfen gerieten; und noch ein Dritter schloss sich begeistert lallend an. Die übrigen hoben ihre Pfeifen auf den ausgezeichneten Vorschlag und pufften den Dreien mit lustiger Heftigkeit in die Rippen, auf die Schultern sowie gegen die Oberarme. Es dauerte noch eine Stunde, bis sich die Aufmerksamkeit vollends aufs Trinken verlagerte.