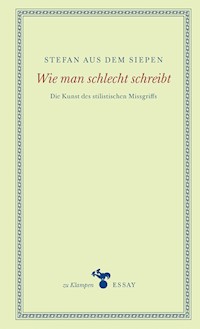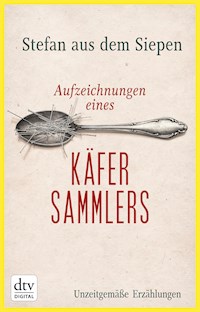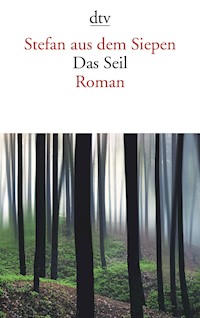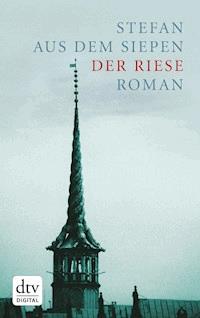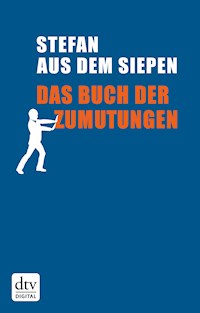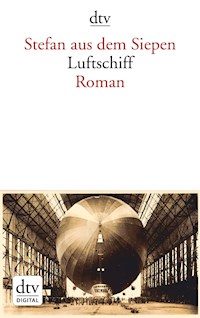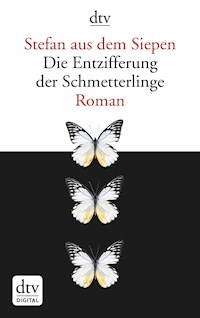
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der sonderbare Lebenszickzack des Herrn Nauten Peter Nauten führt das Leben eines sympathischen Einzelgängers. Schon früh muss er erkennen, dass er es im bürgerlichen Dasein wohl zu nichts Vorzeigbarem bringen wird. Sein Studium der alten Sprachen endet im Debakel; eine Anstellung bei einer Versicherung verliert er nach kurzer Zeit. Er wird Kellner in einem Münchner Szene-Café und wagt sich an die ehrgeizigste Aufgabe seines Lebens: Die Entzifferung der Schmetterlinge. Eine humorvolle und zugleich von melancholischem Ernst getragene Parabel über einen liebenswerten Helden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 195
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Stefan aus dem Siepen
Die Entzifferung der Schmetterlinge
Roman
Deutscher Taschenbuch Verlag
Vom Autor neu durchgesehene, überarbeitete Ausgabe
2013 Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co. KG, München
Lizenzausgabe mit Genehmigung
© Stefan aus dem Siepen
Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist nur mit Zustimmung des Verlags zulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Konvertierung Koch, Neff & Volckmar GmbH,
KN digital – die digitale Verlagsauslieferung, Stuttgart
eBook ISBN 978-3-423-41563-7 (epub)
ISBN der gedruckten Ausgabe 978-3-423-14208-3
Ausführliche Informationen über unsere Autoren und Bücher finden Sie auf unserer Website www.dtv.de/ebooks
Erster Teil
1
Die Entdeckung
Als der kleine Peter Nauten im zweiten Schuljahr von seiner Lehrerin gefragt wurde, was er später einmal werden wolle, gab er mit dem sanften und gesammelten Ernst, der bei seinen Mitschülern immer wieder ein Zucken der Mundwinkel auslöste, zur Antwort, das wisse er nicht, dafür sei er noch viel zu jung, in den nächsten Jahren werde er genügend Zeit haben, darüber nachzudenken; die meisten Kinder in seinem Alter wünschten sich, Feuerwehrmann oder Rennfahrer zu werden, tatsächlich würden sie aber, wenn sie erwachsen seien, doch etwas ganz anderes, daher sage er jetzt lieber nichts, dann könne er auch nichts Falsches sagen.
Die Lehrerin war sich unschlüssig, was sie darauf erwidern sollte, und strich ihm zögernd, mit einem kaum verborgenen Ausdruck von pädagogischer Ratlosigkeit, übers Haar. Die Mitschüler, die allesamt Feuerwehrmänner oder Rennfahrer werden wollten und keinen Zweifel hegten, dass ihre Kinderwünsche die kommenden Jahre unbeschadet überstehen würden, brachen in jaulendes Gelächter aus und verdrehten unter Stöhngeräuschen die Augen. Ein paar von ihnen, die aus Erfahrung wussten, dass Peter sich gegen kleine und größere Misshandlungen niemals zur Wehr setzte, hüpften später auf dem Schulhof um ihn herum und traten ihm gegen die Beine; dies war aber wohl, alles in allem genommen, eine übertrieben harte Bestrafung, und so traten sie auch nicht sehr lange.
Nautens Antwort fand im Lehrerkollegium Verbreitung und gelangte auf Wegen, die er nicht zu ergründen vermochte, bis zu seinen Eltern, die sie in ihren überschaubaren Schatz an Geschichten über den kleinen Peter aufnahmen und in regelmäßigen Abständen dankbar zum Besten gaben. Damals verstand Peter nicht, warum ausgerechnet diese Antwort so verhältnismäßig große Beachtung fand; erst später dämmerte ihm, wie wenig es augenscheinlich über ihn zu sagen geben musste, wenn eine Geschichte, deren Komik sich doch in überschaubaren Grenzen hielt, zur unausweichlichen Standard-Anekdote avancieren konnte, die ihren Reiz selbst durch ständige Wiederholung nicht verlor.
Noch dreißig Jahre später, in seiner Zeit als Kellner im »Café Wirtschaftswunder«, als er dem gut aussehenden und wohlsituierten Teil der Münchener Jugend Pina Colada und Tortellini servierte und durch sein Äußeres, das von allen als lustig und skurril empfunden wurde, einen wichtigen Beitrag zum Flair des Cafés leistete, konnte ihm die Geschichte plötzlich wieder einfallen, obwohl es inzwischen niemanden mehr gab, der sie ihm unter gutmütigem Lächeln und Schulterklopfen erzählte. Jetzt wusste er, dass es damals wohl keinen Schüler in seiner Klasse gegeben hatte, dessen Lebensweg so wenig vorhersehbar gewesen war wie der seine. Erst Student der Alten Sprachen, dann Sachbearbeiter bei einer Versicherung, dann Kellner in einem Szene-Café, dann Entzifferer einer Schrift, die noch niemals vor ihm ein Mensch zu entziffern versucht hatte – nein, man konnte schwerlich bestreiten, dass dies vom Gewöhnlichen abwich. Student, Sachbearbeiter, Kellner, Entzifferer – was für ein sonderbarer und trostloser Lebenszickzack. Einen solch mäandrierenden Pfad durchs Dasein vorauszusagen, der von Zufällen hierhin und dorthin gelenkt wurde, in dem niemals B auf A folgte, ging zweifellos über das Vermögen eines Schülers der zweiten Klasse hinaus, und es gehörte auch keineswegs zu dem, was man sich in diesem Alter üblicherweise wünschte. Hätte er es sich dennoch gewünscht, wäre er mit vollem Recht zum Gegenstand brüllenden Gelächters geworden und hätte auf dem Schulhof nicht nur ein paar wenige Tritte bezogen.
2
Nauten fällt auf,
wird aber nicht beachtet
Was immer der kleine Peter tat, tat er bedächtig und verhalten. Wenn es in der Schule zur großen Pause klingelte, seine Kameraden von den Stühlen sprangen und schreiend auf den Hof hinausliefen, blieb er noch eine Weile sitzen und lauschte mit versonnenem Ausdruck auf die Stille, die Einzug ins Klassenzimmer hielt. Dann ging er allein und geruhsam über die Flure, in jenem Zustand von träumerischer Halbaufmerksamkeit, über den er kaum je einmal hinausgelangte, blieb von Zeit zu Zeit stehen, um sich dies und jenes anzusehen, das an seinem Wege lag, oder um in seinen Hosentaschen nach etwas zu suchen, das sich nicht finden ließ. Draußen angekommen, zog er langsam auf dem Schulhof seine Runden, hatte dabei den gemessenen Gang eines Lehrers, der die Aufsicht führt, und hing seinen Gedanken und Halbgedanken nach. Wenn er mit seinen Kameraden spielte, was hin und wieder geschah, schien er nicht wirklich bei der Sache zu sein, wahrte noch inmitten des ärgsten Getümmels, wenn um ihn her vor lauter Schreien und Lachen und Rennen kein Halten war, einen bemerkbaren Zug von Zerstreutheit: In seinen Augen lag ein Abglanz, der nicht zu dem passte, was er gerade tat – doch wozu hätte er gepasst?
Dass er meist allein blieb, ergab sich auf zwanglose Weise. Zwar war es nicht leicht möglich, etwas gegen ihn zu haben; doch taten sich die meisten noch schwerer, etwas an ihm zu entdecken, das sie anzog. Seinerseits unternahm er nicht den Versuch, um die anderen zu werben, nicht einmal um die sehr wenigen, die ihn allenfalls gereizt hätten; denn auf seine Kameraden zuzugehen, sich ihnen von einer Seite zu zeigen, die Aussichten besaß, Anklang zu finden, gehörte zu dem, was er beim besten Willen nicht über sich brachte. Nicht, dass er sein Anderssein herausgekehrt hätte – im Gegenteil bemühte er sich, einen halbwegs normalen und gesellschaftsfähigen Eindruck zu erwecken, nichts zu tun, was denjenigen unter seinen Kameraden, die ihn für »doof« und »komisch« hielten – und das waren so gut wie alle –, den Beweis in die Hände geliefert hätte, dass sie Recht besaßen. Doch seinen Bemühungen war kein Erfolg beschieden: Er brauchte sich nicht merkwürdig zu benehmen, um merkwürdig zu wirken. Dass er nicht wie alle war, teilte sich noch den unbedeutendsten seiner Lebensäußerungen mit; auch wer ihn nicht kannte, brauchte nur einen kurzen Blick auf ihn zu werfen und war bereits im Bilde.
Vielleicht hätte er sich mehr um die anderen bemüht, wenn er darunter gelitten hätte, ein Leben am Rande und im Außerhalb zu führen – doch davon konnte keine Rede sein. Er träumte nicht den Traum, seinen Kameraden, die nur dann glücklich waren, wenn sie sich in einer gut gelaunten Herde bewegten, gleich zu sein. Es fiel ihm nicht ein, sie um ihre Existenz zu beneiden, denn Neid (das war so einer der Gedanken, denen er nachhängen konnte, während er über den Schulhof ging und die Aufsicht führte) konnte man doch nicht für etwas empfinden, von dem man wusste, dass es einem für immer unerreichbar bleiben würde.
Er kannte nichts Schöneres als dies Dasein, das sich in der überschaubaren Abgeschiedenheit seines Innern vollzog, und war einer gelassenen und eigensinnigen Lebensfreude fähig. Allerdings besaß die Freude, die er empfand, nur wenig Ähnlichkeit mit dem, was landläufig unter »Freude« verstanden wurde. Zeit seines Lebens tat er sich schwer, das schillernde Wort »Glück« mit sich in Verbindung zu bringen, witterte darin eine sprachliche Ungenauigkeit, die ihm missfiel, und war doch nicht imstande, für das, was sich in ihm abspielte, ein treffenderes Wort zu finden.
In sprachlichen Dingen nahm Nauten es auch sonst genau. Als Kleinkind sprach er lange überhaupt nicht, bis an die Grenze des Seltsamen und Besorgniserregenden; dann begann er auf Anhieb ganze Sätze zu bilden, die grammatikalisch ohne Fehler waren und erste Spuren von Verschachtelung und Überlänge zeigten. Wer ihn hörte, konnte spüren, dass ihm das Sprechen nichts Einfaches und Selbstverständliches, keine fraglos zum Leben gehörende Betätigung wie Milch-Trinken und Im-Sand-Spielen war: Immer brachte er seine Sätze schleppend, um Richtigkeit bemüht, mit angespannter Konzentration hervor. Selbst einfache Formulierungen schien er an entlegenen Stellen seines Innern suchen und unter Anstrengungen an die Oberfläche ziehen zu müssen. Hatte er lange genug gesucht und gezogen, war die Gelegenheit, etwas zu sagen, oft schon wieder verstrichen – was ihm nicht ungelegen kam, denn in seiner Schüchternheit war er überzeugt, dass die anderen über seine Worte doch bloß den Kopf geschüttelt, sie des angestrengten Suchens und Ziehens nicht für wert gehalten hätten.
Vorübergehend gaben ihm seine Klassenkameraden den Spitznamen »Opa«. Der Name wurde allgemein als gelungen empfunden, denn er schien alle seine Eigenheiten auf einen bündigen und abfälligen Begriff zu bringen. Nicht einmal Nauten hatte viel gegen ihn einzuwenden, vor allem wenn er sich vor Augen hielt, wie bescheiden ansonsten das Humorniveau derer war, die ihn sich ausgedacht hatten. In einer Schulpause schrieb jemand an die Tafel: »Bitte keinen Lärm machen – Opa braucht Ruhe!«, was Lacher fand.
Trotzdem hielt der Name sich nicht, blieb eine dürftige Episode von kaum einer Woche. Jemanden zu ärgern, der so blass und langweilig wie Nauten war, besaß letztlich keinen Reiz, und so ließ man sich den Namen »Opa«, dies handliche Mittel, ihm regelmäßig einen sprachlichen Nackenschlag zu versetzen, achtlos entgehen. Nauten erkannte diesen Zusammenhang und war traurig darüber. Andere Schüler bekamen Namen angeheftet, die eindeutig dümmer und fader als »Opa« waren und doch über Jahre hin mit sturer Ausdauer benutzt wurden! Einen Spitznamen so rasch wieder zu verlieren, war demütigender, als nie einen besessen zu haben.
3
Das unergründliche Haus
Der Arzt für Nervenkrankheiten Doktor Nauten wohnte mit Frau und Kind in einem alten Haus am Marburger Stadtrand. Über die Mauer des rückwärtigen Gartens fiel der Blick auf ein Wäldchen, in dem Eulen und Käuzchen lebten, deren Schreie Peter am Abend in seinem Bett hörte; weiter entfernt floss, malerisch anzusehen, die Lahn in sanften Windungen zwischen Feldern hin. Als Vater Nauten das Anwesen nach dem Krieg kaufte, befand es sich in trübe verwahrlostem Zustand: Zwei Fliegerbomben, die in den Garten gefallen waren, hatten Bäume geknickt und vom hinteren Teil des Hauses die Dachziegel gefegt. Der Vater ließ, aus Mangel an Geld und weil er ein wenig unternehmender Mann war, nur ein paar Räume des Vorderhauses wiederherrichten, in denen er wohnte und seine Praxis unterhielt; alles Übrige musste auf bessere Zeiten warten: So wurden die Bombenkrater zu Tümpeln voller Pflanzen und Tiere, die zerspellten Bäume lagen im Gras wie gestern erst niedergestreckt, und aus dem verwüsteten Dach ragten Balken wie die Rippen eines Skeletts.
Peters Eltern hatten die bewohnten Zimmer mit einem allerersten Chic der Nachkriegszeit eingerichtet, für den das Geld dann doch gereicht hatte. Die Mutter gab sich Mühe, alle Räume in einem Zustand systematischer Sauberkeit zu erhalten, machte sie zu überwachten Zonen, in denen Peter sich artig und korrekt bewegen wusste, wo jedes versuchte Laufen und Tollen zu Rügen führte. Zum Ausgleich bot der leere Teil des Hauses viele Zimmer, in denen an Sauberkeit nicht zu denken war; die Mutter hütete sich, sie auch nur zu betreten, und Peter durfte in ihnen nach Herzenslust tun, was Schmutz und Durcheinander schuf.
Das Hinterhaus war groß, bestand aus einem Hauptund zwei Nebenflügeln und hatte im Laufe der Zeit Umbauten nach wechselnden und rätselhaften Plänen erfahren. Selbst einem Erwachsenen mochte es nicht leichtfallen, sich in dieser architektonischen Wirrnis zurechtzufinden – für Nauten war es eine unüberschaubare Welt aus lauter Zimmern und Treppen und Gängen und Türen, die sich selbst in tagelangen Expeditionen niemals würde erkunden lassen. Der Dachboden, zu dem eine ächzende Wendeltreppe emporführte, dehnte sich zu einem Labyrinth voller Verzweigungen und Unerforschlichkeiten, in dem auf Schritt und Tritt das Verirren lauerte. Der Keller war ein Gewirr aus staubigen und lichtlosen, von gefährlichen Spinnweben überwucherten Stollen, die sich wie der unterirdische Bau eines Tiers in alle Richtungen bohrten, bis hinaus unter die Wurzeln der Bäume und in die Gründe der Tümpel.
In einem ehemaligen Salon stand ein Klavier, mit Staub und Putzbröckchen dick überrieselt, das frühere Bewohner in den Wirren des Krieges zurückgelassen hatten: Wenn Nauten auf seinen Streifzügen hier vorüberkam, öffnete er den Tastendeckel und schlug ein paar Töne an, die so scheppernd und jenseits von verstimmt klangen, dass sie mit Tönen nichts mehr zu tun hatten. In manchen Kisten des Dachbodens waren böse Männer eingesperrt, die ihn in heiße Angst versetzten, obwohl sie, wie er in nüchternen Augenblicken durchaus einsah, seit Langem verschmachtet sein mussten. Auch der Garten gehörte zu seinem Kinderreich: Abend für Abend besuchte er die darniederliegenden Bäume, um Zwiesprache mit ihnen zu halten und auf die Wunden, die in ihrer Rinde klafften, eine Salbe aus Regenwasser und zerstampften Kräutern zu streichen.
Zur Stadtseite hin wurde der Garten durch einen morschen, von Feuerdorn überwachsenen Staketzaun beschlossen. Jenseits davon spielte sich das gewöhnliche und geheimnislose Leben ab: Menschen waren dort zu sehen, die in Autos fuhren, aus Haustüren traten, über Bürgersteige gingen. Nauten hielt es für ausgeschlossen, dass die Welt jenseits und diesseits des Feuerdorns dieselbe war, dass die Gestalten dort drüben die gleiche Luft atmeten und von derselben Sonne beschienen wurden wie er. Wäre einer von ihnen auf den Gedanken gekommen, den Zaun zu übersteigen und in sein Reich einzudringen, wäre er im dornigen Gezweige stecken geblieben und eines sicheren Todes gestorben.
In Haus und Garten fand Nauten alles, was für sein kleines Leben nötig war. Hier konnte sein Glück, das nichts Landläufiges besaß, auf Stunden so groß und bezwingend werden, dass selbst er beinahe bereit war, es für ein »Glück« zu halten. So blieb es immer: Alles Verwinkelte und Labyrinthische zog ihn an, es ähnelte dem unergründlichen Haus und musste mit ihm und seiner Welt zu tun haben. Alles Übrige, wie die Schule, war nur aufgenötigt, ein Übel, das die Eltern für notwendig erklärten; er ging dorthin, weil er musste, doch kehrte er, sobald sich die Gelegenheit zur Flucht ergab, ins Eigene und Eigentliche zurück.
Als Peter zehn war, verkaufte Doktor Nauten das Haus und bezog mit seiner Familie eine geheimnislose Wohnung im Herzen der Innenstadt. Das neue Heim war komfortabel bis zur Trostlosigkeit und in seiner wirtschaftswunderlichen Adrettheit nicht mehr zu steigern; die wenigen Zimmer lagen diesseits jedes Traums und ließen sich binnen Minuten ohne Rest erforschen. Dass ein Garten fehlte, konnte gar nicht anders sein: Die Mutter hielt sich Topfpflanzen auf dem Fensterbrett, leicht zu pflegende und nicht zu viele, die sie pünktlich begoss und mit denen Zwiesprache unmöglich war.
4
Auf der Lahn
Doktor Nauten war ein Pflichtmensch. Vom frühen Morgen an arbeitete er in seiner Praxis und gönnte sich über den Tag hin kaum eine Pause; selbst während der Mittagszeit blieb er am Schreibtisch des Konsultationszimmers sitzen, verzehrte einige Stullen, die seine Frau ihm mitgegeben hatte, und arbeitete mit kaum reduziertem Fleiß weiter. Lange nachdem am Abend der letzte Patient gegangen war, machte er die wenigen Schritte in die Wohnräume hinüber und setzte sich mit den Seinen zu Tisch. Freilich war das Essen recht bald schon beendet – er liebte es nicht, sich lange damit aufzuhalten, denn nachher kehrte er noch einmal in die Praxis zurück, um dies und jenes abzuarbeiten. Später konnte man ihn mit Pantoffeln und bequemer Hausjacke auf dem Sofa im Wohnzimmer sitzen sehen, wo er bei einem wohlgekühlten Glas Bier den Tag ausklingen ließ und noch ein Stündchen in Fachzeitschriften und Krankendossiers las.
Warum Doktor Nauten so viel arbeitete, war nicht leicht zu begreifen, denn seine Praxis ging schlecht. Schon dem kleinen Peter blieb nicht verborgen, dass in die weiß getünchten Räume des Vorderhauses nur wenige Patienten kamen. Es mochte damit zusammenhängen, dass die Praxis am äußersten Stadtrand in einem Haus mit durchlöchertem Dach und verwildertem Garten lag – doch auch später, als der Vater, aus ebendiesem Grund, in die Innenstadt umgezogen war, besserte sich nichts, im Gegenteil: Die meisten der wenigen Patienten, die er bisher immerhin besessen hatte, folgten ihm nicht nach, und andere zu finden, erwies sich als eine Aufgabe, der er nicht gewachsen war. Bis zu seinem frühen Tod gelang es ihm nicht, die neue Praxis zu etablieren; ja eine Zeit lang erwog er sogar, wieder an den Stadtrand zurückzukehren, konnte sich jedoch nicht dazu durchringen, wahrscheinlich weil er vorausahnte, dass ein solcher Schritt sinnlos gewesen wäre – so sinnlos wie der Umzug in die Innenstadt und jeder andere Schritt, den er sonst hätte tun können.
Doktor Nauten liebte seinen Sohn. Er nahm aufmerksam und mit Zärtlichkeit an seinem Leben Anteil, strengte sich an, ihm nie ein scharfes oder ungerechtes Wort zu sagen, gab ihm liebevolle und wechselnde Kosenamen wie »mein Petermännchen«. Er hätte ein guter Vater sein können, wäre nur nicht die viele Arbeit in der leeren Praxis gewesen, die seine Tage unerbittlich auffraß. Sobald er sich für eine Viertelstunde freimachen konnte, besuchte er Petermännchen im unergründlichen Haus – doch um die freien Viertelstunden eines ganzen Monats zu zählen, reichten die Finger einer Hand. Abends beim gemeinsamen Essen erzählte er dem Sohn Märchen, oder er stellte ihm anspruchsvolle und im Vorhinein zurechtgelegte Fragen, um ein Gespräch in Gang zu bringen, das über die kleinen Familiendinge hinausführte – dies jedoch nur, wenn er nicht zu müde war, und meist war er zu müde.
Hin und wieder fuhr Doktor Nauten mit seinem Sohn Kajak auf der Lahn. An warmen Sommerabenden, wenn die Dämmerung schon eingesetzt hatte, radelten sie durch die stiller werdenden Straßen der Vorstadt zu einem Wassersportclub, liehen sich zwei Boote und paddelten hinaus ins Freie. Eine Weile glitten sie nebeneinander her, ließen die Häuser und Lichter Marburgs hinter sich zurück, drangen ins immer Ländlichere vor; dabei genossen sie die Stille auf dem Wasser, gaben sich der zugleich müßigen und beschäftigten Zweisamkeit des Paddelns hin, die von niemandem gestört werden konnte, und tauschten schweigende Blicke aus. Dann geschah das immer Gleiche, das Peter vom ersten Augenblick an mit heimlicher Bedrücktheit vorausgesehen hatte: Doktor Nauten winkte ihm zu, sagte mit einem Lächeln, das linkisch war und um Verzeihung bat: »Bis später, Petermännchen. Wir treffen uns am Bootshaus, einverstanden?«, und zog mit schnelleren Schlägen davon. Peter legte sein Paddel über die Knie und blickte ihm nach; im sinkenden Licht wurden die Umrisse des Vaters rasch grauer und verschwammen zu nichts. Es war ihm zumute, als habe die Finsternis lediglich darauf gewartet, dass der Vater sich endlich von seinem Sohn trennen werde, um ihn mit ungeduldiger Eifersucht einzusaugen …
Peter ließ sich von der gemächlichen Strömung treiben. Kühle Schwaden zogen über das Wasser, hüllten im Vorbeistreichen seinen Körper ein und jagten ihm Schauer über die Haut. Leise pfiff er eine unzusammenhängende Melodie, um sich Mut zu machen, was nötig war. Manchmal tauchten im Dämmerlicht Ruderboote auf – Vierer oder Achter, in denen junge Männer mit halb nackten Oberkörpern im kraftvollen Gleichtakt ihrer Bewegungen, ein kleines unheimliches Rauschen erzeugend, durch das Dunkel zogen. Peter sah mit großer Aufmerksamkeit zu ihnen hinüber und musste zugleich lächeln; er wusste, dass er nicht der Rechte war, und sein Vater auch nicht, sich ein Boot mit anderen zu teilen. Jetzt in Reih’ und Glied in einem dieser Gefährte zu sitzen, sich gemeinsam dem einlullenden Rhythmus des Ruderns zu überlassen, selbst noch hier draußen auf dem Fluss eine Herde zu bilden: Was hätte ihm fremder sein können. Und doch, wenn er schon ein Boot für sich allein hatte, und der Vater auch, warum konnten sie dann nicht wenigstens zusammenbleiben, Seite an Seite durch die schöne Dämmerung gleiten?
Nach einer Weile machte er kehrt und paddelte zur Stadt zurück. Die schwärzlich-graue Breite des Flusses bereitete ihm Furcht; so hielt er sich nahe am Ufer und pfiff noch lauter und mutwilliger. Als er am Bootshaus ankam, zog er das Kajak aus dem Wasser, holte sich eine wärmende Decke, die er um seine Beine wickelte, und setzte sich zum Warten auf die Böschung. Seine Augen starrten in die immer tiefere Finsternis hinaus, suchten sie vergeblich nach dem Boot des Vaters ab. Die Lahn floss dicht unter seinen Füßen vorüber, in der Stille des Abends war ihr gelassenes, mit sich selbst beschäftigtes Rauschen überklar zu hören. Der Vater kam nicht zurück. Obwohl Peter daran gewöhnt war, lange auf ihn warten zu müssen, wurde ihm doch beklommen zumute. Er malte sich aus, wie es wäre, wenn die Dunkelheit den Vater nie wieder preisgäbe: Was sollte dann aus ihm werden? Die Mutter konnte kein Geld verdienen, das war gewiss, so würde ihnen nichts übrig bleiben, als ein Leben in Not zu führen, mit zerlöcherten Kleidern am Straßenrand zu sitzen, die Passanten um Geld anzubetteln …
Da begann sein Herz zu klopfen: Gespenstisch unklar zeichnete sich in der Mitte des Flusses der Schatten des Vaters ab. Schon von Weitem winkte er mit einer kräftig ausholenden Armbewegung zu Peter herüber, als sei er sich seiner Verspätung bewusst und wolle dem Sohn, der voller Angst auf ihn wartete, so früh wie möglich ein beruhigendes Zeichen geben. Dabei schien er allerdings recht langsam zu paddeln, auf der finsteren Fläche kaum voranzukommen – so eilig konnte er es also nicht haben. Oder hielt die Dunkelheit ihn fest, lähmte die Bewegungen seiner Arme, mochte ihn dem wartenden Petermännchen, dreist und eifersüchtig wie sie war, selbst jetzt nicht zurückgeben? Noch lange blieb das Gesicht des Vaters nur ein verschwommener Fleck in der Nacht, der mehr zu ahnen als zu sehen war, doch Peter wusste bereits, dass sich ein Lächeln darauf malte, das linkisch um Verzeihung bat.
Ab und an, mit pädagogischer Zurückhaltung, drückte Doktor Nauten seinem Sohn ein Buch in die Hand. In seinem eigenen Leben war für Lektüre kein Platz, oder nur für die von Krankenakten; umso größeren Wert legte er darauf, seinen Sohn in die Welt der Literatur einzuführen. Mehr als einmal riet er Peter, er solle die Kinderzeit ausnutzen, um so viel wie möglich zu lesen, denn später werde er – das sage er ihm aus Erfahrung voraus – kaum noch dazu kommen. Er empfand Erleichterung, dass zwar nicht in seinem eigenen, aber doch im Leben des Sohnes Raum für Bücher war, und grämte sich schon im Vorhinein, dass auch Peter früher oder später, dem unausweichlichen Gang der Dinge folgend, eine lektürelose Existenz werde führen müssen.
Der Vater hatte eine glückliche Hand, konnte seinem Sohn erste schöne Lesepfade zeigen. Bald machte Petermännchen sich selbstständig, begann über die Bücher, die ihm zugesteckt wurden, die Brauen zu runzeln, bog hierhin und dorthin ab und fand zu noch Besserem. Am Ufer der gärenden Tümpel und in den Zweigen der geknickten Bäume waren seine Leseplätze; auch nutzte er oft die Pausen in der Schule aus, um mit einem Buch in der Hand über den Hof zu schlendern; dies hielt er für eine so sinnvolle Art, seine Zeit zu verbringen, dass er ausnahmsweise gegen die Regel verstieß, nichts zu tun, was einen allzu seltsamen Eindruck auf seine Kameraden machen konnte.
Bald entwickelte er eine Technik, die ihm sehr naheliegend schien und der er zeitlebens treu blieb: Er kaufte sich Taschenbücher, schnitt ihnen mit einer kräftigen Küchenschere den Rücken ab und steckte die losen Blätter in die Taschen; so trug er von morgens bis abends einen Leseproviant bei sich, konnte jederzeit, auch in schwierigen und unvermuteten Lagen, mit einer kurzen Bewegung eine Buchseite hervorziehen und dem Tag einige Minuten des Lesens ablisten.
5
Die Mutter