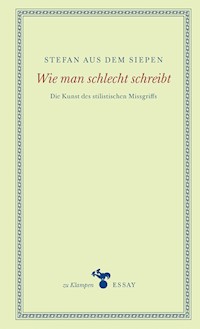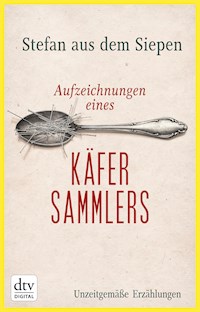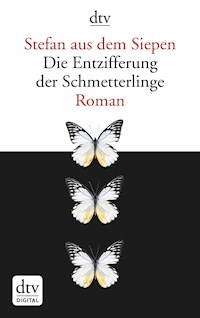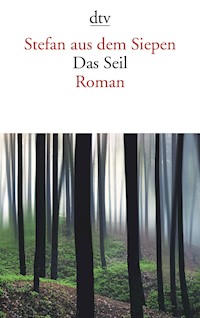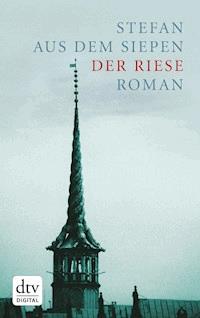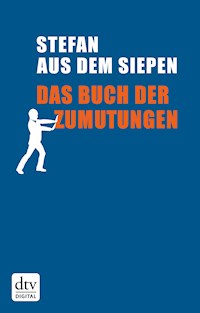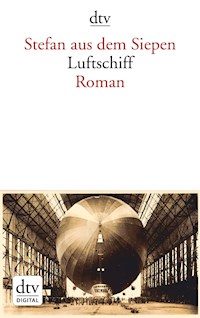
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Unser Leben - eine Irrfahrt Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts macht Oberregierungsrat Neise in dem luxurösen Luftschiff ›Berlin‹ eine Reise quer über den Atlantik nach Amerika. Bald zeigt sich, dass nichts an Bord mit rechten Dingen zugeht: Die ›Berlin‹ fliegt auf rätselhaften Routen durch Nebel und über Meer, Dimensionen wie Zeit und Raum beginnen sich aufzulösen… Stefan aus dem Siepen erzählt wirklichkeitsgetreu von einer zwar unmöglichen, aber faszinierenden Irrfahrt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 171
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Über das Buch
Für Oberregierungsrat Neise geht ein Traum in Erfüllung. In dem Luftschiff Berlin, das luxuriös wie ein Grandhotel und schnell wie ein Expresszug ist, macht er eine Reise quer über den Atlantik nach Amerika. Es sind die späten 20er Jahre, die Welt ist in Bewegung, und der Beamte Neise will der Routine seines Schreibtischs entfliehen. Zuerst verläuft der Flug normal – oder fast: Neise genießt den verschwenderischen Komfort des Bordlebens, knüpft interessante und bizarre Bekanntschaften, erlebt den berauschenden Anblick des nächtlichen Paris, lauscht den seicht-schönen Klängen des Salonorchesters Salut d’Amour.
Plötzlich weicht das Luftschiff von seinem Kurs ab und begibt sich auf eine Irrfahrt. Allmählich begreift Neise, dass tausend Meter über dem Meer und in einem hochentzündlichen Luftschiff alles anders ist. Dimensionen wie Raum und Zeit lösen sich auf, in die Salons und Kabinen beginnt das Chaos einzusickern. Nur noch kurze Zeit gelingt es der bürgerlich-wohlsituierten Gesellschaft, ihr angenehmes Leben an Bord fortzusetzen.
Ein von kluger Ironie getragener Roman, der in eine Welt voller Absurdität und Komik entführt.
Stefan aus dem Siepen
Luftschiff
Roman
1
Nebelschwaden trieben über das Rollfeld, strichen um die silbergrauen Hangars, rissen die gelben Lichterreihen der Landebahn in Stücke. Auf dem Tempelhofer Flughafen wurde die Berlin zum Aufstieg bereit gemacht, die im regelmäßigen Transatlantikdienst Europa mit Amerika verband und hier wie dort so berühmt war, so viel verwirrte, zwischen Superlativen umhertappende Bewunderung auslöste wie vor ihr nur die Titanic. Ihr Rumpf besaß Ausmaße, die selbst gut vorbereitete Passagiere benommen machten: Die Lettern des Schriftzuges »Berlin« waren hoch wie Häuser und doch in der weiten Fläche leicht zu übersehen. Sechs lange Taue, an denen Trauben von Männern aus Leibeskräften zogen, lebendiger Ballast, hielten das Schiff am Boden. Ein Traktor paffte schwarzbraune Dieselwolken in den Nebel und zog auf einer Kette aus Anhängern Koffer und Postsäcke heran. Die meisten Passagiere waren bereits an Bord und richteten sich in den Kabinen ein, nur einige Nachzügler gingen noch über das pfützenbedeckte Flugfeld; die Frauen wurden von Stewards begleitet, die Schirme über sie hielten, was eine bloß symbolische Geste war, denn der Regen schwebte mehr, als dass er fiel, und war nicht abzuhalten.
Neise sah aufmerksam vor sich auf den Boden, um mit seinen wohlgeputzten Schuhen nicht in Pfützen zu treten, wodurch er sich um den Anblick der Berlin brachte. Im Vorübergehen fing er Fetzen seines Spiegelbildes auf, das sepiabraun eingefärbt war wie eine Fotografie; unwillkürlich prüfte er, ob sein Schal korrekt gebunden war, weder zu straff noch zu locker im Mantelausschnitt saß, und ob er auch keine lächerliche Figur abgebe, wenn er breitbeinig, mit unregelmäßigem Schritt um die Pfützen herumging. Wie selbstverliebt muss man sein, dachte er, um selbst noch beim Weg über ein Rollfeld, kurz bevor man die Treppe zu einem Zeppelin hinaufsteigt, das eigene Spiegelbild zu betrachten – und hielt nach der nächsten Pfütze Ausschau.
Er hatte Reisefieber. In seinem bisherigen Leben war er noch wenig herumgekommen, sein Koffer trug, obwohl er ihn schon zwanzig Jahre besaß, lediglich die Aufkleber von Berchtesgaden und Venedig. Abhilfe stand bevor: Für drei Ferienwochen würde er in jenes elektrisierende Land reisen, von dem er schon so viel gelesen und in Wochenschauen gesehen hatte und das ihm doch noch immer so ungeheuer schien, als liege es nicht jenseits des Atlantiks, sondern auf einem der ferneren Planeten des Sonnensystems. Dass es möglich sein sollte, Amerika in drei Tagen zu erreichen und einen halbwegs irdischen Urlaub dort zu verbringen, konnte er nicht glauben. Auch dass er im schönsten und modernsten Zeppelin der Zeit fliegen würde, besaß einen phantastischen, ins Unwirkliche spielenden Zug. Wenn die Berlin über Deutschland schwebte, gab es am Boden niemanden mehr, der nicht den Kopf in den Nacken legte, den Mund zu einem Oval formte und auf dümmliche Art ergriffen aussah. Obwohl die frühen Jahre vorüber waren, in denen Zeppeline den Reiz des Neuartigen besaßen, seriöse Männer mit Hurra!-Rufen Hüte über sich warfen, Automobile in rhythmisches Hupen, Straßenbahnen in anhaltendes Klingeln ausbrachen, war die Berlin doch noch immer eine vollwertige Sensation. In ihr das spektakulärste Fortbewegungsmittel aller Zeiten zu sehen, gehörte zu den Meinungen, die niemand bestritt. Neise lehnte es sogar ab, ein Luftschiff als »Fortbewegungsmittel« zu bezeichnen – wer dieses Wort benutzte, besaß entweder kein Sprachgefühl oder wollte die Berlin herabwürdigen. Dass Luftschiffe nichts weiter tun sollten, als »sich fortzubewegen«, ihre Passagiere auf geheimnislose Weise von einem Ort zum nächsten zu befördern wie eine Straßenbahn Linie 17 – wer glaubte das?
Am Fuß der Treppe, die vom Rollfeld ins Schiff hinaufführte, stand ein kleiner Mann. Er war für die Begrüßung und Einweisung der Ankommenden zuständig und trug, was er für diese Aufgabe benötigte: eine würdige Stewarduniform in Dunkelblau mit nicht zu wenig Gold. Schon lange blickte er Neise unter dem Mützenschirm diskret, mit professionell getarnter Aufmerksamkeit entgegen, wartete nur noch ein paar Sekunden ab, bis er nahe genug heran war, eine unsichtbar über den Boden gezogene Linie überschritt, dann würde er die Mütze lüpfen und seinen zurückgestauten Eifer loslassen.
– Guten Tag, der Herr! Ich darf Sie im Namen des Kapitäns herzlich willkommen heißen! Wie ist Ihr werter Name?
– Neise.
– Ah! Herr Oberregierungsrat. Nochmals herzlich willkommen. Wir haben für Sie die Kabine 23 reserviert. Wenn Sie erlauben, werde ich Sie hinführen. Darf ich vorangehen? Vielen Dank, Herr Oberregierungsrat.
Vergebens versuchte Neise, ein Lächeln zu unterdrücken, denn es gab am Steward wenig, das er nicht komisch und rührend fand. Seine Art zu sprechen war die erste Anekdote dieser Reise: Er verkörperte die Rolle des unbelehrbar Altmodischen, der den Ehrgeiz besitzt, traditionelle Formen der Höflichkeit in Zeiten, die immer roher werden, vor dem Aussterben zu bewahren. Immerhin leistete er sich, das dann doch, eine kleine Aufschneiderei: Als er Neises Titel und die Nummer seiner Kabine nannte, war er bemerkbar stolz auf sein gutes Gedächtnis; in seiner Stimme lag ein Ton, den Neise aus Schulzeiten kannte – so klang ein Streber, wenn er den Arm nach oben riss, mit den Fingern schnippte und Oberregierungsrat! ins Klassenzimmer rief.
Ein langer Gang bohrte sich in den Bauch des Schiffes. Obwohl es draußen dämmerte, meinte Neise vom Hellen ins Dunkle, vom Mittag in den Abend zu kommen; wäre der Strom ausgefallen und eine Notbeleuchtung eingeschaltet gewesen, es hätte nicht trüber sein können. Der Steward legte, wohl um seinen Eifer zu unterstreichen, einen zügigen Schritt vor. An den Gangwänden hingen Stiche aus der Geschichte der Luftfahrt, von bonbonbunten Montgolfieren über die hochzerbrechlichen Apparate Lilienthals bis zu den Zeppelinen der jüngsten Fortschrittsstufe. Neise sah Luftschiffe über die Hochhäuser von New York, durch Alpentäler mit Wiesen und ragenden Bergzacken, vorbei an den Türmen von Schloss Neuschwanstein und über die Pyramiden von Gizeh fliegen. Dass Luftschiffe schon so weit herumgekommen waren, überraschte ihn, und er war sich nicht sicher, ob er es für bare Münze nehmen sollte. Der Anstrich des Märchenhaften, ohne geschmackliche und sonstige Bedenken Ausgedachten ließ sich nicht übersehen – wer imstande war, so etwas zu glauben, der glaubte auch, dass die Berlin nach Amerika flog!
Der Steward wandte den Kopf über die Schulter zurück und machte dienstlich Konversation:
– Die Berlin verfügt über dreißig Kabinen. Fünfundsechzig Passagiere finden in ihnen Platz. Das Schiff ist ausgebucht bis auf das letzte Bett. Bei dieser Reise war der Andrang so groß, dass eine Warteliste geführt werden musste …
Er legte die Stirn oder das wenige, was unter der Mütze von ihr zu sehen war, in Falten: Dass nicht alle, die es wollten, mitreisen konnten, betrübte ihn. Er hielt es für einen Verstoß gegen die Höflichkeitsregeln, dass manche in schnöder Weise auf eine Warteliste gesetzt, ja am Ende sogar abgewiesen werden mussten. Wenn Neise zu denen gehört hätte, für die keine Kabine mehr frei war: Er hätte ihn nicht betrübter ansehen können.
Der Gang wurde heller und breiter; Türen erschienen.
– Hier vorne links liegt der Speisesaal. Das Frühstück wird ab acht serviert, das Mittagessen beginnt um eins, das Abendessen um sieben. Dort, hinter den Flügeltüren, befindet sich der Rote Salon. Er dient als Aufenthalts- und Gesellschaftsraum – vom Nachmittag an sorgt ein Bordorchester für musikalische Unterhaltung, und vierundzwanzig Stunden lang erwartet Sie eine wohlsortierte Bar. Hier, linker Hand, sehen Sie das Lesezimmer. Es bietet eine umfangreiche Bibliothek sowie eine große Auswahl deutscher und internationaler Zeitungen. Und dort rechts – das Rauchkabinett. Es wird durch eine speziell konstruierte Schleusentür betreten. Aus Gründen der Sicherheit ist das Rauchen lediglich in diesem einen Salon gestattet – ich bitte um Ihr Verständnis.
Sie erreichten den Kabinentrakt. Durch offen stehende Türen sah Neise, wie Passagiere ihre regenfeuchten Mäntel und Hüte ablegten, durch kurzes Sichsetzen und Wiederaufstehen die Betten prüften, in denen sie drei Nächte verbringen würden, ihre Köpfe aus den Fenstern streckten, um einen Blick auf das Flughafentreiben zu werfen … Ein dicker Mann lehnte mit verschränkten Armen in seiner Tür und zog die Lippen auseinander, sodass man seine Zähne sah, die er besser versteckt gehalten hätte. Schlecht gelaunt fragte er in die Kabine hinein: Wo haste denn nu meene braune Hose, Lotte?! Haste se vleicht jarnischt einjepackt – det wär dat Dollste.
Mit einem »Bitte sehr, Herr Oberregierungsrat, ich bin sicher, dass Sie sich wohlfühlen werden« öffnete der Steward die Tür zur Nummer 23. Neise betrat eine Kabine, in der Eleganz und Enge einander die Waage hielten. Der Versuch, den Passagieren einen stilvollen Rahmen zu bieten, hinter dem splendiden Komfort der Luxusdampfer nicht zurückzubleiben, war spürbar; und doch zeigte jedes Detail, dass es bei der Konstruktion von Luftschiffen darauf ankam, Platz und Gewicht zu sparen. Die Couch war mit grünem Plüsch bezogen und hätte auch auf der Titanic passend gewirkt – trotzdem konnte sie nicht verbergen, dass sie klappbar war und sich in eine Pritsche für die Nacht verwandeln ließ. Das muschelförmige Waschbecken in Altrosa, dessen Wasserhähne wie Schwanenhälse geformt waren, spielte auf die Belle Époque an und machte sich nicht einmal lächerlich damit – zugleich war es so winzig, dass Neise keine rechte Vorstellung hatte, was er mit ihm anfangen sollte; am ehesten eignete es sich für Kinder unter zehn Jahren.
Der Steward ließ einen prüfenden Blick herumwandern, beugte sich über die Couchpritsche, um ein Kissen zentimeterweit zu verschieben …
– Sollten Sie noch einen Wunsch haben, Herr Oberregierungsrat, wenden Sie sich bitte an den Zimmerservice. Hier, über dem Waschbecken, befindet sich ein Klingelzug. Die Kollegen stehen jederzeit gern zu Ihrer Verfügung, wann immer Sie es wünschen, rund um die Uhr.
Er legte die Hand auf die Klinke und zögerte. In seinen Augen lag ein unfreier, besorgter Ausdruck – die Vorstellung machte ihm zu schaffen, Neise könne, allein zurückgelassen, einen unvorhergesehenen Wunsch haben, der nicht augenblicklich in Erfüllung ging. Dass es die Kollegen vom Zimmerservice gab, die jederzeit – rund um die Uhr – auf ein Klingelzeichen aus der Kabine warteten, schien ihm nicht zu genügen.
Neise legte ihm die Hand auf die Schulter.
– Machen Sie sich keine Sorgen. Ich glaube nicht, dass ich heute noch etwas benötigen werde. Wenn aber doch – dann werde ich mich melden! Gut zu wissen, dass es die Klingel gibt. Hier über dem Waschbecken!
Der Steward öffnete die Tür, blieb auf der Schwelle stehen und sah noch einmal zu Neise zurück.
– Selbstverständlich können Sie sich mit jedem Ihrer Wünsche nicht nur an den Zimmerservice, sondern auch … an mich wenden. Fragen Sie bitte nach Steward Diehl! Ich stehe zu Ihren Diensten, wann immer Sie es wünschen … – Steward Diehl.
Die Tür schnappte ins Schloss. Neise stieß ein Pruschen aus, das er gleichermaßen mit der Nase wie den Lippen hervorbrachte und das zu seinen charakteristischen Äußerungen gehörte. Dann legte er seinen Mantel ab und nahm, ohne Zeit zu verlieren, mit ungeduldiger Raschheit, von der Kabine Besitz. Er baute seinen Büchervorrat auf der Nachtkonsole auf, verteilte den üppigen Inhalt seiner Kulturtasche vor dem Spiegel, dekorierte das Fensterbrett mit einer Fotografie … Er wollte dieser abenteuerlichen Umgebung, in die er sich auf Zeit versetzt fand, die ihm ein sonderbar spannendes Gefühl im Bauch verursachte, einen Zug von Vertrautheit geben, sich eine vorübergehende Bleibe, eine Ahnung von Zuhause schaffen. Schon hing am Haken neben der Tür sein braun gestreifter Bademantel – noch am Morgen hatte er ihn in seiner Charlottenburger Wohnung beim Frühstück getragen. Der Kamm vor dem Spiegel, der daheim Furchen durch seine pomadisierten Haare gezogen hatte, würde ihn quer durch das Sonnensystem begleiten. Wenn er auf der Couch-Pritsche die ersten Sätze seines mitgebrachten Romans las, würde alles um ihn her versinken wie in der Ecke seines Biedermeiersofas …
Die Motoren liefen an, ein Zittern flutete durch den Boden der Kabine, vor dem Spiegel stießen zwei Fläschchen klirrend gegeneinander. Neise legte einen Stapel Unterwäsche, den er eben in den Spind räumen wollte, beiseite und öffnete das Fenster. Feine Regentropfen wehten herein und spielten kitzelnd um seine Hände. Rußflöckchen, die der Traktor in die Luft blies, hafteten wie schwarzer Schnee auf seiner Hemdbrust. Unter dem Fenster, in überraschender Nähe, zerrten Männer unter vollem Einsatz ihres nichtigen Gewichts an einem Tau, starrten mit Gesichtern, die von Anstrengung rot geschwollen waren, zum Schiff hinauf, tänzelten mit den Füßen über das Rollfeld. Neise musste lächeln: Dass diese Zwerge genug Kraft besitzen sollten, den Riesen zu fesseln, auch nur seine Aufmerksamkeit zu erregen, sich ihm als Ballast, als noch so schwacher Widerstand zu präsentieren – das gehörte zu den Dingen, die hier nicht stimmten.
Auf ein Kommando, das von irgendwoher gebrüllt wurde, ließen die Männer die Berlin aus den Händen. Ruhig und gleichmäßig, als kehre sie in ihr eigentliches Element zurück, begann sie in die Höhe zu steigen. Wieso tat sie es gerade in diesem Augenblick? Wollte sie den Stolz der Männer nicht verletzen, ihnen die freundliche Illusion erhalten, sie seien stark genug, die Berlin zu bändigen?
Die Kofferträger und Schirmhalter winkten mit ihren Mützen. Der Fahrer des Traktors, der von seinem Sitz herabgestiegen war, zog ein Taschentuch aus der Latzhose und ließ es im Wind spielen. Die Tauhalter wischten sich den Schweiß von den Stirnen und glotzten mit offenen Mündern nach oben. Neise hörte Schreie. Ein Mann in grauem Straßenanzug und mit Aktentasche lief unter den Kabinen umher. In großer Erregung rief er zu den Fenstern empor, fuchtelte mit den Armen und der Tasche und zeigte auf die Propellermotoren, die jetzt ihre ganze Kraft entfalteten. Jeder begriff, dass er Angst hatte, vor etwas Schrecklichem warnen wollte, doch was war es? Kein Schreien und kein Fuchteln konnte dem, was er, und nur er, kommen sah, Einhalt gebieten. Die Berlin gewann an Höhe, immer leiser klangen die Rufe aus der Tiefe herauf, flogen wie Fetzen zwischen Erde und Himmel umher … Drei Tauhalter liefen auf den Schreier zu und packten ihn an Armen und Beinen.
2
Neise machte es sich mit Stuhl und Kissen am Fensterbrett gemütlich und sah ausdauernd zur Erde hinab. Dass er mit der Geschwindigkeit eines Expresszuges in neunhundert Meter Höhe über die Mark Brandenburg schwebte, war neu und musste ausgenutzt werden. Bisher hatte er noch nie Gelegenheit gehabt, die Erde aus größerem Abstand zu betrachten, außer als er in Venedig in den Glockenstuhl des Campanile gestiegen und in Berchtesgaden mit der Seilbahn auf den Watzmann gefahren war. Dass es wenig zu sehen gab außer Dörfern und Äckern, die sich in reizloser Einförmigkeit aneinanderreihten, störte ihn nicht: Die landschaftliche Tristesse schläferte sein Gehirn ein und wirkte beruhigend auf seine Nerven, die es nötig hatten.
Vor dem Abendessen rasierte er sich ausgiebig, legte seinen förmlichsten Anzug und die bessere seiner beiden Taschenuhren an. Aus einer Vase mit Osterglocken schnitt er sich eine Blüte fürs Revers ab, was ihn Zeit kostete, denn er konnte sich nur schwer entscheiden, welche der Blüten weder zu groß noch zu klein, weder zu geschlossen noch zu aufgeblüht war. Da das Abenteuer dieser Reise nicht länger als drei Tage dauern würde, war die Zahl der Mahlzeiten begrenzt, und jede einzelne besaß Anspruch darauf, zelebriert zu werden. Außerdem würde er sich im Speisesaal zum ersten Mal den taxierenden Blicken der Mitpassagiere stellen, und so glaubte er, sich keinen Fehler erlauben zu dürfen, nicht einmal eine schlecht ausgewählte Blüte oder ein stehen gebliebenes Barthaar. Sein Reisefieber ging in Lampenfieber über, er fühlte sich wie ein Schauspieler vor dem Auftritt. Bisher hatte er nichts an Bord entdeckt, dem nicht eine Spur von Schein, sich seriös gebender Spielerei beigemischt gewesen wäre; selbst der Schreier auf dem Flugfeld war nicht echt gewesen, hatte bei allem Ernst doch auch eine Farce aufgeführt, sich vor den Passagieren an den Fenstern in Szene gesetzt wie vor den Zuschauern einer Theaterloge.
Bei der Einrichtung des Speisesaals waren Zugeständnisse an technische Zwänge vermieden oder bis zur Unkenntlichkeit überspielt worden – nichts fehlte oder wirkte ökonomisch. Damasttücher bedeckten die Tischplatten aus Blech. Gobelins schmückten die Wände aus Sperrholz. Schweres Silberbesteck umrahmte die Meißener Teller. Manche Passagiere waren erstaunt, dass sie drei Gabeln und drei Messer und drei Löffel vor sich hatten, sahen auf der Speisekarte nach, wie viele Gänge es wohl geben werde, und kamen beim Durchzählen auf sieben ohne das Amuse-Gueule. Das einzige Tischrequisit, das dann doch fehlte, waren Kerzenleuchter, doch niemanden gab es, der dafür nicht Verständnis besessen hätte: Dass die Berlin mit hochentzündlichem Gas gefüllt war und offenes Feuer Folgen haben konnte, war bekannt.
Neise saß allein und ließ den Blick schweifen. Die Passagiere machten den Eindruck wohlig betuchter Bürgerlichkeit: Die Herren trugen dunkle Anzüge mit Fliege und Taschenuhr, die Damen führten den Geschmack der Zeit in seiner kostspieligsten Variante vor; sie hatten so sichtbar Schmuck angelegt, dass der Eindruck einer Verabredung entstand und die Grenze zwischen Übertreibung und akzeptierter Üppigkeit verschwamm. Aus allen Gesichtern sprach selbstverständliche Saturiertheit, in einigen wenigen hatten auch Bildung und Intelligenz ihre Spuren gezogen. Draußen im abendlichen Himmel schoben sich anthrazitfarbene Wolken vorüber, sahen beiläufig und neugierig zwischen den Vorhängen herein wie Passanten in ein Restaurant. Fünf Wanduhren verkündeten die Zeiten in Berlin, Moskau, Peking, New York sowie an Bord. Ihre Sekundenzeiger rückten in kurzen scharfen Sprüngen wie auf einen Gegner zu. Eine Weltkarte füllte die Decke; sie war mit roten Linien übersät, die Flugrouten der Berlin bezeichneten und sich als wirres Knäuel über alle Ozeane und Kontinente erstreckten.
Die Wanduhren begannen gleichzeitig zu schlagen, und als sei dies ein geheimes Zeichen, trat ein Mann in den Salon. Keiner der Passagiere nahm etwas an ihm wahr, das ihn zu einer auffälligen Erscheinung gemacht hätte, und doch zog er von überall her Blicke auf sich: ein Fünfzigjähriger mit schwarzen, bohrenden Augen. Die grauen Haare so fest gescheitelt, dass keine Macht der Erde sie verrücken konnte. Die Hose mit überscharfen Bügelfalten, die wie Waffen waren.
– Guten Abend, der Herr, mein Name ist Pohlschröder. Wir teilen uns diesen Tisch. Freue mich sehr.
Neise begrüßte den Ankömmling, indem er sich rasch erhob, eine Verbeugung machte, an der nicht nur sein Kopf, sondern auch der Körper bis zur Hüfte beteiligt war, und mit einer zeremoniellen Geste die Hand ausstreckte. Gewandtes Auftreten zählte zu den wenigen Eigenschaften, die er eindeutig besaß und von denen er sich, eben darum, niemals hätte abbringen lassen. Er war höflich aus Freude an allem Durchgeformten und Zivilisierten, doch auch weil es seiner Persönlichkeit an Inhalt fehlte: Die Vorschriften des guten Benehmens bis ins Kleinste einzuhalten, in jeder Lage eine Illustration der Artigkeitsregeln der Zwanzigerjahre zu liefern, entband ihn von der Herausforderung, einen eigenen Stil zu entwickeln.
– Warum reisen Sie in die Staaten? Haben Sie geschäftlich dort zu tun?
Pohlschröder stellte diese Frage, noch ehe er sich auf seinem Stuhl zurechtgesetzt hatte; mit der ungeduldigen Direktheit eines Menschen, der unter einem Überschuss an Tatendrang und geistiger Energie leidet, wollte er alles Geplänkel vermeiden, sogleich zum Interessanten durchstoßen.
– Warum ich nach Amerika reise? Nun, ich … fliege in die Ferien. Zuerst will ich ein paar Tage in New York verbringen und später … nach Long Island. Und Sie?
– Ich habe geschäftlich in San Francisco zu tun. Urlaub mache ich nie – Arbeit ist meine einzige Erholung.
Neise empfand diese Antwort als wenig originell, hatte sie schon öfters in dieser oder jener Abwandlung gehört und immer von Leuten, aus deren Mund sie weniger selbstgefällig klang.
– Ich sehe, dass uns beide der gleiche Grund nach Amerika treibt: Wir wollen uns erholen.
– Jawohl.
– Allerdings gibt es etwas, worin wir uns unterscheiden: Ich erhole mich von der Arbeit, Sie bei der Arbeit.
– Jawohl.
– Darf ich fragen, was für eine Arbeit es ist, bei der Sie sich erholen?
– Ich mache in Röhren.
– Ah! Röhren … Kann es sein, dass Sie … der Pohlschröder sind? Von den Vereinigten Röhrenwerken?
– Jawohl.
Neise ließ die Hand mit dem blauen Siegelring, die er gern ins Spiel brachte, erstens, weil sie gut geformt war, und zweitens wegen des Siegelrings, auf dem Tisch spielen.
– Ich habe schon viel von Ihnen gehört, den Namen Pohlschröder kennt ja jeder … Die Vereinigten Röhrenwerke produzieren … Stahlrohre, nicht wahr? Es ist die größte Fabrik für Stahlrohre in ganz Deutschland?