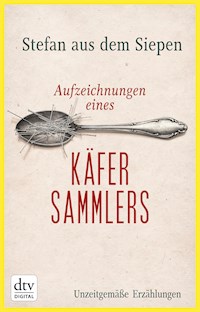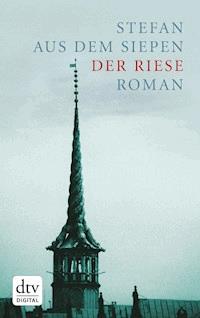17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: zu Klampen
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Stilkunden beschäftigen sich in der Regel mit dem, was als guter Stil gilt, der schlechte findet allenfalls am Rande Erwähnung. Dabei ist er, statistisch gesehen, viel verbreiteter als der gute und verdiente schon deshalb größere Aufmerksamkeit. Außerdem hat er in seinen mannigfaltigen Erscheinungsformen durchaus eigene, wenn auch meist unbeabsichtigte Reize. Stefan aus dem Siepen nimmt sich ihrer mit der Leidenschaft eines maliziösen Genießers an. Erzählerische Nachlässigkeiten, überfrachtete Sätze, missglückte Anfänge, preziöse Wortwahl, sprachliche Vulgaritäten, schiefe Metaphern, raunende Titel, ungelenke Intimszenen, … – sämtliche vorgestellten stilistischen Patzer stammen aus den Federn großer Schriftsteller. Selbst diese waren gegen gelegentliche Ausrutscher nicht gefeit. Stefan aus dem Siepen legt mit seiner spiegelverkehrten Stilkunde keine Anthologie pedantisch kompilierter literarischer Fehlgriffe vor, vielmehr erweist er dem Geglückten seine Reverenz. Denn die Reflexionen über das sprachliche Pappmaché handeln immer auch von den edleren Materialien der Literatur.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Reihe zu Klampen Essay
Herausgegeben von
Anne Hamilton
Stefan aus dem Siepen,
geboren 1964, trat nach Abschluss seines Jurastudiums in den Diplomatischen Dienst ein. Seine Tätigkeit führte ihn u. a. nach Luxemburg, Shanghai, Moskau und Berlin. Er hat mehrere Romane, aber auch Erzählungen und Betrachtungen veröffentlicht. Sein dritter, vielbeachteter Roman, »Das Seil« (2012), wurde als ARTE-Serie verfilmt. In der Zeitschrift CICERO erscheint monatlich seine Kolumne »Der Flaneur«. Stefan aus dem Siepen lebt in Potsdam und Paris.
STEFAN AUS DEM SIEPEN
Wie man schlecht schreibt
Die Kunst des stilistischen Missgriffs
»Ein Schriftsteller ist jemand,dem das Schreiben schwerfällt.«
Thomas Mann
Inhalt
Nachlässigkeit
Wie Klaus Mann einmal die Zahlen Elf und Zwölf verwechselte – und dafür von Hermann Hesse getadelt wurde
Unverständlichkeit
»Ein Kennzeichen höchsten Stils ist die geschliffene Dunkelheit.« (Ernst Jünger)
Der schlechte Name
Ingrid Babendererde, Kunigunde Rosenstiel und andere Verstöße
Übertreibung
Der Pyramidentrick
Abstraktheit
Wenn der Leser nichts sieht, nichts hört, nichts riecht und nichts schmeckt
Der schlechte Anfang
Wie der Autor den Leser mit einem Fauxpas begrüßt
Wiederholung
Die Ästhetik der hängengebliebenen Schallplatte
Überfrachtung
Wenn der Autor nicht weiß, wann es genug ist
Der schlechte Titel
Von Warnhinweisen auf Buchdeckeln
Fremdwörter
Warum der alte Stechlin lieber »Hydropsie« als »Wassersucht« sagte
Füllwörter
Goethes schwarze Liste
Der schlechte Relativsatz
Wie Walter Benjamin einmal sich selbst nicht mehr verstand
Vulgärwörter
Wie George Bernard Shaw mit einem einzigen Wort Theatergeschichte schrieb
Negative Ausdrucksweisen
Sage, was nicht ist!
Wortspiele
»How every fool can play upon the word« (Hamlet)
Die schlechte Sexschilderung
»Ein Gedanke wohnt, ach, in zwei Brüsten« (Günter Kunert)
Prahlerei
Es reicht nicht aus, ein großer Schriftsteller zu sein – man muss den Leser auch darauf hinweisen
Erklärungen und Belehrungen
Was gute Literatur mit Ikea-Möbeln zu tun hat
Der schlechte Vergleich
Ein Bild sagt mehr als tausend schiefe Worte
Impressum
Vorwort
DIE meisten Stilkunden beschäftigen sich nur mit dem guten Stil. Den schlechten erwähnen sie allenfalls am Rande, mit kurz angebundener Geringschätzung, in warnend hingeworfenen Beispielen. Kaum je nehmen sie die zahlreichen Erscheinungsformen, in denen er auftritt, auch die unbeabsichtigten Reize, die er haben kann, näher unter die Lupe. Dabei ist der schlechte Stil, statistisch gesehen, um vieles verbreiteter als der gute und verdiente schon deshalb größere Aufmerksamkeit. Diese soll ihm hier zuteil werden.
Ich liebe die Literatur, und dieses Buch wendet sich an Leser, die es ebenfalls tun. Nur wenn man guten Stil schätzt, kann man überhaupt auf den Einfall kommen, sich mit dem weniger guten zu beschäftigen. Indem man das Missglückte analysiert, seinen Geheimnissen auf den Grund geht, lernt man das Gelungene noch besser verstehen und genießen – so jedenfalls meine Hoffnung. Auf den ersten Blick mag diese Stilkunde wie eine Anthologie von Fehlgriffen erscheinen, in Wahrheit ist sie eine Hommage an das Geglückte.
Gibt es in unserer Zeit überhaupt noch allgemeingültige Kriterien, um gutes Schreiben von schlechtem zu unterscheiden? Auf diese Frage lautet meine klare Antwort: Ja und nein! Nein, weil das »Anything goes« natürlich auch in der Welt der Literatur seinen festen Platz besitzt und immer wieder die erstaunlichsten Dinge hervorbringt. Ja, weil es das sichere Ende der Literatur wäre, wenn die Leser darauf verzichteten, einen Unterschied zwischen gut und schlecht zu machen. Wenn alles gleich gültig ist, ist alles gleichgültig.
Jeder Leser legt an Bücher zwar seine individuellen Maßstäbe an, doch die Urteile über guten und schlechten Stil fallen in der Regel einhellig aus. Obwohl sich alle Regeln erledigt zu haben scheinen, entsteht immer wieder, ebenso zuverlässig wie wundersam, ein Konsens. Jedenfalls kenne ich niemanden, der nicht die »Buddenbrooks« oder »Auf der Suche nach der verlorenen Zeit« für stilistisch gelungener hielte als … Hier kann jeder Leser einen Titel seiner Wahl einsetzen. Die Regeln des guten Stils haben ihre Verbindlichkeit eingebüßt, gelten jedoch fort.
Sämtliche Beispiele für missglücktes Schreiben, die in diesem Buch versammelt sind, stammen aus der Feder großer, zum Kanon gehörender Schriftstellerinnen und Schriftsteller. Auch sie waren, wie jeder erfahrene Leser weiß, gegen kleine Missgriffe nicht gefeit. Thomas Mann leistete es sich, gelegentlich Füllwörter zu verwenden; bei James Joyce gibt es Sätze, die wohl niemand außer ihm selbst versteht; Robert Musil häufte manchmal mehr Adjektive an, als für das Vergnügen an der Lektüre gut ist; ausgerechnet der berühmteste Roman von García Márquez beginnt mit einem unguten Satz; Günter Grass hatte seine stärksten erzählerischen Augenblicke nicht dann, wenn er über Sex schrieb … Sich bei den Heroen der Literatur zu bedienen, erfüllt nicht den Tatbestand der Majestätsbeleidigung (macht dafür aber hoffentlich die Lektüre ein wenig unterhaltsamer). Gerade die Meister bleiben in ihrer olympischen Entrücktheit unberührt, und auf ein Büchlein wie dieses werfen sie von ihren Ruhebänken nur ein sanftes Lächeln herab.
Harper Lee, die große amerikanische Erzählerin, schrieb: »Vorwörter verderben das Vergnügen, machen die Vorfreude zunichte, entziehen der Neugier den Boden.« Wohl wahr! So verstoße denn auch ich gegen die Regeln des guten Schreibens – und schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt. Sicher werde ich noch viele weitere Fehler begehen, ohne es auch nur zu bemerken. Der Leser nehme diesen Hinweis als ein Zeichen meiner Demut: Ich sehe den Balken in meinem eigenen Auge, nicht nur das Splitterchen in dem Hermann Hesses oder Elfriede Jelineks.
Nachlässigkeit
Wie Klaus Mann einmal die Zahlen Elf und Zwölf verwechselte – und dafür von Hermann Hesse getadelt wurde
BEGINNEN wir mit Schopenhauer: »Wer nachlässig schreibt, legt dadurch zunächst das Bekenntnis ab, dass er selbst seinen Gedanken keinen großen Wert beimisst. Denn nur aus der Überzeugung von der Wahrheit und Wichtigkeit unserer Gedanken entspringt die Begeisterung, welche erforderlich ist, um mit unermüdlicher Ausdauer überall auf den deutlichsten, schönsten und kräftigsten Ausdruck derselben bedacht zu sein; – wie man nur an Heiligtümer oder unschätzbare Kunstwerke silberne oder goldene Behältnisse wendet.« (»Parerga und Paralipomena«) Die Anekdoten über Schriftsteller, die sich beim Schreiben große Mühe gaben, um silberne oder goldene Behältnisse für ihre Gedanken zu schaffen, sind Legion. Theodor Storm machte immer wieder lange Spaziergänge, auf denen er nach einem bestimmten Wort suchte, das ihm zuvor am Schreibtisch nicht eingefallen war. Fontane war für sein unermüdliches »Düffeln« am Manuskript bekannt: »Drei Viertel meiner ganzen literarischen Tätigkeit ist überhaupt Korrigieren und Feilen gewesen. Und vielleicht ist drei Viertel noch zu wenig gesagt.« Schiller behauptete von sich: »Es kann eine Stunde kosten, bis ich einer Periode die bestmögliche Rundung gegeben habe.« Robert Musil arbeitete über zwanzig Jahre lang an seinem »Mann ohne Eigenschaften« und musste ihn doch, oder eben darum, als Torso zurücklassen; das Kapitel »Atemzüge eines Sommertags« soll er zwanzigmal umgeschrieben haben. Flaubert klagte in einem Brief an seine Vertraute George Sand: »Kein rascher Geist, Ihr Freund, nein!, durchaus nicht! So drehe und wende ich da seit zwei ganzen Tagen einen Absatz, ohne zum Ziel zu kommen. Mitunter möchte ich weinen!«
Natürlich gibt es auch Schriftsteller, die sich weniger Mühe gaben, zumindest hin und wieder. Die Methode, eine Stunde lang an einer einzigen Periode zu feilen, oder einen Spaziergang zum Zweck der Wortsuche zu unternehmen, lässt sich, aus ökonomischen wie anderen Gründen, nicht lange durchhalten; und selbst Musil ging nicht so weit, alle Kapitel seines Romans zwanzig Mal umzuschreiben (sonst wäre der Torso weniger breit ausgefallen). So finden sich in der Literatur zum Glück genug Fälle von Nachlässigkeit, um dieses Kapitel mit einer Reihe von Beispielen zu versorgen.
Klaus Mann leistete sich in seinem Roman »Treffpunkt im Unendlichen« ein halb komisches, halb peinliches Versehen. Der Held des Buches, Sebastian, wohnt in einem Berliner Hotel; die Nummer seines Zimmers gibt Klaus Mann einmal mit »Elf«, dann mit »Zwölf« an. Hermann Hesse, der eine Rezension des Werkes schrieb, bemerkte den Fehler und war nicht bereit, ihn auf humorvolle Art zu nehmen. Die falsche Nummer zeige, dass der Autor es an der nötigen Sorgfalt habe fehlen lassen; das »hübsche Buch« sei bloß für den Augenblick geschrieben, es verliere durch den Lapsus »an innerem Gewicht, an Verantwortung, an Echtheit und Substanz, alles wegen dieser dummen Nummer Zwölf«. Klaus Mann war über dieses Urteil zerknirscht; er antwortete Hesse in einem ausführlichen Brief, dass er den Ausrutscher von Herzen bedaure. »Wie sehr schäme ich mich nun wegen Nummer Zwölf! Wie konnte mir das passieren – und, denken Sie sich, ich hatte es bis jetzt nicht gemerkt!« – Ob diese Selbstbezichtigung auf Hesse großen Eindruck gemacht hat, lässt sich bezweifeln. Dass Klaus Mann den Fehler »nicht gemerkt« hatte, war ja gerade das Problem.
Sherlock Holmes wohnte in der Baker Street 221 B. Die Adresse ist Teil des Mythos, der sich um die Figur rankt, das englische Lesepublikum kennt sie, und angeblich hat die Bank, deren Gebäude sich an der fraglichen Stelle befand, jahrelang einen Sekretär beschäftigt, der nichts anderes tat, als die Briefe zu beantworten, die Leser an den großen Detektiv schrieben. Angenommen, der Autor Conan Doyle hätte Holmes in einer seiner Geschichten aus Versehen unter einer anderen Nummer wohnen lassen: Die Verwirrung wäre groß gewesen, und zahlreiche Leser hätten ihre Briefe an die falsche Adresse geschickt.
Es gibt ein Gegenbeispiel aus der amerikanischen Krimiliteratur. Nero Wolfe, die nicht ganz so berühmte Detektivfigur von Rex Stout, wohnte in New York, 35. Straße West. Wie seine Hausnummer lautete, ist nicht bekannt: Der Autor hielt dieses Detail offenbar für belanglos, denn er gab in seinen Romanen mal diese und mal jene Nummer an, insgesamt zehn verschiedene. Die Nero-Wolfe-Anhänger ließen sich davon nicht beirren: Sie legten aufs Geratewohl fest, die richtige Nummer sei die 454 gewesen, und brachten an dem betreffenden Haus eine Gedenktafel zu Ehren ihres Helden an. Was sagt uns dies? Kleinere Unstimmigkeiten sind, wenn sie nicht gerade den Kern der Geschichte berühren oder den Leser in ernstliche Verwirrung stürzen, ohne Bedeutung, ja sie können sogar lässig wirken. Für die Arbeit eines Schriftstellers spielen Hausnummern keine große Rolle – darin unterscheidet er sich von einem Briefträger.
Im ersten Kapitel von »Anna Karenina« heißt es:
»Im Hause der Oblonskijs herrschte großes Durcheinander. Die Gattin hatte nämlich erfahren, dass ihr Mann mit einer Französin, die früher im Hause Gouvernante gewesen war, ein Verhältnis unterhielt, und hatte ihm erklärt, dass sie jetzt nicht mehr in einem Hause mit ihm leben könne.«
Hier kommt dreimal das Wort »Haus« vor. Dies ist nicht etwa der Übersetzung geschuldet, sondern findet sich ebenso im Original. Wortwiederholungen sind bei Tolstoj nichts Ungewöhnliches, doch seine russischen Leser nehmen sie ihm nicht übel: Sie halten Nachlässigkeiten dieser Art für etwas, das nun einmal zur Schreibart ihres Nationalautors gehört, meinen sogar, er sei »zu groß« gewesen, um sich mit stilistischen Kleinigkeiten abzugeben. Möglich wäre auch eine andere Deutung: Die Wiederholungen haben nichts mit Größe zu tun, sondern mit deren zeitweiliger Abwesenheit.1
Die Romane Dostojevskijs enthalten ebenfalls zahlreiche sprachliche Nachlässigkeiten. Dies ist vor allem eine Folge der schwierigen äußeren Bedingungen, unter denen sie entstanden. Dostojevskij musste finanziell für die Familie seines verstorbenen Bruders sorgen, außerdem stürzte ihn der Zusammenbruch einer von ihm herausgegebenen Zeitschrift in Schulden. So war er gezwungen, alle seine berühmten Romane, von »Schuld und Sühne« bis »Die Brüder Karamasov«, unter großem zeitlichem Druck zu schreiben. Oft waren die Abgabetermine so eng gesteckt, dass ihm kaum Zeit zum Korrigieren blieb, und manche Kapitel soll er, ohne noch einen Blick darauf zu werfen, gleich an den Verlag geschickt haben. Den »Spieler«, ein Werk von zweihundert Seiten, vollendete er in sechsundzwanzig Tagen. Die Flüchtigkeiten, die man in seinen Büchern findet, gewinnen so einen fast ergreifenden Zug: Sie spiegeln die rastlose Art seines Produzierens wider, und was objektiv ein »Fehler« ist, kann zwischen Autor und Leser ein Gefühl der Nähe erzeugen: Manchmal meint man, im Hintergrund Dostojewskijs gepressten Atem zu hören.
Fontane schrieb in »Effi Briest«: »Und ehe die Uhr noch schlug, stieg Frau Briest die Treppe hinauf und trat bei Effi ein. Das Fenster stand auf, und sie lag auf einer Chaiselongue, die neben dem Fenster stand.«
Hier wäre es besser gewesen, noch ein wenig zu »düffeln« – oder möglicherweise hätte auch das nicht geholfen? Jeder Autor kennt das fatale Phänomen, dass sich von Zeit zu Zeit eine Art Lese-Blindheit einstellt. Man verliert die Fähigkeit, den eigenen Text klar vor Augen zu sehen, und liest selbst über die handgreiflichsten Fehler hinweg. Die Schwierigkeiten nehmen noch zu, wenn die Arbeit am Manuskript fortgeschritten ist: Man kennt seine Sätze so gut wie auswendig, und sie zum fünften oder siebten Mal durchzulesen, immer von neuem nach Nachlässigkeiten auszuspähen, gerät zur nervlichen Strapaze. Da bleibt einem nur übrig, seine Hoffnungen auf den Lektor zu setzen; doch wenn auch dieser seinen schläfrigen Tag hat …
Hermann Hesse pflegte seine Manuskripte mit schwäbischer Gewissenhaftigkeit zu korrigieren. Auch ihm ist allerdings das eine oder andere durchgerutscht, wie die folgende Passage in »Narziss und Goldmund« zeigt:
»Er schloss die Augen, um die Formen (einer Schnitzarbeit) nur mit den tastenden Fingern zu erfühlen, das war eine alte Gewohnheit und Spielerei von ihm. Die Schnecke zwischen den losen Fingern drehend, tastete er gleitend, ohne Druck, ihre Formen liebkosend nach, beglückt vom Wunder der Formung.«
Wenn ich Klaus Mann gewesen wäre, hätte ich über »Narziss und Goldmund« eine Rezension geschrieben und mich lustvoll gerächt.
Es gibt Fälle, in denen Sorgfalt mehr schädlich als nützlich ist. François de Malherbe, ein Dichter des französischen Klassizismus, der als Hofpoet Ludwigs XIII. wirkte, war berühmt für seine überaus gründliche, keinen Zeitaufwand scheuende Arbeitsweise. Einmal verbrachte er ganze drei Jahre damit, Gedenkverse auf den Tod einer adeligen Dame zu verfassen. Als er endlich damit fertig war, kamen sie zu spät: Inzwischen hatte der Ehemann der Verstorbenen bereits wieder geheiratet, doch nicht nur das – er war sogar selbst schon gestorben.
Die Geschichte erinnert an die langsame und sorgfältige Arbeitsmethode in Ministerien, die ich selbst als Diplomat kennengelernt habe. Wenn das Oberhaupt eines fremden Staates ernstlich erkrankt, wird im Auswärtigen Amt ein Schreiben mit Genesungswünschen verfasst. Da der Entwurf mehrere Hierarchiestufen durchlaufen muss, kann es vorkommen, dass der Adressat stirbt, ehe die letzte Billigung erfolgt ist. In solchen Fällen wird das Genesungs- in ein Beileidsschreiben umgewandelt; dies geht nun schneller, denn ein Teil der Formulierungen kann übernommen werden.
Das Gedicht »Über die Heide« von Theodor Storm enthält eine scheinbare Nachlässigkeit:
Über die Heide hallet mein Schritt;
Dumpf aus der Erde wandert es mit.
Herbst ist gekommen, Frühling ist weit –
gab es denn einmal selige Zeit?
Brauende Nebel geisten umher;
Schwarz ist das Kraut und der Himmel so leer.
Die Verse wirken stark, besonders die Metapher des »Mitwanderns« aus der Erde ist originell und eindringlich. Allerdings gibt es eine Unstimmigkeit, oder jedenfalls scheint es so: »Über die Heide hallet mein Schritt« – das ist unrealistisch, denn auf dem weichen, mit Kräutern bewachsenen Heideboden können Schritte nicht hallen. War Theodor Storm hier nachlässig? Ist er nicht lange genug spazieren gegangen? Wohl doch. Das Motiv des Hallens fügt sich zur Stimmung der Einsamkeit, verleiht ihr sozusagen akustische Anschaulichkeit. Das Gedicht erschafft sich eine eigene Wirklichkeit, in der vieles möglich ist, selbst eine hallende Heide. Der Autor darf sich nicht zum Sklaven der Wahrscheinlichkeit machen – in einem Kunstwerk hängen die Dinge anders zusammen als in der Wirklichkeit, und manchmal beruht seine Glaubwürdigkeit gerade auf dem, was objektiv nicht glaubwürdig ist.
In Goethes »Faust« wimmelt es von unrealistischen Details. So trinken die Studenten in Auerbachs Keller »moussierenden Champagnerwein« – was ein Anachronismus ist, denn das Stück spielt im Mittelalter, und zu dieser Zeit war das Getränk noch nicht erfunden. Aber natürlich wäre es absurd anzunehmen, Goethe habe nicht genügend recherchiert, gehe nachlässig mit den Tatsachen um. Erstens handelt es sich bei »Faust« um ein Theaterstück, nicht um eine Geschichte des Schaumweins. Zweitens will Mephisto die Studenten in Stimmung bringen, und da sie sonst nur Bier und deutschen Most trinken, kredenzt er ihnen zur Abwechslung eine französische Spezialität. »Realistisch« ist, was sich schlüssig in das Kunstwerk einfügt, eine überzeugende Rolle in seiner Eigenwelt spielt. Goethe schreibt gegen die Realität an und schafft etwas Spritzigeres.
Da wir bei Goethe sind: Dieser sprach bekanntlich kein reines Hochdeutsch, sondern ein ausgeprägtes Frankfurterisch. In seinen Gedichten haben sich davon einige schöne Abdrücke erhalten, so im »Mailied«:
Es dringen Blüten
Aus jedem Zweig
Und tausend Stimmen
Aus dem Gesträuch.
Noch weicher und gemütlicher:
Ich komme bald, ihr goldnen Kinder,
Vergebens sperret uns der Winter
In unsere warme Stuben ein …
Am berühmtesten ist Gretchens Mundart-Gebet an die Jungfrau Maria:
Hilf! Rette mich vor Schmach und Tod.
Ach neige,
Du Schmerzenreiche,
Dein Antlitz gnädig meiner Not.
Zur Goethezeit gab es in Deutschland kein geistig-kulturelles Zentrum, wie England mit London eines besaß und Frankreich mit Paris. Die Dichter waren weit über das Land hin verstreut, saßen in ihren beschaulichen Winkeln und sprachen ihre beschaulich-winkeligen Dialekte. Wäre Goethe ein französischer Schriftsteller gewesen, hätte ihm die Académie Française, die sich als Verteidigerin der Pariser Hochsprache gegen die Abirrungen der Provinz verstand, sein »Winder« und »Gesträusch« nicht durchgehen lassen. In deutschen Landen dagegen gab es nur Provinz; daher galt die Einhaltung der korrekten Aussprache nicht als Voraussetzung für gutes Schreiben, und auch mit Hessisch konnte man es auf den Olymp schaffen.
Josef Weinheber stammte aus Österreich, und wer es bisher noch nicht wusste, der erfährt es hier aus seinem Gedicht »Im Grase«:
Glocken und Zyanen
Thymian und Mohn.
Ach, ein fernes Ahnen
Hat das Herz davon.
(…)
Löwenzahn und Raden,
Klee und Rosmarin.
Lenk es, Gott, in Gnaden
Nach der Heimat hin.
Die österreichische Sprachfärbung kommt den Versen in doppelter Hinsicht zugute. Erstens sorgt sie dafür, dass sich »Mohn« sauber auf »davon« reimt, ebenso »Rosmarin« auf »hin«; die einschnürenden Reim-Grenzen des Hochdeutschen werden auf wohltuende Art erweitert. Und zweitens macht das mundartliche Timbre die Strophen noch rührender, als sie ohnehin schon sind, lässt sie geradezu herzergreifend ausklingen und verschweben.
Noch ein Gedicht von Goethe, diesmal ohne Spurenelemente aus Frankfurt:
Der du von dem Himmel bist,
Alles Leid und Schmerzen stillest,
Den, der doppelt elend ist,
Doppelt mit Erquickung füllest,
– Ach, ich bin des Treibens müde,
Was soll all der Schmerz und Lust? –
Süßer Friede,
Komm, ach komm in meine Brust!
Grammatisch aufmerksame Leser werden hier zwei Reibungen entdecken. Statt »Alles Leid und Schmerzen« müsste es, streng genommen, »Alles Leid und alle Schmerzen« heißen; und in »Was soll all der Schmerz und Lust?« bezieht sich »der« auch auf »Lust«. Wen stört’s? Das Gedicht ist von der ersten bis zur letzten Zeile schön, und Winzigkeiten dieser Art gehen im Wohlklang unter, werden aufgesogen und unschädlich gemacht. Sie erhöhen sogar die sprachliche Intensität; nichts klingt ja so dröge und steril, entfaltet eine so einschläfernde Wirkung wie stilistische Perfektion. Die italienischen Künstler der Renaissance erfanden die sprezzatura, die gewollte Nachlässigkeit: Sie fügten ihren Werken hier und da kleine Fehler und Unebenheiten zu, um den Eindruck der Vollkommenheit zu vermeiden. Alles sollte den Anschein erwecken, als hätten sie es sich mühelos, einer genialen Eingebung folgend, aus dem Ärmel geschüttelt. Auch Goethe hatte für diese Technik etwas übrig, ließ gern ein paar Ecken und Kanten stehen, die er mit Leichtigkeit hätte abfeilen können. – Wer nie einen stilistischen Verstoß begeht, begeht einen stilistischen Verstoß.
In Joseph von Eichendorffs Gedicht »Sehnsucht« ist eine Kante stehengeblieben:
Es schienen so golden die Sterne,
Am Fenster ich einsam stand
Und hörte aus weiter Ferne
Ein Posthorn im stillen Land.
Das Herz mir im Leib entbrennte,
Da hab’ ich mir heimlich gedacht:
Ach, wer da mitreisen könnte
In der prächtigen Sommernacht!
Warum schreibt Eichendorff »entbrennte«? Jedes Mal, wenn ich das Gedicht lese (und ich tue es in losen, doch nie zu langen Abständen seit Jahrzehnten), stelle ich mir diese Frage. War es ihm bloß um einen Reim auf »könnte« zu tun? Den hätte er auch anders finden können. Eher glaube ich, dass er die kleine Holprigkeit geradezu angestrebt, oder sich wenigstens nicht gegen sie gewehrt hat, denn er wollte sein Gedicht im volksliedhaften Ton schreiben, ihm jenen Hauch des Unbeholfenen, Nicht-ganz-so-Kunstfertigen geben, der zum literarischen Konzept der Romantik gehörte. Auch hat »entbrennte«, gerade wegen des leichten Missklangs, einen kraftvolleren, unruhigeren, expressiveren Charakter als »entbrannte«: Vor lauter Sehnsucht nach der Ferne gerät der Dichter, nachts am Fenster stehend, in eine milde Form des Stammelns.
1Das russische Wort für Haus lautet »dom«. Nabokov stellt in seinen »Vorlesungen über russische Literatur« die These auf, Tolstoij habe in »Anna Karenina« mit dem dreimaligen »dom-dom-dom«, dieser »bedeutungsschweren und feierlichen Wiederholung«, den Klang einer Totenglocke nachahmen wollen: Schon im ersten Kapitel läute er, dem Gang der Handlung vorausgreifend, das Ende der Familie Oblonskij ein. Dieser Gedanke ist so originell, dass ich ihn nicht unterschlagen möchte; allerdings ist er auch so weithergeholt, dass ich ihn in eine Fußnote verbanne.
Unverständlichkeit
»Ein Kennzeichen höchsten Stils ist die geschliffene Dunkelheit.« (Ernst Jünger)
JACQUES Lacan, der französische Philosoph und Psychoanalytiker, schenkte uns folgenden Satz:
»So also symbolisiert das erektionsfähige Organ den Platz des Genießens, nicht als es selbst, ja nicht einmal als Bild, sondern als der fehlende Teil des begehrten Bildes: darum auch ist es der Wurzel aus Minus 1 der weiter oben produzierten Bedeutung gleichzusetzen, der Wurzel des Genießens, die es durch den Koeffizienten seiner Aussage der Mangelfunktion des Signifikanten wiedererstattet: Minus 1.« (»Das Seminar«)
Hier geht es vermutlich um das männliche Glied. Dieses ist ein trivialer Gegenstand, den jeder mehr oder weniger kennt. Anscheinend hat Lacan etwas darüber zu sagen, das ganz und gar nicht trivial ist, das womöglich noch nie ein anderer vor ihm gedacht und gesagt hat. Doch was ist es?
»Die Sprache ist dem Menschen gegeben, um seine Gedanken zu verbergen«, so lautet das bekannte Bonmot des französischen Diplomaten Talleyrand.1Er bezog es auf seinen Beruf, auch wohl auf den zwischenmenschlichen Verkehr im allgemeinen – nicht jedoch auf die Literatur. Für diese wäre es auch wenig passend, denn warum sollte sich jemand die Mühe machen, Hunderte Seiten zu schreiben, nur um vor seinen Lesern zu verbergen, was er denkt? Vielleicht hilft es, das Bonmot ein wenig umzustellen: »Die Sprache ist dem Menschen gegeben, um zu verbergen, dass er keine Gedanken hat.« In dieser Form lässt es sich schon eher auf die Literatur anwenden. Wer keine Gedanken hat, wohl aber den Eindruck erwecken will, er hätte welche, kann nichts Geschickteres tun, als Bücher zu schreiben.
Wer dunkel und unergründlich schreibt, fügt sich in eine große Tradition ein. Schon die Griechen verehrten Heraklit, den sie voller Respekt den »Dunklen« nannten, weil sie seine raunenden, bruchstückartigen Aussprüche nicht verstanden, so wie auch wir Heutigen sie nicht verstehen. Von ihm zieht sich eine lange und ehrwürdige Reihe sprachlicher Dunkelmänner durch die Jahrtausende bis in unsere Zeit. Ihre unverständliche Sprache scheint auf höhere Wahrheiten hinzudeuten, die der Leser nicht kennt und die ihm die Dunkelmänner auch nicht verraten – so bleibt ihm nichts übrig, als ihnen Glauben zu schenken. Die Wahrheit ist, nach alter und vielleicht nicht einmal falscher Vorstellung, schwierig und verwickelt; wer also schwierig und verwickelt schreibt, der scheint die Wahrheit zu sagen. Im Falle Lacans: die Wahrheit über das männliche Glied.
Hegel gibt in seiner »Naturphilosophie« folgende Definition der Elektrizität:
Sie ist »der reine Zweck der Gestalt, der sich von ihr befreit, die Gestalt, die ihre Gleichgültigkeit aufzuheben anfängt; denn die Elektrizität ist das unmittelbare Hervortreten oder das noch von der Gestalt herkommende, noch durch sie bedingte Dasein – oder noch nicht die Auflösung der Gestalt selbst, sondern der oberflächliche Prozess, worin die Differenzen die Gestalt verlassen, aber sie zu ihrer Bedingung haben und noch nicht an ihnen selbständig geworden sind.«