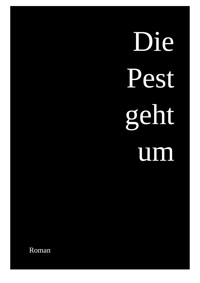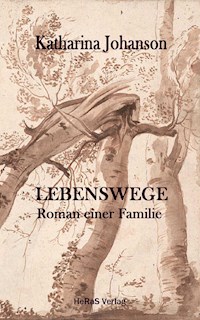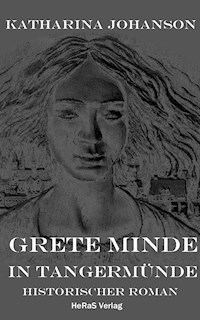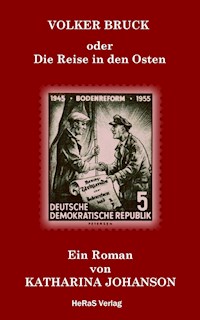0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dieser Roman hat die Form einer Autobiografie. Ilona Schimmel berichtet unbekümmert, freimütig und nachdenklich aus ihrem Leben. Der Leser lernt sie als verträumtes Kind, als fleißige Arbeiterin und hernach als gute Mutter kennen. Wobei nicht alles nach ihren Wünschen verläuft und ihre Mühen selten belohnt werden. Da ist sie Enttäuschungen erlegen, da greift sie zu Tricks, da muss sie sich durchmogeln, bis sie Papiere fälscht, sich Lügengeschichten ausdenkt und gänzlich die Orientierung verliert. Die Handlung beginnt im Jahr 1955 in der DDR und endet siebzig Jahre später in der Bundesrepublik Deutschland. Die Personen sind frei erfunden, wobei die historischen Persönlichkeiten, Ereignisse und Orte selbstverständlich gewissenhaft recherchiert und authentisch sind.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 498
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
© 2025 Katharina Johanson
Illustration von: Cornelia Noack
Covergrafik von: Cornelia Noack
Druck und Distribution im Auftrag der Autorin:
tredition GmbH, Heinz-Beusen-Stieg 5, 22926 Ahrensburg, Deutschland
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist die Autorin verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne ihre Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag der Autorin, zu erreichen unter: Katharina Johanson, Arnold-Zweig-Straße 43A, 13189 Berlin, Germany.
Kontaktadresse nach EU-Produktsicherheitsverordnung: [email protected]
Das Sonntagskind
Katharina Johanson
Cornelia, Eisenhüttenstadt, und im Gedenken an ihren Wolfgang gewidmet
Dieser Roman hat die Form einer Autobiografie. Ilona Schimmel berichtet unbekümmert, freimütig und nachdenklich aus ihrem Leben. Der Leser lernt sie als verträumtes Kind, als fleißige Arbeiterin und hernach als gute Mutter kennen. Wobei nicht alles nach ihren Wünschen verläuft und ihre Mühen selten belohnt werden. Da ist sie Enttäuschungen erlegen, da greift sie zu Tricks, da muss sie sich durchmogeln, bis sie Papiere fälscht, sich Lügengeschichten ausdenkt und gänzlich die Orientierung verliert. Die Handlung beginnt im Jahr 1955 in der DDR und endet siebzig Jahre später in der Bundesrepublik Deutschland. Die Personen sind frei erfunden, wobei die historischen Persönlichkeiten, Ereignisse und Orte selbstverständlich gewissenhaft recherchiert und authentisch sind.
Ihr Lieben!
Da sitze ich nun und schreibe mein Leben auf.
Wozu tut einer sowas, will er sich wichtig machen? Ganz ehrlich und wahrhaftig geht es um Selbstgeltung. Wer das leugnet und die eigene Stellung im Gesamtensemble für unwichtig hält, hat schon ein Stück weit seines eigentlichen Daseinszwecks verfehlt zum einen, und zum anderen schreibt einer auf, weil er Bilanz ziehen will. Er ist sozusagen im Abrechnungsmodus, denn jeder oder fast jeder will doch wissen, ob alles, was er leistete, rechtens war oder ob er etwa eine Schuld auf sich geladen hat. Insofern enthält die Autobiografie immer auch eine nicht zu unterschätzende moralisch-sittliche Komponente und lässt den Berichterstatter vor das Hohe Gericht seines Gewissens treten. Des Weiteren geht es nicht zuletzt um Zeugenschaft. Ich will Zeugnis ablegen über eine Zeit, über die im Nachhinein soviel Widersinniges, Widersprüchliches, Verlogenes und Falsches kursiert, wie sonst in der Geschichte wohl nur selten. Ich rede von der Deutschen Demokratischen Republik, die ich ganz lebendig mitbekam und von der ich sagen kann, dass es die schönste Zeit meine Lebens gewesen ist. Ich bin sogar stolz darauf, ihr die Treue gehalten zu haben. Schlussendlich bezieht sich meine Zeugenschaft auch auf die Bundesrepublik Deutschland, mit der ich zwangsvereinigt wurde, und deren Häupter immerdar einen schönen Schein von sich zu vermitteln suchen. Mein Lebensbericht wird demzufolge auch davon erzählen, was der kleine Mann alles verkraften muss und welche Niederlagen er durchlebt und durchleidet und dennoch nie ganz kaputtgeht, wenn er aufpasst und vor allem nicht alleine bleibt.
Ich erblickte als Ilona Schimmel am Sonntag, den 13. März 1955, in Berlin-Pankow das Licht der Welt. Natürlich blickte ich nicht sogleich so, wie man blickt, wenn man irgendetwas versteht. Ich war ein ganz normales Baby. Aber als sprichwörtliches und buchstäbliches Sonntagskind kam ich in eine geordnete, sonnige Welt. Diese Welt war friedlich, dem Leben zugewandt und überaus gütig zu uns Kindern. Ich kann nur Gutes davon berichten. Meine Kindheit war schön, wirklich schön. Sie war nicht nur schön, weil man in der Erinnerung sowieso so manches vergisst und wegschiebt, sondern sie war ganz real schön, wie auch andere Zeitzeugen glaubhaft und ehrlich berichten. Mitunter sehe ich ein Foto von damals an oder ich lese ein paar Zeilen über diese Zeit, und dann staune ich immer wieder, was wir alles hatten und wie ungetrübt unsere Kindheit war.
Unsere Wohnung lag in der Barnimstraße im Pankower Ortsteil Niederschönhausen. Das Haus, in dem wir wohnten, war die für sechs Familien umgebaute Stadtvilla eines ehemaligen, jüdischen Fabrikanten, den die Faschisten vertrieben hatten. Diese Villa stand in einem herrlichen, großen Garten, wo jede Mietpartei ein Fleckchen für sich bewirtschaftete und wo es zugleich einen Platz zum Ausruhen, Feiern und Plaudern für alle und einen Spielplatz für uns Kinder gab. Überhaupt war Niederschönhausen dazumal ein recht weitläufig angelegte Siedlung mit vielen Gärten, Parks und sehr ruhigen Straßen. Eine idyllische Gegend, wie man sie sich schöner eigentlich nicht wünschen konnte. Unsere Nachbarn waren freundlich und aufgeschlossen. Wir fühlten uns wohl, und zwar sehr wohl.
Freilich war auch bei uns nicht alles eitel Sonnenschein, denn meine Eltern waren verschieden hinsichtlich ihres Herkommens und ihres Charakters, wie sie unterschiedlicher nicht hätten sein können. Meine Mutter, eine geborene Franziska von Ansbach, ein adliges Fräulein und die Tochter eines weitverzweigten Stammes schlesischer Großgrundbesitzer, war eine von der Geschichte abgehängte, vom Zeitgeschehen überholte und maßlos enttäuschte Frau, die grundsätzlich abgeneigt war von den Neuerungen und den gesellschaftlichen Einrichtungen, wie wir sie in dem jungen Arbeiter-und-Bauernstaat hatten. Mutter gab bei uns daheim die Hausfrau und den Ton an. Mein Vater, Rudolph Schimmel, ein gebürtiger Ostpreuße, war ein bodenständiger und gelernter Bauer. Er arbeitete im neugeschaffenen Staatswesen in der Bezirksverwaltung und teilte den fortschrittlichen Zeitgeist voll und ganz. Da ergaben sich zwangsläufig gewisse Spannungen zwischen den beiden. Ich habe sie manchmal heftig streitend, immer viel diskutierend, mitunter auch weinend und klagend oder tagelang sich ausschweigend erlebt. Aber ich kannte sie nie restlos verfeindet. Denn eins hatten sie aus der bis dahin fürchterlichsten Katastrophe der Menschheitsgeschichte mitgenommen: Kein Streit darf so ausufern, dass man sich dabei gegenseitig an Gurgel geht! Der Friedenswille lag ihnen im Blut, hatte sich tief in ihr Gedächtnis eingegraben, sodass die Vernunft allemal obsiegte. Am Ende lenkten beide immer wieder ein, suchten den goldenen Mittelweg und machten das Beste aus jeder Situation.
Mein Vater war viel unterwegs, was unser inniges Verhältnis zwar nicht beeinträchtigte, ihn aber mehr zur Randfigur meiner Kinderjahre werden ließ. Die Hauptrolle spielte meine Mutter, die sehr darauf achtete, dass es mir gutging, dass ich mich beim Spielen nicht verausgabte, meine Kleider nicht zerriss oder verdreckte, nicht mit anderen Kindern raufte oder gar welche mit nach Hause brachte. Meine Kontakte zu anderen Kindern waren zunächst also sehr gering. Ich war im Kindergarten immer Mittagskind, wurde daheim beköstigt, hielt danach Mittagsruhe und anschließend wurde ich fast täglich zur Christenlehre geführt. Meine Mutter war nämlich eine fromme Christin und praktizierte ihre Anhänglichkeit zu dem lieben Gott und zu ihrer katholischen Gemeinde mit wahrer Hingabe.
Diese Gemeinde bestand aus einer Handvoll vertrockneter Gestalten, immer die gleichen Gesichter, die mich wenig ansprachen und interessierten, und dazu ein Priester, der genauso wenig gehaltvoll daherkam. Mit ihrem aufdringlichen, übertriebenen Getue gingen sie mir maßlos auf den Geist, zumal ich von der religiösen Heilslehre sowieso nichts verstand. Alles war alt, düster und grau. Da war ich dann froh, wenn sie mich in diesen Gebets- und Andachtsstunden in Ruhe ließen und ich Bilder nach meiner Fasson malen durfte. Ich hockte in einer Ecke, an einem kleinen Tischchen, das extra nur für mich angeschafft worden war, und beschäftigte mich selbstständig. Auch hier will ich mich nicht beklagen. Es war gut so, wie es war. Ich kannte es ja auch nicht anders. Meine Mutter war die Güte in Person, hielt ständig ein Auge auf mich und ich brauchte nur einen Pieps von mir zu geben und schon war das Gewünschte da. Nur ich musste halt mitgehen in diese Gruft, fast jeden Nachmittag. Kein Wunder, dass aus mir ein schwächliches, verzogenes, weltfremdes, arg wortkarges Einzelding wurde. Und den lieben Gott konnte ich von Anfang an nicht so richtig leiden.
Im Januar des Jahres 1961 traten meine Mutter und ich zu meiner Einschulungsuntersuchung an. Meine Mutter hatte mir größten Respekt und achtungsvolles Verhalten eingeschärft, wie immer. Ich war sehr klein, viel zu klein für diese hohe Aufgabe. Sicherheitshalber, um bloß nichts falsch zu machen, schloss ich mich gänzlich ab und folgte den Anweisungen des Arztes und der Fürsorgerin ausgesprochen zögerlich. Da entschied der Arzt: „Geben wir dem Kind noch etwas Zeit.“ Wir durften gehen. Als wir draußen auf der Straße waren und ich befreit an Mutters Seite heimwärts sprang, meckerte sie mich aus: „Tut dumm, als könnte sie ihren Namen nicht sagen!“ Sie knurrte mich an und war in einem Maße verärgert, wie ich es vordem noch nie bei ihr erlebt hatte. Zu Hause verkroch ich mich in mein Zimmer und malte dunkle Regenwolken.
Spät am Abend, ich lag bereits im Bett, kam Vater heim und das Gewitter entlud sich. Meine Eltern zankten sich wiedermal. Oder diskutierten sie nur? Ich konnte es nicht verstehen, denn ich war noch viel zu klein. Später kapierte ich, worum es ging. Aufgrund meines schüchternen Wesens und meiner körperlichen Kleinheit hatten der Schularzt und die Fürsorgerin beschlossen, für mich eine sechswöchige Kur zu beantragen, mich auf dieser Kur aufzupäppeln und dem Entwicklungsniveau der Gleichaltrigen anzupassen. Diesen Antrag beziehungsweise Vorschlag betrachtete meine Mutter als harschen Eingriff in ihre ureigensten Mutterrechte. Mein Vater billigte meine Verschickung, nannte sie gut, erfolgversprechend und fand sie ausgesprochen förderlich. Eine Kur und ein Jahr Zurückstellung von der Schule würden mir nicht schaden, meinte er. Es ging eine Weile hin und her. Schließlich einigten sich meine Eltern und ich fuhr für sechs Wochen an die Ostsee.
Kinder, war das ein Erlebnis! Was für einen gigantischen, belebenden Eindruck übte das Meer auf mich aus! Ich hatte diese ungeheure Erfahrung von Größe und Weite, von grenzenloser Freiheit, die mein Leben verändern sollte. Wahrscheinlich erzähle ich hier nichts besonderes, diese Erfahrung werden viele Leser mit mir teilen. Aber als Kind übten die tiefe Bläue des Meeres und der unendlich lichte Himmelsbogen eine derart unglaubliche Faszination auf mich aus, dass alles andere weit in den Hintergrund rückte. Das gepflegte Kinderheim, der große Essensaal, die unzähligen Spielmöglichkeiten, die vielen, fröhlichen Kinder, die frischen, sehr weichen Betten, das überaus freundliche Personal nahm ich gelassen hin, ich war doch ohnehin ein ziemlich verwöhntes Einzelkind und gewöhnt, mit dem Besten versorgt zu werden, aber das Meer, dieses wunderschöne Meer krempelte regelrecht meine Seele um, wie ich noch heute weiß. Wir waren schon zwei oder drei Tage da, hatten die lange Zugfahrt, das Ankommen, verschiedene Untersuchungen und Einweisungen mitbekommen, als uns unsere Erzieherinnen festes Zeug anzogen, warme Mützen aufsetzten, den Schal nochmal festzurrten und uns hinaus führten. Wir gingen zuerst durch die sehr stille Siedlung, dann den Weg zwischen den Dünen hoch, der Wind brauste, es war ein ganz normaler Vorfrühlingstag im kalten Norden. Es lief sich schwer auf dem weichem, rutschigen Sand, mit meinen kleinen Füßen in dem derben Schuhwerk hatte ich mächtig zu tun – nichts Ungewöhnliches bahnte sich an und plötzlich öffnete sich die diesige Landschaft und ich erblickte das tosende Meer und darüber spannte sich ein stürmisch bewegtes Himmelszelt von atemberaubender Schönheit. Mir geschah die Verwandlung, meine Schale zersprang, mir wuchsen Flügel und ich war wie ausgewechselt. Und jedes Mal, wenn ich an unsere Ostsee komme, empfinde ich wieder diesen belebendem Schauder beim Eintritt in dieses Paradies.
Als mich meine Mutter nach den sechs Wochen auf dem Bahnhof wieder in Empfang nahm, erkannte sie mich kaum wieder. Sie herzte und drückte mich übermäßig. Ihr kullerten die Tränen über die Wangen und sie schluchzte: „Mein Mädel, mein liebes, kleines Mädel.“ Ich ließ mich drücken und kosen und dachte sogleich darüber nach, wie ich sie loswerden könnte, denn ich war nun kein kleines Kind mehr, sondern mächtig gewachsen. „Mutter, du bist peinlich!“, knallte ich ihr an den Kopf und schob sie barsch weg. Da traf mich ein Blick meines Vaters, ein stechender, tadelnder Blick. Mutter hatte sich so gefreut, sie hatte gebangt und gehofft, nächtelang nicht geschlafen. Kann einer Liebe so vergelten? Ich verwandelte mich wieder und wurde ihr zahmes Kätzchen wie ehedem. Hand in Hand gingen wir heim. Vater trug meinen Koffer.
Fortan hatte ich zwei Gesichter: eins für meine Mutter und eins für alle anderen. In der Schule, welche ich ab dem 1. September 1962 besuchte, war ich groß und daheim war ich klein, zahm und kuschelweich. Eine Strategie, die freilich nicht so richtig aufgehen konnte, weil die anderen mich kritisch beobachteten – wir lebten nicht im luftleeren Raum –, weil mich meine Klassenkameraden für verrückt hielten und mich ihre Bemerkungen arg kränkten. Natürlich durfte ich nicht Pionier werden und auch nicht zu den Arbeitsgemeinschaften gehen. Ich war immer noch Mittagskind und musste direkt nach dem Unterricht heim, während sich alle anderen auf dem Schulhof zum Spielen zusammenfanden, in Gruppen aufteilten und an den verschiedenen Freizeitveranstaltungen teilnahmen. Meine Mutter stand förmlich mit der Stoppuhr hinter der Tür und wartete mit dem Mittagessen auf mich. Anschließend hielt ich Mittagsruhe und dann schleppte sie mich beharrlich zur Christenlehre in ihre allein seligmachende Kirche. Das fand ich dermaßen fade und abstoßend, dass mir die Lust verging, kaum dass die Schule begonnen hatte. Ab dem zweiten Halbjahr machte ich nicht mehr mit. Irgendwie legte ich es darauf an, rausgeschmissen zu werden, und dann nur noch ein Leben, nämlich das Leben für meine Mutter führen zu dürfen und zu müssen. Ich hatte schon das Gefühl, dass mit meiner Mutter etwas nicht stimmte und dass sie der eigentliche Grund meines Unglücks war, nur wie soll ein Kind diesen Konflikt lösen? Also wählte ich die Schule ab, von der ich annahm, dass man sie abwählen könne. Ich stellte mich besonders blöd an, baute in Klassenarbeiten Fehler ein oder schrieb gleich gar nichts auf. Ich bekam haufenweise Vieren und Fünfen. Meine Mutter sorgte sich schwer, glaubte, dass ich ein Sitzenbleiber werden würde, fürchtete, dass die Leute mit Fingern auf uns zeigen würden und hatte Versagensängste. Immerhin war sie eine von Ansbach, erfolgsverwöhnt oder zumindest ehrgeizig und wollte gut dastehen vor allen. Da passte ihr mein Versagen nicht. Sie kochte mir mein Lieblingsessen – Grießpudding mit Kirschen –, fütterte mich und setzte sich dann zu den Hausaufgaben neben mich. Aber ich lernte nicht, hörte nicht auf Ansprache und tat völlig dumm. Ich wollte aufgeben.
Nun war ja meine Mutter weder herzlos noch dumm. Sie dachte nach und forschte, was mir fehle: die Gemeinschaft aller anderen! Schließlich lag es ja auch auf der Hand. Probehalber, zunächst erst einmal stundenweise durfte ich an ein, zwei Nachmittagen in der Schule bleiben, mit allen anderen Kindern an der Schulspeisung teilnehmen und anschließend zu einer der Arbeitsgemeinschaften gehen. Wobei das natürlich nicht ganz so lief, wie ich mir das vorgestellt hatte, denn auch in der Schule wurde in Klasse eins und zwei noch Mittagsruhe gehalten, was ich erst gar nicht so erbaulich fand. Aber nach dieser Pause setzte dann das gesellige Leben ein und ich blühte förmlich auf. Am meisten hatte es mir das Malen angetan. Diese Arbeitsgemeinschaft wurde von Frau Pfeifer geleitet.
Sie war eine professionelle Künstlerin, hatte ihre Werke bereits auf mehreren Ausstellungen gezeigt und war auch schon in der Zeitung erwähnt worden und wurde mein großes Vorbild, Lichtblick und Leitstern. Sie erklärte feinfühlig und geduldig, wie wir malen sollten, sie wies uns auf Fehler hin, öffnete unseren Blick für die Wirklichkeit und gab uns technisch die treffenden Hinweise. Ihre Anleitung war schon einzigartig und für mich ungeheuer hilfreich. Unter meiner Hand entstanden die schönsten Bilder. Ich vergötterte Frau Pfeifer und sie mochte mich auch, wie ich mitbekam. Sie lobte mich oft und viel. Sicher war ich nicht ganz untalentiert und Malerei interessierte mich sowieso, nur ich denke halt auch, ohne sie wäre ich wohl kaum zu Erfolg gekommen. Prompt bekam ich im Zeichenunterricht eine Eins, was auch meine Mutter erleichtert registrierte und sehr freute.
Übrigens bei uns gab es damals keine Haupt- und Nebenfächer. Alles war gleichermaßen wichtig, was auch zur Harmonie im Kollektiv der Lehrer beitrug, wobei mir diese Sphäre als Kind freilich noch verschlossen blieb. Ich erinnerte mich jedoch später daran, nach der politischen Wende, als es in den Arbeitskollektiven so richtig krachte, dass es diese wohltuende Atmosphäre bei uns im Sozialismus gab. Kein Talent, keine Arbeit, keine Berufsgruppe wurde irgendwie geschmäht. Da stand der Zeichenlehrer neben dem Deutschlehrer, wie der Müllfahrer neben dem Betriebsdirektor stand, die Putzfrau stand neben der Hochschullehrerin und der Minister neben der Bäuerin. Und wenn ein Kind nur eins konnte, wie zum Beispiel Singen oder Tanzen und darin gut war, dann wurde es gelobt und gefördert, wenngleich keine Fachidioten bei uns herangezogen wurden. Jeder sollte von allem möglichst viel mitbekommen, denn die Dynamik der gesellschaftlichen Entwicklung verlangte und bekam universell befähigte Arbeitskräfte, wie ich weiter unten noch erzählen werde. Wobei der Begriff Arbeitskräfte unser Bildungs- und Erziehungsziel nur unzureichend charakterisiert. Zunehmend ging es bei uns auch um Lebensqualität und den Lebenssinn an sich – nämlich der Mensch lebt nicht nur, um zu arbeiten, sondern er arbeitet in erster Linie, um zu leben – und der Mensch lebt erst dann richtig, wenn er auch in seiner Freizeit, etwas mit sich anzufangen weiß. Dazu braucht es die Schule, die ihn mit dem ganzen Reichtum seiner Geschichte und seiner Gegenwart vertraut macht und ihm auch Raum für seine Träume eröffnet, wie ich meine und als Kind mitbekam.
Nachdem ich im Zeichnen mit einer Eins heimgekommen war, ließ mich meine Mutter auch zu den Naturforschern und zum Technischen Basteln gehen, wodurch sich meine Zensuren in Heimatkunde und im Werken verbesserten. Überhaupt lebte ich auf, lernte fleißig, erledigte meine Hausaufgaben gewissenhaft und fand Schule einfach wunderbar. Da ließ meine Mutter gänzlich los und die Schule mit ihren Freizeitangeboten schalten und walten. Mir ging es gut und ich genoss das Leben in vollen Zügen.
Mehrmals kam unsere Gruppenratsvorsitzende mit dem Antrag zum Eintritt in die Pionierorganisation zu mir. Ich lehnte strikt ab mit der Begründung, dass ich lieber in die Kirche ginge, als in ihren Verein einzutreten, was freilich so nicht ganz stimmte. Zwar ging ich nach wie vor an den meisten Sonntagen mit meiner Mutter zum Gottesdienst und ab und an unter der Woche zur Christenlehre, denn ich war bereits alt genug, um zu begreifen, wie sehr meine Mutter an der Kirche hing und wie tief sie meine Abtrünnigkeit verletzen müsste, aber an den lieben Gott glaubte ich schon lange nicht mehr und ich gedachte auch nicht, mit ihm meine Lebenszeit auf Gedeih und Verderb zu vertrödeln. Nur in die Pionierorganisation trat ich halt auch nicht ein, aus Rücksicht auf meine Mutter. Also blieb ich, was ich war: ein aktives Mitglied unserer Pioniergruppe ohne Mitgliedsbuch und Halstuch. Außerdem genoss ich meine Sonderrolle. Nämlich als bekennende Christin umgab mich die Aura des Geheimnisvollen. Es gab immer eine Wand, an der sich die anderen stießen und was ich heimlich belächelte. Denn die wenigsten wussten, was Kirche wirklich ist: ein Haufen Langweiler.
Mein Aktionsradius wurde größer. Mit den Kameraden aus dem Mal- und Zeichenzirkel besuchten wir selbstverständlich auch Ausstellungen, um die Werke anderer Künstler anzuschauen, die Ausführung zu diskutieren und für uns etwas abzukupfern. Auf dem Weg zu den Galerien und Museen im Stadtzentrum Berlins sah ich dann die Zerstörungen, die der Krieg angerichtet hatte. Niederschönhausen, wo ich zu Hause war, hatte die Kämpfe unbeschadet überstanden, aber das große Berlin war im Wesentlichen fast vollständig zerstört worden. Zu meiner Zeit war zwar schon wieder viel aufgebaut worden und die Lücken im Stadtraum waren durch Grünanalgen und Neubauten aufgefüllt worden, aber es war noch nicht alles heil und hier und dort sah man noch Ruinen, nackte, löchrige Wände, notdürftig abgestütztes, schräges Mauerwerk. Es war gruselig und ich wendete den Blick schnell ab und zu schöneren Dingen hin. Wenn ich dann heimkam, von meinem Kunsterlebnis erzählte, kam unterschwellig immer wieder der Gedanke an Krieg hoch. Ich begann mich zu fürchten. Mit dieser Furcht vertraute ich mich meinen Eltern an. Sie zeigten mir den Ausweg: „Es ja nicht so, dass man nichts tun kann. Man kann immer etwas tun. In Niederschönhausen gab zum Beispiel Männer und Frauen, die sich selbst in dem größten Wahnsinn der totalen Vernichtung noch entgegenstemmten.“ Und sie berichteten, was sich gerade bei uns ereignet hatte.
Im April 1945 war der Berliner Ortsteil Niederschönhausen vollgestopft mit Flüchtlingen und Verwundeten. Die zwei Knaben-Gymnasien und das Mädchen-Lyzeum waren als Schulen geräumt und als Lazarette eingerichtet worden, und in den beschaulichen Villen, deren Besitzer sich bereits nach dem Westen abgesetzt hatten, hatten sich die Flüchtlinge aus den Ballungsgebieten und aus den Ostprovinzen des dritten Reiches Schutz suchend niedergelassen. Die Rote Armee eilte mit Riesenschritten in irrem Tempo auf die Hauptstadt zu und blies gerade zum letzten Sturm auf die Bastion der Faschisten, die im Berliner Stadtzentrum errichtet worden war. In der Abgeschiedenheit seiner Arztpraxis trafen sich einige Männer und Frauen um Johannes Kupke und verabredeten die kampflose Übergabe. Das war freilich äußerst riskant, weil Kapitulation verboten war, sich Militärpolizei, marodierende Banden und kopflose Scharfmacher überall herumtrieben. Unser Stadtteil war eigentlich ruhiges Terrain, die Flüchtlinge und die Kriegsversehrten unbewaffnet, allerdings gab es Waffenlager, den letzten Führerbefehl und ein paar irre, planlos feuernde Männer, die nicht aufgeben wollten. In den sehr frühen Morgenstunden des 17. April jagten die fünf Parlamentäre in einem Personenwagen mit abgedunkelten Scheinwerfern die Blankenfelder Chaussee hinauf. An der Stadtgrenze stoppten sie, stiegen aus, entrollten ein weißes Fahnentuch und liefen zu Fuß weiter. Die Bauernhäuser standen geduckt und dunkel, neblig lagen die Felder, ein nasser Wind ging, keine Menschenseele war hier draußen, kein Tier war zu sehen, selbst Vögel hörte man nicht. Unsere Männer liefen stramm weiter, ihr Herz schlug bis zum Hals. Eine falsche Bewegung, ein Irrtum, Übereifer, Rache oder Hass, alles konnte den Tod bedeuten. Sie bogen von der Straße ab und betraten freies Feld. Dort hinten, in dem sich grau und dunstig vor dem Himmel abzeichnenden Waldstück müssten die ersten sowjetischen Posten liegen, hatten sich die Parlamentäre ausgerechnet, obgleich sie es nicht genau wissen konnten. Sie liefen, sackten ein, der Boden war weich und nass, sie schwankten, bangten, zitterten und hielten die Fahne hoch. Im Osten zeigte sich ein Silberstreif. Unverzagt liefen sie weiter. Das Waldstück lag nah. Ihre Hosen waren nass, die Füße eiskalt, die Hände blutleer wie die Lippen. Sie spürten nichts mehr, nur noch ihre Angst und den eiskalten Tod. Plötzlich hörten sie ein hartes „Stoi!“ und im gleichen Augenblick waren unsere Fünf von einem Kordon Bewaffneter umringt. Sie stoppten und hielten den Atem an. Ein Sowjetsoldat trat in den Kreis und fragte barsch: „Was wollen Sie?“ Johannes Kupke antwortete: „Wir ergeben uns kampflos.“ Der Soldat gab das Zeichen, der Fahnenträger senkte das Tuch, ein Melder flitzte nach hinten, der sowjetische Sprecher sagte: „Sie kommen spät, vielleicht zu spät.“ Denn die Artillerievorbereitung erfolgte aus sicherer Entfernung nach Plänen, die langfristig ausgearbeitet worden waren. Inwieweit die Sowjetsoldaten den einmal erteilten Befehl würden rückgängig machen können, stand in den Sternen. Aber dann ging alles gut. Die Befehlskette lief retour, unsere Fünf gingen in Geiselhaft, weil es ja auch möglich war, dass die Rote Armee in eine Falle gelockt werden sollte. Dann fuhren sie eskortiert von etlichen Panzern der Roten Armee die Blankenfelder Chaussee zurück in das stark bevölkerte Wohngebiet. Das weiße Tuch flatterte im Wind. Inzwischen war die Sonne aufgegangen und bot über den nassen Feldern ein fantastisches Schauspiel aus Nebelschleiern und Licht. In den Abendstunden des 17. April 1945 war Niederschönhausen gerettet und seine Bewohner waren dem Leben wiedergeben.
Nachdem meine Eltern ihre Erzählung beendet und mich beruhigt hatten, malte ich ein Bild, das die Stimmung dieses letzten Kriegstage einschließlich seines glücklichen Endes so recht zum Ausdruck bringen sollte. Ich malte einen gewaltigen Gewittersturm und eine aufgehende Sonne. Ich malte wie besessen. Als ich fertig war, hatte ich tatsächlich ein Werk geschaffen, auf das ich stolz sein konnte. Ich war von mir selbst überwältigt. Die Farbgebung war gelungen, die Perspektive stimmte, es lag viel Bewegung im Bild und die friedliche Aussicht unter der Sonne war ebenfalls gut getroffen.
Ich verpackte mein Bild und trug es am nächsten Morgen in die Schule. Meine Klassenkameraden waren geteilter Meinung. Einige sagten nichts, andere fanden mein Bild blöd und dritte lobten mich sehr. Ich ließ mich von den Miesmachern nicht beeindrucken, ich hörte nur das Lob. Ich hielt mich für eine große Künstlerin und legte das Bild am Nachmittag unserer Arbeitsgemeinschaftsleiterin, Frau Pfeifer, vor. Auf ihr Urteil kam es mir an. Sie schaute, wiegte den Kopf und sagte dann: „Nicht schlecht.“ Mein Herz stand still. Ich wartete bange. Und nach einer Weile vertiefte sie: „Wirklich nicht schlecht. Wir könnten es zum Wettbewerb einreichen.“ Ich jubelte vor Glück und Freude. Wirklich und wahrhaftig! Ich fühlte mich dermaßen geehrt und gelobt und bestätigt durch das Wort der gestandenen Künstlerin, dass ich vor Glück fast platzen wollte. Ich war mir völlig sicher, dass ich den ersten Preis bekommen würde, denn nicht jeder wurde eingereicht und nicht jeder malte so wie ich. Mir schwebte auch sofort wieder eine riesige Künstlerkarriere vor. Nämlich der oder die Sieger dieses Wettbewerbs wurden auf die Kunsthochschule delegiert und durften dort Malerei studieren.
An diesem Tag kam ich vor Aufregung und Vorfreude nicht mehr zum Malen. Ich vertrödelte meine Zeit vor der Staffelei, brachte nichts fertig, guckte Löcher in die Luft und träumte mich in eine glorreiche Zukunft. Als wir einpackten und aufräumten, sagte Frau Pfeifer noch: „Du musst dein Bild signieren und lege es dann dahin.“ Sie zeigte zu der Ablage, wo sie immer die Auserwählten aufbewahrte. Ich schrieb meinen Namen winzig klein, bescheiden und zittrig auf die Rückseite, vorn wollte ich nichts verderben, und legte mein Kunstwerk an die richtige Stelle.
Und dann kam Warten, Warten und nochmals Warten. Ich bangte und hoffte. Ich wurde ungeduldig und rief mich gewaltsam zur Ruhe. Die Tage dehnte sich unendlich und machten jede Stunde zur Qual. Ich konnte nichts anderes mehr tun, als an mein Werk zu denken. Ich malte mir die glücklichsten und die schlimmsten Szenen aus. Allmählich zermürbte mich das Warten. Ich lief wie verrückt, wie völlig vernagelt in der Gegend herum. Nur leider tat sich auch nach Wochen noch nichts. Ich sprach Frau Pfeifer an. Sie sagte: „Ach, Kindchen, manche Dinge brauchen ihre Zeit“. Ich fühlte mich nicht getröstet, sondern beleidigt von diesem „Kindchen“. Mit zwölf Jahren ist man kein „Kindchen“ mehr!
Kaum eine Woche später nannte uns Frau Pfeifer die Preisträger des diesjährigen Wettbewerbs, alles Namen, die mir nichts sagten, von Maltalenten aus anderen Schulen. Ich war nicht dabei. Ich fasste es nicht und erfasste es doch. Ich war so enttäuscht, dass ich mich sofort abwendete. Frau Pfeifer lud uns alle zum Ausstellungsbesuch ein: „Da werden durchweg gute Sachen gezeigt, es lohnt in jedem Fall.“ Diese Wettbewerbe hatten tatsächlich ein hohes Niveau. Nur für mich war das in dieser Stunde nichts. Ich winkte ab und verzog mich in mein Mauseloch.
Nun hätte ich die Malerei eigentlich an den Nagel hängen wollen und brachte es dann doch nicht fertig. Nachdem ich lange genug geschmollt hatte, fügte ich mich in mein Schicksal. Ich fand mich ab, nahm wieder den Pinsel zur Hand und malte halbwegs hübsche Bilder. Was soll schon sein, dachte ich immer noch pikiert, es muss auch drittklassige Maler geben. Am Schuljahresende kamen die eingereichten Werke von der Jury zurück. Meins war nicht dabei. Mir war auch das egal geworden. Ich forschte nicht nach, obgleich ich meine „Werke“ normalerweise wie einen Augapfel hütete und fein säuberlich in einer Mappe aufbewahrte. Mit der Zeit wurde ich besser und vergaß die Enttäuschung. In Klasse acht und Klasse neun reichten wir wieder Bilder von mir ein. Die schwache Hoffnung auf eine Künstlerkarriere hegte ich nach wie vor. Ich belegte einmal einen siebenten und einmal sogar einen dritten Platz. Ich fand mich leichter als zuvor mit meiner künstlerischen Mittelmäßigkeit ab, denn ich hatte mich derweil anders entschieden. Eine Künstlerin wollte ich nicht mehr unbedingt werden. Mir schwebte Geflügelzüchterin als Traumberuf vor. Nach bodenständiger, erdiger Arbeit stand mir der Sinn.
Nämlich ich war zugleich auch die Tochter meines Vaters, der ursprünglich als Knecht gearbeitet hatte und groß geworden war, und wollte nun als Bäuerin in seine Fußstapfen treten. Leben und arbeiten auf dem Dorfe erschien mir derweil als das Größte. Probehalber gab es dafür das Pionierhaus am Rande unserer Siedlung, in Berlin-Blankenfelde. Dort konnte man sich erste Sporen als Landwirt verdienen, viel lernen und sich bei abwechslungsreicher Arbeit an der frischen Luft austoben und ausleben. Das Pionierhaus war eine riesige Anlage mit Waldstücken, Ackerfläche, Tiergehegen, Gewächshäusern und Lehrkabinetten. In kleinen Trupps, immer unter der Anleitung von Mitarbeitern des Hauses, zogen wir über die Felder und durch die Ställe und erledigten, was zu erledigen war: Aussaat, Pflanzenpflege, Ernten, Tierpflege, Füttern, Ausmisten, wie in der richtigen Landwirtschaft, nur nicht ganz so groß und ganz so intensiv, wie es in den echten landwirtschaftlichen Produktionsbetrieben gang und gäbe ist. Wir waren Kinder und sollten uns auch erholen, spielend lernen. Die Arbeit machte mir Spaß, ich sah, was geschaffen wurde, und die Geselligkeit im Kollektiv tat das Ihrige. Ich liebte besonders die lustig gackernden Hühner in ihren Freigehegen. Kein Wunder, dass daraus mein Berufswunsch wurde.
Eines Tages saß bei uns ein fremder Mann am Küchentisch. Meine Eltern und er unterhielten sich angeregt. Das war an sich nichts Außergewöhnliches. Bei uns kehrten oft Arbeitskollegen meiner Eltern ein. Meine Mutter war inzwischen auch berufstätig geworden. Sie arbeitete erst als Stationshilfe im katholisch geführten Krankenhaus St. Elisabeth und recht bald dort auch als reguläre Krankenschwester im Schichtbetrieb. Für meine Eltern und deren Kollegen gab es immer viel zu besprechen. Außerdem war mein Vater gesellschaftlich sehr aktiv. Nachbarn gingen bei uns ein und aus, wenn sie etwas zu erzählen hatten oder etwas brauchten. Unsere Tür stand praktisch immer offen. Ich kümmerte mich in der Regel eher weniger um die Gäste meiner Eltern. Diesmal erregte der Besucher jedoch meine Neugierde, sodass ich eintrat und blieb.
Der Mann hieß Joseph Sochor und stammte wie meine Mutter von dem Gutshof im Schlesischen, den die Familie von Ansbach bis zum Jahr 1945 besessen hatte. Er war aus Polen zu uns herübergekommen und knüpfte soeben neue Bande zu seiner ehemaligen Dienstherrschaft, deren einer Spross meine Mutter schließlich war. Seit der Vertreibung der von Ansbach aus dem polnischen Zarowiće waren an die fünfundzwanzig Jahre vergangen. So erzählten sich meine Mutter und Herr Sochor einander hingebungsvoll putzige Geschichten, von denen ich natürlich nur die Hälfte verstand. Aber ich spürte ganz deutlich, wie glücklich sie über ihr neuerliches Zusammentreffen waren. Zwar fand ich es albern, wie Herr Sochor meine Mutter beständig als „gnädige Frau“ ansprach, liebedienerte und sie umschmeichelte. Nur ich sah dann darüber hinweg, weil ich doch wusste. wie schrullig und merkwürdig alte Leute manchmal sein können. Nichtsdestotrotz gefiel mir Herr Sochor ausnehmend gut, weil er ein Bauer war, weil ich seine Berichte unglaublich interessant fand und weil sie mich gewissermaßen auf mein Lebensziel hinlenkten.
Am Ende lud er uns alle zu einem Gegenbesuch in seine ferne Heimat ein. Meine Eltern waren nicht sogleich und so leicht von einem Ausflug nach Polen zu überzeugen. Nämlich wir verreisten damals nicht, wie es allseits bereits üblich geworden war – meine Mutter erlaubte mir auch keine Ferienfahrten mit Schulkameraden –, aber nachdem ich dann genug gedrängelt und Herr Sochor seine Einladung mehrfach wiederholt hatte, stimmten meine Eltern doch zu. Im Sommer des Jahres 1970 brachen wir zu einem dreiwöchigen Urlaub in die Volksrepublik Polen auf. Zuerst führten wir tagelange Diskussionen, was wir an Kleidung und an anderen Utensilien brauchen würden. Anschließend packten wir mehrere Koffer, Taschen und Körbe. Dann nahmen wir Abschied von meinen Freunden und von unseren Nachbarn. Wir reisten damals nicht mit der gleichmütigen Selbstverständlichkeit, wo einer einfach mal ein paar Sachen in sein Täschchen wirft, die Türe zuklappt und fort ist. Wir bereiteten uns vor, als würden wir Jahre unterwegs sein, und steckten mit unserer Aufregung selbstverständlich auch unsere ganze Umgebung mit an. Dann ging es zum Bahnhof. Natürlich nahmen wir ein Großraumtaxi, weil wir die Berge an Gepäck überhaupt nicht mit den öffentlichen Verkehrsmitteln bewältigen konnten.
Auf dem Bahnhof war ich ebenso stark beeindruckt von dem gigantischen Verkehr. Ich kam aus dem Staunen nicht mehr heraus. Wir wuchteten unser Gepäck in den Wagen hinein, wobei der Taxifahrer und andere Reisende bereitwillig mit zugriffen. Als alles soweit verstaut war, nahmen wir unsere Plätze ein und es ging los. Eine Zugfahrt, eine richtige Zugfahrt hat schon was. Wir packten unsere Brote aus, begannen zu essen und fingen Gespräche mit den Mitreisenden an. Wir beantworteten Fragen nach dem Woher und Wohin und hörten auch von den Zielen der anderen Leute. Wir schauten aus dem Fenster, bewunderten die sich verändernde Landschaft und machten einander auf Sehenswertes aufmerksam. – Verglichen mit heute war Reisen dazumal wirklich ein ganz großes Abenteuer, ein fast einmalige Gelegenheit, etwas zu erleben, und an Abwechslung und Wissenszuwachs kaum mehr zu überbieten. Damit will ich den Fortschritt nicht kleinreden, denn er erfüllt seinen Zweck, und der Blick aufs Display oder die Mattscheibe und die Stöpsel im Ohr mögen einem die Zeit bis zur Ankunft angenehm verkürzen. Nur wenn einer überhaupt nicht mehr mitbekommt, wo er sich befindet, und nicht mehr registriert, was außerhalb seiner virtuellen Welt passiert, dann mag er auch zu Hause bleiben, meine ich. Ist es nicht interessant zu erfahren, wohin einer fährt und welche Motive er hat? Will keiner mehr wissen, wie es dem anderen geht? Das scheint mir auch ein wenig ungesund zu sein. Wir hingegen verplauderten die Zeit mit den Mitreisenden, wobei wir auch manchmal, wenn uns der Gesprächsstoff ausging, nach einem Buch oder einer Zeitung griffen. Im Wesentlichen schauten wir jedoch herum und nahmen schon mal Tuchfühlung mit Land und Leuten auf, machten uns mit den Gepflogenheiten vertraut und erweiterten unser Blickfeld. – Nach ein paar Stunden erreichten wir Opole. Auf dem Bahnsteig gab es ein großes Gewühl hin und her eilender Menschen mit suchenden Blicken und überschwänglich freudigen Umarmungen. Und da stand auch schon eine Abordnung aus Zarowiće, Leute aus dem Geburtsort meiner Mutter, die uns erwarteten, uns umringten, begrüßten, unser Gepäck ergriffen, und uns zu den bereitstehenden Wagen auf dem Bahnhofsvorplatz führten.
Unsere polnischen Gastgeber hatten ein unglaubliches Programm für uns vorbereitet. Wir lernten die Leute in ihrem Umfeld, in ihren Wohnungen, mit ihren Familien, auf ihren Arbeitsstellen und beim Feiern kennen. Wir besichtigten Burgen, Schlösser, Museen und besuchten die Gottesdienste in den Kirchen. Wir hörten Konzerte mit Kompositionen von Robert Schuhmann, Franz Liszt, Felix Mendelssohn Bartholdy und Fryderyk Chopin, vor allem von Chopin, der von allen Musikern und Hörern hochverehrt und von jung und alt meisterhaft dargeboten wurde.
In seinem Schaffen und Werk legt Fryderyk Chopin Zeugnis ab für das Leben und Leiden des tausendfach geschlagenen, zerrissenen, gestorbenen und wiederauferstandenen polnischen Volkes. Noch während seiner Schulzeit schloss sich der junge Fryderyk den Revolutionären an und trat an die Spitze des Warschauer Aufstandes von 1830. Der Aufstand wurde brutal niedergeworfen von den vereinigten Truppen der russischen, sächsischen und preußischen Monarchie. Die Reaktion wütete grausam. Das Land wurde aufgeteilt, die Geistesschaffenden samt und sonders verfolgt und in der Mehrzahl ermordet, Handwerker, Arbeiter und Bauern wurden unter die Knute der Fremdherrschaft gebracht, die polnische Sprache verboten, sämtliche Schriften verbrannt und Schulen geschlossen. Deutsche, russische und sächsische Landadlige und Bourgeois rissen sich den Boden, die Werkstätten und die Gruben unter den Nagel und hatten von da an das Sagen. Nachdem sich die Reaktion abreagiert und ausgetobt hatte, bekamen die restlichen Polen eine kümmerliche Überlebenschance. Kein Kind durfte mehr Polnisch sprechen, patriotisch eingestellte Intellektuelle waren nach wie vor unerwünscht. Wer bei Zuwiderhandlung erwischt wurde, landete auf dem Schafott. Eine ganze Generation junger Polen wanderte aus, unter ihnen Fryderyk Chopin, der begabte Komponist. Er verdiente sich fortan das harte Brot des ungeliebten Emigranten. – Es führe hier zu weit, würde ich den wirtschaftlichen und kulturellen Aufstieg Mittel- und Westeuropas anhand des polnischen Aderlass’ ausführlich beschreiben wollen. Nur soviel dazu: Kein Schornstein in Berlin hätte geraucht ohne die schlesische Kohle, keine Turbine wäre bei Borsig gebaut worden ohne das Geschick polnischer Mechaniker, niemand hier in unserer Gegend hätte seine Haut ausreichend bedecken können ohne die Tuche der schlesischen Weber und so manche mittelständische Berlinerin hätte schlampig in die Oper gehen müssen, wenn ihr nicht ihr polnisches Zimmermädel die Kleidung zurechtgemacht hätte. – Fryderyk Chopin kam bis Paris. Allein, es war ihm nicht vergönnt, in der Stadt der Liebe Fuß zu fassen, oder zu gut Deutsch, den revolutionären, glühenden, polnischen Patrioten wollte auch an der vielgepriesenen Wiege der europäischen Kultur keiner haben. So spielte und komponierte er für einen Hungerlohn, bis er im Alter von nur neununddreißig Jahren verstarb. Es ist überliefert, dass er sich vor Heimweh verzehrte. Seine Musik verewigte polnisches Liedgut und polnische Tänze. Diese Werke überlebten und wurden nach über einhundert Jahren in ihre Heimat zurückgeholt.
Ich hörte das virtuose Spiel und ward hingerissen inmitten eines sowohl sachverständigen als auch begeisterungsfähigen Publikums.
Meine Mutter war ebenfalls begeistert. Beglückt und verzückt ging sie überall herum und zottelte mich mit. Sie zeigte mir die Gegend ihrer Kindheit und frühen Jugend, wo sie gespielt, gelernt, Freunde getroffen und Feste gefeiert hatte und wo sie konfirmiert worden war. Allerdings waren die Zeugnisse und Spuren der von Ansbach in Zarowiće dünn gesät, denn auch in Polen war die Zeit nicht stehengeblieben. Das Gutshaus war zur Schule umgebaut, die Ländereien an Bauern aufgeteilt und die kleine, ländliche Kirche nur mäßig besucht. Mutters Vorträge langweilten mich bald. Ich rückte von ihr weg und neigte mich mehr zu unserem Gastgeber, Joseph Sochor, hin. Er nahm mich dann an die Hand, zog mit mir über Land, zeigte und erklärte mir alles. Durch ihn lernte viel über Landwirtschaft. Nur leider stellte er mich überall als eine „von Ansbach“ vor den Leuten heraus, was ich ein bisschen peinlich fand. Nichtsdestotrotz waren mir die polnischen Männer und Frauen dennoch alle sehr zuneigt, wie ich meinte. So kam ich herum, sah sehr viel und fühlte mich ausgesprochen wohl. Das war ein wunderschöner, sehr abwechslungsreicher und zu Herzen gehender Urlaub. Wir reisten wir wieder heim.
Zu Hause träumte ich unaufhörlich von dieser unvergesslichen Zeit und hätte gern mehr davon gehabt. Bis zu den nächsten Ferien, das waren die Herbstferien ab Mitte Oktober, hatte ich meine Mutter dann soweit, dass ich allein nach Zarowiće fahren durfte. Sie musste ja arbeiten gehen, Gott sei dank. Nämlich ich wollte erwachsen sein und das Abenteuer gern allein erleben und in vollen Zügen genießen. Ich packte mir ein paar Sachen zusammen – viel war wirklich nicht mitzunehmen, weil für uns in Polen alles vorhanden und die dortigen Leute ausnehmend gastfreundlich gewesen waren – und sauste gleich am Sonnabend nach der letzten Unterrichtsstunde los. Vom Bahnhof in Opole holte mich Joseph Sochor ab und chauffierte mich wie eine Fürstin mit dem schicken Wagen ins Dorf. Ich logierte in seinem sehr hübschen, leicht altertümlichen Bauernhaus. Alles wurde für mich vom Feinsten und Besten hergerichtet. Ich bekam ein wunderbar weiches Bett, reichlich Essen und Trinken sowieso, aber auch Unterhaltung und Ausflüge, soviel ich nur haben wollte. Und immer war jemand für mich da, der mich hierhin oder dorthin begleitete, der für mich übersetzte und vermittelte, denn ich konnte ja kein Polnisch und war im Grunde fremd. Joseph Sochor gab mir auch Geld, sehr viel Geld, das ich auf dem städtischen Markt in Opole nach Belieben ausgeben durfte, was ich zunächst gut fand, denn ich wurde von daheim mit Taschengeld äußerst knapp gehalten. Ich kaufte viel Tinnef.
Alsbald wurde ich der Fülle überdrüssig, kapselte mich ab, ging allein spazieren und genoss die herrliche Natur. Überall arbeiteten die Bauern: im Wald, auf dem Feld, in den Ställen und auf den Höfen. Ich drückte mich neugierig herum. Die Leute wurden aufmerksam und luden mich ein. Und weil sie nun alle zu tun hatten, fasste ich auch mit zu. Was musste ich rumstehen und gaffen, während alle anderen arbeiteten? Ich begriff schnell und war wohl auch geschickt, jedenfalls wurden wir rasch eins und freundeten uns an. Ich war mittendrin und dabei. Mir gefiel ihre Lebensart und ich liebte die Atmosphäre, die Gegend und die Leute. Mit der Sprache haperte es auch bald nicht mehr. Wir verständigten uns leicht. Ich war höflich und fleißig. An den Abenden zog ich mit der Dorfjugend um die Häuser. Das passte ebenfalls ausgezeichnet. Ich war reine verrückt nach den Vergnügungen und dem geselligen Leben. Denn viel mehr und viel fantasievoller und aufgeschlossener, als es bei uns üblich war, wurden Musik, Tanz und Gesang jederzeit improvisiert, an jeder Ecke und zu fast jeder Stube trafen sich die Menschen, redeten, lachten, speisten und feierten ausgelassen. Da schlug mein Herz dann hoch und höher. Viel zu rasch verging die Zeit. Beim Abschied versprach ich wiederzukommen. Ich fuhr heim.
Zu Hause erzählte ich begeistert von diesem Urlaub und was ich alles erlebt hatte. Meine Mutter freute sich mit mir. Immer wieder sprachen wir von Zarowiće, was es dort alles gibt und wie wunderbar es dort ist. Insofern ich mich von meiner Mutter ein wenig entfernt hatte, rückte ich nunmehr wieder enger mit ihr zusammen, weil wir ein gemeinsames Thema, eine gemeinsame Liebe und Sehnsüchte hatten. Die nächsten Ferien kamen, ich sauste wieder los und verbrachte erneut einen wunderschönen Urlaub in Zarowiće und mit den Menschen dort, die mir alle lieb und teuer waren.
In der zehnten Klasse musste ich mich für eine Lehrstelle entscheiden. Nun hatte auch ich die Qual der Wahl.
Das ganze Prozedere muss man sich natürlich nicht so vorstellen, wie es heutzutage abläuft, indem so ein kleiner Stift allein oder mit seinen Eltern, die Bewerbungsmappe unterm Arm monatelang Klinkenputzen geht, sich anstellt, wartet, bangt, hofft, Absagen kassiert, sich wieder anstellt, bittet und bettelt, bis er endlich die Zusage bekommt, oder auch nicht. Nach der Konterrevolution habe ich miterlebt, wie jungen Menschen und ganze Familien an diesem fürchterlichen Bewerbungsmarathon kaputtgingen. – Übriges steht hier der historische Marathonlauf nicht zufällig als sprachliches Gleichnis. Immerhin berichtet die Sage, dass der Bote am Zielort tot zusammengebrochen sei. – Genauso erging und ergeht es vielen Jugendlichen im Kapitalismus. Ich habe gesehen, wie Eltern ihre unter größten Opfern liebevoll aufgezogenen Kinder, gesunde, junge Menschen, wie übelriechende Ware anboten und eine Klatsche nach der anderen einstecken mussten und daran zerbrachen. Das unsägliche Leid, das der kapitalistische Verwertungsprozess, dieses brutale Auswahlprinzip, die hochgelobte Freiheit, ja die ach so heilige Marktwirtschaft über die Kinder und ihre Eltern bringt, zeigt sich gerade und besonders deutlich in der vorgeblich freien Wahl des Arbeitsplatzes. Das kann man sich noch so schönreden, da kommt nichts Menschliches mehr herüber. Da geht es um die nackte Existenz, da heißt es, friss oder stirb. Nichts ist unfreier als der „freie Arbeitsmarkt“ und nichts ist brutaler als Jugendliche im zarten Alter von sechzehn auf eben diesen Markt zu werfen. So betrachtet, war Sklavenhandel noch ein Wohlfahrtsunternehmen. Der Sklave wurde wenigstens noch ernährt, gewärmt, gekleidet und beschützt, solange er in arbeitsfähiger Verfassung war und sich den allgemeingültigen Regeln seines Abhängigkeitsverhältnisses bereitwillig unterwarf. Der Sechzehnjährige in unserer heutigen, fortgeschrittenen, kapitalistischen Gesellschaft kann sich noch so freiwillig unterwerfen, bereitwillig und gekonnt anpassen, er landet trotzdem auf der Straße, wenn es der Privatunternehmer will.
Seinerzeit bei uns erfasste die Berufskommission der Schule und beim Rat des Stadtbezirkes frühzeitig die Wünsche der künftigen Schulabgänger und verteilte die Berufsanwärter dann auf die ebenfalls zentral erfassten, passenden Ausbildungsplätze respektive weiterführenden Schulen, sodass unsere Berufswahl beziehungsweise der Übergang von der Schule zum Arbeitsleben fast automatisiert vonstatten ging.
Natürlich ward uns dazumal der neue Lebensabschnitt nach allen Regeln der Kunst bewusst gemacht. Wir schrieben im Deutschunterricht fein säuberlich unseren Lebenslauf auf und fertigten dazu ein Bewerbungsschreiben an, aber im Grunde war das alles nur noch eine Formalie, eine Übung in Schönschrift und letztendlich ein Mittel zur Stärkung unseres Selbstvertrauens. Denn wer sich einmal konzentriert mit seiner eigenen Biografie beschäftigt hat, begreift sich zugleich als außerordentliches, herausragendes Individuum in seiner sozialen Gruppe sowie als Teil des Ganzen, weil sich das Individuum und das Kollektiv in Wirklichkeit nämlich nicht ausschließen, wie uns die neoliberalen Klugschwätzer heutzutage weismachen wollen, sondern einander bedingen, befördern und nach vorne bringen. Der einzelne ist ohne alle anderen nichts, wie ich weiter unten noch vertiefen werde. In diesem Sinne beugten wir uns im Deutschunterricht über unseren Lebenslauf und das Bewerbungsschreiben, formulierten alles gründlich aus und legten es handschriftlich sehr sauber nieder, um es dann bei der Berufskommission einzureichen, einen Ausbildungsplatz und unsere künftige Wirkungsstätte zu finden.
Selbstverständlich waren seinerzeit bei uns über die kollektive Tat hinaus auch Initiativbewerbungen möglich. Wer sich allein kümmern wollte und vorzeitig kümmerte, ward nicht gebremst und durfte dann auch bei entsprechender Eignung seinen Traumberuf erlernen. Ich wollte immer noch Geflügelzüchterin werden und hätte mir gern meine Stelle allein ausgesucht.
Damit bekam ich mit meiner Mutter ein echtes Problem, weil sie mich nämlich künftig gern in dem polnischen Zarowiće gesehen hätte. Welche Denkweise bei ihr dahinter steckte, welche angestaubten Vorstellungen sie hatte, bekam ich damals freilich nicht gleich mit. Erst mit dem Abstand der Jahre lernte ich etwas über Vertriebenenverbände und Reaktionäre, die nur darauf warteten, die Errungenschaften Arbeiterrevolution rückgängig zu machen, und dass gerade die noch immer recht rückständig organisierte Landwirtschaft in der Volksrepublik Polen den geeigneten Nährboden für allerlei Spekulationen bot und eine regelrechte Brutstätte für die Restauratoren des Kapitalismus war. So habe ich dann begriffen, wie sehr meine Mutter und Joseph Sochor über mich die alten Herrschaftsverhältnisse aufrechterhalten respektive rein äußerlich nach wie vor demonstrieren wollten. Eine „von Ansbach“ in Zarowiće, das wäre doch mal wieder was gewesen! Da hätte man doch ein Zeichen setzen können! So rangen die beiden um meine Gunst, um mich als ein „von Ansbach“ in Zarowiće anzusiedeln. Allerdings will ich weder meiner Mutter noch Joseph Sochor etwas Böses unterstellen. Ich glaube nicht, dass sie einen konterrevolutionären Umsturz ins Auge gefasst hatten. Sie waren halt nur in den alten Denkmustern befangen. Ihr Gefühl war mehr rückwärtsgewandt, weil sie einfach nicht loslassen und akzeptieren konnten, und bezogen mich in ihre nebulösen Pläne mit ein. Freilich, hätte ich gewusst, wie alles kommt, wäre ich eventuell auf ihr Angebot eingegangen, schließlich sollten Grundbesitz und Geld beziehungsweise eine ganz böse Existenznot in meinem weiteren Leben noch eine große Rolle spielen. Damals schwamm ich jedoch nicht im Fahrwasser von Revanchisten und Reaktionären. Ich war der sozialistischen Landwirtschaft meiner Heimat zugeneigt. Und so kam es zwischen mir und meiner Mutter zu einer heftigen Auseinandersetzung.
Sie sagte: „Du kannst in Zarowiće innerhalb kürzester Frist ein Vermögen machen und dir das Paradies einrichten.“ Ich entgegnete: „Wovon? Ich besitze nichts und ich kann nichts“, und meinte, dass auch in der benachbarten Volksrepublik Ausbildung, Fachwissen und vor allem umfangreiche, sprachliche Fertigkeiten etwas gelten müssten. Ich käme dort wie ein unbeholfener Anfänger, mittellos und ratlos an. Meine Mutter vertiefte mit naiver Selbstverständlichkeit: „Joseph Sochor wird dich in jeder Beziehung unterstützen.“ Frohlockend strahlte sie mich an. Ich legte keinen Wert auf derartige Beziehungen. Ich wollte selber etwas aus meinem Leben machen, mich selbst durchboxen, mich allein bewähren. Zugleich erinnerte ich mich an den Mann mit seiner großtuerischen Art, wie er mich empfangen, verwöhnt und letztendlich gegängelt hatte. Ich sagte: „Ich mag nicht nach Zarowiće gehen, so allein und ohne Beistand“, und fragte misstrauisch geworden: „Willst du mich loswerden?“ – „Bewahre!“, antwortete sie spontan und das läge ihr fern. Aber sie ließ mich auch nicht mehr in Ruhe. Sie redete und redete beschwörend auf mich ein, und je länger sie redete, umso idiotischer wurden ihre Argumente. Sie sprach von Heimatliebe und Familienbanden, von Treue, Tradition und vom Adel der Geburt, was ich ziemlich blödsinnig fand. Freilich war mir Zarowiće als Urlaubsort lieb gewesen, nur diese Liebe langte bei mir nicht für den Rest meines Lebens. Meine Mutter ließ sich immer theatralischer aus und ich verstand sie immer weniger. Da rastete ich völlig aus: „Pass auf, Alte! Wenn du ohne Bildung ein Leben lang so durchgekommen bist, bitte schön. Ich will einen richtigen Beruf lernen. Lass mich mit dieser Scheiße in Ruhe!“ Damit war ich durch. Meine Mutter brach förmlich zusammen, weinte zum Gotterbarmen, herzergreifend und todunglücklich. Ich strich jegliches Mitgefühl aus, ging hinaus und ließ sie heulen.
Spät am Abend kam Vater in mein Zimmer und setzte sich zu mir auf die Bettkante: „Schläfst du?“ Ich schlief noch nicht, denn ich war zutiefst betroffen, verärgert und irritiert. Ich knurrte: „Nein.“ Vater sagte leise und sehr spitz: „So geht man nicht mit Menschen um.“ Ich horchte auf und merkte, dass ich grundlegend etwas falsch gemacht hatte. Ich sagte: „Ich entschuldige mich.“ Er erwiderte: „Eine Entschuldigung tut es nicht. Die kannst du dir schenken. Lass dir was einfallen. Und merke dir eins! Merke dir für dein ganzes Leben, so geht man nicht mit Menschen um!“ Er stand auf und wendete sich ab. Ich blieb im Dunklen allein. Aus dieser Episode habe ich gelernt, dass man das, was man selbst nicht erleiden will, niemals anderen antun sollte. Ja, meine Mutter hatte sich vor mir erniedrigt, ja, sie hatte geweint und gebettelt und sie war gründlich auf dem Holzweg. Das gab mir aber noch lange nicht das Recht, hier dermaßen ungebührlich hineinzutreten.
Am nächsten Tag war meine Mutter wie ausgewechselt. Ich dachte, ich höre nicht richtig. Plötzlich schlug sie mir vor, mich bei der Suche nach der Lehrstelle zu begleiten. Freilich war ich es gewöhnt, dass meine Eltern alles für mich regelten und mir jeden Wunsch erfüllten. Aber das wollte ich nun auch wieder nicht. Ich wollte mich selbst kümmern. Ich wiegelte ab. Sie blieb dran. Sie hielt mich auf der Couch im Wohnzimmer fest, breitete Karten und Papier aus und fragte mich nach meinen Wünschen aus. Und langsam, ganz langsam dämmerte es mir. Nämlich Vater hatte ihr ein Auto versprochen, wenn sie mich nach eigenem Gutdünken entscheiden lässt. Meine Mutter wünschte sich schon seit Jahren ein Auto, denn sie war ja von früher her einen gehobenen Lebensstandard gewohnt. Vater hingegen hatte sich stets vehement gegen ein Auto ausgesprochen, weil wir die öffentlichen Verkehrsmittel vor der Haustür hatten und preisgünstig jederzeit nutzen konnten. Er hielt Mutter dann auch vor: „Wozu brauchst du ein Auto und vor wem willst damit angeben?“ Da fühlte sie sich ertappt und sagte nichts mehr, obgleich sie normalerweise überhaupt nicht zimperlich war. Aber auf ihre verpfuschte Vergangenheit angesprochen, knickte sie ein wie ein Hälmchen im Wind. Nun hatte Vater ihr ein eigenes Auto zugestanden. Und schon erklärte sie mir: „Da können wir in Ruhe herumfahren und für dich was Schönes suchen, ja?“ Sie strahlte mich wieder an, meine liebe, arme Mutter! Mein Widerstand schmolz wie Schnee in der Frühlingssonne. Ich war auch froh, dass der Haussegen wieder gerade hing.
Ich weiß nicht, wo mein Vater so plötzlich das Auto hergenommen hat. Wahrscheinlich hat er wiedermal seine Beziehungen zum Amt spielen lassen. Egal, wie dem auch sei, mit dem Auto wurde alles gut. Mutter und ich gondelten ein paar Tage lang in den Bezirken Rostock, Schwerin und Neubrandenburg herum. Wir suchten und fanden für mich eine Leerstelle in Neuendorf bei Parchim. Dort gab es ein großes Ausbildungszentrum, wo viele Lehrlinge aus der ganzen Republik zusammenkamen. Ziemlich stolz setzte ich meinen Namen, Ilona Schimmel, unter den Lehrvertrag. Mein Gott, fühlte ich mich erwachsen mit meinen siebzehn Lenzen. Ich war glücklich und zufrieden und Mutter war es auch. Von Joseph Sochor und Zarowiće hörte ich viele Jahre lang nichts mehr. Das polnische Dorf war einfach kein Thema mehr zwischen meiner Mutter und mir. Ich fuhr auch nicht mehr auf Urlaub dorthin, denn ich hatte ja jetzt alles, was ich mir wünschte: Tiere, die herrliche Natur, kleine Häuser, eine winzige Siedlung, fleißig schaffende Bauern ringsherum und ich mittendrin in dem fröhlichen, erdigen Treiben.
Wie enttäuscht war ich dann, als ich das erste Mal den Hühnerstall in Neuendorf betrat. Unglaublich, was ich dort sah. Allein das Wort Enttäuschung trifft es nicht. Ich war entsetzt und wollte weglaufen. Allerdings läuft man nicht weg, wenn man in einer Gruppe aus dreißig frischen Lehrlingen unter der Führung eines überaus selbstsicheren, von seiner Sache überzeugten und redseligen Lehrmeisters einen Stall betritt und erste Erklärungen anhört. Ich war wie gelähmt, starrte die langen Reihen Käfige an, sah die gackernden und pickenden Hühnerchen hinter den Stäben und dachte: Das kann doch nicht wahr sein! Dreitausend Hennen unter einem Dach, exakt aufgereiht in ihren Gefängnissen, vorne ein Futterband und hinten das Band zur Eiablage – so hatte ich mir das nicht vorgestellt! Meine Erfahrungen und mein Träume von Landwirtschaft gingen anders: gemischte Viehhaltung in Gehegen und Buchten, dazu weitläufigen Auslauf, grüne Wiese, goldgelbe Felder, rauschende Wälder, strömende Bäche, spiegelblanke Seen und zwischen all der Herrlichkeit der Bauer und die Bäuerin, die je nach Bedarf hier und dort etwas richten. Ich hatte mir Landarbeit nie einfach vorgestellt, bewahre, ich wusste, wie hart sich so mancher Bauer mitunter schindet, um Fleisch, Milch, Eier und Mehl am Ende herauszubekommen. Ich wollte auch keine Bequemlichkeit, im Gegenteil, ich wollte mich beweisen und kräftig zupacken, aber an Fließbandarbeit in hochtechnisierten Anlagen dachte ich nicht, als ich mich für diesen Beruf entschied. Freilich lief ich nicht weg, sondern hörte mir das alles erst einmal an. Denn eine Sache nach dem ersten missglückten Anlauf hinzuschmeißen, war sowieso nicht mein Ding.
Wir bekamen unsere Arbeitsaufgaben und es ging los. Unser Lehrmeister – er hieß Herr Hofmann – machte es uns vor und teilte jedem von uns ein paar Käfige zu. Ich griff zum Schieber und begann die Kotflächen zu reinigen, lustlos und schlecht motiviert, ganz auf mich gestellt in dieser riesengroßen Halle. Nach einer Weile kam Herr Hofmann zu mir, feuerte mich an, lobte mich und korrigierte meine Handgriffe. Er sagte noch ein paar kluge Sprüche und ging dann zum nächsten Lehrling, der da ebenfalls verbissen, völlig vereinsamt und demütig seine Fron ableistete. Nach Feierabend ging ich ins Wohnheim, war fix und fertig, haute mich in mein Bett und fand die Welt ungerecht und grausam. Am nächsten Morgen nahm ich die Last wieder auf und machte weiter.
Alsbald lernte ich dann, dass industriemäßige Tierproduktion das Nonplusultra zur Befriedigung der grundlegenden Lebensbedürfnisse der Bevölkerung ist. Was traditionelle Landwirtschaft, die uns heutzutage von den Reformisten und Ewiggestrigen so gern als Idealfall vorgeführt wird, schon lange nicht mehr leistet, bringt die industriemäßig organisierte und technisch gut ausgestattete Landwirtschaft zustande: nämlich ausreichende Nahrungsmittel in guter Qualität und zu einem erträglichen Preis. – Bei dieser knappen Darstellung zu Sinn und Zweck dieser Produktionsorganisation möchte ich es zunächst bewenden lassen. Weiter unten wird der geneigte Leser sehen, dass dieses ganze Gedöns um Umwelt und Tierschutz nur ein Ablenkungsmanöver ist, die geheuchelte Tierliebe der Gegenwart die Verhältnisse nur verschmiert, statt die wirklichen Probleme der Menschheit zu lösen. – Trotz meines Einsehens in die Notwendigkeit industriemäßig organisierter Tierproduktion musste ich mich sehr zwingen und zusammenreißen, diese Arbeit überhaupt anzunehmen und zu schaffen, denn im Grunde wollte ich nie in einer Fabrikhalle arbeiten. Ich fand das widrig, wo ich mir das doch alles so romantisch vorgestellt hatte! Säubern, Tierpflege, Sortieren der Eier, Futteraufbereitung und Füttern, eben all das, was eine versierte Geflügelzüchterin ausmacht und was sie tagtäglich bringen muss, waren Arbeiten, die in unserem Stall in endloser Folge, stereotyp und bis zum Erbrechen eintönig abliefen – Industriearbeit halt. Ich war fleißig und anstellig wie immer, aber unglücklich mit meiner Berufswahl. Wenn ich schon morgens den Stall betrat, das Licht aufflammte und ich diese schier endlosen Reihen vor mir sah, wurde mir ganz übel. Ich griff wieder zum Schieber und begann die Käfige zu reinigen.
Das ging so eine ganze Weile, bis einer plötzlich damit anfing, schneller und besser putzen zu wollen als alle anderen. Fröhlich klotzte er ran, trällerte und pfiff, tat so, als wäre das alles hier nur ein Klacks und schrubbte wie wild. „Wetten, dass ich in einer halben Stunde durch bin“, verkündetet er übermütig lachend. Es war Holger, der sich da derart exponierte, und noch hinzufügte: „Und dass ich dann zehn Minuten früher als ihr alle Frühstück mache.“ Seine Worte schwangen durch die Halle und trafen auf entgeisterte Hörer. Wir anderen stockten und staunten. Er aber schaute weder links noch rechts, putzte und war bereits vier Käfige voraus. Hundertzwanzig Käfige waren jedem von uns zugeteilt, die einer in Ordnung zu halten und bis zur Frühstückspause vom gröbsten Dreck zu befreien hatte. Wir anderen verharrten immer noch still. Holger war bereits sechs Käfige voraus. Doch dann packte es uns. Wir wollten es dem Angeber zeigen. Vergessen war der Stress, vergessen auch die Fron und jeglicher Missmut. Es ging nur noch darum, Holger zu überholen. Ein Rasen und Brausen ging durch die Halle. Zwei waren schneller, fünf kamen dicht nach ihm ins Ziel. An der Kopfseite des Stalles standen die Sieger und beobachteten die Einlauf der Nachfolgenden. Ich hing ein wenig nach, kam aber auch noch auf eine gute Zeit. Natürlich hatten sich sofort Parteien gebildet, die ihre Favoriten anfeuerten. Dann liefen auch die Letzten ein und ließen glücklich ihre Schieber fallen. Sie wurden empfangen, beglückwünscht und umarmt wie bei einem ganz großen Sieg. Wir lachten, beklopften einander die Schultern, frotzelten und freuten uns und gingen in die Frühstückspause. – Hatten wir gewonnen? Na klar! Wir hatten die Frühstückspause um Minuten verlängert. In erster Linie hatten wir jedoch uns selbst überwunden und diese stumpfsinnige Gleichförmigkeit besiegt.
Natürlich lässt sich so ein kleiner Wettlauf gegen die Uhr nicht endlos ausdehnen. Die Arbeit musste getan werden, egal, wie sauer sie uns ankam. Aber in diesem Miteinander und in dem Wettbewerb, den wir später planmäßig organisierten, lag zu einem Großteil der Schüssel, um im Beruf wirklich anzukommen. Der sozialistische Wettbewerb, wie wir ihn spontan für uns entdeckten und dann in ganz anderen, viel größeren Dimensionen entwickelten, ist selbstredend nicht vergleichbar mit dem kapitalistischen Konkurrenzdruck, unter dem Unternehmer und auch Arbeiter um ihres eigenen Überlebens willen Zeit schinden. Es wäre uns im Traum nicht eingefallen, den Schwächeren zurückzulassen. Wir vermittelten uns gegenseitig Tipps und Kniffe, wie die Arbeit besser ginge. Und wer partout irgendwie naturgemäß immer hintenan blieb, dem griffen die Flinken und Begabteren helfend unter die Arme und nahmen ihm einen Teil seiner Aufgaben einfach ab. Selbstverständlich gab es auch bei uns Außenseiter, Nörgler und Faulpelze, mit denen wir nicht zurechtkamen. Eine Handvoll Jungen und Mädchen verließ uns nach kurzer Zeit, brach die Lehre ab, lernte dann andere Berufe oder nichts – ich habe deren Weg nicht verfolgt –, aber das Gros unserer Truppe blieb bei der Stange und wir alle wurden später tüchtige Landwirte.
Nun hatte ich den Kopf frei. Ich musste nicht mehr stets und ständig über den Sinn des Lebens nachdenken und wie ich dieser Fron ausweichen und mir das Leben erleichtern könnte, sondern ich lebte frei und unbeschwert. Mein Missmut und Argwohn waren verflogen. Die Arbeit fing an, mir Spaß zu machen, mit Eifer war ich dabei, und schaffte fortan nicht nur um der Kollegen und des Wettbewerbs willen, sondern auch wegen des Arbeitsgegenstandes selbst. Ich hatte Freude an besonders sauberen Käfigen, fand die Tiere wieder anziehend, beobachtete die einzelnen Hühner genauer und lernte sie mit ihren Eigenheiten kennen und dadurch voneinander zu unterscheiden. Hundertzwanzig Stück – ich kannte jedes einzelne. Die Arbeit bekam für mich wieder jenen Sinn, den ich mir zuvor erträumt hatte: Tierliebe, Freude an der Natur und ein Schuss Romantik. Ich war sowieso immer eine große Träumerin und habe mir die Dinge gern schöngeredet. Auch davon wird der geneigte Leser später mehr erfahren, wenn er mich besser kennengelernt hat. Ich meine aber auch, dass bei aller Schwere des Lebens, und was der Mensch alles zu stemmen und zu meistern hat, eine Spur Optimismus und Durchhaltewillen immer dazu gehören, denn der Kopf geht schließlich voran. Schlussendlich hat es der Optimist immer leichter als der ewige Miesmacher. Derart befreit, ging ich dann auch relativ entspannt in den Feierabend.
Überhaupt waren der pünktliche Feierabend und ausreichend Freizeit die großen Errungenschaften industriemäßig organisierter Produktion in der Landwirtschaft. Was der individuelle Bauer mit seiner kleinen Warenproduktion an Lasten zu schleppen und an Einsatz zu bringen hat, fiel bei uns selbstverständlich komplett weg. Wir erledigten tagtäglich unser festes Pensum und gingen dann heim. Selbstredend gab es auch bei uns Arbeitsspitzen, wie sie in der Landwirtschaft schon wegen der engen Anbindung der Produktion an den natürlichen Reifeprozess vorkommen. Wir hatten Zeiten, in denen wir tüchtig zupacken und zusätzlich schaffen mussten. Unbesehen hatten wir auch Hürden zu überwinden, manchmal mächtigen Ärger mit der Technik oder Ausfälle, die uns um den wohlverdienten Nachtschlaf brachten. Nur, wer bis hierhin gelesen hat, weiß schon, dass ich den ewigen Besserwissern und Miesmachern nicht das Wort rede, sondern dass ich die positiven Seiten unsere sozialistischen Gesellschaft zeigen will. Und das Positive war halt der geregelte Feierabend, den wir meistens hatten, wo sich Unsereins dann voll ausleben konnte und durfte. Da bekam ich Lust, einfach mal auch wieder etwas anderes anzufangen. Ich dachte wieder mehr über meine geliebte Malerei nach und wälzte im Kopf schon das eine oder andere Motiv, das ich aufs Papier bannen wollte.