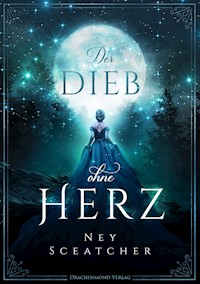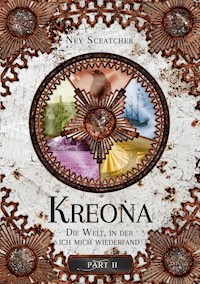5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Zeilengold Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Willkommen beim Albtraumschach. Kannst du deine schlimmsten Ängste besiegen? Nein? Dann fürchte um dein Leben. Als Taija durch einen Spiegel in eine schneebedeckte Welt stürzt, hält sie das für einen bösen Traum. Schon bald stellt sich heraus, dass jenes Märchen, von dem ihre Tante immer erzählt hat, nicht nur ein Mythos ist. Das Mädchen befindet sich mitten in der seltsamen Welt der weißen Königin und des dunklen Prinzen, in der sich alles um ein grausames Spiel dreht. Nur, wer das Albtraumschach gewinnt, darf zurück in seine eigene Welt. Wer scheitert, verliert sich in seinem Albtraum – für immer!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 336
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Ney Sceatcher
Das Spiel des dunklen Prinzen
Besuchen Sie uns im Internet:
www.zeilengold-verlag.de
Nadine Skonetzki
Blütenhang 19
78333 Stockach
1. Auflage
Copyright © Zeilengold Verlag, Stockach 2018
Buchcoverdesign: Marie Graßhoff
Satz: saje design, www.saje-design.de
Illustrationen: So Lil´art
Illustration Weltkarte: Flavia Zimmermann
Lektorat: Sabrina Uhlirsch, www.spreadandread.de
Korrektorat: Martina König
Druck: bookpress, 1-408 Olstzyn (Polen)
ISBN Print: 978-3-946955-07-8
ISBN E-Book: 978-3-946955-88-7
Alle Rechte vorbehalten
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese
Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;
detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über
http://dnb.dnb.de abrufbar.
»Das Unmögliche zu schaffen, gelingt einem nur,
wenn man es für möglich befindet.«
(Lewis Carroll – Alice im Wunderland)
Für alle, die Geschichten lieben, da sie uns verzaubern
und manchmal unsere Augen mehr öffnen können
als die Realität.
In einer Welt wie dieser, an einem Ort wie hier.
So verborgen, so dunkel, so voller Schatten.
Meine Stimme wandert durch die dunklen Gänge, das Kaninchen stets neben mir.
Tränen führen unseren Weg, auf einem Schachbrett all diese Träume und Wünsche.
Der Hutmacher mit dem Tee, die Tassen in tausend Scherben. Dieser kleine Funken Magie, der uns am Leben hält.
All die Wolken geformt wie Diener der weißen Königin.
All die Schatten hinter jedem Baum.
Dunkle Welten, die sich hier kreuzen, gefallen durch ein Spiel ohne Zeit und Raum.
Und wenn ich erwache, werde ich all die Träume vermissen.
Diese Schatten im Schloss des Prinzen, dieser betörende Duft von Freiheit. Vielleicht war es nur Illusion. Verloren in meinen Gedanken, verloren in der Zeit.
Inhalt
Prolog
Wie alles begann
Das Erwachen
Das Erwachen in einem Albtraum
Der dunkle Prinz
Der dunkle Wald
Dicht auf den Fersen
Erwachen in einer sternenlosen Nacht
Der unsichtbare Albtraum
Der Weg hinaus
Für immer und ewig
Der nächste Albtraum
Das Buch der Antworten
Flucht aus der Bibliothek
Das Versteckspiel geht weiter
Der Maskenball
Der Garten der Rosen
Erwachen in eisigen Fängen
Der verrückte Hutmacher
Der Handel
Eine verrückte Teegesellschaft
Der vergessene Name
Die Jagd
Im Palast der Königin
Die weiße Königin
Das Kaninchen und der Spiegel
Das Spiel um Leben und Tod
Der Albtraum des Wolfes
Die Geschichte eines Diebes
Der Wunsch eines Mädchens
Und wenn sie nicht gestorben sind
Ein Ende, ohne wirklich eines zu sein
Epilog
Albtraumschach
Das Märchen …
Danksagung
Die Autorin
Prolog
ES WAR NUR eine Legende, eine vage Geschichte, welche immer anders erzählt wurde, und doch kannte man sie.
Eigentlich erzählte man sie nur kleinen Kindern, um sie vor dem unheimlichen Wald zu schützen. Doch auch die Älteren sprachen davon, während die Flammen des Lagerfeuers vor ihnen langsam erloschen und die Dunkelheit endgültig einkehrte.
Auch dem Furchtlosesten kroch ein kalter Schauer den Rücken hinunter, sobald er den letzten Sätzen dieser Geschichte lauschte.
Das Märchen von einem verlassenen Land, einem dunklen Prinzen, einer weißen Königin und einem Spiel, das noch Spielfiguren brauchte.
Und da gab es noch andere Kreaturen, jenseits des Waldes, vor denen sich alle fürchteten.
Aber das alles war nur eine Legende, eine alte Sage.
Man durfte nur niemals vergessen, dass in jedem Märchen ein Funken Wahrheit steckte.
Wie alles begann
VOR LANGER ZEIT einmal, da existierte eine Stadt mit dem Namen Tarasa. Sie bestand aus nichts als Eis und Kälte. Schnee bedeckte die Bäume und Dächer, die Wiesen und Seen. Kaum Leben gab es mehr an diesem Ort.
Umgeben von ständiger Dunkelheit und einer Aura des Bösen, stand auf dem höchsten Hügel ein riesiges Schloss aus Eis. Niemand anderes als die weiße Königin selbst trieb dort oben ihr Unwesen. Sie war klug und bildhübsch, so erzählte man sich, und dennoch trübten schwarze Schatten ihre Gedanken.
Es dauerte nicht lange, da gesellte sich ein dunkler Prinz zu ihr. Allein sein Name und die Ahnung seiner Macht verbreiteten Angst und Schrecken. Auch er war bildhübsch und kein einziger Makel entstellte sein junges Gesicht.
Als sich die beiden zum ersten Mal trafen, schien es, als prallten zwei Welten aufeinander. Fortan kämpften der dunkle Prinz und die weiße Königin um den Titel des Stärksten im ganzen Land.
Nach Jahren des Kampfes mussten sie sich eingestehen, dass keiner dem anderen überlegen war. Fieberhaft suchten sie nach einer anderen Möglichkeit, um zu erfahren, wer der Stärkere von ihnen war. Sie erschufen ein Spiel namens Albtraumschach, welches keiner freiwillig spielen würde.
Als sich die ersten Menschenkinder in die Gegend verirrten, waren gleich einige Spielfiguren gefunden. Von da an ließen sie diese in ihren Träumen gegeneinander kämpfen. Und es waren schreckliche Kämpfe, denn die Fantasien der Menschen waren grenzenlos und grausam. Viel schrecklicher als die des Prinzen und der Königin.
Das Erwachen
EIN KLEINER SONNENSTRAHL stahl sich durch mein sonst düsteres Zimmer und brachte mich dazu, die Augen zu öffnen.
Es dauerte eine Weile, bis ich begriff, dass es schon Mittag war, zumindest zeigte mir das der Wecker neben meinem Bett an. Warum wachte ich erst jetzt auf?
Seufzend rieb ich mir über die Augen. Ich war definitiv kein Morgenmensch. Für mich blieben Frühaufsteher, die morgens mit breitem Lächeln in den Tag starteten, ein unerklärliches Phänomen.
Wenig später schlug ich die Bettdecke zurück, erhob mich aus dem weichen Bett und tapste in den langen Flur. Dieser stellte mit seinen bunten Farben das genaue Gegenteil zu meinem dunklen Zimmer dar. In allen Nuancen leuchteten mir grasgrüne Wänden, himmelblaue Böden und rote Bilderrahmen entgegen. Trotz der ungewöhnlichen Farbkombinationen harmonierte alles perfekt.
Leise Stimmen drangen von unten herauf. Mit schnellen Schritten lief ich weiter. Die Kälte umschloss sogleich meine Füße und kroch meinen Körper entlang. Es war keine schlaue Idee, mitten im Winter barfuß durch die Gänge zu huschen. Ich betrat das winzige Badezimmer am Ende des Ganges. Blaue Wände, blaue Duschvorhänge, blaue Kerzen, alles hier war blau. Eilig wusch ich mich, zog mir frische Kleidung und gefütterte Hausschuhe an, ehe ich gähnend wieder hinaus in den Gang trat.
»Taija!«, erklang eine leicht gereizte Stimme. Ohne das besagte Gesicht vor mir zu haben, wusste ich genau, zu wem diese Stimme mit dem harten Tonfall gehörte.
Taija bedeutet Feuer in einer alten und längst vergessenen Sprache. Meine Mutter hatte schon immer viel gelesen und seit sie klein war, zumindest hatte sie das immer behauptet, hatte sie sich alle einzigartigen Namen aus ihren Büchern notiert. Irgendwann hatte sie sich dann dazu entschieden, mich Taija zu nennen, womöglich wegen der widerspenstigen roten Mähne auf meinem Kopf.
»Ich komme, Tante Kaisslin«, schrie ich zurück, während ich die Treppe in solch einem Tempo hinunterfegte, dass ich beinahe meine Tante über den Haufen gerannt hätte. Tadelnd rückte sie mit dem ausgestreckten Zeigefinger die dunkle Brille zurecht, die dank meines rasanten Auftauchens leicht verschoben auf ihrer Nase saß.
»In den Gängen wird nicht gerannt, meine Liebe.«
»Aber ja doch, verzeih mir«, murmelte ich und lächelte sie an.
»Wenn das deine Mutter sähe«, wisperte sie mit vorgehaltener Hand. »Sie würde sich im Grabe umdrehen.«
Tante Kaisslin war streng, manchmal auch etwas launisch, und doch hatte sie einen festen Platz in meinem Herzen. Immerhin kümmerte sie sich seit Jahren um mich.
Ihre dunkelbraunen Augen erinnerten mich an die Rinde einer alten Tanne. Dunkel und dennoch von einem warmen Ton umgeben. Durch ihr kohlrabenschwarzes Haar spannen sich immer mehr silberne Strähnen und verliehen ihr eine gewisse Strenge.
»Es tut mir leid, wirklich. Kann ich dir zur Hand gehen?«, fragte ich und sah zu ihr hoch.
Kopfschüttelnd richtete sie ihr Haar und strich sich danach die Hände mit einer energischen Bewegung an ihrem grauen Kleid ab. »Ich muss zuerst einmal in Ruhe nachdenken, was alles noch zu tun ist«, sprach sie und wandte sich ab.
Diese Antwort genügte. Mit einem Seufzer und einem kurzen Blick aus dem Fenster auf die verschneiten Straßen ging ich langsam wieder nach oben. Kurz bevor ich das erste Stockwerk erreichte, rief mir meine Tante noch nach: »Taija?«
»Ja, Tante?« Misstrauisch beugte ich mich über das Treppengeländer.
»Du könntest den Dachboden aufräumen«, wies sie mich an und ließ mich damit einfach stehen. Ich hasste den Dachboden, das wusste sie. Bis jetzt hatten wir es jedes Jahr aufgeschoben, ihn auszumisten. Dieses Jahr war es wohl oder übel Zeit, damit zu beginnen.
Nachdenklich schlenderte ich durch den langen Gang. Das ganze Haus erinnerte an ein altes Spukhaus, welches ich anfangs noch gehasst hatte, aber inzwischen wahrlich liebte. Man fand jeden Tag neue Dinge: alte Tagebücher, Bilder aus längst vergangener Zeit, getrocknete Blumen und ab und zu steckten auch Goldmünzen zwischen dicken Büchern in verstaubten Regalen. Und manchmal, nachts, wenn man aus einem bösen Traum erwachte, hörte man leise Stimmen raunen.
Nach dem tödlichen Autounfall meiner Eltern hatte Tante Kaisslin mich aufgenommen. Sie lebte hier allein, sofern man es so bezeichnen konnte, denn oft trieben sich junge Reisende auf der Suche nach einem Nachtlager in den großen Ställen herum.
Das Anwesen war riesig. Das Haus selbst besaß vier Stockwerke; zwanzig Zimmer; drei große Arbeitsräume; einen Salon; eine moderne Küche im Erdgeschoss und ein Bücherzimmer, in welchem sich uralte Wälzer stapelten. Die Einbände waren bereits vergilbt und die Titel aufgrund der Jahre kaum lesbar. Jedes Mal, wenn ich eines davon in meinen Händen hielt, fürchtete ich, es könnte zu Staub zerfallen. Das war einer der Gründe, warum ich keines dieser Bücher gern las. Der andere Grund waren die Gerüche. Irgendwie rochen sie alle nach Rauch oder modrigem Sumpf. Doch trotz allem wollte Tante Kaisslin das Bücherzimmer nicht räumen, denn diese seltenen Werke machten einen Teil der Erbschaft meiner Großeltern aus. Im Grunde stellte das gesamte Haus einen Erbteil dar. Es wurde von Generation zu Generation weiter vermacht und um ehrlich zu sein, sah es auch dementsprechend aus. Der Putz bröckelte von den Wänden, an regnerischen Tagen tropfte Wasser von der Decke und eine Heizung kannte dieses Gebäude nicht. Selbst die benachbarten Stallungen waren alt und standen seit Langem leer. Nur die gepflasterte Einfahrt und das hohe Eisentor mit den Verzierungen brachten etwas Moderne auf das Anwesen.
Seufzend kletterte ich die Treppe immer weiter hinauf. Der Schlüssel des Dachbodens lag auf der obersten Stufe. Ich erinnerte mich nicht mehr daran, wann ich zuletzt da oben gewesen war. Selbst jetzt überkam mich ein ungutes Gefühl, obwohl man mich nicht gerade einen Angsthasen nennen konnte. Nach Horrorfilmen schlief ich wie ein Baby und es machte mir auch nichts aus, wenn das Licht im Keller ausfiel und ich dringend etwas von dort brauchte. Aber dieser Dachboden … Irgendetwas Seltsames ging hier oben vor sich. Man spürte förmlich die negative Energie, die einem aus jeder Ecke dieses verlassenen Raumes entgegenschlug. Selbst Alfred Hitchcock hätte keinen grusligeren Ort erschaffen können.
Ich hob den Schlüssel eilig auf, steckte ihn in das alte Schloss und drehte ihn um. Mit einem fürchterlichen Knarzen sprang die Tür des Speichers auf. Staub rieselte mir entgegen und die dicke Luft dort oben ließ mich einen Moment nach Atem ringen. Ich trat in den Raum, den einzig und allein ein schwacher Lichtstrahl von draußen erhellte. Es war beinahe so dunkel wie in meinem Zimmer. Nur das dort keine meterhohen Spinnweben von der Decke hingen. Staub und Schmutz tauchten den Boden in ein Grau. So viel Dreck hatte ich selten zu Gesicht bekommen.
Wo fing ich am besten an? Suchend spähte ich durch den Raum. Ein altes Fotoalbum lag vergessen auf den Brettern, dahinter stand ein großer Schrank. Stühle mit abgebrochenen Beinen, Puppen ohne Augen, ein alter Teddybär, Tische, Bänke und Truhen waren achtlos durcheinandergeworfen. Ein silbriger Spiegel lehnte an der Wand und mein Blick fixierte diesen. Wieso stand er hier oben, obwohl wir unten genügend Platz für ihn hatten? Von hier wirkte er gar nicht so trostlos wie der restliche Plunder. Solch eine Rarität machte sich bestimmt gut in meinem Zimmer.
Ich ging langsam auf den Spiegel zu. Er hatte im Gegensatz zu den anderen Gegenständen nur eine leichte Staubschicht und wurde zum Teil von einem weinroten Tuch abgedeckt.
Rasch zog ich den Stoff beiseite. Der Spiegel wackelte und rutschte zu Boden. Es klirrte, Staub wirbelte auf und ich musste meine Augen fest zusammenkneifen.
Langsam, nachdem sich die Staubwolke wieder gelegt hatte, blinzelte ich zwischen meinen roten Haarsträhnen hindurch.
Der Spiegel lag zwar flach auf dem Boden, war jedoch absolut unversehrt. Kein Kratzer, nichts. Ich wandte mich kurz um, um sicherzugehen, dass der Lärm meine Tante nicht angelockt hatte.
Nichts …
Seltsam …
Vorsichtig kniete ich mich hin und versuchte, den Spiegel wieder hochzuziehen. Sein Gewicht überraschte mich, er war schwerer als gedacht. Mit knirschenden Zähnen und einem verbissenen Gesichtsausdruck versuchte ich mit aller Kraft, ihn zu bewegen. Auf einmal rutschte ich aus und flog der Länge nach mitten auf das Glas. Ein knackendes Geräusch, wie eine Art Protestschrei, erklang unter mir.
»Nun gut«, seufzte ich und wollte gerade wieder aufstehen, doch plötzlich geschah etwas total Verrücktes. Die Oberfläche verwandelte sich in eine Art Wasser. Meine Hände tauchten in die glatte Spiegeloberfläche ein. Etwas zog mich nach unten und mein Körper folgte widerstandslos. Mein entsetzter Schrei wurde augenblicklich von der Spiegelmasse erstickt, als mein Kopf darin versank.
Zuerst bekam ich keine Luft und Dunkelheit umhüllte mich, dann fiel ich in eine Art endlose Leere, bis ich auf einmal in einer Schneewehe landete.
Panisch blickte ich in alle Richtungen, doch um mich herum war alles nur voller Schnee. Schneeberge aus glitzernden weißen Pulvern erstreckten sich kilometerweit. Tannen waren eingetaucht in sattes Weiß und selbst mein Atem gefror bei jedem Luftzug. Tiefschnee und Eis, so weit das Auge reichte. Kälte durchdrang meine feinen Kleider.
Wo war ich? Bestimmt hatte sich eine der Holzdielen gelöst und ich lag nun unter einer Menge Schutt in Tante Kaisslins Keller begraben. Ich musste ohnmächtig geworden sein und nun befand ich mich in einer Art Traumwelt. Dies war die einzige logische Erklärung für das Winterwunderland, welches sich vor mir erstreckte.
Meine Gedanken rasten.
»Das alles ist nur ein Traum, du wachst bald auf«, flüsterte ich, um mich zu beruhigen.
Anders konnte ich mir nicht erklären, wie ich durch einen Spiegel in ein Land voller Schnee gelangt war. Obwohl es bei uns auch geschneit hatte, aber solch hohe Türme hatten sich noch nie gebildet. Außerdem sah ich hier weit und breit keine Straße oder irgendwelche Häuser. Nicht einmal andere Menschen konnte ich entdecken.
Plötzlich regte sich etwas in einiger Entfernung. Zwei schemenhafte Gestalten kamen langsam auf mich zu. Wie dunkle Schatten krochen sie über den Boden und jetzt bemerkte ich auch wieder diese negative Energie, die meinen Körper einnahm. Still blieb ich im Schnee hocken und starrte den beiden entgegen.
»Wer seid ihr?«, rief ich panisch, als sie wenige Meter vor mir verharrten.
»Die weiße Königin wünscht, Euch zu sprechen«, erklang es in meinen Gedanken.
Wie? Verwundert sah ich zu den schemenhaften Gestalten. Nun erkannte ich auch ihre Umrisse. Sie entpuppten sich als riesige Polarwölfe, waren aber um einiges größer und bestimmt auch schwerer als die gewöhnlichen Tiere, die man aus dem Fernsehen oder aus Zeitschriften kannte. Wo zur Hölle war ich?
»Komm mit uns«, sprach abermals eine Stimme in meinem Kopf. Die dunklen Augen der Wölfe starrten mich an.
»Komm.«
Dichtes Schneegestöber kam auf und verhüllte die Landschaft. Zwischen den Schneewogen wehte rotes Haar, welches zwei Polarwölfen folgte. Bald verwischte der Sturm ihre Spuren und selbst der Prinz hätte Mühe gehabt, das Mädchen zu finden.
Doch dieser saß auf seinem Thron und warf nur einen langen Blick über die Schneelandschaft. Ein leises Knurren entwich seiner Kehle. Alles musste man selbst machen, alles …
Das Erwachen in
einem Albtraum
KLIRRENDE KÄLTE UMSCHLOSS mich. Es schien, als ob ein Gefühl von Machtlosigkeit in jeder Zelle meines Körpers steckte. Müdigkeit und Erschöpfung hielten meine Augenlider geschlossen. Die Kälte wurde immer schlimmer, während ich zitternd und entkräftet versuchte, die Augen zu öffnen. Eine gefühlte Ewigkeit später gelang es mir endlich und ich richtete mich mühsam auf.
Es dauerte einen Moment, bis ich wusste, wo ich mich befand. Die Wände waren weiß und kleine Eiskristalle bildeten ein Muster auf der ebenmäßigen Fläche. Ein Kronleuchter hing von der Decke. Helle, beinahe durchsichtige Möbel standen in dem geräumigen Zimmer. Die Kälte, welche in der Luft lag, kam scheinbar von den Objekten um mich herum. Alles bestand aus Schnee oder Eis. Fröstelnd rieb ich mir die Arme. Selbst der Boden schien aus glattem Eis zu sein, denn mein Gesicht spiegelte sich darin, sobald ich hinabblickte.
Um mich herum erstrahlte endloser weißer Glanz. Ich saß in einem weichen Bett, umgeben von Kissen und hellen Vorhängen.
Vorsichtig erhob ich mich und machte einen Schritt auf der Eisschicht. Angst und Kälte hatten mich fest im Griff.
Wo war ich hier bloß gelandet?
Der Boden fühlte sich kein bisschen kühl an, obwohl ich nichts mehr an meinen Füßen trug. Meine Hausschuhe waren verschwunden und stattdessen stand ein Paar brauner Stiefel am Rande des Bettes. Womöglich war ich wirklich gefangen in einem Traum. Doch seit wann fühlten sich diese so real an? Ich kniff die Augen fest zusammen, zählte laut bis zehn und öffnete sie dann ruckartig. Nichts …
Seufzend zwickte ich mir in den linken Arm. Schmerz zuckte durch meinen Körper. Warum wachte ich nicht auf?
Ein Klopfen an der Tür aus dichtem Eis ließ mich aus meinen verwirrten Gedanken hochschrecken.
Ich zögerte. Was nun? Sollte ich mich verstecken oder … Es klopfte erneut. Mir blieb keine andere Wahl.
»Herein!«, rief ich. War das überhaupt angemessen? Immerhin war das nicht mein Zimmer.
Die Tür schwang auf und ein kleiner Junge betrat den Raum. Er hatte dunkles, zotteliges Haar und ebenso dunkle Augen, welche mich ängstlich musterten. Wie alt er wohl sein mochte?
»Die weiße Königin wünscht, Euch zu sprechen«, raunte er und verneigte sich vor mir.
»Du musst dich nicht verbeugen«, erwiderte ich lachend und ging auf ihn zu. Ein Rascheln brachte mich für einen Moment aus dem Konzept. An meinem Körper trug ich ein längeres weißes Kleid. Es saß perfekt, reichte bis unter die Knie und hatte unscheinbare kleine Stickereien und Verzierungen, welche sich vom Halsausschnitt bis zur Taille schlängelten. Im oberen Teil war das Kleid etwas enger, ab den Hüften bauschte sich der samtweiche Stoff. In der Tat, es war wunderschön und dennoch befremdend. Woher kam es und wer hatte es mir angezogen?
»Folgt mir«, forderte der Junge mich auf, den Blick noch immer auf den Boden gesenkt. Was blieb mir auch anderes übrig? Doch zuvor zog ich mir eilig die bereitgestellten Stiefel über meine nackten Füße.
Das alles ist nur ein Traum, bald werde ich aufwachen.
Mit schnellen Schritten eilte ich dem Kind nach und ließ das eisige Zimmer hinter mir.
Die Gänge glichen einem Labyrinth. Alle sahen völlig gleich aus und immer mehr wunderte ich mich, wie der kleine Kerl wusste, wo es lang ging. Auch er trug keine Schuhe und während man meine Schritte auf der glatten Oberfläche deutlich hörte, bewegte er sich so leise wie ein Schatten.
Nach einer gefühlten Ewigkeit blieb er vor einem weißen Tor stehen. »Tretet ein«, wisperte er und verschwand wieder in einem der langen Gänge. Seufzend wandte ich mich dem Tor zu. Ich fühlte mich beobachtet, aber wer sollte mich beobachten?
Das ist nur ein Traum.
Immer und immer wieder kreisten diese Worte durch meinen Kopf.
Nur ein Traum.
Mein Blick glitt an dem hellen Tor entlang. Darauf befanden sich ähnliche Verzierungen wie auf meinem Kleid. Je länger ich diese betrachtete, umso mehr Objekte erkannte ich. Da gab es Schneeflocken, Diamanten, Augen, Wellen und noch anderes, was ich leider nicht zu deuten vermochte.
Langsam griff ich mit meiner linken Hand nach der Türklinke. Sie war eisig kalt. Schnell öffnete ich das Tor, ehe meine Hände festfrieren konnten.
Als mir ein noch eisigerer Luftzug entgegenwehte, hielt ich erschrocken die Luft an. Die Temperatur in diesem Raum schien noch um einiges niedriger zu sein. Schemenhafte Gestalten aus dunklem Eis beugten sich mir entgegen und beobachteten jeden meiner Schritte. Sie wirkten wie lebendige Schatten und starrten mich mit ihren schwarzen Augenhöhlen an. Unsicher krallte ich die Finger in den weichen Stoff des Kleides. Bestimmt sah das albern aus, aber irgendwo musste ich mich festhalten.
Vor mir stand ein riesiger Thron aus Eis, in welchem sich jegliche Farben spiegelten. Eiszapfen ragten wie spitze Zähne von der Lehne auf und ließen ihn noch unheimlicher und mächtiger wirken. Der Boden zu meinen Füßen war ebenso glatt wie im restlichen Gebäude, nur spürte ich die Kälte hier um einiges deutlicher.
Auf dem Thron saß eine Frau mit langen weißen Haaren. Den schlanken Kopf hatte sie auf den rechten Arm gestützt und ihr blaues Kleid floss wie eine Art Wasserfall um ihren Körper. Ihre Augen wirkten blau, fast durchsichtig, und irgendwie erinnerten sie mich an die Antarktis. Alles an dieser Frau strahlte so viel Kälte und Macht aus, dass mir beinahe übel wurde. Mein Magen rebellierte und meine Finger krallten sich noch tiefer in den Stoff.
Im Blick der seltsamen Frau lag Langeweile und sie schaffte es nicht, ein herzhaftes Gähnen zu unterdrücken.
»Wo bin ich?«, fragte ich nach einer halben Ewigkeit. Meine Stimme hallte durch den Raum und irgendwo schien Eis zu splittern. Erschrocken presste ich beide Hände auf den Mund.
Ein bitteres Lächeln stahl sich auf ihr helles Gesicht. »Du bist in mein Land eingedrungen.« Ihre Stimme zitterte leicht.
»Ich weiß nicht einmal, wo ich hier bin!« Wieder zerbrach in meiner Nähe Eis.
»Du bist im Palast der weißen Königin, meiner Wenigkeit«, sagte sie und stützte ihren Kopf in Zeitlupe auf den anderen Arm. Das Kleid raschelte bei jeder Bewegung. »Aber sag mir, Kind, wie bist du hierhergekommen?«
»Mein Name ist Taija. Ich bin durch einen Spiegel gefallen. Nein, ich war auf einem alten Dachboden und als Tante …« Ich hielt inne, als sie die Hand hob und sich langsam aufrichtete.
»Der Spiegel … Du bist also ein Menschenkind.«
Misstrauisch beäugten mich die schemenhaften Gestalten. Ihre Köpfe waren zackig, voller Ecken und Kanten, in ihren Gesichtern gab es nur diese leeren Augenhöhlen und furchterregende Münder mit spitzen Zähnen. Der Rest der Körper war blau und unförmig. Sie besaßen keine Beine, sondern schienen mit dem Boden zu verschmelzen.
»Ja, ich bin ein Mensch und ich heiße noch immer Taija«, flüsterte ich, da ich befürchtete, dass wieder irgendwo Eis wegen meiner Stimme zerbrach.
»Menschenkind, wie ich sagte. Es trifft sich gut, dass du zu mir gefunden hast. Der Prinz wird Mühe haben, das Spiel zu gewinnen«, kicherte sie. Ihre blassen Augen starrten mich an. Kälte kroch meinen Rücken hinunter. Es schien sie nicht einmal einen kühlen Windhauch zu interessieren, wie ich hieß.
»Welches Spiel? Wartet, wenn Ihr die weiße Königin seid und es hier um ein Spiel geht und um einen Prinzen … In welcher Stadt bin ich hier gelandet?«, rief ich ihr entgegen. Krachend brachen weitere Eisklumpen herunter. Das alles kam mir bekannt vor. Ich war also tatsächlich in einem Traum gefangen.
»In Tarasa, der Stadt aus ewigem Eis, Menschenkind«, sagte sie und kam näher. Das lange blaue Kleid spiegelte sich im Eis des Bodens. Kleine glitzernde Eiskristalle bildeten sich dort, wo sie entlanglief.
»Das ist nur ein Märchen, das alles hier«, sprach ich und funkelte sie wütend an. Meine Angst war auf einmal wie weggeblasen. Bald würde ich aufwachen.
Verwundert blieb die weiße Königin stehen. »Ein Märchen?«
»Ja, das hat mir meine Mutter immer erzählt. Die Geschichte mit der weißen Königin und dem dunklen Prinzen. Die beiden spielten gegeneinander ein Spiel. Es ging darum, wer von ihnen der Bessere, Klügere und Stärkere war, und das geschah in ebendieser Stadt aus Eis namens Tarasa. Ein Märchen, um die kleinen Kinder von dem dunklen Wald fernzuhalten, hinter dem das Ganze liegen sollte, mehr nicht.«
Nur ein Traum, nichts weiter.
»Ach, also bin ich nur eine erfundene Figur und das alles hier ist auch nicht echt? Nun gut, Menschenkind, dann sag mir doch, ob du das auch spüren könntest, wenn es nur ein Traum wäre«, zischte sie und stand mit einem Mal vor mir. Ihre Augen wirkten so leblos, so kalt und unheimlich. Sie grub ihre dunkelblauen Nägel in meinen rechten Arm. Sofort schoss Kälte daran hoch und voller Schmerzen verzog ich mein Gesicht.
»Aua!«
»Siehst du, in einem Traum spürt man weder Kälte noch Schmerzen.«
Ein furchteinflößendes Lachen drang aus ihrer Kehle. Erschrocken fuhr ich zusammen und brachte einige Meter Abstand zwischen uns.
Auf einmal wurde sie wieder ernst und funkelte mich wütend an. »Du bist meine Spielfigur, meine, nur meine! Sobald das Spiel vorbei ist und du einen Weg findest, darfst du natürlich wieder zurück. Doch bis dahin bleibst du bei mir.« Ihre Augen verzogen sich zu schmalen Schlitzen und ihren Mund umspielte ein hämisches Lächeln. Diese Königin beherrschte anscheinend nicht nur die Kälte, sie war die Kälte höchstpersönlich!
»Um welches Spiel handelt es sich?«, fragte ich und hoffte, sie würde sich wieder beruhigen. Es konnte nur ein Traum sein. Das alles hier gab es in der realen Welt nicht. Aber vielleicht lag ich in einer Art Koma wegen des Sturzes und würde erst aufwachen, wenn das Spiel vorbei war. Wahrscheinlich spielte mir meine Psyche einfach nur einen Streich.
»Schach, aber mir fehlen noch ein paar Figuren. Du darfst gern der nutzlose Bauer sein.« Kühl sah sie mich an und gähnte erneut gelangweilt.
»Schach?« Einen Moment starrte ich sie fassungslos an, ehe ich plötzlich loslachen musste. »Das heißt, Ihr und der Prinz spielt einfaches Schach, nichts weiter?«, fragte ich. Ich hätte meiner Fantasie ja weit mehr zugetraut. Irgendwelche Schlachten oder von mir aus Geschicklichkeitsrennen, Versteckspiele im Wald, Schwertkampf, Bogenschießen. Aber Schach? Dabei konnte man sich ja nicht einmal den Nagel abbrechen.
»Albtraumschach, meine Liebe. Du wirst es sehen. Ich zeige es dir, sobald es so weit ist. Wenn du mich jetzt entschuldigst, ich bin müde. Der dunkle Prinz wird uns heute beehren, also ruh auch du dich aus. Ich will ihm meine neuste Trophäe zeigen und dafür solltest du nicht wie ein abgekauter Lappen aussehen«, sagte sie lachend und ihre Augen wanderten besitzergreifend über mich.
Was für kranke Träume habe ich?
Nervös versuchte ich, den Abstand weiter zu vergrößern.
Nun gut, ich musste ja nur mitspielen und dann würde ich aufwachen. Es war ein Märchen, nicht mehr.
»In den Kerker mit dem Menschenkind«, rief die Königin. Alles an ihr wirkte so makellos. Sie war wunderschön und doch nur eine Hülle. Alle Perfektion nutzte einem nichts, wenn man kein Herz besaß. Und um ehrlich zu sein, zweifelte ich immer mehr daran, dass sie oder diese eisigen Kreaturen ein solches besaßen.
Zwei der schemenhaften Gestalten packten mich an den Armen und zogen mich aus dem Thronsaal. Erst jetzt fiel mir der große zottelige Wolf auf, der neben der Tür schlief. Er öffnete seine Lider und starrte mich an. Sein dunkelschwarzes Fell zitterte ganz leicht, bevor er ein tiefes Knurren ausstieß. Die gelben Augen wirkten irgendwie menschlich. Ich wandte den Blick ab und wurde weiter geschleift.
Meine Füße glitten über den spiegelähnlichen Boden und nur mit Mühe schaffte ich es, nach vorn zu schauen. Mein Kopf war wieder so schwer und die Erschöpfung nistete sich erneut in meinen Knochen ein. Die Luft hier tat mir nicht gut, zu viel Kälte und zu viel Boshaftigkeit. Wenn ich noch lange hierbleiben müsste, würde ich verrückt werden.
Die Gestalten öffneten eine pechschwarze Tür und stießen mich eine lange Treppe hinunter. Unsanft prallte ich gegen eine Art Mauer. Schnell rappelte ich mich auf und rannte die Treppe hinauf, zwei Stufen auf einmal nehmend, ehe ich zitternd an der dunklen Tür ankam. Meine Hände glitten zum Türknauf und zogen daran. Vergeblich, abgeschlossen …
Eingeschlossen und gefangen in meinem eigenen Albtraum.
Das arme Mädchen saß fest. Viele Fragen wirbelten durch ihre Gedanken, nur eine Lösung, die fand sie nicht. Die Dunkelheit nagte an ihr, brach ihren Mut und ihre Entschlossenheit. Und so schloss sie die Augen, weinte still vor sich hin und dachte an Vergangenes, um sich zu beruhigen, während die weiße Königin zufrieden an einem Glas nippte und hinaus auf die Schneelandschaft blickte.
Der dunkle
Prinz
DÜRRE, ZÄHE KÄLTE zog an mir. Seit einer Ewigkeit schon hockte ich mit angezogenen Knien in einer Ecke des dunklen Raumes. Das Klappern meiner Zähne war das einzige Geräusch in diesem Gefängnis. Inzwischen schaffte ich es kaum mehr, Zehen und Finger warm zu halten. Zumindest hatten mir vorhin zwei der Gestalten einen Krug Wasser und einen Teller mit Früchten gebracht. Verhungern und verdursten würde ich in den nächsten Stunden nicht.
Schatten durchzogen meine Gedanken. Wieso wachte ich nicht auf? Alles schien so real, aber es war unmöglich. Das konnte nicht echt sein. In der Realität gab es weder riesige Schneepaläste noch dunkle Prinzen, geschweige denn eine weiße Königin. Es gab auch keine schemenhaften Gestalten und riesige Polarwölfe.
Wäre das hier Wirklichkeit, würde die Polizei bald auftauchen, weil meine Tante mich vermisste. Auf den Straßen ständen dichte Autoschlangen und wenn jemand auf die Idee käme, zu behaupten, er sei die weiße Königin, würde man ihn direkt in die Psychiatrie verfrachten. Das alles hier musste ein Traum sein, wenn auch ein täuschend echter.
Ich schreckte hoch, als ein Poltern durch die Tür drang. Laute Stimmen schallten zu mir herein. Überrascht stemmte ich mich an den kalten Wänden hoch. Meine Füße waren taub und mit jedem Schritt machten sie sich schmerzend bemerkbar. Mit zitternden Händen griff ich ganz langsam nach vorn, dort, wo ich die Tür vermutete. Das Stimmengewirr draußen wurde lauter.
Mit einem Ruck riss jemand die Tür auf. Grelles Licht schien mir entgegen und nur mit Mühe gewöhnten sich meine Augen an die plötzliche Helligkeit. Sichtlich erschrocken blinzelte ich zu dem Kerl, der vor mir stand. Er trug ein dunkles Oberteil, eine ebenso dunkle Hosen und hatte die Kapuze über sein Gesicht gezogen. Ich musste meinen Kopf ein wenig in den Nacken legen, um ihn direkt anschauen zu können. In der linken Hand hielt er ein langes Schwert, welches er lässig auf dem Boden abstützte.
»Das ist sie also?«, fragte er und drehte seinen Kopf nach hinten. Ich starrte ihn weiterhin an, bis mir bewusst wurde, dass ich noch immer die Arme ausgestreckt hatte. Schnell nahm ich diese herunter.
Ganz langsam wandte sich der Kerl mir wieder zu.
»Sie ist ja noch ein Kind.« Er seufzte und verschränkte die Arme vor der Brust.
Dass ich ihn laut und deutlich hören konnte, war ihm wohl nicht bewusst oder er machte sich keine Gedanken darüber.
»Ich bin fast achtzehn!«, protestierte ich und verschränkte bockig meine Arme.
»Achtzehn Jahre? Besart!«, rief er, ohne sich umzudrehen.
Wie aus dem Nichts tauchte eine weitere Gestalt neben ihm auf. Diese trug ebenfalls dunkle Kleidung und eine Kapuze. Auch von Größe und Statur glichen sich die beiden.
»Ja, Meister?«
»Besart, sind achtzehn Jahre für ein Menschenkind viel?«, fragte er. Noch immer sah er in meine Richtung. Ein Schauer überkam mich. Wer waren die zwei und wieso nannte er ihn Meister?
»Nicht wirklich«, sprach der andere.
»Nicht wirklich? Mit achtzehn darf man abstimmen, Auto fahren, Alkohol kaufen und noch viel mehr«, widersprach ich und sah abwechselnd von einen zum anderen.
»Ich weiß ja nicht, was Alkohol kaufen mit … wie hieß das? Auto? … zu tun hat, aber gut«, murmelte Besart.
Verwirrt sah ich sie an. Was bedeutete das nun schon wieder? So viel älter als ich konnten die Kerle wohl kaum sein, oder?
Aufgebrachte Stimmen hallten durch den Gang. Mit wehendem Haar kam die weiße Königin auf uns zu. Hinter ihr, mit großem Abstand, liefen zwei der schemenhaften Gestalten.
»Prinz!«, fauchte sie, kurz bevor sie vor den beiden anhielt.
Das also waren Besart und der dunkle Prinz.
»Ja?«, fragte der, den Blick noch immer auf mich gerichtet.
»Ich habe Euch verboten, meine Spielfiguren zu belästigen!«
»Das interessiert mich herzlich wenig«, zischte er und wandte sich endlich von mir ab. Die Königin stieß ein lautes Knurren aus, doch der Prinz blickte sie nur stumm an. Plötzlich schüttelte die Weiße den Kopf. Feine Eiskristalle klimperten in ihrem Haar.
»Nun gut, ich bitte Euch jedoch, mir zu folgen. Wir haben noch etwas zu besprechen«, flötete sie. Ihr Ton war auf einmal sanft, beruhigend sanft. Ihre Augen hingegen funkelten noch immer voller Hass.
Der mysteriöse Prinz nickte.
»Wächter! Bringt sie in den anderen Kerker!«, rief die weiße Königin nach hinten. Die beiden Gestalten sahen zuerst zum Prinzen, dann wieder zu ihr.
»Na los, macht schon!«, schrie sie.
Erschrocken fuhren sie zusammen und kamen auf mich zu. Kalte Hände griffen nach meinen Armen und zogen daran. Ich versuchte gar nicht erst, mich zu wehren.
»Wenn Ihr erlaubt, wird Besart das Mädchen begleiten. Immerhin ist er mein Diener und hat nichts bei den Besprechungen verloren«, sprach der Dunkle und rauschte an ihr vorbei. Besagter nickte nur und folgte uns. Die Königin schien einen Moment zu überlegen, bevor sie dem dunklen Prinzen nacheilte. Womöglich stufte sie Besart nicht als Gefahr ein.
Die Gestalten zogen mich weiter, immer tiefer in die Gänge hinein. Auch hier war alles aus Eis, selbst die dichten Gitterstäbe einiger Kerker. Ab und zu erhaschte ich einen Blick in die Zellen. Menschliche Wesen kauerten darin. Manche wimmerten vor sich hin, andere knurrten mich an. Erschrocken zuckte ich zusammen. Warum sperrte man sie ein? Handelte es sich auch bei ihnen um Spielfiguren?
Irgendwann erreichten wir das Ende des Ganges und liefen einige Treppenstufen hoch, bevor vor uns ein weiterer Gang auftauchte. An dessen Ende erwartete uns wieder eine dunkle Tür.
»Stopp!«, rief Besart. Die Gestalten hielten an. Er holte uns ein und blieb vor ihnen stehen. »Sicher, dass wir hier richtig sind?«, fragte er.
»Natürlich!«, zischte der auf meiner linken Seite. Er drückte mit seinen langen blauen Krallen fester zu. Überrascht schrie ich auf.
»Gebt sie mir. Ich vertraue euch nicht. Ihr wollt ja schließlich nicht als Eisskulpturen der Königin enden, oder?«, fragte er und zog langsam sein Schwert. Es klirrte, sobald er die Waffe auf das Eis zu unseren Füßen schwingen ließ. Mit der anderen Hand zog er sich die Kapuze vom Kopf. Kohlefarbenes längeres Haar kam zum Vorschein, seine Augen waren dunkel, fast schwarz wie eine sternenlose Nacht, und die Lippen umspielte ein spöttisches Grinsen.
Ich konnte nicht einfach wegsehen, er zog mich magisch an. Jedoch vermochte ich mir nicht zu erklären, was genau ihn so besonders machte. Irgendetwas schien er auszustrahlen.
Die beiden Gestalten quietschten auf.
»Hinterhalt!«, schrie der eine, was ihm nicht viel half, denn einige Sekunden später landete die Schwertklinge in seinem Bauch. Auch der zweite hatte wenig Glück und fiel ebenfalls leblos zu Boden. Erschrocken schlug ich die Hände vor den Mund.
Lauf! Er wird dich töten!
Und dann rannte ich. Ich rannte und schlitterte über das helle Eis. Doch ich kam nicht einmal bis zum Ende des Ganges, da packten mich zwei Hände an den Hüften und zogen mich einfach zurück. Eine davon verschloss sogleich meinen Mund.
»Hör auf, zu schreien, wenn dir dein Leben lieb ist! Wir sind schon viel zu spät«, wisperte er in mein linkes Ohr. Warmer Atem strich mir über den Nacken. Von dem Schwert, das wieder an seiner Hüfte hing, tropfte noch immer dunkles Blut. Ganz langsam nahm er die Hand von meinem Mund.
Ich hätte ihn fragen sollen, für was wir zu spät waren, aber meine Panik siegte. »Hilfe!«, schrie ich, so laut ich konnte. Wütend drückte er mich so nah an sich, dass es mir beinahe den Atem raubte. Seine Muskeln spannten sich und seine Atemzüge wurden flacher. Stimmen drangen zu uns. Zuerst nur ein leichtes Wispern, dann nahmen sie an Lautstärke zu.
»Gut gemacht«, knurrte er und zog mich mit sich. Ich wehrte mich mit aller Kraft, biss und trat um mich. Das Flüstern umgab uns und schlich die eisigen Wände entlang. Plötzlich, wie aus dem Nichts, wandelte es sich in einen gellenden Schrei. Eissplitter platzten von den Wänden und prasselten von allen Seiten auf uns ein. Sie rissen mir die Haut auf und ließen mich zusammenzucken.
Besart keuchte auf.
Der Ton wurde immer schriller und lauter. Am liebsten hätte ich mir die Ohren zugehalten, aber das ging nicht. Ich schrie auf und krümmte mich vor Schmerzen. Müdigkeit überkam mich und weiterhin splitterte Eis. Meine Augen schlossen sich allmählich und ich sank in Besarts Armen zusammen. Dunkle Schatten umarmten mich, während sanfte Stimmen mich in den Schlaf wiegten.
Leise Geräusche drangen an mein Ohr. Aus der Ferne vernahm ich das Knistern eines Lagerfeuers und ein vertrauter Geruch nach Kräutern lag in der Luft. Meine Arme und Beine wogen Zentner, die Augen hielt ich geschlossen und doch hatte ich keine Schmerzen. Alles schien so leicht, so bequem und vertraut.
War ich etwa tot? Fühlte sich Sterben so an?
Vorsichtig öffnete ich die Lider. Ich lag unter einer weichen Felldecke. Wärme umgab mich und diese ungemütliche Kälte war endgültig verschwunden.
Langsam richtete ich mich auf. Das weiße Kleid, welches ich noch immer trug, raschelte. Über mir spannte sich ein beiges Zelt. Ein kleines Feuer brannte in der Mitte der Fläche und Waffen lagen auf dem Boden verstreut. Der vertraute Geruch kam tatsächlich von Kräutern, die überall an Schnüren von der Zeltdecke hingen. Einige kannte ich, andere waren mir fremd. Tante Kaisslin hatte mich in Pflanzenkunde gelehrt, denn sie verzichtete auf Medikamente aus der Apotheke und nahm stattdessen die Kräuter aus ihrem Garten.
Mehr gab es nicht zu sehen. Es wirkte beinahe, als ob man dieses Zelt absichtlich nicht eingerichtet hätte, damit man schnell verschwinden könnte.
Ich zog das Fell höher.
Endlich war diese eisige Kälte aus dem Palast verschwunden. Erst jetzt betrachtete ich das weiche Ding in meinen Armen genauer.
Was zum …?!
Dunkle Bärenaugen und ein dazugehörender Kopf starrten mich an. Schreiend schleuderte ich das Bärenfell ins Feuer. Im Nu fing es an, zu brennen. Panisch drückte ich mich gegen die Zeltwand, die ächzend unter meinem Gewicht nachgab.
Ein Mann mit schwarzem Umhang kam hereingerannt, den Blick auf das brennende Fell gerichtet. Noch immer starrten mich die Augen des toten Tieres an, bevor sie endgültig vom Feuer verschlungen wurden.
Der Mann sah zu mir. »Du bist wach, wie schön«, murmelte er genervt und zog die qualmenden Reste aus den Flammen. Erst jetzt erkannte ich Besart wieder.
»Wo bin ich? Und wieso haben Eure Decken Köpfe?«, verlangte ich zu wissen und starrte ihn finster an.
»Im Lager der Jäger. Und zu deiner anderen Frage: Wieso nicht?« Verwundert sah er mich an. Achtlos schmiss er das angekohlte Fell in eine Ecke. »Feuermädchen, wolltest du das ganze Zelt abfackeln?«
»Mein Name ist Taija!«
»Taija, wie das Feuer, passt ja«, knurrte er und kam bedrohlich näher.
Schnell richtete ich mich auf. »Was ist bei der weißen Königin passiert und wo steckt sie?«
»Ich wollte dich befreien, aber du musstest ja durch den ganzen Saal brüllen. Die Königin hat ihre Augen überall und hat versucht, dich mit ihrer Stimme zu locken. Und keine Angst, sie ist weit weg in ihrem Schloss«, sagte er, während er mich weiterhin wütend anfunkelte.
»Und warum befreit Ihr mich?«
»Wieso nicht? Die Weiße darf das Spiel nicht gewinnen.«
»Spiel, immer dieses Spiel. Dreht sich bei Euch alles nur um den Streit des Prinzen mit der Weißen?«, schrie ich ihm entgegen. Meine Stimme bebte. Wut brodelte in mir auf.
»Es ist nicht einfach nur ein Spiel. Es entscheidet, wer die Ländereien regiert.«
»Ein Machtkampf also. Und welche Rolle nehme ich dabei ein?« Fragend musterte ich ihn.
Seufzend fuhr er sich durchs Haar. »Menschenkinder können besser Albtraumschach spielen, weil ihre Fantasie grenzenlos ist. Außerdem sind die Weiße und der Prinz gleich mächtig, darum macht es keinen Sinn, wenn nur sie gegeneinander antreten. Da sich nur etwa jede zweite Vollmondnacht ein Menschenkind hierher verirrt, will es jeder in seinen Besitz bringen.«
»Albtraumschach? Davon hat die Königin ebenfalls gesprochen. Was ist das?«, fragte ich genervt.
»Das wirst du noch sehen.«
Er stand kurz vor meinem Bett und betrachtete mich forschend aus seinen eigenartigen Augen. Es wirkte beinahe, als ob sie nicht von dieser Welt wären. Sobald man hineinblickte, verlor man sich darin. Ich schluckte.
»Was sagt eigentlich Euer Meister dazu, dass Ihr ihn einfach im Palast zurückgelassen habt?«, hakte ich nach und räusperte mich. Irgendwie musste ich Antworten bekommen. Dieser Traum dauerte schon viel zu lange.
»Meister?«, fragte er zögerlich. Besart schien einen Moment zu überlegen, ehe er anfing, so laut zu lachen, dass man ihn womöglich kilometerweit hörte. Spitze Zähne, wie die eines Raubtieres, blitzten hervor. Verwundert sah ich ihn an.