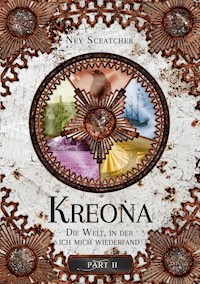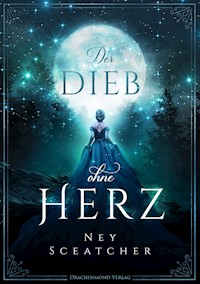
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Drachenmond Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Es waren einmal ein Mädchen ohne Geschichte und ein Dieb ohne Herz In einer Winternacht taucht in einem Fischerdorf die junge Malina auf. Sie hat keinerlei Erinnerung an ihre Vergangenheit, doch die Sehnsucht nach ihrer Herkunft bleibt unvergessen. Als sie eine Einladung der Königin aus der Stadt der Masken erhält, sieht Malina ihre Chance gekommen. Doch auf dem Weg lauern viele Gefahren, denn ihr Begleiter ist der Dieb ohne Herz und er ist nicht die einzige Märchenfigur, die Wirklichkeit wird.Auf der Suche nach der Wahrheit müssen sie hinter viele Masken blicken auch hinter die eigenen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 414
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Dieb ohne Herz
Ney Sceatcher
Copyright © 2020 by
Lektorat: Stephan R. Bellem
Korrektorat: Michaela Retetzki
Layout: Michelle N. Weber
Dekorelemente: Shutterstock
Illustrationen: Ana Neves
Umschlagdesign: Alexander Kopainski
Bildmaterial: Shutterstock
ISBN 978-3-95991-419-2
Alle Rechte vorbehalten
Für den Jungen ohne Herz,
der mir den Anfang meiner Geschichte gab.
Für meine Eltern,
die mich in allem unterstützen.
Für meine Freunde,
die mich auffangen, wenn ich falle.
Für meine Leser,
die mich zum Lächeln bringen.
Und für dich,
ich hoffe, du findest deine Geschichte und lebst deine Träume.
Inhalt
Prolog
1. Wo Sterne funkelten
2. Wo Wünsche wahr wurden
3. Wo Mädchen verschwanden
4. Wo Entscheidungen Herzen brachen
5. Wo Fremde einem halfen
6. Wo Diebe ihr Herz in Bäumen versteckten
7. Wo Märchen begannen
8. Wo Hexen die Guten waren
9. Wo die Wahrheit sich hinter Lügen tarnte
10. Wo Masken grün wie die Hoffnung waren
11. Wo Schwestern sich für lange Zeit trennten
12. Wo Namen keine Bedeutung mehr hatten
13. Wo Tränen für Erinnerungen standen
14. Wo Ungeheuer sich nahmen, was sie wollten
15. Wo Märchen schöner klangen, als sie waren
16. Wo manche Welten grau wirkten
17. Wo Musik einen Herzschlag ersetzte
18. Wo Mädchen mit Raben sprachen
19. Wo Schmetterlinge sterben mussten
20. Wo drei Menschen beim Ankleiden halfen
21. Wo fremde Menschen aufeinandertrafen
22. Wo Masken ihre Besitzer wechselten
23. Wo Narben eine Bedeutung hatten
24. Wo Gedanken und Träume wie Seifenblasen platzten
25. Wo Diebe Herzen stahlen …
26. Wo ein Zauber die Wahrheit verbarg
27. Wo manches Ende zu früh kam
28. Wo drei Hexen Lebewohl sagten
29. Wo alles zu Ende ging mit einem letzten Märchen
Epilog
Danksagung
Prolog
Es war einmal vor langer Zeit, so erzählte man sich, da existierte eine Stadt, in der die Menschen Masken trugen, um ihr wahres Gesicht zu verbergen. Masken aus Glas, aus Papier, aus Holz oder aus Metall. Es gab sie in allen Variationen. Niemand wusste, wie die Menschen dahinter aussahen, und niemand fragte. An jenem Ort, der auch Malufra genannt wurde, regierte eine Königin mit langem blondem Haar. Ihr Haar war so lang, dass die Diener morgens eine Stunde damit verbrachten, die dichte Mähne zu bändigen und hochzustecken. Auch die Königin trug Masken, nur waren ihre schöner und prunkvoller als die der anderen. Sie sei verrückt, so tuschelte man hinter vorgehaltener Hand, würde mit ihrem Spiegelbild sprechen, würde sich selbst Lieder vorsummen und Gestalten sehen, die gar nicht existierten. Ja, um die Königin von Malufra rankten sich viele Geschichten. Nur was der Wahrheit entsprach und was nicht, das wusste keiner. Die Stadt lag schon seit Jahrzehnten abgeschieden, und um sie zu betreten, musste man durch den dunklen Wald, vorbei an dem Dieb ohne Herz.
Ein Dieb ohne Herz? Auch das ist eine andere Geschichte.
Vor Malufra und dem dunklen Wald, da lag ein kleines Fischerdorf. In dem man im Gegensatz zu Malufra keine Masken trug. In diesem Dorf lebte ein Mädchen, sein Haar war so weiß wie Schnee und seine Augen so blau wie das Meer, das es tagein, tagaus zu Gesicht bekam. Seit sie klein war, sammelte sie Geschichten. Das Mädchen lauschte gespannt all den Erzählungen. Egal ob wahr oder nicht, verwahrte alles in seinem kleinen Köpfchen und trug sie seitdem wie ein Gepäckstück mit sich herum.
Manchmal, wenn niemand sprach, dann blickte sie in die Gesichter der Menschen und versuchte sich ihre Geschichte vorzustellen. Versuchte zu erahnen, was für Geheimnisse sie versteckten, was für Lieder sie hinter verschlossenen Türen sangen und was ihnen durch den Kopf ging, während sie gedankenversunken in den Himmel starrten.
Das Mädchen liebte Geschichten und Märchen und ganz tief in ihrem Herz, da hatte sie ihre liebsten Erzählungen versteckt. Die Geschichte über die verbotenen Wünsche oder die der gläsernen Prinzessin, die Erzählung von dem Mädchen ohne Kopf oder eben die Geschichte vom Dieb ohne Herz.
Doch das Mädchen lebte nicht von klein auf in diesem Dorf. An einem stürmischen Wintertag tauchte es auf und niemand wusste, wer es war oder woher es kam. Seitdem arbeitete sie in der Werkstatt einer herzensguten Frau und half ihr dabei, Masken herzustellen. Masken für die reichen Leute in dem Fischerdorf, die auch so etwas Einzigartiges besitzen wollten wie die Menschen in Malufra. Die Masken stellten sie bei sich zu Hause auf oder hängten sie an die Wand, um zu zeigen, dass sie das Geld dafür besaßen.
Inzwischen war das Mädchen älter geworden und sein Herz verlangte nach mehr Geschichten. Sie wollte hinaus in die Welt, wollte alles erkunden, verspürte den Drang, endlich ihre eigene Geschichte zu entdecken.
Da stand sie also, blickte hinaus auf das Meer, in ihrer Hand eine schwarze Maske, auf der leuchtende Sterne abgebildet waren.
Lasst es mich so sagen, in dieser Geschichte wird es ein Happy End geben, nur nicht so, wie wir alle es erwarten.
Wo Sterne funkelten
vor einigen Jahren
Es war bereits dunkel auf den Straßen, keine Menschenseele war mehr zu sehen. Der Mond beleuchtete schwach die kleinen gepflasterten Wege, die durch das Dorf führten, während vereinzelte Schneeflocken sich einen Weg hinunter auf die Erde bahnten. Kalt war es und dunkel, nur das leise Flüstern des Windes drang durch die Ritzen hinein in die Häuser. Die meisten Menschen lagen in ihren Betten, verkrochen sich unter dicken Wolldecken und träumten bereits von morgen.
In einem Haus, das etwas weiter abgelegen stand, da brannte noch Licht. Eine Frau mit dichtem schwarzem Haar saß an ihrem Arbeitstisch und hatte sich über einen Gegenstand gebeugt. Diese Frau liebte die Nacht, da war es ruhig und man konnte ungestört arbeiten. Während die anderen schliefen, da stellte sie Masken her.
In ihrer Hand lag das neueste Werk, die Bestellung einer reichen Adelsdame. Die Maske war aus Glas, ganz bunt und farbenprächtig, die Seiten zierten Federn von Vögeln. Vögel, die man seit Jahren nicht mehr zu Gesicht bekommen hatte. Die Frau fuhr sich seufzend durch das Haar. Bis morgen früh musste sie fertig sein, nur fehlte noch das gewisse Etwas. Nur was?
Sie wollte erneut aufseufzen, als ein schwaches Klopfen an der Tür sie zusammenzucken ließ.
»Herein!«, rief die Frau, die sich selten fürchtete. Sie glaubte an die Gerechtigkeit und auch an das Gute in den Menschen. Wenn jemand sie bestehlen wollte, dann könnte sie es ohnehin nicht verhindern. Mehr als Masken und bunte Federn konnte sie nicht bieten, denn das Geld, das sie nicht brauchte, das schenkte sie den Armen und Bedürftigen.
Die Holztür schwang auf und ein Mädchen erschien in ihrem Sichtfeld. Zitternd blickte es zu der Frau, eine Hand noch immer auf der Klinke. Der Wind blies ihr durch das Haar, verlieh ihr etwas Gespenstisches. Vielleicht lag es auch einfach an ihrer Haarfarbe. So hell wie das milchige Gesicht des Mondes.
»Verzeihung«, stammelte das Mädchen und umklammerte den Griff der Tür etwas fester.
Die Frau mit dem schwarzen Haar legte die Maske auf die Seite und blickte dann wieder zu ihr auf.
»Wie kann ich dir helfen?«, fragte sie zögerlich.
»Ich brauche eine Maske.« Noch immer zitterte es und erst jetzt fiel der Frau auf, dass diese dürre Gestalt mit dem hellen Haar nur ein einfaches Kleid trug. Der Stoff wehte um ihre Beine und bedeckte kaum ihre Knie. Immer wieder versuchte das Mädchen, das Kleid herunterzuziehen, der Wind war jedoch kräftiger. Die Haut des Mädchens war voller Dreck, kaum eine saubere Stelle war in seinem Gesicht zu finden.
Besorgt stand die Frau auf. »Masken sind hier kostbar, beinahe unbezahlbar.« Sie schüttelte den Kopf. »Komm erst einmal herein.« Auffordernd winkte sie das Mädchen in die warme Stube.
Das Kind nickte erleichtert, trat ein und schloss die Tür hinter sich. Das Rauschen des Windes verwandelte sich augenblicklich wieder in ein sanftes Flüstern.
»Wo sind deine Eltern?«, fragte die Frau und drehte sich kurz um, um nach einer dicken Decke zu greifen, die über einem der Stühle lag. Eilig reichte sie dem Kind das Stück Stoff.
Das Mädchen schwieg, starte einfach geradeaus zu der flackernden Kerze, die auf dem Holztisch stand und den Raum spärlich beleuchtete.
»Bist du auf der Flucht?«, versuchte es die Frau weiter.
Noch immer schwieg das Mädchen.
»Du brauchst nicht zu antworten, wir sind alle auf der Flucht vor irgendetwas.«
Das Mädchen lächelte und nickte. Die Frau wusste nicht warum, doch dieses Lächeln erweichte ihr Herz. Sie durfte dieses Kind nicht einfach wieder hinaus in die Kälte schicken. Bestimmt hatte es seine Eltern bei dem Sturm verloren und morgen, sobald der Himmel wieder klar war, würde sie dem Mädchen helfen, seine Familie zu finden.
»Was für eine Maske möchtest du denn?«
»Eine dunkle, mit Sternen«, sprach das Mädchen ganz überzeugt. Ihre anfängliche Unsicherheit schien wie verflogen.
»Ich muss dich leider enttäuschen, ich werde dir keine Maske machen.«
Die Mundwinkel des Kindes wanderten wieder nach unten.
»Ich werde dir zeigen, wie es geht, und dann machst du deine eigene.«
»Malina!«
»Malina!«
»Himmel noch mal, Malina, das Wasser!«
Erschrocken zuckte ich zusammen. Meine Gedanken waren gerade bei meiner ersten Begegnung mit Irena gewesen. An diesen Tag aus meiner Kindheit konnte ich mich noch gut erinnern. Er war einer der wenigen, die mir im Gedächtnis geblieben waren.
»Malina!«
»Ja!« Ich rollte mit den Augen und nahm den Topf mit dem kochenden Wasser von der Feuerstelle.
»Ich wundere mich bei dir manchmal, dass die komplette Hütte noch nicht in Brand steht.« Irena seufzte und fuhr sich energisch durch ihr dichtes, dunkles Haar.
Ich schwieg und verdrängte den Gedanken, dass mir genau das beinahe vor einer Woche passiert wäre. Ich hatte das Feuer vergessen und war eingeschlafen. Zum Glück befand Irena sich zu dieser Zeit auf dem Marktplatz.
»Irgendwelche interessanten Bestellungen?«, fragte ich, um sie von dem Thema abzulenken. Es war warm und die Sonne schien erbarmungslos vom Himmel. Manchmal bedauerte ich es, dass wir nicht unten am Meer wohnten. Dort wehte wenigstens ein kräftiger Wind. Den brauchten die Fischer auch. Sie verbrachten den ganzen Tag auf ihren Segelbooten und waren der Sonne ausgeliefert.
»Eine Maske für die Zofe eines adligen Herrn, eine Maske für den Stadtältesten für ein Fest, eine Maske für eine reiche Dame aus Bolinski und eine Maske für einen Handelsmann.« Irena setzte sich auf ein beiges Holzscheit neben dem Feuer und betrachtete die Flammen. Hinter ihr befand sich unser Heim, in dem wir beide lebten. Das Haus war wie alle Behausungen des kleinen Fischerdorfes Rondama klein, alt und trotzdem robust. Der einzige Unterschied waren die vielen kleinen Verzierungen an den Wänden. Es waren vergilbte Zeichnungen aus einer früheren Zeit und trotzdem erkannte man anhand der Umrisse, was sie darstellen sollten. Es waren Bilder von Geschichten, von Märchen, die man sich erzählte. Irenas Zuhause befand sich in der Nähe des Waldes, den keine Menschenseele betrat. Unheimliche Erzählungen rankten sich darum. Dort lebte nämlich der Dieb ohne Herz mit seinen Kameraden. Der Wald war ihr Zuhause, und wer dort vorbeiwollte, der musste einen hohen Preis zahlen. Der Dieb konnte mit den Bäumen und dem Wind sprechen, auch die Dunkelheit war ein Teil von ihm, und wer es wagte, ihn zornig zu machen, der würde sich in den Tiefen des Waldes verirren und nie mehr zurückkehren. Gleich dahinter lag Malufra, die Stadt der Masken.
»Das klingt nach viel Arbeit«, sprach ich und stellte den Topf mit dem Wasser neben mir ab.
»Viel Arbeit für nichts.« Sie seufzte und erst jetzt fielen mir die dunklen Schatten unter ihren Augen auf. Ich wusste nicht, wie alt sie war. Irena wirkte immer noch jung, und wenn ich sie ansah, dann vergaß ich irgendwie immer, dass sie diejenige war, die mich aufgezogen hatte. Sie war mehr Freundin als Ersatzmutter für mich. Sie besaß keine Familie, ihre Eltern starben schon früh an einer Krankheit und ihr Bruder verließ nach seiner Verlobung mit einer angesehenen Frau das kleine Fischerdorf.
»Mein Einkommen reicht kaum für uns beide, wie will ich weiterhin die Armen unterstützen? Viele Menschen stellen Masken her und jeder bietet sie günstiger an. Die Preise gehen immer mehr zurück und irgendwann können wir diese Dinger verschenken.«
Ich schwieg, wusste nicht so recht, was ich darauf antworten sollte. Etwas nachdenklich betrachtete ich meine Hände. An der linken Hand zog sich ein tiefer Schnitt quer über die Handfläche. Er war noch frisch. Masken aus Glas herzustellen war aufwendig und schwer. Die Glasstücke hatte Irena von einem bekannten Händler aus dem Dorf. Mithilfe eines speziellen Schneidwerkzeuges konnte man die Stücke kleiner schneiden. Dabei musste man äußerst vorsichtig sein; wenn man zu kräftig drückte, dann zersprang das Glas in Tausende Teile und bohrte sich in die Handflächen. Trotz des Aufwandes liebte ich diesen einen Moment, wenn man die bunten Stücke vereinte, die fertige Maske abschliff und gegen das Licht hielt. Erst im Licht bekamen die Farben Leben und funkelten im Schein der Sonne. Magie, hatte Irena diesen Vorgang genannt. Magie war der Teil des Lebens, der einen zum Staunen brachte.
»Wo hast du schon wieder deine Gedanken?« Erneut weckte die Stimme von Irena mich. Sie ließ mich auftauchen aus meiner tiefen Gedankenwelt, in der ich mich manchmal verlor.
Lächelnd sah ich in ihre grünen Augen. »Die Idee mit den Masken, die Idee …« Ich wollte gerade weitersprechen, als Irena die Augen schloss und die linke Hand hob, um mich zum Schweigen zu bringen.
»Ich weiß, was du sagen möchtest. Fang bitte nicht wieder damit an.«
»Irena, hör mir doch zu. In Malufra ist der Bedarf nach Masken viel größer als hier, und wenn wir erst einmal Masken in Malufra selbst verkaufen würden, dann würden wir …« Abermals hob sie die Hand, um mich zu unterbrechen. Ich schwieg und blickte zu Boden. Die hellen Haarsträhnen schoben sich vor mein Blickfeld.
»Wenn ist ein Wort mit vielen Bedeutungen. Erinnerst du dich an die Geschichte des Fischerjungen, der den Mond besitzen wollte?« Irena war inzwischen aufgestanden und hatte sich das schwarze Haar mit einem Tuch zurückgebunden. Ihre Hände waren makellos. Kein Kratzer, keine Schwielen, keine Verletzungen. Nur ab und an entdeckte man bei starkem Licht kleine Narben. Narben von früher, aus einer Zeit, in der Irena noch lernen musste, dass auch Masken ihren eigenen Willen hatten.
»Die Geschichte vom jungen Fischer, der alles besaß und alles hatte?«
»Genau diese Geschichte.« Irena nickte zufrieden und klopfte sich die Hände an dem schwarzen, langen Kleid ab, das sie trug. »Holst du die bestellte Ware ab? Ich fange derweil schon mal an.« Sie wartete erst gar nicht meine Antwort ab, sondern verschwand im Inneren des Hauses.
Ich dachte noch einmal über ihre Worte und die Geschichte vom Fischer nach.
Er hatte viele Freunde, eine Familie und ein wunderschönes Mädchen an seiner Seite. Seine Taschen waren gefüllt mit Geld und dennoch wollte er immer mehr. Er wollte ein Schloss wie das des Königs, er wollte ein Pferd so schnell wie der Wind, ein Huhn, das goldene Eier legte, und eine Schar an Dienern. Irgendwann, nach unzähligen Jahren, waren all diese Dinge in seinem Besitz. Er hatte wirklich alles und doch war es noch nicht genug. Er blickte hoch in den Himmel und sah den runden Mond dort hängen. Den Mond dort oben, den wollte er auch besitzen. Die Gier spiegelte sich in seinen Augen, und seine Freunde und seine Familie hatten bald Angst um den Fischer. Doch dieser ließ sich nicht beirren und jagte fortan den Mond. Er lief dem Mond entgegen, achtete nicht auf seine Schritte und den Weg zu seinen Füßen. Er war so versunken in seinen Gedanken, so voller Gier, dass der Fischer nicht bemerkte, dass er gerade einen Fluss durchquerte. Ehe er sich’s versah, da riss die reißende Strömung an seinen Kleidern und zog ihn hinab in die Tiefe des Wassers. Ja, dort lag er nun und starb eines einsamen Todes. Manchmal war alles einfach nicht genug.
Seufzend warf ich einen Blick hinüber zu dem Wald, der nicht weit von uns entfernt lag. Dichte Bäume versperrten mir die Sicht. Die Blätter raschelten im Wind. Irgendetwas Unheimliches ging von diesem Wald aus. Schnell schüttelte ich den Kopf, um meine Gedanken zu vertreiben, und machte mich auf den Weg hinab zu dem Dorf. Ja, manchmal war alles einfach nicht genug.
Wo Wünsche wahr wurden
Geschichten waren es, die uns zum Leben erweckten, dank ihnen gerieten wir niemals in Vergessenheit. Sie belebten uns, ließen uns fühlen und träumen, verliehen uns unsichtbare Flügel, die uns hoch hinauf Richtung Himmel trugen.
Es war bereits später Abend, als ich mit der bestellten Ware vor dem Eingang des Hauses stand. Seufzend ließ ich den schweren Sack auf den mit Gras überwucherten Boden gleiten. Unsere Aufträge wurden immer weniger und trotzdem bestellte Irena dieselbe Menge bei den Händlern. Ihr Herz ließ es nicht zu, dass andere unter unseren schweren Zeiten litten. Innerlich hoffte ich, dass es wirklich nur schwere Zeiten waren, obwohl ich die Wahrheit eigentlich kannte.
Mein Blick glitt hoch zu den Sternen über uns. Schon als junges Mädchen hatten mich diese hellen Punkte auf der schwarzen Tapete fasziniert. Wie sie einfach da waren, so winzig und doch so wunderschön. Gern erinnerte ich mich an eines der ersten Märchen, das ich in meinem Leben gehört hatte, das Märchen über die Wünsche. In der Geschichte hieß es, dass man sich alles wünschen konnte, was man wollte. Jeder noch so kleine Wunsch würde in Erfüllung gehen, wenn man als Gegenleistung dafür etwas bot. Als eine Art Vertrag wurde für jeden ausgesprochenen Wunsch ein Stern am Himmelszelt erleuchtet, der erst wieder verschwand, wenn man seine Schuld beglichen hatte, damit der Traum in Erfüllung gehen konnte. Sternschnuppen trugen ihn dann hinab auf die Erde.
Mein Blick verweilte noch etwas länger bei dem Lichtermeer dort oben, ehe ich den vollen Sack wieder hochhob und in das Innere des Hauses trat. Auf dem kleinen Schreibtisch in der Ecke brannte noch eine Kerze. Die Flamme schien im Schein der Dunkelheit zu tanzen. Ganz langsam bewegte sie sich hin und her. Irena saß am Tisch. In ihrer linken Hand hielt sie eine angefangene Maske und in der rechten Hand eine ziemlich ausgefallene Feder. Ihren Kopf hatte sie auf die Holzfläche gelegt und ein leises Schnarchen war zu hören.
Lächelnd zog ich die Tür hinter mir langsam zu. Morgen würde sie sich wieder ärgern, dass sie eingeschlafen war, aber das war in Ordnung. Irena brauchte ihren Schlaf.
Ich schnappte mir die Kerze und lief durch das Vorzimmer, hinein in die kleine Küche mit dem runden Holztisch in der Mitte des Raumes. Ein Topf mit Suppe stand dort. Doch diesen beachtete ich kaum. Essen konnte ich noch später. Ich schritt die Holzstufen hinauf, die gleich nach der Küche anfingen. Die Decke war etwas niedrig und mit jedem Schritt musste ich meinen Kopf etwas mehr einziehen, bis ich endlich wieder aufrecht gehen konnte. Oben im Dach befand sich mein Zimmer. Es war groß, wenn auch etwas spärlich eingerichtet. Der komplette Dachstock gehörte mir, na ja, fast mir. Außer meinem Zimmer befanden sich noch zwei weitere Räume dort oben. Zum einen eine Abstellkammer und zum anderen Irenas Zimmer, das sie seit Jahren nicht mehr betreten hatte. Oft schlief sie unten bei ihrem Arbeitsplatz, weswegen sie starke Rückenschmerzen plagten.
In meinem Zimmer befanden sich ein schmales Bett, ein Tisch mit zwei Stühlen, eine Kommode und ein kleines Regal. Platz für mehr hätte ich gehabt, nur mehr brauchte ich nicht.
Auf meinem Bett lagen einige Kissen und Decken. Einen kleinen Teil nahm ich mit, während ich die Kerze noch in der anderen Hand hielt, und lief wieder hinunter zu Irena. Ihr Schnarchen unterbrach sie kein einziges Mal. Ihr Schlaf war tief und fest und womöglich hätte sie nicht einmal bemerkt, wenn sich eine Horde Ziegen in unserem Haus befunden hätte. Ich deckte sie zu und bettete ihren Kopf auf eines der Kissen. Das dichte Haar fiel ihr dabei vor die Augen. Ich lächelte, flüsterte leise »Gute Nacht« und wagte mich dann noch einmal hinaus in die Dunkelheit. Ich setzte mich direkt vor den Eingang des Hauses, stellte die flackernde Kerze neben mich und zog die Knie an meine Brust. Die Stille war wunderbar und manchmal genoss ich es einfach, wenn ich meine Augen schließen konnte und der Wind durch mein Haar fuhr.
Nur war heute etwas anders. Ich fühlte mich beobachtet. Fröstelnd rieb ich mir die Arme und starrte dorthin, wo die dichten Bäume sich umarmten. War da ein Schatten, oder spielte mir bloß die Dunkelheit einen Streich? Dieses eigenartige Gefühl verschwand wieder so schnell, wie es aufgetaucht war. Da war nichts, zumindest hoffte ich das.
Ich schüttelte meinen Kopf und stand auf. Erstaunlicherweise war ich immer noch hellwach. Ich ging kurz nach drinnen und vergewisserte mich noch einmal, dass Irena wirklich tief und fest schlief, ehe ich eines der Küchenmesser in meinem Stiefel versteckte, die Kerze ausblies und hinaus in die Nacht schlich. Ich schlenderte einen kleinen Weg entlang, über einen Hügel und vorbei an Sträuchern und Wildblumen. Immer wieder wanderte mein Blick dabei zu den dichten Baumkronen des Waldes, der sich nun immer mehr entfernte, je weiter ich hinab in das Dorf lief.
Über all die Jahre hatte ich mich immer wieder gefragt, woher ich kam. Warum ich in jener Nacht nach einer Maske gefragt hatte, war für mich weiterhin ein Rätsel. Es schien beinahe so, als ob mir all die Erinnerungen vor jenem Abend fehlten. Auch Irena konnte mir nicht wirklich weiterhelfen. Sie hatte sich überall erkundigt, doch niemand kannte mein Gesicht oder meine Geschichte. Alles rund um meine Vergangenheit blieb verborgen hinter dem Schatten der Ungewissheit.
Bald erreichte ich die Mauer des Dorfes. Der einzige Eingang war ein schweres Eisentor, das bewacht wurde. Ein Wachmann stand davor. Sein Haar war dunkel, jedoch entdeckte man selbst im schwachen Licht einige graue Strähnen. Er lächelte, als er mich sah, dabei bildeten sich kleine Fältchen um seine Augen.
»Malina, noch wach zu solch später Stunde?«, fragte er, während er die Hand zum Gruß hob. Ich erwiderte den Gruß und nickte leicht.
»Kann nicht schlafen«, sprach ich und wartete geduldig, bis er das Tor öffnete. Eilig schlüpfte ich hindurch, ehe ich mich noch einmal umdrehte. »Richte deiner Frau Grüße aus, Edmund.« Er nickte, wie ich es vorhin getan hatte, und schloss dann wieder die Pforte.
Meine Beine trugen mich immer weiter hinab, vorbei an Häusern, in denen noch Licht brannte, vorbei an dem alten Wirtshaus und den betrunkenen Kaufleuten. Erst am Hafen machte ich halt, als das Rauschen des salzigen Wassers an meine Ohren drang. Hier war es kühler und irgendwie bereute ich es, dass ich keine Jacke angezogen hatte. Der Wind blies immer kräftiger, während die Wellen in unregelmäßigen Abständen gegen die Mauern aus Stein schlugen. Es roch nach Salz, nach Fisch, nach Freiheit und nach …
»Seltsamer Abend, nicht wahr?«
Ich drehte mich überrascht um. Es war ein Junge. Ich hatte gar nicht bemerkt, wie er neben mich getreten war. Er hatte blondes, längeres Haar und blickte starr zum Meer. Seine Kleidung war schwarz und er trug ungewöhnlich viele Schichten auf einmal. So was taten meist nur Menschen, die auf der Durchreise waren.
»Ist nicht jeder Abend seltsam?«, fragte ich zurück und blickte immer noch zu dem jungen Mann. Auf seinem Rücken trug er einen Köcher mit Pfeilen und einen Bogen. Unbewusst dachte ich an das Messer in meinem Stiefel. Im Nahkampf würde ihm der Bogen nichts mehr nützen, obwohl, konnte ich überhaupt einen Menschen verletzen?
»Du kommst nicht von hier, oder?«, fragte ich.
»Ich bin auf der Durchreise.«
»Aha!« Triumphierend schnipste ich mit den Fingern.
Er wandte nun seinen Kopf von dem Meer ab und sah mich etwas verwirrt an. Seine Augen waren von einem sanften Braun. Die Gesichtszüge des Jungen waren weich, was zu seinem freundlichen Lächeln passte. Irgendwie war es beinahe unmöglich, sein Alter zu erraten. In seinem Blick lag so viel Tiefe und Wissen, aber trotzdem wirkte er jung, was womöglich an dem fehlenden Bart lag. Hier im Dorf trugen die meisten Männer stolz einen Bart, und wenn es nur ein winziger war.
»Und du?«, fragte er nun. Er wirkte interessiert, richtete seine volle Aufmerksamkeit auf mich.
»Ich wohne hier«, sprach ich.
»Deine Haare sind seltsam.«
»Sie sind nicht …« Ich schüttelte den Kopf, blickte wieder hinauf zu den Sternen. Im Grunde waren sie wirklich nicht so eigenartig, wie manche dachten. Viele Leute trugen andere Haarfarben. Ganz früher existierten nur diese typischen Braun-, Schwarz- und Blondtöne, selbst Rot war sehr selten. Irgendwann im Laufe der Zeit fanden Kräuterfrauen heraus, wie man die Farbe der Haare auf Dauer ändern konnte, und seitdem gab es die unterschiedlichsten Haarfarben.
»Sie sind nicht seltsam«, vervollständigte er meinen Satz.
»Sie sind nicht seltsam«, wiederholte ich nun und musste ein Lächeln unterdrücken.
Die Sterne über mir funkelten, verzauberten mich mit ihrer kompletten Schönheit und zogen mich in ihren Bann. Immer wieder geisterte mir dabei das Märchen mit den Wünschen durch meinen Kopf. Was, wenn es wirklich wahr wäre? Was würde ich mir wünschen?
»Starrst du andauernd hoch in die Sterne?«
Ich spürte, dass er mich immer noch ansah. Wie das Braun seiner Augen auf mir lag und wie er sich wunderte, was diesem seltsamen Mädchen mit den hellen Haaren wohl durch den Kopf ging.
»Nein, manchmal nehme ich mir auch etwas Zeit und esse, damit ich nicht ganz eingehe«, antwortete ich.
»Es gibt da so ein Märchen, dass man sich wünschen kann, was immer man möchte.« Er fuhr fort, ohne auf meine kreative Antwort einzugehen.
Noch immer blickte ich hoch in den Himmel, beobachtete ihn dabei aus dem Augenwinkel heraus. Jungen Männern sollte man nicht trauen, besonders nicht, wenn sie einen Bogen bei sich trugen und Mädchen nachts auflauerten. »Das Märchen kenne ich.«
»Was würdest du dir wünschen?«, fragte er und machte einen Schritt auf mich zu. Nun senkte ich wieder meinen Blick und ging etwas auf Abstand.
»Ich tue dir nichts, keine Sorge.« Besänftigend hob er beide Hände hoch und schenkte mir dieses nette Lächeln von vorhin.
»Ich würde ganz gern nach Malufra gehen«, beantwortete ich die Frage wahrheitsgemäß.
»Der Stadt der Masken? Dafür müsstest du durch den Wald.« Er schüttelte sich. »Dort lebt ein Ungeheuer.«
»Im Grunde ist es ein Dieb.« Das Märchen vom Dieb ohne Herz war eines meiner liebsten. Es war unheimlich, schauerhaft und trotzdem schön auf seine Art und Weise.
»Ein Dieb ohne Herz.« Erneut schüttelte sich der Junge und spuckte dann drei Mal auf den Boden.
»Vertreibt Unglück«, beantwortete er meine fragenden Blicke.
Wieder etwas, woran man merkte, dass er nicht von hier kam. Hier spuckte niemand auf den Boden, nicht einmal, wenn eine schwarze Katze einem den Weg kreuzte.
»Trotzdem würde ich gern nach Malufra, ich würde gern zur Königin gehen.«
»Die ist verrückt.« Schon wieder hatte er etwas einzuwenden.
»Was auch nur ein Märchen ist«, sagte ich und kickte einen Stein zu meinen Füßen in hohem Bogen in das Meer.
»Und was würdest du dafür als Preis zahlen, um mit der verrückten Königin zu sprechen?«
Langsam ging mir das Gespräch zu nahe.
»Ich sollte jetzt wirklich wieder zurück, hat mich gefreut.« Eilig hob ich die Hand und lief wieder Richtung Tor.
»Und deine Geschichte, wie geht deine Geschichte?«, rief mir der Fremde noch nach, doch ich drehte mich kein einziges Mal mehr um. Im schlimmsten Fall würde er mir einen Pfeil in den Rücken schießen, was, um ehrlich zu sein, wirklich ein schlimmer Fall wäre.
Ich huschte durch die Nacht, begegnete wieder den Betrunkenen, schlich um die Häuser herum, nur brannte diesmal kein Licht im Inneren. Beim Tor verabschiedete ich mich von Edmund und ließ das Dorf und den Jungen hinter mir.
Erst kurz vor unserem Haus hielt ich an. Keuchend schnappte ich nach Luft. Den Hügel war ich beinahe hinaufgerannt. Nun zerrte die Müdigkeit an mir. Während des gesamten Weges war mir dieses Ding mit den Wünschen nicht aus den Gedanken gewichen. Ich hatte einen Plan gefasst. Ich würde der Königin einen Brief zukommen lassen und sie bitten, dass wir sie besuchen dürften. Ein ziemlich unkluger Vorschlag, den ich auf meine Müdigkeit schob, genau wie das, was ich nun machte.
»Ich wünsche mir«, begann ich, »dass wir eine Einladung von der Königin von Malufra bekommen würden.«
Ich wartete einen Moment. Irgendwie fühlte sich das Ganze noch nicht richtig an. Da fehlte noch etwas.
»Dafür biete ich, was immer ihr wollt.«
Noch immer war es still. Was hatte ich auch erwartet? Dass dieses Märchen wahr war und in den nächsten Sekunden der königliche Bote auftauchte, um mich und Irena mit auf das Schloss zu nehmen?
Ich schnappte mir die Kerze vom Boden und öffnete die Tür. Einen kurzen Moment blickte ich noch einmal hoch zu den Sternen. Täuschte ich mich, oder war da ein neuer Leuchtpunkt am Himmelszelt aufgetaucht?
Einer, der heller strahlte als alle anderen?
Wo Mädchen verschwanden
Malina!«
»Malina!«
»Himmel noch mal, Malina!«
Es fühlte sich an, als ob ich gerade erst meine Augen geschlossen hätte, als mich die Stimme von Irena weckte. Ich blinzelte, rieb mir zaghaft über die Augen und wagte einen Blick unter der Decke hervor. Hatte ich verschlafen?
»Malina!« Völlig außer Atem kam Irena die breiten Stufen hoch. Ihr Haar war zerzaust und es wirkte beinahe, als sei sie gerade erst aus dem Bett beziehungsweise aus dem Stuhl hochgeschreckt.
»Was ist los?«, fragte ich und rieb mir erneut über die Augen.
»Sie haben wieder einen gefunden.« Irena schüttelte den Kopf.
Nun war ich endgültig wach. Ohne ein weiteres Wort von Irena erhob ich mich, zog meine einfache graue Jacke über das Schlafgewand und rannte die Stufen hinunter. Meine nackten Füße huschten über die hölzernen Treppenabsätze und beinahe wäre ich in Edmund gerannt. Er stand im Eingang unseres Hauses. Noch immer trug er seine Wachmannsuniform und das dunkle Haar war perfekt frisiert. Auch seine Stiefel glänzten und seine Uniform war sauber zugeknöpft. Doch selbst diese Perfektion und dieser Schein konnten die Wahrheit nicht verbergen. Edmund hatte denselben nachdenklichen Blick aufgesetzt wie Irena vor wenigen Sekunden.
»Wo?«, fragte ich einfach und drängte mich an ihm vorbei.
»Unten am Meer. Sie haben ihn bereits weggeschafft«, beantwortete er meine Frage. Ich schloss die Augen und trat nun endgültig hinaus ins Freie. Die Sonne war gerade erst aufgegangen und es roch noch nach Morgentau. Ein kühler Wind blies mir durchs Haar und ließ mich trotz meiner Jacke frösteln.
»Ich denke, wir sollten uns langsam Sorgen machen.« Irena erschien hinter dem Wachmann und verschränkte die Arme vor der Brust.
Ich nickte. Es war bereits der vierte Todesfall in diesem Monat und so langsam musste etwas geschehen. Auf einmal erschien das Bild des blonden Jungen vor meinen Augen. »Wie sah er aus?«, fragte ich zaghaft und hoffte, dass nicht er der Tote war.
»Ein älterer Mann mit gräulichem Haar. Er war auch Fischer.
Wie die anderen.«
Wie die anderen … Immer wieder hatte man unten am Meer tote Männer gefunden. Sie alle hatten als Fischer gearbeitet und waren in den hohen Wellen ertrunken, zumindest deutete alles darauf hin.
»Das liegt an der Geldnot. Die Abgaben werden immer höher und irgendwann fahren die Fischer auch nachts hinaus, um irgendwie an ihr Geld zu kommen.« Irena schluckte, als sie die Worte aussprach, und schüttelte dann traurig den Kopf. »Diese ständige Suche nach Geld, sie bringt uns alle noch ins Grab.«
Wieder nickte ich. Wer der Mann wohl gewesen war? Hatte er Familie und Kinder gehabt? Ich wollte mir seine Geschichte gar nicht erst ausmalen.
»Ich werde wieder hinuntergehen und schauen, ob ich etwas helfen kann«, sprach Edmund und verneigte sich leicht.
»Ich komme mit!«, rief Irena und fuhr sich eilig durch ihre dichte Mähne. »Noch einmal sehe ich nicht tatenlos zu.« Mit energischen Schritten lief sie die Treppe hoch.
»Dann werde ich wohl warten«, seufzte er und kratzte sich verlegen am Kopf. Er wusste nur zu gut, dass es nichts brachte, Irena zu widersprechen. Sie hatte einen sturen Kopf und ließ sich nicht von ihrem Vorhaben abbringen.
Es dauerte nicht lange, da erschien Irena wieder bei der Treppe. »Ich bin gleich wieder zurück, schlaf du ruhig noch etwas.« Sie lächelte, ehe sie zusammen mit Edmund das Haus verließ.
Erst jetzt fiel mir diese Stille auf. Im ganzen Haus war es ruhig, kein einziger Laut drang von draußen herein. Ich seufzte und gähnte noch einmal herzhaft. An Schlaf konnte ich nun nicht mehr denken. Ich war zwar noch müde, aber wenn ich mich jetzt noch einmal hinlegen würde, dann würden meine Gedanken wegen des Toten ständig abschweifen. Also ging ich in die Küche und suchte nach etwas Essbarem. Viel gab es nicht. Die Suppe von gestern stand noch dort, aber inzwischen war nicht mehr viel davon übrig. Daneben lag noch ein Stück Brot, dem ich jetzt meine Aufmerksamkeit schenkte. Ich brach es in der Mitte auseinander und wollte gerade einen Bissen nehmen, als mir etwas anderes auffiel. Ein brauner Umschlag lag auf dem Boden. Womöglich hatte ihn ein Windstoß vom Tisch befördert, immerhin stand das Fenster offen. Neugierig hob ich ihn auf. Das Papier war ganz rau und vergilbt, als ob der Brief schon eine Weile dort unten läge. Dort, wo ich den Umschlag berührt hatte, kribbelten meine Finger ganz leicht. Überrascht ließ ich ihn wieder fallen. Nun lag er auf der anderen Seite und ich entdeckte auch, an wen er adressiert war. Malina
Ein Brief für mich? Ein ungutes, beinahe schon beängstigendes Gefühl kroch meinen Rücken hinauf. Ich hatte bisher noch nie einen Brief bekommen, höchstens von Irena selbst, aber das hier war nicht ihre Handschrift. Ich legte das Brot beiseite und hob den Brief erneut auf. Diesmal blieb das Kribbeln aus. Er war verschlossen durch ein blutrotes Siegel mit dem Buchstaben M. Ganz vorsichtig durchbrach ich das Siegel und öffnete den Umschlag.
Eine Einladung in das Reich Malufra. Mit dieser Einladung ist es Euch gestattet, die Königin höchstpersönlich zu besuchen und auf Kosten des Königreiches einige Tage in meiner Stadt zu verbringen.
Die Königin
Ich las den Brief immer und immer wieder, machte mir alle möglichen Gedanken dazu. Warum war diese Nachricht an mich gerichtet? Warum sollte die Königin mich einladen?
Und während ich dasaß und meinen Gedanken folgte, vergaß ich komplett die Zeit.
»Was ist das?«
Ich keuchte auf und drehte mich ruckartig um. Irena stand hinter mir. Sie strich sich eine dunkle Haarsträhne hinter das Ohr und blickte mich dann auffordernd an.
»Ein Brief mit einer Einladung nach Malufra«, sprach ich leise.
Nun weiteten sich ihre Augen. »Ein Brief mit einer Einladung nach Malufra?«, wiederholte sie ungläubig. Langsam schritt sie näher und nahm mir den Zettel aus der Hand.
So standen wir eine Weile, die mir wie eine Ewigkeit vorkam. Irena musste den Brief inzwischen schon Dutzende Male gelesen haben, schwieg aber weiterhin.
»Bestimmt ein Scherz.« Ich zuckte mit den Schultern und nahm mein Brot wieder in die Hand.
»Leider nicht, das hier ist wirklich eine Einladung zur Königin.« Sie schüttelte den Kopf und setzte sich dann auf einen der Holzstühle rund um den Tisch. Sie deutete auf das Siegel. »Solch ein Siegel besitzen nur adelige Menschen und auch den Initialen nach zu urteilen, hat die Königin von Malufra den Brief unterzeichnet. Nur, warum sollte sie dir so etwas schicken?« In ihrem Blick lag eine Art Vorwurf.
»Ich weiß es …« Ich wollte gerade meinen Satz mit dem Wort nicht beenden, als mir das Märchen mit den Wünschen in den Sinn kam. »Ich habe es mir gewünscht.« Nun setzte auch ich mich auf einen der Stühle. Mein Herz pochte und ein unangenehmes Gefühl breitete sich in meiner Brustgegend aus.
»Malina …« Irena holte tief Luft und schluckte ihren Ärger hinunter. »Zu welchem Preis?«
Nun sagte ich nichts mehr, da ich wirklich nicht wusste, was ich dazu noch sagen könnte. Ich kannte den Preis nicht und vielleicht war das der Grund für dieses unangenehme Ziehen in der Nähe meines Herzens.
»Ich weiß, es sind nur Märchen, aber in jedem Märchen steckt ein Funke Wahrheit.« Sie schüttelte den Kopf. »Ich möchte nur, dass du mir eines versprichst.«
»Was?«, fragte ich zögerlich.
»Dass du nicht dorthin gehst. Du bleibst hier und folgst der Einladung nicht!« In ihrer Stimme lag ein warnender Unterton. Ich wusste, sie war nicht wütend, sie machte sich bloß Sorgen.
»Und was, wenn das eine perfekte Möglichkeit wäre, um der Königin von unseren Masken zu erzählen? Und vielleicht …« Ich holte erst tief Luft, bevor ich den Satz zu Ende sprach, denn ich wusste, Irena würde nicht begeistert darauf reagieren. »Vielleicht würde ich irgendwo dort draußen auch einen Hinweis auf meine Herkunft finden. Ich kenne meine Geschichte immer noch nicht und hier kann mir keiner helfen.«
»Malina«, seufzte sie und starrte aus dem Fenster hinaus. »Die Königin versteckt ihr Gesicht nicht umsonst hinter Masken. Sie ist verrückt und in ihrem Reich gelten ihre Regeln. Man kann dich nicht vor ihr schützen, ich kann dich nicht vor ihr schützen.«
»Und wenn du mitkommst?«, fragte ich, obwohl ich die Antwort bereits kannte.
»Ich betrete den Wald nicht, meine Welt ist hier, und darum möchte ich, dass du mir versprichst, dass du hierbleibst.«
»Es wäre nur für eine kurze Zeit!« Ich spürte, wie dieses Ziehen, dieser Schmerz sich an die Oberfläche kämpfte und in Form von Tränen meine Wange hinunterrann.
»Malina!« Die Stimme von Irena wurde immer lauter. »Ich will nicht, dass du gehst.«
»Und warum?« Meine Stimme bebte. Es war nicht gut von mir, dass ich mich wie ein kleines Kind benahm. Irena war für mich da gewesen, sie hatte sich um mich gekümmert, und sie war es auch, die mir ein Zuhause gegeben hatte. Nur genau darum musste ich nach Malufra. Ich wollte ihr helfen und ich wollte endlich erfahren, wer die Malina von früher war.
»Weil du die Welt dort draußen nicht kennst.« Sie schüttelte traurig den Kopf. »Du verstehst nicht, zu was Menschen fähig sind«, fügte sie hinzu und ihr Blick glitt wieder hinüber zu dem Fenster. »Und genau darum möchte ich jetzt, dass du mir versprichst, dass du hierbleibst.«
Ich schwieg und wischte mir mit dem linken Handrücken die verbliebenen Tränen aus dem Gesicht.
»Malina …«
»Ich verspreche es«, sagte ich enttäuscht. Ich stand wieder auf und ließ den Brotlaib auf dem Küchentisch. Der Appetit war mir vergangen.
»Es ist zu deinem Besten«, fügte Irena besänftigend hinzu, nur war ich bereits aus der Tür hinaus verschwunden. Mir war es egal, dass ich nur eine einfache Jacke trug und darunter noch mein Schlafgewand. Ich brauchte einfach einen Moment für mich. Diese Einladung war höchst sonderbar, und gleichzeitig war sie eine gewaltige Chance. Wenn die Königin erst einmal sehen würde, was für Masken Irena herstellte, dann würde sie mit Sicherheit welche kaufen. Dann hätten wir wieder mehr Geld und womöglich würde dann dieser Ausdruck aus den Augen von Irena verschwinden. Sie brauchte das Geld. Damit könnte sie auch wieder den Armen helfen und so würden solche schrecklichen Dinge wie mit dem Fischer hoffentlich nie mehr passieren.
Als ich spätabends wiederkam, waren alle Lichter gelöscht. Irena war nirgends zu sehen, aber ich brauchte sie nicht zu suchen, ich wusste auch so, dass sie heute wieder einmal nach langer Zeit in ihrem Zimmer schlief. Wenn man Masken herstellte, dann brauchte man einen ruhigen Verstand. Denn Masken formten sich nach den Gedanken derer, die sie herstellten. Dies hatte Irena mir einmal erklärt. Darum stellte sie keine her, wenn sie traurig, wütend oder enttäuscht war.
Der Brief von heute Morgen lag immer noch auf dem Küchentisch. Ich setzte mich nieder und nahm ihn in die Hände. Wenn ich gehen würde, würde ich Irena verletzen. Wenn ich blieb, dann wäre sie glücklich. Aber was wollte ich?
Wo Entscheidungen Herzen brachen
Ich blickte noch einmal zurück zu dem Haus, das in all den Jahren mein Zuhause gewesen war. Irena schlief bestimmt noch, und wenn sie aufwachte und bemerkte, dass ich fehlte, dann würde sie zuerst wütend werden. Nach der Wut käme dann schon bald die Enttäuschung. Irgendwann würde sie dann den Zettel auf dem Küchentisch sehen, auf dem stand, dass ich gegangen war. Ich hatte es ihr versprochen und ich hatte mein Versprechen gebrochen.
Ich musste es tun. Ich drehte mich wieder in die Richtung des Waldes und lief los. Ich hatte gestern kein Auge zugetan und hatte stattdessen eine kleine Reisetasche mit den wichtigsten Dingen gepackt. Natürlich hatte ich ein schlechtes Gewissen, aber wenn ich hierbleiben würde, würde ich niemandem helfen.
Je näher ich den dunklen Bäumen kam, umso kräftiger blies der Wind. Er war wie eine Art Warnung.
Ich zog den Umhang enger um meine Schultern und die Kapuze etwas tiefer ins Gesicht. Der Eingang des Waldes wurde von zwei knorrigen Eichen gekennzeichnet. Sie hatten dicke Stämme, und unzählige Äste und Blätter bildeten ihre Baumkronen. Wie zwei Wächter standen sie da und schienen mich zu beobachten. Trotzdem lief ich zielstrebig weiter, immer weiter in die Dunkelheit des Waldes hinein. Es war zwar helllichter Tag und doch schien es, als ob das Licht nicht durch die Blätterdecke hindurchdringen würde.
Es war nicht nur die Beinahedunkelheit, die mir einen eisigen Schauer über den Rücken laufen ließ, es war die Stille, die mir Unbehagen bereitete. Ich hörte nur meine eigenen Schritte auf dem Waldboden. Selbst das Rauschen des Windes war verschwunden. Ich verdrängte die Angst und lief immer weiter geradeaus. Solange ich nirgends abbog oder vom Weg abkam, konnte ich mich auch nicht verirren.
So lief ich, bis meine Beine schmerzten und sich Blasen an meinen Füßen bildeten. Inzwischen konnte ich nicht einmal mehr sagen, wie viel Zeit vergangen war. Meine Augen hatten sich an die schwachen Lichtverhältnisse gewöhnt. Wirklich viel zu sehen gab es nicht. Wald, so weit das Auge reichte. Ich seufzte, lehnte mich an den Stamm eines Baumes. Langsam rutschte ich daran herunter und legte meinen Kopf auf die Knie. Ich war müde vom Laufen und auch hungrig. In meiner Tasche hatte ich zwar eine Notration, aber wer wusste schon, wie lange ich mich hier aufhalten würde. Wenn ich nur …
»Drei Meter groß war er!«
»Deine Nase wird nur noch länger, wenn du weiterhin so einen Unsinn redest.«
Ich erstarrte. Wer war das? Ich dachte, hierher würden sich keine Menschen verirren. Eilig kroch ich hinter den Baum und duckte mich etwas. Die Kapuze rutschte mir dabei wieder nach hinten.
»Wenn ich es dir sage! Du glaubst mir so oder so nichts.« Die Stimme gehörte einem Mann, während die andere unbekannte Person eine Frau sein musste.
»Das tue ich tatsächlich nicht, du erfindest ständig irgendwelche Märchen, um andere zu beeindrucken«, antwortete die Frau. Die beiden kamen immer näher. Sosehr ich mich auch anstrengte, ich erkannte nicht wirklich viel. Was zum einen an den schlechten Lichtverhältnissen und zum anderen an ihrer Kleidung lag. Sie trugen Kapuzen, die sie sich bis ins Gesicht gezogen hatten, und dunklen Stoff. Ihre Bewegungen waren geschmeidig, fast lautlos schlichen sie über den Waldboden, und würden sie sich nicht miteinander unterhalten, so hätte ich sie gar nicht gehört.
Mein Herz schlug mir bis zum Hals. Was, wenn sie mich entdecken würden?
»Und funktioniert es?«, fragte der Mann und lachte. Er war größer als die Frau und hatte breitere Schultern. Außerdem trug er ein Schwert um die Hüften, während es aussah, als ob seine Begleiterin unbewaffnet unterwegs war.
»Was?«, fragte die Frau. Sie wirkte etwas genervt. Ich konnte mir nur allzu gut vorstellen, wie sie unter der Kapuze ihre Augen verdrehte.
»Das mit dem Beeindrucken.« Er blieb stehen. Nun standen die beiden im Grunde direkt vor meinem Baum und ich wagte kaum noch zu atmen.
Sie murmelte irgendetwas, was ich nicht wirklich verstand. Ich wandte den Kopf ab und duckte mich noch etwas mehr Richtung Waldboden. Sobald die beiden verschwunden waren, würde ich rennen. Ich würde meine Beine in die Hand nehmen und um mein Leben rennen. Mein einziger Schutz war das stumpfe Küchenmesser in meinem Stiefel. Gegen ein Schwert würde ich damit wohl nicht ankommen, zumindest nicht in diesem Leben.
»Irgendetwas ist eigenartig.« Die Stimme des Mannes ließ mich zusammenzucken.
»Es ist nichts eigenartig«, seufzte die Frau und lehnte sich nun direkt an den Baum, hinter dem ich kauerte.
»Hörst du mir überhaupt zu?« Jetzt wirkte er genervt.
»Bis auf das Mädchen hinter dem Baum gibt es hier aber nichts Eigenartiges«, schnurrte sie.
Ich schloss die Augen für einen kurzen Moment, holte tief Luft, öffnete sie wieder und stieß mich blitzschnell vom Boden ab. Dann rannte ich los.
»Jetzt hast du sie erschreckt«, hörte ich die Stimme des Mannes aus weiter Ferne. Doch ich kümmerte mich nicht darum und sprintete immer weiter. Der Boden zu meinen Füßen war uneben und ich geriet immer wieder ins Straucheln, fing mich so schnell es ging wieder. Zweige streiften mein Gesicht und verfingen sich in meinen Haaren. Ich keuchte und meine Lunge schien nach Luft zu schreien. Für gewöhnlich rannte ich nicht durch unebene Waldgebiete. Erst als ich mir sicher war, dass die beiden mir nicht folgten, hielt ich an. Ich kauerte auf dem Boden, inmitten von moosbewachsenen Steinen, und holte gierig Luft. Mein Mund fühlte sich staubtrocken an und meine Zunge klebte an meinem Gaumen. Ich schnappte mir meine Tasche und suchte nach dem kleinen Wasserschlauch. Gierig trank ich einige Schlucke, ehe ich wieder lauschte. Nichts war zu hören.
Ich stand wieder auf und setzte meinen Weg fort. Ich konnte nur hoffen, dass die beiden kein Interesse an mir hatten und ihren Weg in die andere Richtung fortsetzten.
Nach einiger Zeit kam der Regen. Die Blätter der Bäume fingen das meiste Wasser auf, aber es reichte nicht für einen vollständigen Schutz. Das wenige Licht wurde immer schwächer, da sich nun auch noch dicke Wolken vor die letzten Sonnenstrahlen geschoben hatten. Wasser durchnässte meinen Umhang und Kälte breitete sich in meinem Körper aus. Ich lief weiter, presste die Tasche an meine Kleidung und strich mir das nasse Haar aus dem Gesicht. Der Brief der Königin lag sicher verwahrt in der Tasche. Ich hatte ihn in ein kleines metallenes Kästchen gepackt und einen alten Schal darum gewickelt. Das Wasser sollte ihn also nicht erreichen.
Der Regen wurde immer kräftiger und nun blies auch noch ein störrischer Wind umher. Dieser zerrte die letzten Kräfte aus meinem Körper. Ich geriet ins Straucheln, stützte mich an einem Baumstamm ab und wollte weitergehen. Auf einmal schlang sich etwas um meinen Knöchel. Erschrocken schrie ich auf. Mein Schrei wurde vom Regen und dem Wind erstickt. Entsetzt blickte ich hinunter an meinem Körper, wo sich dicke Wurzeln um meinen Fuß wanden. Ich warf mir die Tasche über die Schulter und zog mit beiden Händen an der Wurzel. Sie lockerte sich etwas, sodass ich meinen Fuß befreien konnte.
Ehe ich erleichtert einen Schritt zurückmachen konnte, kroch bereits die nächste über meine Beine und wickelte sich darum wie eine Schlange um ihre Beute. Ich zog und zerrte, nun kamen neue Wurzeln und schlangen sich um meine Handgelenke. Keuchend gab mein Körper nach und ich fiel auf den harten Waldboden. Die hartnäckigen Dinger wanden sich um meinen Körper, zogen an mir, während ich kaum noch Luft bekam. Schwarze Punkte tanzten vor meinen Augen und ich war mir nicht sicher, ob dies an der Anstrengung oder an dem prasselnden Regen lag, der mir die Sicht nahm.
In meinen Gedanken tauchten Bilder von Irena auf, wie sie verzweifelt nach mir rief. Ihre Hände umklammerten eine Maske, während sie in meinem leeren Zimmer stand.
Ich schüttelte den Kopf. Wut kochte in mir. Mit letzter Kraft richtete ich mich auf und zerrte die Wurzeln weg von mir. Ich schrie und zog, kämpfte dagegen an. Die engen Fesseln lösten sich. Erleichtert rappelte ich mich auf, strauchelte wieder, aber gab nicht auf. Ich lief wieder zurück zu dem Waldweg und ballte die Fäuste. Dann knickte ich vor Erschöpfung endgültig ein.
Wo Fremde einem halfen
Irenas kühle Hände strichen über meine Stirn. Ganz behutsam und sanft, als ob sie Angst hätte, ich wäre so zerbrechlich wie ihre Masken aus Glas. Ich wollte etwas sagen, fand aber keine geeigneten Worte. Ich kämpfte gegen das Schwindelgefühl und gegen das Pochen in meinem Schädel an. Langsam öffnete ich die Augen und vertrieb endlich die Dunkelheit, die schon viel zu lange Besitz von mir ergriffen hatte.
»Irena«, krächzte ich und hustete. Nur stand vor mir nicht Irena. Erschrocken wich ich zurück und stieß dabei gegen etwas Hartes.
»Du hast Fieber, du solltest dich noch etwas ausruhen«, sprach die Frau vor mir. Sie war jung, womöglich um die einundzwanzig Jahre, und hatte lange schwarze Haare, die sie zu einem Zopf geflochten hatte. Ihre Augen besaßen die Farbe von hellem Grau und sie trug einen dunkelblauen Umhang. Erst jetzt erkannte ich die Stimme wieder. Sie war die Frau von vorhin aus dem Wald.
»Wer seid Ihr?«, fragte ich und richtete mich etwas auf. Meine Kleidung war inzwischen wieder trocken.
»Rabea, zumindest nennt man mich so, und du bist Malina?«, fragte sie und ließ mich dabei nicht aus den Augen.
»Woher …?«
»… ich deinen Namen kenne? Du sprichst im Schlaf«, beendete sie meinen Satz, zuckte mit den Schultern und gähnte dann herzhaft.
»Wir dachten wirklich, du stirbst uns weg«, fuhr sie fort und gähnte erneut. »Was für eine Nacht.« Lächelnd schüttelte sie den Kopf.
»Wir? Du und der Mann aus dem Wald?« Nun war meine Neugierde stärker als meine Angst.
»Du meinst Lev? Oh nein, dieser Elefant hat so viel Feingefühl wie ein hungriger Raubvogel auf Beutejagd.« Sie lachte.
»Wo bin ich hier überhaupt?« Schmerzverzerrt rieb ich mir über die Stirn. Ich konnte mich nur noch daran erinnern, wie ich mitten im Wald zusammengebrochen war.