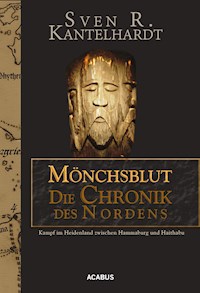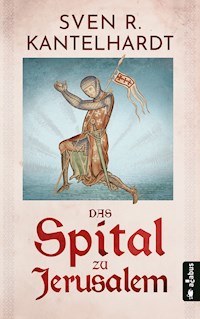
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Acabus Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein historischer Roman über Seefahrt, Krieg, Handel und den Ursprung des Johanniterordens Man schreibt November 1095: Papst Urban ruft zum Kreuzzug ins "Heilige Land". Ein Heer von Bauern und Tagelöhner sammelt sich in Frankreich, italienische Kaufleute gründen die erste "Compagnia", um die Kreuzfahrer von See zu unterstützen. Ein junger Mainzer Jude, ein verliebter Patrizier und die fromme Tochter eines amalfitanischen Kaufmanns werden vom Strudel der Ereignisse mitgerissen und treffen unverhofft aufeinander im "Spital zu Jerusalem". Sven R. Kantelhardt, der Autor von "Der Schmied der Franken" und "Mönchsblut," nimmt uns mit in die frühe Geschichte dieses außergewöhnlichen Ortes und lässt uns eintauchen in die Zeit der großen Kreuzzüge und Eroberungen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sven R. Kantelhardt
Das
Spital
zu
Jerusalem
Historischer Roman
Kantelhardt, Sven R. : Das Spital zu Jerusalem. Hamburg, acabus Verlag 2022
Originalausgabe
EPUB-ISBN 978-3-86282-767-1
Dieses Buch ist auch als Print erhältlich und kann über den Handel oder den Verlag bezogen werden.
Print-ISBN: 978-3-86282-766-4
Lektorat: Bianca Weirauch, Weida
Korrektorat: Antonia Jahnke, Hamburg
Satz: Katharina Breu, acabus Verlag
Umschlaggestaltung: © Stephanie Gauger | Guter Punkt, München unter Verwendung von Motiven von AKG Images und iStock / Getty Images Plus
Umschlagabbildungen: © Sonate/ iStock / Getty Images Plus, © CaoChunhai / iStock / Getty Images Plus © akg-images / British Library
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Der acabus Verlag ist ein Imprint der Bedey & Thoms Media GmbH,
Hermannstal 119k, 22119 Hamburg.
_______________________________
© acabus Verlag, Hamburg 2022
1. Auflage 2022, acabus Verlag Hamburg
Alle Rechte vorbehalten.
http://www.acabus-verlag.de
Gewidmet allen, die auch heute unter dem achtspitzigen Kreuz ihren Dienst an den
Damen und Herren Kranken leisten
Inhalt
„Ansaldo“
„Ein paar Gedanken und historische Anmerkungen zum Geleit“
„Personenverzeichnis“
„Glossar“
„Danksagung“
„Der Autor“
Ansaldo
Mare inferior, September 1095
Die San Matteo dümpelte in der leichten Dünung, die als Einziges noch an den Sturm vom Vortag erinnerte. Die schnittige Galera lief getrieben von zwanzig Ruderern nach Südwesten. Platz gab es für achtundvierzig Riemen, aber die wurden nur im Kampf bemannt, um die Kräfte der Besatzung zu schonen. Auch Ansaldo Doria, der Magister und Capitano stand gelassen im Heck seines schnellen Schiffes. Er hatte das Backbordruder hoch gelascht und führte die Pinne des zweiten Seitenruders mit leichter Hand.
»Schiff voraus«, erklang ein Ruf vom Bug. Ansaldo beschattete die Augen mit der flachen Hand gegen die Strahlen der bereits tief stehenden Sonne. Tatsächlich, dort im Westen trieb etwas. Kein Segel, aber seit der Wind gegen Mittag gänzlich eingeschlafen war, hatte auch Ansaldo Segel und Mast umlegen lassen. Er überlegte kurz, wen er dort vor sich haben könnte. Hier südlich von Pianosa und Montecristo mochte das gut und gerne ein Schiff der verhassten Pisaner sein, die nach der gemeinsam durchgeführten Eroberung Sardiniens mit den Genuesen erbittert um Einfluss auf der Insel rangen. Es konnten auch Mallorcinische Piraten sein, die sich immer wieder bis in das Tyrrhenische Meer und sogar an die Küste des italienischen Festlandes wagten, um christlichen Handelsschiffen aufzulauern oder Dörfer zu überfallen und die Bewohner in die Sklaverei zu verschleppen. »Alle Mann an die Ruder«, rief Ansaldo, entschlossen, sich von nichts überraschen zu lassen. »Macht euch kampfbereit!« Dröhnend schoben die Männer die langen Riemen durch die Pforten im Schanzkleid. Im Kampf wurde die San Matteo á la Zencile gerudert, immer drei Mann teilten sich eine Ruderbank, aber jeder führte seinen eigenen Riemen. Das forderte ein gehöriges Maß an Koordination, doch in Ansaldos Mannschaft, zur Hälfte Angehörige der Familie Doria und alle aus der gleichen Isola, also dem gleichen Viertel ihrer Heimatstadt Genua stammend, kannte jeder genau seinen Platz und seine Aufgabe. Wie ein Pfeil schoss das schlanke Schiff über das Wasser dem fremden Fahrzeug entgegen und Ansaldo blickte voller Stolz auf die wehende Flagge mit dem roten Georgskreuz, dem Zeichen der Seerepublik Genua, welches einst die Oströmische Garnison der Stadt verliehen hatte.
»Setzt noch die Flagge mit dem schwarzen Kopf!«, befahl er. Diese Flagge zeigte, ebenfalls auf weißem Grund, den abgeschlagenen Kopf eines Mauren, mit Ring im Ohr und einer Binde vor den Augen. Eine Erinnerung an alle Balearischen Piraten, wie es ihnen ergehen würde, wenn sie sich mit den Genuesen anlegten. Irgendwann hatte die Flagge die echten, auf Pfähle gespießten Köpfe ersetzt – sie stank weniger, war durch ihre Größe und den weißen Hintergrund auch von Ferne zu erkennen und vor allem: Man konnte sie bereits vor dem Kampf setzen, wenn sich die Köpfe der Feinde noch auf den dazugehörigen Körpern befanden. Bald erkannte Ansaldo Einzelheiten des anderen Schiffes. Der dickbauchige Rumpf mit den hohen Seiten verriet den Kauffahrer, wahrscheinlich tatsächlich ein Pisaner oder Amalfitaner? Die Mastspitze schwankte im Rhythmus der Wellen vor dem Horizont, der von der untergehenden Sonne rot gefärbt war. Ohne Wind war das Handelsschiff der schnellen Galera hilflos ausgeliefert, doch niemand zeigte sich an Deck. Da sah Ansaldo eine Leine vom Heck ins Wasser hängen. Das mochte die Großschot oder eine Brasse gewesen sein, jedenfalls würde kein vernünftiger Kapitän solch eine Schlamperei dulden. Gute Leinen waren teuer. »Halbe Kraft«, wies Ansaldo seine Schlagleute an und steuerte die San Matteo in einem weiten Bogen dichter heran. »Ruder halt«, rief er den nächsten Befehl und die Galera glitt von ihrem Schwung getragen bis dicht unter das Heck des fremden Seglers. »Ich bringe sie längsseits«, rief er über die Ruderbänke nach vorn. »Antonio, du steigst mit deinen Männern über und siehst nach, was da los ist!« Ein mulmiges Gefühl hatte ihn ergriffen, aber wenn sie sich fernhielten, würden sie niemals erfahren, was es mit dem seltsamen Geisterschiff auf sich hatte. Die Männer an Steuerbord zogen ihre Riemen ein, als das schlanke Schiff an der Bordwand des Kauffahrers entlangschrammte. Die Enterhaken flogen hinüber und verbanden die schlanke Galera fest mit dem bauchigen Segler. Schon sprang Antonio an der Spitze der Genuesen über das zu den Seiten auskragende Schanzkleid der Galera auf die hohe Seereling des Seglers.
Ansaldo griff sich Schwert und Schild und hastete über die Planken, die mittschiffs auf den Ruderbänken lagen und so einen Mittelgang über dem Schiffsraum formten. Er lief bis zu dem Punkt, wo der Rumpf des geenterten Handelsschiffs am niedrigsten war. Einen Augenblick zögerte er, bevor er über eine Ruderbank bis auf die wogende Reling balancierte. Sein rechtes Knie machte ihm seit einiger Zeit zu schaffen und hatte ihn einige Male im Stich gelassen, wenn er sich darauf aufrichten wollte. Er schluckte und sprang mit dem linken Bein voran. Ein kurzer stechender Schmerz war alles, einen Augenblick später stand auch er auf dem Deck des Seglers. Antonio trat ihm entgegen. »Keine Ahnung, was hier los ist«, berichtete er. »Niemand an Bord, auch keine Toten.« Ansaldo atmete innerlich auf. Dann waren die Fremden wenigstens nicht einer Seuche zum Opfer gefallen, sonst lägen ihre Leichen noch herum.
»Sie treibt sicherlich schon einige Tage herrenlos im Meer. Fast das ganze Schiffsgerät und selbst Segel und Rah sind verschwunden«, fuhr Antonio schulterzuckend fort. Ansaldos Blick schweifte zum Mast. »Sie wurde von Piraten geentert«, behauptete er bestimmt. Antonio sah ihn verblüfft an. »Woher weißt du das?«
»Siehst du die Kerben am Mast?«, fragte Ansaldo zurück und wies auf einige quer laufende Schrammen, die sich tief in das harte Holz gegraben hatten. »Das waren Axthiebe.«
»Ja, das sehe ich«, bestätigte Antonio. »Aber wieso sollten die Piraten versuchen den Mast umzuhauen?« Ansaldo seufzte. Sein Vetter war zwar tapfer, aber manchmal ziemlich schwer von Begriff. »Das haben sie nicht, sonst stände er ja nicht mehr«, kommentierte er trocken. »Sie haben das Fall des Segels durchgehauen. Die ersten Piraten an Deck wollten das Schiff stoppen, damit ihre Kameraden nachkommen könnten. Deshalb haben sie das Fall gekappt und das Segel fiel herab. Der Sturm letzte Nacht hat dann sein Übriges getan.« Antonio nickte zustimmend. »Ich wundere mich nur, dass die Piraten das Schiff nicht mitgenommen haben. Sieht doch noch ganz solide aus.«
»Es waren bestimmt die Mauren von den Balearen. Die haben die ganze Besatzung massakriert oder versklavt, wollten sich aber vor dem aufziehenden Sturm in Sicherheit bringen und sich nicht mit dem dicken Eimer belasten«, meinte Ansaldo schulterzuckend.
»Dann nehmen wir das Schiff in Schlepp?«, schlug Antonio vor. Ansaldo runzelte die Stirn. »Wenn die Pisaner uns begegnen, denken sie, wir hätten es gekapert. Das gibt Ärger.«
David
Magenza, Januar 1096
Die Brüder aus Rouen haben uns einen Brief geschrieben.« Onkel Ruben stand mit gerunzelter Stirn vor der Gemeinde, die sich in der Synagoge an der Stadthausstraße versammelt hatte. »Neben Rittern hat sich allerhand Volk gefunden, um dem Aufruf des Papstes zur Fahrt ins Land unserer Väter zu folgen. Ein gewisser Peter aus Amiens hat sich zu ihrem Anführer aufgeschwungen, und einige lose Gesellen mochten offenbar nicht warten, bis sie das Land der Väter erreichten, sondern haben sich in Westfranken direkt am Eigentum unserer Brüder vergriffen.« Sein Blick schweifte ernst über die versammelten Männer und Frauen. »Auf ihrem Weg nach Konstantinopel werden diese Horden auch den Rhein aufwärts ziehen.« David blickte sich betreten um. Rabbi ben Ezer hatte sich erhoben. Er, der noch selbst zu Füßen Rabbenu Gerschoms gesessen hatte, den man weit über die Grenzen von Magenza hinaus verehrte und die »Leuchte des Exils« nannte. Derselbe, der in Magenza die berühmte Talmudschule, die Jeschiwa, gegründet hatte. Nach dem Willen seines Onkels sollte auch David einmal dort die heiligen Schriften und Jüdisches Recht studieren, auch wenn ihn selbst die Heilkunst, von der glücklicherweise auch in den Heiligen Texten häufig die Rede war, weit mehr faszinierte.
»Ihr habt sicherlich nicht vergessen, wie es unseren Glaubensbrüdern in Granada vor fünf Jahren erging«, mahnte der alte Rabbi. »Sie wurden allesamt ermordet oder vertrieben!«
»Aber der Papst hat doch zum Kreuzzug gerade gegen die Mohammedaner aufgerufen, nicht gegen uns«, warf Simeon ein, einer der Studenten, die aus ganz Europa nach Magenza kamen, um an der Jeschiwa zu studieren. Ben Levi kam aus der Juderia Toldeos und musste es wissen: »Und in Granada waren es gerade diese, die unsere Brüder überfielen. Die Almoraviden, welche sogar bei ihren Glaubensbrüdern wegen ihrer unmäßigen Strenge verhasst sind!«
»Und außerdem zahlen wir dem Bischof gut für unsere Sicherheit«, warf Jehuda, ein reicher Händler, dessen Haus zwischen denen der christlichen Fernhandelskaufherren im Friesenviertel stand, ein. »Er wird sicher nicht zulassen, dass uns hier etwas passiert.«
»Der Papst hat zum Kampf gegen die Feinde Gottes aufgerufen, und für viele der Wanderprediger und Landstreicher gehören auch wir dazu«, ergriff nun wieder Onkel Ruben, der Gemeindevorsteher, das Wort. »Wir sollten für das Beste beten, uns aber auf das Schlimmste vorbereiten.«
Ansaldo
Genua, Februar 1096
Das erbeutete Schiff, die »Prise« wie es unter Seeleuten hieß, war tatsächlich eine Pisaner Caraca. Ansaldo hatte sie schließlich mit zehn Männern voraus nach Genua geschickt. »Ihr bekommt das viereckige Segel und das Ersatzruder. Haltet euch von der Küste und den Inseln frei. Die Pisaner werden keinen Spaß verstehen«, hatte er seinen Vetter Pietro, den er zum Anführer der kleinen Besatzung bestimmte, noch gewarnt. Mehr konnte er ihm nicht mitgeben. Weder Männer noch Material. Schon so blieb ihm auf der San Matteo nur das Dreiecksegel, welches bei Kursen am Wind gute Dienste leistete, aber vor dem Wind das Steuern erschwerte. Doch inzwischen lagen sowohl die Pisanische Prise als auch die San Matteo längst sicher auf dem schmalen Strand vor der selbst auf dem engen Landstreifen zwischen Meer und ligurischen Alpen eingezwängten Stadt. Doch der Winter brachte dem Stammsitz der Familie Doria an der Piazza San Matteo nicht die übliche Ruhe. Noch im Dezember war Nachricht von der großen Synode in Clermont gekommen: Papst Urban, der zweite dieses Namens, hatte die christliche Ritterschaft zu einem Kreuzzug aufgerufen. Und die Bischöfe von Grenoble und Orange hatten die Nachricht umgehend in die Stadt getragen.
»Die Heiden haben die heiligen Stätten entweiht und unsere Pilger misshandelt!« erklärte Antonio. Der Aufruf zum Kampf gegen die Ungläubigen war in Genua auf fruchtbaren Boden gefallen. Zu sehr litt die Stadt und ihre umgebenden Ortschaften unter den ständigen Überfällen maurischer Piraten, und auch die Plünderung Genuas durch nordafrikanische Sarazenen im Jahr 935 war noch nicht vergessen. Genaldo, Ansaldos älterer Burder und das Oberhaupt der Familie Doria, nickte ernst. »Adalberto Malaspina hat mich und die anderen großen Familien aufgefordert, Männer in seine Compagnia zu schicken. Eine eingeschworene Gemeinschaft, die für diese Sache alle Zwistigkeiten hinter sich lassen und sogar ihr Brot gemeinsam brechen soll. Daher der Name: Com pane …« Er schwieg einen Augenblick und Ansaldo musste an Giulietta denken. Adalbertos hübsche Schwester. Wenn ihre Familie nicht zu den Führern der Guelfenpartei in der Stadt zählte, hätte er Genaldo längst gebeten, ihrem Bruder vorzuschlagen, sie mit ihm zu verloben. Aber der alte Streit mit den Guelfen und die unschöne Geschichte vor zwei Monaten machten das natürlich unmöglich. Damals war es mitten in der Stadt zu einer Konfrontation der beiden Familien gekommen, die darin gipfelte, dass eine Gruppe von Dorias und anderen Ghibellinen den Palazzo der Malaspinas belagerte, die sie ihrerseits von den schießschartenartigen Fenstern mit Armbrustbolzen beschossen. Es hatte auf beiden Seiten mehrere Tote und etliche Verwundete gegeben. Zum Glück keine Namensträger der Kernfamilien.
»Aber wieso ruft der Papst dazu auf? Er ist doch das geistliche, nicht das weltliche Haupt?«, riss ihn Pietro aus seinen Gedanken. Genaldo hatte den Familienrat der Dorias einberufen, um das weitere Vorgehen zu besprechen.
»Kaiser Heinrich befindet sich unter Kirchenbann«, wandte Arturo, ein Vetter zweiten Grades, ein.
»Wie auch König Philipp von Westfranken! Das zeigt doch nur, dass der Papst seine Macht, das Bannschwert zu schwingen, missbraucht«, rief Pietro hitzig.
»Aber der Kreuzzug wird gar nicht von Urban, sondern von einem gewissen Adhemar de Monteil, Bischof von le Puy, geführt«, gab Antonio beschwichtigend zu bedenken. »Und auch wenn wir stolz auf die ghibellinische Tradition unserer Familie sind, können wir uns so einem frommen Werk nicht widersetzen. Deus lo vult!«
Der letzte Satz löste lautes Raunen und Zwischenrufe aus, sodass Genaldo sich schließlich genötigt sah, mit der Faust auf den Tisch zu schlagen, um die Ruhe wiederherzustellen. »Die Normannen in Sizilien rüsten schon ein Heer, heißt es.« Alle Augen richteten sich gespannt auf das Familienoberhaupt. Er hatte die letzte Entscheidung in dieser und allen anderen Fragen. Auch Ansaldo hatte keine Ahnung, worauf sein älterer Bruder hinauswollte. »Und die Pisaner haben versprochen, Bohemunds Heer zu versorgen.« Erschüttert schwiegen die Versammelten. Die Guelfen waren Eiter im Gebein Genuas, aber die Pisaner?
»Sollen wir etwa auch mit denen gemeinsame Sache machen?«, polterte Pietro, wieder als Erster, los. Das Zittern in seiner Stimme verriet, mit welcher Mühe er seinen Ärger unterdrückte.
Doch Genaldo hob beschwichtigend die Hände. »Niemals wieder werden wir Dorias wieder mit den Pisanern gemeinsame Sache machen. Nein, die Frage ist, warum bieten sich die Pisaner an zu helfen?« Er blickte auffordernd in die Runde.
»Deus lo vult?«, schlug Antonio schließlich vorsichtig vor. Doch ein verächtlicher Blick Genaldos ließ ihn verstummen. »Weil sie an den Orten, die Guiscard erobert, Privilegien erhalten. Häuser, Lagerhallen, Brunnen, vielleicht sogar eigene Kirchen und natürlich das Recht, dort Handel zu treiben! Deshalb, ihr Dummköpfe!«
In Anseldos Kopf ratterte es, während er versuchte, sich in die neue Lage hineinzudenken. Gottes Lohn war der Preis, den es zu erringen gab. Und Handelsvorteile. Offensichtlich auch Genaldos Wohlwollen, und vielleicht, vielleicht sogar ein gutes Verhältnis zu Adalberto und seiner hübschen Schwester? Da gab es nichts zu verlieren. »Ich trete freiwillig dieser Compagnia bei, das heißt natürlich nur, wenn du das möchtest, Genaldo!«, rief er.
»Deus lo vult«, bekräftigte diesmal Genaldo selbst. Ein ein dünnes Lächeln spielte um seine Lippen.
David
Magenza, Februar 1096
Reich mir noch den Hochzeitsring, Junge.« Onkel Ruben ergriff den Ring aus fein gearbeitetem Gold, als David ihn hinabreichte. Einen Augenblick betrachtete Ruben den breiten Reif, der von zwei ineinander gelegten Händen gebildet wurde. Dem Sinnbild für eheliche Treue. Zwei Drachen trugen darüber einen unglaublich zierlich gearbeiteten Tempel. Sinnbild für das Jerusalem des Messias. Mit dem Hochzeitsring, den einst Meister ben Levi der jüdischen Gemeinde von Magenza stiftete, hatte er ein Meisterwerk geschaffen, das seinesgleichen suchte. Aber David sah an den verklärten Augen des Onkels, dass er gar nicht die filigran verschlungenen Goldfäden betrachtete. Vielleicht verweilten seine Gedanken bei dem Tag, als Tante Rebecca diesen Ring trug und sie ihm über den silbernen Löffel hinweg ins Hochzeitsgemach folgte. Ruben seufzte und legte den Goldring in den Beutel mit den Silbermünzen. Dann stieg er ächzend aus dem Erdloch, welches sie gemeinsam im Keller seines Hauses gegraben hatten. Das Haus befand sich am Flachsmarkt, in der Nähe des jüdischen Backhauses, und im Boden stand bereits die Feuchtigkeit des nahen Rheins.
»Merke dir gut, wo alles versteckt ist. Sollte es zum äußersten kommen«, er schluckte hart, »und mir und Rebecca etwas zustoßen …« Wieder machte er eine Pause. »Jedenfalls, wenn es so weit ist, musst du den Schatz heben, um damit für dich und deine beiden Nichten Esther und Judith zu sorgen.« Schweigend schütteten sie das Erdloch zu und stampften den Lehm darüber fest.
»Aber Jehuda hat doch gesagt, dass Erzbischof Ruthard uns schützen wird«, brach David endlich das Schweigen.
»Gott helfe ihm dazu«, seufzte Ruben. »Aber Vorsicht ist besser als Nachsicht.«
Ansaldo
Genua, April 1096
Es ist wie ein Wunder«, staunte Ansaldo und blickte über die acht schlanken Rümpfe, die am Strand von Genua langsam die schlanke Gestalt von Galeras annahmen. Die Planken der Schiffe wurden in einer Art Sandloch zusammengefügt, dass die Form des Rumpfes vorgab. Wenn die Hülle stand, wurde sie, wo es nötig schien, durch Spanten verstärkt. So waren die Galeras wesentlich leichter als die großen Caracen, bei denen man andersherum arbeitete, nämlich zunächst das Spantengerüst über den Kiel aufbaute und es im Nachhinein mit auf Stoß gesetzten Planken bedeckte.
»Seit der Gründung unserer Compagnia gab es keine Straßenkämpfe, ja kaum ein böses Wort mehr zwischen den Familien. Unsere Unternehmung ist wirklich von Gott begünstigt!« Antonio nickte bedächtig. »Ich habe sogar mein Pesto mit einem Malaspina geteilt. Nicht nur das Brot!« Ansaldo lachte. »Ja für Fleisch reicht die Liebe noch nicht.« Dann wurde er schlagartig wieder ernst. Fleisch ließ ihn an Fleischliches denken und da stand ihm das Bild Giuliettas vor Augen. Er hatte sie wiedergesehen und über ihre Wangen war eine zarte Röte geflogen. Zumindest hatte er sich das eingebildet. »Es ist nicht immer einfach, diesen Haufen zu lenken«, wandte er ein. »Aber ich glaube, wir Consuln machen unsere Arbeit ganz gut.« Noch immer erfüllte es ihn mit Stolz, dass man ihn unter die Kosuln der Compagnia gewählt hatte. Sie alle sechs entstammten, wie sollte es in Genua anders sein, den großen Familien: Den Doria, Malaspina, Embriachi, Spinola, Negrone und Fieschi. Ihre Aufgabe war es, den Bau und die Ausrüstung der Kreuzzugsflotte zu überwachen. »Heute Abend treffen wir uns. Adalberto hat uns geladen, um den Fortschritt unserer Rüstung zu besprechen. Ich hätte nie gedacht, dass ich den Palazzo Malaspina einmal betreten würde, ohne zuvor die Tür einschlagen zu müssen.«
Als Ansaldo am Abend an der Piazza Santa Brigida eintraf, wurde der Eingang des Palazzo Malaspina von Fackeln festlich erleuchtet. Diener der Familie halfen ihm am Eingang aus dem schweren Wintermantel.
»Geradlo befindet sich bereits mit den anderen Gästen in der großen Halle. Bitte entschuldige, dass er dich nicht selbst dorthin geleiten kann. Wenn du erlaubst, übernehme ich das.« Ehrerbietig verbeugte sich der junge Mann, dessen bunte Kleidung keine Zweifel an seiner hohen Stellung aufkommen ließ. In der Tat hatte Ansaldo den jungen Patrizier bereits gesehen, konnte sich aber nicht an den Namen erinnern, denn damals hatte Giulietta seine ganze Aufmerksamkeit gefesselt. Er spähte unauffällig zur Treppe hinüber, ob sie nicht irgendwo zu sehen sei, wurde aber enttäuscht. Dadurch leicht verstimmt, folgte er dem jungen Mann ins Innere des Gebäudes. Wie bei allen Kaufmannsfamilien Genuas befand sich die Halle der Familie weiter hinten im Gebäude. Vorne waren die Geschäfts- und Lagerräume. Wachsam glitten Ansaldos Blicke über die Ballen flämischen Tuchs, die Säcke mit sardischem Getreide, immer eine Mangelware in Genua, das, eingepresst zwischen Meer und Alpen, kein eigenes Hinterland besaß. Auf dem Gebiet der Stadt wuchsen lediglich Basilikum und Pinien, woraus man die Würze herstellte, mit der alle Genuesen ihr Brot bekömmlicher und schmackhafter zu machen suchten: das Pesto.
Sein Führer schlug einen Vorhang zurück und Ansaldo blickte in den großen Saal. Adalberto hatte sich erhoben und stand vor einem prächtigen Wandteppich mit einem klassischen Motiv: Aneas und Dido in Karthago. Sicherlich eine versteckte Anspielung auf die bis nach Afrika reichenden Macht- und Handelsambitionen der Malaspinas.
»Es wird spät, meine Herren«, eröffnete Adalberto gerade seinen Zuhörern. Ansaldo fragte sich, ob er damit gemeint sei oder die Rüstungsvorbereitungen im Allgemeinen. Doch die nächsten Worte des Familienoberhauptes der Malaspina wischten seine Zweifel davon. »Wir verfügen lediglich über vier fertige Galeras, die uns einige Familien dankenswerterweise zur Verfügung gestellt haben.« Nickte er dabei freundlich in Ansaldos Richtung? Sein Bruder Genaldo hatte tatsächlich verfügt, dass die San Matteo am Kreuzzug teilnehmen sollte. Doch Adalberto ließ ihm keine Zeit, sich weiter in dem Lob zu sonnen. »Der Bau der Schiffe ist im Winter nur langsam vorangekommen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir es schaffen werden, vor Mare clausumin See zu gehen.« Mare clausum, das geschlossene Meer, bezog sich im Gegensatz zu Mare apertum, dem offenen Meer, auf die Zeit von Oktober bis Mai, in der die Schifffahrt wegen der schweren Stürme normalerweise ruhte. Insbesondere bei den schlanken Kriegsgaleras ging die Leichtigkeit auf Kosten der Stabilität und es war ratsam, bei schwerem Wetter im sicheren Hafen zu bleiben.
»Zwölf Galeras werden wir bemannen. Das heißt, wir können zwölfhundert Männer Besatzung und Bewaffnete einschiffen«, fuhr Adalberto fort. »Ich brauche euch nicht zu erklären, dass das fast die Hälfte der waffenfähigen Einwohner Genuas ist. Eine solche Flotte dürfen wir nicht leichtfertig auf See in Gefahr bringen. Ein einziger Sturm könnte den Untergang unserer Stadt bedeuten.«
»Ich habe über einen Amalfitaner Geschäftspartner sichere Nachricht erhalten, dass das Ritterheer bereits vollständig in Konstantinopel eingetroffen ist«, warf Guglielmo ein, der ältere der Embriachi-Brüder und Consul seiner Familie. »Die werden nicht ewig warten, und wenn wir nicht schnell sind, kommen uns die Pisaner oder Amalfitaner zuvor!«
»Alle Ritter sind versammelt?«, fragte ein Ansaldo unbekannter Spinola zurück. »Wie viele sind es denn und wer soll sie führen?«
»Ich habe von Normannen und fränkischen Rittern aus dem Norden des Reiches gehört. Sie werden von Robert von der Normandie und Hugo de Vermandois geführt. Dann sind da Flamen unter Robert von Flandern und einem Herzog Gottfried von Bouillon. Aus der Languedoc kommt Graf Raimund von Toulouse mit seinen Männern. Bohemund von Tarent führt die sizilianischen Normannen und Balduin von Boulogne seine Franken. Alles in allem sollen sich an die siebentausend Ritter und über zwanzigtausend Fußsoldaten versammelt haben.« Betretenes Schweigen breitete sich aus. »Und was sollen wir mit unseren zwölfhundert Mann da ausrichten?«, fragte der Spinola schließlich.
»So eine Armee benötigt Nachschub«, erklärte Adalberto. »Proviant, Holz für Belagerungsmaschinen, Pferde, Heu, Waffen und Wein. Und wir beherrschen die See.« Daraufhin erhob sich lautes Gemurmel und Adalberto musste seine ganze Autorität einsetzen, um die Männer wieder zum Schweigen zu bringen. Doch der Rest der Versammlung verlief sich in zahlreichen technischen Details. Am Ende wurde lediglich festgelegt, dass man so schnell wie möglich weiterarbeiten müsse. Die Entscheidung, wann die Flotte in See stechen könnte, wurde vertagt. Bald verließen die ersten Männer die Versammlung, und auch Ansaldo, der nicht gerne als Letzter im Hause der Malaspinas zurückbleiben wollte, erhob sich. Er grüßte kurz in Richtung Adalbertos, murmelte eine Entschuldigung und drückte sich durch den Teppich in den Lagerraum. Zu seiner Überraschung fand er sich hier alleine. Der junge Patrizier, der ihn hineingeführt hatte, nahm inzwischen an der Versammlung teil. Zögernd lenkte er seine Schritte in Richtung der Eingangstür. Doch plötzlich hörte er schräg hinter sich ein Rascheln. Eine Maus im Lager?, dachte er und fuhr instinktiv herum. Doch es war nicht sein Lagerraum, nein, sogar der einer verfeindeten Familie, fiel ihm ein und er wollte sich gerade wieder umwenden, als ihm hinter einem der Ballen eine Bewegung auffiel. Zielte da etwa ein Malaspina mit der Armbrust auf ihn? War er in eine Falle getappt? Reflexartig fuhr seine Hand zum Schwert, doch sie griff ins Leere. Er hatte seine Waffe vor dem Besuch abgelegt, um die Malaspinas nicht zu provozieren. Während er hinter einem Kornsack in Deckung sprang, bereute er seine Gutgläubigkeit. Vorsichtig lugte er um den Stapel Säcke herum. Da war sie wieder. Ganz sicher eine hochgewachsene schlanke Gestalt. Ansaldo nahm allen Mut zusammen und sprang hinter seinen Säcken hervor, direkt vor den Fremden, um ihn zu stellen. Doch im nächsten Augenblick stand er wie angewurzelt. Die Gestalt vor ihm hatte langes dunkles Haar, und es war überhaupt kein Mann. »Giulietta«, stieß er heraus, obwohl seine Kehle mit einem Mal knochentrocken schien. Sie lächelte.
»Ansaldo.« Sie kannte also seinen Namen! Sein Herz tat einen Sprung. »Was tust du hier in unserem Warenlager?«, fragte sie stirnrunzelnd.
»Ich habe eine Bewegung gesehen und …« Er brach ab. Sollte er gestehen, dass er einen Anschlag ihrer Verwandten gefürchtet hatte? Wohl kaum. Doch da kam ihm die rettende Idee. »Ich dachte, es wären Mäuse eingedrungen, die eure Vorräte verderben. Die wollte ich fangen.«
Sie blickte erstaunt. »Obwohl unsere Familien doch verfeindet sind?«
Wieder tat sein Herz einen Sprung. Sie hatte nicht »Obwohl wir verfeindet sind«, sondern »unsere Familien verfeindet sind« gesagt. Das gab ihm Hoffnung, obwohl es eigentlich auf das Gleiche hinauslief. »Aber nein«, widersprach er rasch. »Wir haben zusammen die Compagnia gegründet. Dein Bruder Adalberto ist auch einer ihrer Consuln. Wie ich!« Das war ihm so rausgerutscht. Er spürte, wie ihm die Hitze ins Gesicht schoss.
Doch sie nahm ihm die offensichtliche Angeberei nicht krumm. Im Gegenteil. Rasch vergewisserte sie sich, dass sie weiterhin allein im Lagerraum standen. Dann beugte sie sich vor und hauchte ihm einen Kuss auf die Wange. »Nimm das als Zeichen meiner Hochachtung vor der neuen Compagnia und meiner Hoffnung auf Frieden mit deinem ehrwürdigen Geschlecht!«
Ansaldo stand mit offenem Mund da, doch schon drehte sie sich um. »Das muss dir erst einmal reichen. Man darf uns hier auf keinen Fall zusammen sehen!«
Ansaldo hob die Hand, um sie aufzuhalten, doch schon war sie entschwunden. »Habe ich das gerade geträumt?«, murmelte er und fasste sich an die Wange. Benommen suchte er sich zwischen den Ballen den Weg zur Tür. Einen Augenblick später stand er vor dem Palazzo Malaspina und atmete die kühle Nachtluft. »Habe ich geträumt?«, fragte er noch einmal lauter, während trotz der Kühle der nahen Alpen eine Welle heißer Gefühle über ihm zusammenschlug. Erst viel später fiel ihm wieder ein, dass er Giulietta gar nicht gefragt hatte, was sie im Lagerraum gewollt hatte.
David
Magenza, April 1096
Ein kleiner Mann, der die Kutte eines Einsiedlers trug und auf einem einfachen Maultier ritt, führte den Zug an. »Das muss Peter sein«, raunte Marcus David zu.
»Peter?«, fragte er zurück.
»Peter von Amiens, der Prediger. Viele nennen ihn wegen der Kutte auch Peter den Einsiedler«, erklärte Marcus, der wie sein Freund an der Schwelle zum Mannesalter stand. Als habe der kleinwüchsige Mönch sie gehört, verweilte sein stechender Blick kurz auf den beiden Jungen. David fröstelte. Dem Mönch folgten einige Ritter, aber bald schon ersetzten Bauernkittel und manches geflickte oder zerrissene Gewand die rostigen Kettenhemden des niederen Adels. Alles in allem kein glänzender Eindruck.
»Das ist das Heer der Christenheit?«, fragte David seinen Freund ungläubig. »Das Heer König Heinrichs, das auf dem Weg nach Italien hier durchkam, sah aber viel prächtiger aus.«
»Das sind auch nur die armen Schlucker«, flüsterte Marcus bedeutungsvoll. »Die hohen Herren und Ritter sollen erst im Mai überhaupt aufbrechen.« Doch auch die »armen Schlucker« füllten die Stadt. David hatte den Einzug der Gotteskrieger am St.-Quintin-Tor, hinter dem nicht nur die gleichnamige Kirche, sondern auch die Synagoge lag, beobachtet. Doch nun hatte er Schwierigkeiten, durch die vollen Straßen bis zum Flachsmarkt und dem Haus des Onkels zu gelangen. Die Stimmung unter Fremden und Einheimischen war gereizt und die Mannen des Bischofs patrouillierten wie zum Krieg gerüstet in kleinen Haufen durch die Gassen. David erreichte das Haus des Onkels gleichzeitig mit Jehuda, dem Kaufmann aus dem Friesenviertel und Rubens Stellvertreter in der Gemeindeleitung. Doch Jehuda war so aufgeregt, dass er David keinerlei Beachtung schenkte. »Peter der Einsiedler hat einen Brief unserer Brüder aus Tours vorgelegt«, rief er Ruben entgegen, kaum dass Johanna, die christliche Magd der Familie, die Tür des stattlichen Hauses geöffnet hatte.
»Gott zum Gruß, Bruder Jehuda«, antworte Ruben ernst. »Du hast den Anführer der Kreuzfahrer getroffen?«
»Ich war im Bischofspalast, als Peter dorthinkam. Und es traf sich gut, denn nach kurzer Zeit ließ Ruthard mich in seine Gemächer rufen und dort wurde mir von Peter eben dieser Brief vorgelegt.«
»Und was schreiben die Brüder?«, drängte Ruben, nun ebenfalls mit vor Aufregung gerötetem Gesicht. Ein Zustand, den David an seinem sonst immer ruhigen und überlegten Onkel noch nie gesehen hatte.
»Es ist eine Art Empfehlungsschreiben. Die Brüder aus Tours versichern Peter darin, dass wir Juden am Rhein sein Heer auf der Durchreise mit Lebensmitteln versorgen werden.« Ruben atmete tief aus. »Gepriesen sei ER!«, rief er und erhob den Blick zum Himmel. »Wenn sie uns dafür in Ruhe lassen, wollen wir sie so gut versorgen, dass sie rasch weiterziehen können!«
Trotz der hohen Summe, die die jüdische Gemeinde zusammenlegen musste, um die ausgehungerten Kreuzfahrer zu versorgen, war die Stimmung in der heiligen Gemeinde am nächsten Tag gelöst. Jeder hatte einen Beitrag geleistet, sogar der alte Rabbi ben Ezer hatte eine goldene Kette gegeben, die einst Rabbenu Gerschom gehörte.
»Wer hätte gedacht, dass wir doch noch so billig davonkommen«, lachte Jehuda Ruben entgegen, als sie sich am folgenden Tag, es war ein Sabbat, vor der kleinen steinernen Synagoge trafen.
Doch Ruben wiegte das Haupt. »Ich hoffe nur, dass es dabei bleibt«, dämpfte er den Enthusiasmus seines Stellvertreters. Und tatsächlich wartete auf dem Heimweg ein ärmlich gekleideter Mann vor dem Hause am Flachsmarkt.
»Gerold«, stellte Ruben fest, als sie bei ihm angekommen waren. »Was möchtest du? Etwa deine Schulden bezahlen?« Ruben verlieh Geld gegen Zinsen, ein Geschäft, welches den Christen nicht gestattet, aber doch sehr gerne von ihnen angenommen wurde.
»Nein, ich brauche noch mehr Geld«, rief der Angesprochene. »Ich werde mich den Kreuzfahrern anschließen und benötige ein Pferd und eine Rüstung!«
»Wie willst du so ein großes Darlehen denn zurückzahlen?«, fragte Ruben mit hochgezogenen Brauen. »Du hast schon zweimal um Aufschub des viel kleineren Betrages gebeten, den ich dir geliehen habe. Und ich habe es dir beide Male gewährt.«
»Ich bin ein Kreuzfahrer«, erwiderte der Angesprochene stolz. »Und ihr müsst die Kreuzfahrer versorgen! Nur weil ich aus Moguntia komme, heißt das nicht, dass ich weniger Rechte habe als die Westfranken!«
Doch Ruben schüttelte den Kopf. »Du bist ein Habenichts und ich hätte dir niemals mein Geld anvertrauen sollen. Weil du so gebettelt hast und es mir leidtat, dass du die Mitgift nicht bezahlen konntest, nachdem dein Mädchen schwanger wurde. Deshalb war ich großherzig. Und ist das nun dein Dank?«
»Das ist das Mindeste, was ihr uns schuldet, ihr Heilandsmörder!«, rief der junge Mann auffahrend.
»Scher dich fort und komm erst wieder, wenn du deine Zinsen bezahlen kannst!«, fuhr Ruben, der nun ebenfalls in Zorn geriet, ihn an. Gerold lief rot an und David erschien es fast, als würde er jeden Augenblick anfangen vor Zorn zu weinen. Anscheinend war auch er sich seiner selbst nicht sicher, denn unvermittelt drehte er sich um. »Du wirst noch an mich denken und dir wünschen, du hättest mir mein Recht gewährt!«, rief er noch über die Schulter, bevor er davonlief und hinter der Ecke Richtung Schusterstraße verschwand.
Auria
Reede vor Amalfi, Mai 1096
Gemeinsam mit ihrer Zofe Laura hatte sich Auria am Vorabend auf der Sant’Andrea eingeschifft, einem schweren Lastsegler, dessen Eigner Pantaleone zu den mächtigsten Männern in Amalfi gehörte. Er war einer der sechs Söhne des Mauro und in diesem Jahr zudem zum zweiten Mal zum Hypatos oder Consul des Amalfitanischen Kontors in Konstantinopel gewählt worden. Dort, wohin jetzt auch ihre Reise ging. Es war üblich, sich am Vorabend einer Seereise auf dem Schiff einzufinden und für eine gute Überfahrt zu beten. So waren alle Kaufleute, die sich an der Ladung der Sant’Andrea beteiligten, bereits versammelt. Lediglich der Eigner, Pantaleone selbst, fehlte noch.
»Vor Mittag kommt sowieso kein Wind auf«, behauptete die fünfzehnjährige Auria naseweis. Das stimmte, und es war eine Quelle ewigen Verdrusses für die Kaufleute von Amalfi.
Die ältere Zofe betrachtete ihren Schützling missbilligend. »Und trotzdem quillt dein Haar schon unter der Haube hervor. Setz die Haube ordentlich auf, es ist schlimm genug, dass wir hier alleine mit diesen groben Seeleuten sind. Da musst du sie nicht noch aufreizen«, wies sie Auria sauertöpfisch zurecht.
Die seufzte, stopfte die Unbill erregenden blonden Strähnen aber artig unter die Haube. Ihr Blick glitt zum Ufer hinüber, wo sich ihre Heimatstadt auf einen schmalen Streifen unter der steil aufragenden Gebirgsmasse des Sorrents zusammendrückte. Dann folgte er der einzigen Hauptstraße und blieb an den in der Morgensonne blitzenden Bronzetüren der Kathedrale hängen. Die hatte der Großvater des Schiffseigners, ebenfalls ein Pantaleone, seiner Heimatstadt vor bald einem halben Jahrhundert aus Konstantinopel mitgebracht. Für das junge Mädchen ein greifbarer Beweis für die Herrlichkeit der fernen Kaiserstadt. »Pantaleone hat nun auch solche Türen nach Rom zum Papst gebracht«, behauptete sie unvermittelt. Ihre Zofe benötigte einen Augenblick, um dem Gedankensprung des jungen Mädchens zu folgen.
»Du meinst unseren Schiffsherrn?«, fragte sie, denn die Familie Pantaleone war bei der Namensgebung wirklich nicht sonderlich erfinderisch. Pantaleones Vater hieß wie einer seiner Brüder – Mauro. Und sie alle hatten prächtige Bronzetüren aus Konstantinopel gebracht. Vater Mauro hatte seinerzeit Abt Desiderius beschwichtigt, der angeblich bei dem Anblick der Kathedrale von Amalfi grün vor Neid geworden war, indem er ihm ein eigenes Paar Türen für die Hauptkirche von Montecassino stiftete.
»Ja, unseren Schiffsherrn«, bestätigte Auria.
»Die neuen Türen schmücken nun die Kirche San Paulo fuori le Mura in Rom«, ergänzte Laura.
»Das wusste ich auch«, behauptete Auria und zog eine Schnute. Sie schüttelte ihren Kopf und wieder stahl sich eine ihrer Langobardischen Locken aus dem Kopfputz. Doch in demselben Augenblick bewegte sich etwas am Strand und verhinderte so eine weitere Maßregelung. »Sie machen ein Boot fertig, sicherlich kommt Pantaleone nun endlich an Bord!«, rief sie aufgeregt. Es war ihre erste größere Reise und von dem Hof in Konstantinopel erzählte man sich wahre Wundergeschichten.
David
Magenza, Mai 1096
Dieser Graf Emicho ist der Teufel in Person. In Schpira haben sie zwölf Brüder aufgehängt, die sich weigerten, die Taufe zu nehmen«, rief Jehuda aufgeregt. Die Schreckensnachricht von dem neuerlichen Heerhaufen, der sich nach dem Durchzug Peters des Einsiedlers gefunden hatte, war erst vor einer Woche nach Magenza gedrungen. Offenbar hatte der Graf, eigentlich ein erfahrener Kriegsmann, wie es hieß, beschlossen, dass es leichter sei, die Juden in der Heimat auszuplündern als die beschwerliche Reise in den Orient auf sich zu nehmen, um dort mit unsicherem Ausgang gegen die Ungläubigen zu kämpfen.
»Und das konnte einfach so passieren, am helllichten Tag? Hat denn niemand eingegriffen?«, fragte Mose, der die Mikwe betrieb, das rituelle Bad der Gemeinde an der Schusterstraße.
»Bischof Johann hat ihnen auf Befehl des Kaisers Einhalt geboten. Er ließ sogar zehn Männern zur Strafe die Hände abhacken und hat die Mörder aus der Stadt geworfen. Aber es kommt noch schlimmer«, fuhr Jehuda fort. »Der Haufen des Grafen Emicho ist von Schpira nach Warmaisa gezogen und obwohl Adalbert von Sachsen als auch der dortige Bischof, der unsere Brüder schützen wollte, haben vor zwei Tagen das Judenviertel gestürmt und alle, die sich nicht taufen ließen, in ihren Häusern erschlagen. Eine fromme Frau wurde sogar lebendig begraben. Die heilige Gemeinde von Uarmaisa ausgelöscht.« Erschüttertes Schweigen breitete sich aus.
Schließlich räusperte sich ben Levi, der Goldschmied. »Und nun kommen sie zu uns nach Magenza? Will dieser Teufel auch die letzte der Schum-Städte heimsuchen? Wir haben nicht einmal ein eigenes Viertel, welches wir verteidigen könnten! Wir alle wohnen über die Stadt verteilt zwischen den Christen. Wir müssen sofort eine Abordnung zu Bischof Ruthard schicken, er darf die Mörder auf gar keinen Fall in die Stadt lassen. Nur die Mauern von Magenza können uns jetzt noch retten!«
»Und der Wille des Allmächtigen«, erklang Rubens tiefe Stimme. »Aber ich stimme dir zu. Jehuda und ich werden uns unverzüglich auf den Weg zum Bischofspalast machen.«
David
Magenza, 24. Mai 1096
Graf Emicho soll ein Engel erschienen sein und ihm als Zeichen seiner Berufung ein Kreuz auf die Brust gemalt haben. Er hat ihm versprochen, Kaiser zu werden, wenn er alle Juden im gesamten Abendland zur Taufe zwingt«, wusste Marcus zu berichten. »Bleib lieber bei mir, ihr bekommt bestimmt Ärger.«
»Ein Engel?«, wollte David wissen. »Wie kann ein heiliger Engel so einem gemeinen Kerl erscheinen, der nicht einmal den Erzbischof respektiert?«
»Das ist noch gar nichts«, fuhr Marcus halb staunend, halb belustigt fort. »Andere sind einer heiligen Gans gefolgt!«
»Einer Gans?«, fragte David nun ungläubig.
»Ja, einer Gans, die sie in Richtung des Kreuzzugheeres geführt haben soll.«
»Die ist sicher einfach nur vor den Strauchdieben davongelaufen!« Die beiden Jungen lachten.
»Vielleicht braten sie den Vogel ja gerade«, meinte David übermütig und zeigte auf die Kochfeuer, die zu Füßen der Mauer brannten. Trotz der gefährlichen Lage fühlten sie sich innerhalb oder derzeit auf der dicken Stadtmauer von Magenza, auf die sie einmal mehr unerlaubt hinaufgeklettert waren, sicher. Draußen vor der Porta Hrahhada brannten die Kochfeuer von Emichos Heer. Bischof Ruthard hatte Wort gehalten, die Tore verschlossen und die Stadtmauern mit seinen Mannen besetzt. »Ich gehe jetzt lieber nach Hause«, erklärte David schließlich. »In diesen unruhigen Zeiten macht sich Onkel Ruben sonst noch Sorgen um mich.«
»Ja«, bestätigte sein christlicher Freund. »So eine Belagerung ist schon unheimlich. Und das mitten im Frankenreich!«
Doch der Morgen brachte eine böse Überraschung. »Die Kreuzfahrer sind in der Stadt«, rief Johanna. David hörte ihre atemlose Stimme vom Hof heraufschallen.
»Wie kann das sein?«, hörte er seine Tante Rebecca fragen. Sie stand sonntags ebenfalls früh auf, um der Familie die Morgensuppe zu bereiten. Am Feiertag der Christen hatte ihre Magd Johanna frei, um die Messe in St. Quintin zu besuchen. Von dort musste sie gerade gekommen sein. Im Nu war auch David auf den Beinen und lief hinab, während er den Kittel noch im Rennen zuknöpfte.
»Wie kann das sein?«, wiederholte Rebecca ängstlich ihre Frage. Die kleine Judith, die die Angst ihrer Mutter spürte, versteckte sich hinter ihrem Rockzipfel.
Johanna holte nochmals tief Luft. »Verräter aus der Stadt haben ihnen das Tor geöffnet«, schnaufte sie.
Inzwischen war auch Ruben auf den Hof getreten. Er war leichenblass, zögerte aber keinen Augenblick: »Wir müssen zum Bischofspalast. Sofort«, entschied er. Dann blickte er sich um und entdeckte David. »Lauf los und warne ben Levi, den Goldschmied, Jehuda und die anderen. Die wohnen so weit weg, dass sie vielleicht noch gar nichts mitbekommen haben. Wir treffen uns alle im Bischofspalast am Dom!« David nickte. Onkel Ruben wusste immer, was zu tun war. In jeder Lebenslage. Mit diesen Gedanken drückte sich David hinaus auf die Straße. Es war ungewöhnlich ruhig, fast gespenstisch. Der Goldschmied wohnte jenseits des Domplatzes und er rannte so schnell ihn die Füße trugen. Doch als er den Domplatz erreichte, sah er haufenweise Volk. Das mussten die Eindringlinge sein! Er umging den offenen Platz durch die schmalen Gassen, welche sich jenseits des Arkadenhofs und der Liebfrauenkirche zum Rhein hin erstreckten. Schließlich erreichte er das Haus ben Levis. Doch Fenster und Türen waren bereits verrammelt. »Wer ist da?«, antwortete schließlich nach langem Klopfen eine tiefe Stimme.
»Ich bin es, David!« rief er. »Onkel Ruben schickt mich.« Die Tür öffnete sich einen Spalt und David schaute erschrocken über einen Armbrustbolzen hinweg in das Gesicht des Goldschmieds. »Du bist es wirklich«, stellte er fest und senkte die schussbereite Armbrust. »Komm herein, schnell.«
Schon war David im Inneren des Hofes. Er zählte fünf Männer, alle mit Messern, Armbrüsten oder Jagdspießen bewaffnet. »Onkel Ruben sagt, wir sollten zum Bischofspalast. Dort sollen wir uns alle treffen«, berichtete er atemlos.
Doch ben Levi lachte nur trocken. »Da sind wir auch nicht sicherer als hier. Und ich will meinen Laden nicht dem plündernden Pöbel überlassen! Ich wette, auch die lieben Nachbarn lecken sich bereits die Finger nach meinem Gold. Wenn du willst, kannst du bei uns bleiben.« Er blickte in die Runde der fünf Männer. »Wir können jede Hand gebrauchen.«
Doch David schüttelte den Kopf. »Ich muss weiter zu Jehuda«, erklärte er.
»Sein Segen gehe mit dir«, beschied ben Levi und machte mit der rechten Hand ein Segenszeichen über David. Dann zog er die Tür einen Spalt auf und spähte hinaus. »Die Luft ist rein, wir sehen uns nächstes Jahr in Jerusalem!«
Schon stand David wieder auf der Straße. »Nächstes Jahr in Jerusalem«, antwortete er noch halblaut. Die Abschiedsfloskel wirkte in ihm nach. Fürchtete der Goldschmied tatsächlich, dass sie sich längere Zeit nicht mehr sehen würden? Und Jerusalem? Er glaubte nicht, dass er die Heilige Stadt jemals betreten würde. Dann straffte er die Schultern. Peters Kreuzfahrer waren doch auch nach wenigen Tagen weitergezogen, so schlimm würde es schon nicht werden. Gedankenvoll lief er weiter zum Friesenviertel. Jehuda hatte tatsächlich noch nichts von dem drohenden Unheil erfahren. Geschockt versprach er, sich mit seiner Familie auf den Weg zu machen, und schon lief David weiter. Er überbrachte seine Nachricht noch an fünf Familien, dann entschied er, dass seine Pflicht nun erfüllt sei. Zügig machte er sich selbst auf den Weg zum Bischofspalast. Der lag im Süden des Willigis-Doms, der zusammen mit dem alten Dom im Westen und der Liebfrauenkirche im Osten das Herz des Erzbistums bildete. Beim Anblick des prächtigen Bauwerks durchströmte ihn Zuversicht. Mainz war neben Rom der einzige Ort, der sich »Heiliger Stuhl« nennen durfte, und Erzbischof Ruthard war einer der wichtigsten Männer des Reiches, der Vertreter des Papstes nördlich der Alpen. Wie könnte sich ein einfacher Graf dem Willen eines solchen Kirchenfürsten widersetzen? Doch noch bevor er den Kreuzgang des Doms, der ihn mit dem Bischofpalast verband, erreichte, schwand seine Hoffnung. Die Straßen waren voller Kreuzfahrer in ihren abgerissenen, vor Schmutz starrenden Kleidern. Er schauderte, als er erkannte, dass es sich bei manchem Dreck um Blut handelte. Klebte dort das Blut der Brüder und Schwestern aus Uarmaisa? Der Weg zum Bischofssitz war ihm abgeschnitten. Wohin sollte er sich wenden? Da fiel ihm Marcus ein. Er würde bei dem Freund unterkommen, bis sich alles beruhigte! Tatsächlich fand David Marcus bei seinen Eltern in der Fleischergasse. Es dauerte auch hier, bis sich die fest verrammelte Tür des Hauses öffnete.
»Bist du verrückt, draußen rumzulaufen? Emichos Männer gieren nach dem Leben von euch Juden!«, empfing ihn der Freund erschrocken. Seine Eltern standen schweigend hinter ihm. Ihre Blicke sagten, dass sie sich nicht wohl in ihrer Haut fühlten und wohl lieber keinen Juden aufgenommen hätten, aber der Anstand und das Wissen um die langjährige Freundschaft der beiden Jungen ließ sie schweigen.
»Man sieht mir doch nicht an, dass ich zur Gemeinde gehöre«, wehrte sich David lahm.
»Und wenn dich einer erkennt?«, brauste Marcus auf. »Hast du überhaupt schon gehört, wer den Kerlen das Tor geöffnet hat? Das war Gerold, der, soweit ich weiß, bei deinem Onkel in der Kreide steht! Was meinst du, wie der sich ins Fäustchen lacht, wenn er gerade dich erwischt.«
Davids Mund wurde trocken. »Gerold war das?«, fragte er erschüttert. »Dieser, dieser …« Er brach ab. »Noch ist nicht alles zu spät. Mein Onkel hat seine Familie zum Bischofspalast gebracht, und ich hoffe, auch etliche andere sind sicher dort angekommen. Nur als ich nachkommen wollte, war der ganze Domplatz und auch die Gassen vor dem Palast mit Kreuzfahrern verstopft«, erklärte David resigniert.
Da legte Marcus’ Mutter ihm die Hand auf die Schulter. »Nun setz dich erst einmal hin, ich mache dir etwas zu essen.« Offensichtlich hatte ihr Gewissen gesiegt. Auch ihr Mann setzte sich in Bewegung. »Du bleibst einfach hier bei uns, bis die ganze Sache vorbei ist. Hat dich denn jemand hereinkommen sehen?«
David wurde es flau im Magen, doch er schüttelte den Kopf. »Ich habe niemanden bemerkt. In diesem Teil der Stadt ist es sehr ruhig.«
David
Magenza, 27. Mai 1096
Am Abend des Vortages konnte Marcus, der sich für ein paar Besorgungen in die Stadt getraut hatte, berichten, dass die Juden über Vermittlung des Bischofs den Kreuzfahrern Geld für ihre Sicherheit angeboten hatten. »Ich habe aber keine Ahnung, ob Ermicho das angenommen hat«, erzählte er mit bedauerndem Schulterzucken. Doch dann brandete Lärm auf, nicht vom Dom her, aber aus Richtung St. Quintin.
»Das ist bei der Synagoge«, rief David aufgeregt. Auch Marcus horchte. »Mein Gott, es klingt, als würde dort gekämpft!« Doch der Lärm hielt nicht lange an und es breitete sich wieder Stille aus. David horchte angestrengt, doch es war nichts mehr zu vernehmen. »Ich muss nachsehen, was geschehen ist«, presste er zwischen den Zähnen heraus.
»Nein, lass das bloß sein, du kannst ohnehin nichts daran ändern!«, drängte Marcus und griff nach der Hand des Freundes. Doch David zog sie verärgert weg. »Da wird vielleicht das Haus meiner Familie geplündert und ich soll hier sitzen und abwarten?«
»Wenn sie nur plündern«, flüsterte Marcus. »Du hast doch den Haufen gesehen. Sie tragen ihre Waffen bestimmt nicht nur zum Angeben!«
»Das ist mir egal. Ich will wenigstens sehen, wer sich an unserem Besitz zu schaffen macht!« Er lief zur Tür, schob den Riegel auf und sprang auf die Straße, ehe der erschrockene Marcus ihn zurückhalten konnte.
Auf der Straße wandte sich David gleich nach Süden in Richtung St. Quintin und der Synagoge zu. Doch schon von der Straßenecke aus sah er die zerbrochene Tür und zerschlagene Möbel vor dem Gebäude liegen. Mit klopfendem Herzen trat er näher. Die Plünderer hatten sich offenbar verzogen. Er war einen Augenblick versucht einzutreten, überlegte es sich dann aber anders und lief die Straße entlang dem Dom zu. Vor ihm hörte er die Menge schreien. Er begann zu rennen und das massige Querhaus aus rotem Sandstein mit dem rechteckigen Vierungsturm kam ihm in den Blick. Um zum Bischofspalast zu gelangen, musste er entweder im Osten oder Westen um den Komplex der drei Kirchen herum. Er entschied sich für den Westen und wandte sich auf St. Johannis zu. Er lief an der Außenmauer des Kreuzgangs entlang, der hier im Norden des ehemaligen Doms lag, und bog dann um das Westwerk der Kirche herum. Vor ihm führte der lange überdachte Arkadengang zum Dom. Dahinter lag, nun genau vor ihm, der neue Kreuzgang mit dem angrenzenden Palast des Bischofs. Doch davor wogte eine Menschenmenge, die »Taufe oder Tod!« skandierte. David konnte nicht erkennen, was genau vor sich ging. Ohne nachzudenken, stürzte er sich in das Gedränge. Das Rufen und Schreien um ihn herum wurde immer lauter, aber irgendwie schaffte es David, sich vorzuarbeiten. Plötzlich kam Bewegung in die Menge.
»Sie haben die Tür zur Halle aufgebrochen«, rief jemand von vorne. »Jetzt sind die Ungläubigen dran! Taufe oder Tod!« Benommen wurde David von der aufgepeitschten Menge mitgerissen und fand sich plötzlich an der Tür zur bischöflichen Halle wieder. Starr vor Entsetzen wurde er Zeuge des letzten Aktes des Massakers. Einige Brüder versuchten, sich mit wenigen Speeren und Möbelstücken gegen die eingedrungenen Kreuzfahrer zu wehren. Wo waren nur die Mannen des Bischofs? Ohne sie hatten die Juden keine Chance gegen die aufgeputschte Meute. Vor den Verteidigern lagen bereits Leichen von ermordeten Glaubensbrüdern, Schwestern und Kindern auf dem Boden. Doch was er ganz hinten sah, ließ ihm das Blut in den Adern stocken: Eng zusammengedrängte Frauen erstachen ihre eigenen Kinder, bevor sie sich selbst das Messer in die Brust rammten. Sie wollten lieber von eigener Hand sterben, als ein Opfer der Unbeschnittenen zu werden oder den Glauben ihrer Mütter zu verleugnen. Wie in Trance erblickte David seinen Onkel Ruben, der seine Rebecca an sich drückte. Ein Messer blitzte auf und der Hüne hielt sie sterbend an sich gedrückt. Dann legte er sie vorsichtig zu Boden und wollte das Messer gegen sich selbst richten. Doch der Schmerz musste ihm die Sinne vernebelt haben, denn statt sein Werk zu vollenden, stürzte er sich plötzlich mit einem markerschütternden Schrei auf die Angreifer. Erschrocken wichen die Mörder in der vordersten Front zurück, wurden aber von den nachdrängenden vor sich hergeschoben. Ein Handgemenge entspann sich und Blut spritzte auf. David, der endlich wieder aus seiner Trance erwachte, wollte sich zu den Kämpfenden durchdrängen, doch er stolperte und fiel. Bevor er aufstehen konnte, trat ein Mann auf ihn, ein anderer Stiefel traf seinen Kopf. Hart schlug sein Schädel auf den Boden und um David wurde es dunkel.
Als er erwachte, lag er auf einem harten Feldlager. Brand lag in der Luft. Einen Augenblick wusste er nicht, wo er sich befand, doch dann traf ihn die Erinnerung wie ein weiterer Fußtritt und er wünschte sich, in die Besinnungslosigkeit zurückzufallen. Doch sein Körper erfüllte ihm diesen Wunsch nicht. Schließlich schlug er blinzelnd die Augen auf. Neben ihm lag noch ein Verwundeter. Hatten die Männer des Bischofs etwa noch eingegriffen und die letzten Überlebenden gerettet? Doch der Mann neben ihm gehörte nicht zur Gemeinde. Er befand sich im Lager der Kreuzfahrer!
»Na, bist du wieder wach?«, raunzte ihn eine Stimme von der anderen Seite an. David fuhr herum, was er sofort bereute. Sein Schädel dröhnte wie eine Glocke. »Bist du wach?«, wiederholte die fremde Stimme. David erkannte einen älteren bartlosen Mann als den Sprecher. Allem Anschein nach ein armer Bauer oder Tagelöhner. Er nickte vorsichtig. »Hast Glück gehabt, dass ich dich rausgezogen habe. Beinahe hätten sie dich totgetrampelt. Es sind überhaupt mehr Männer totgetrampelt als von den Ungläubigen erschlagen worden!«
David verstand nicht. »Du hast mich aus der Halle des Bischofs gezogen?«, fragte er verwundert. Ein Gefühl warmer Dankbarkeit überkam ihn. Der Bauer hatte ihm das Leben gerettet. Offenbar befand sich unter all den Mördern und Räubern ein Mensch!
»Ja, zu plündern gab es da ohnehin nicht viel. Und wir, die wir gelobt haben, unser Leben dem heiligen Krieg zu weihen, müssen doch zusammenhalten.«
Wieder traf die Erkenntnis David völlig unvorbereitet. Der andere hielt ihn für einen Kreuzfahrer. Einen der Mörder seines eigenen Volkes! Er wollte aufbegehren, doch konnte sich gerade noch beherrschen. Er könnte niemanden mehr retten. Außer sich selbst. »Hast du etwas Wasser für mich?«, bat er und schloss wieder die Augen. »Was ist aus dem Erzbischof geworden?«, fragte er dann.
Der Bauer reichte ihm einen Lederschlauch. »Hier, trink. Der Bischof ist geflohen, soweit ich weiß. Nach Rüdesheim, und auch einige Juden sind mit ihm entwischt. Emicho hat vor Wut getobt. Die Prophezeiung sagt, er wird nur Kaiser, wenn er sie alle erwischt, weißt du?« David trank begierig von dem dargebotenen Wasser. »Wie heißt du eigentlich?«, fragte der Bauer. »Mein Name ist Konrad, oder Kunz, für meine Freunde.«
David nickte wieder. »Ich heiße Da–«, er hustete, »Darius.«
»So, Darius«, wiederholte Kunz nachdenklich. »Ich habe dich bisher noch gar nicht gesehen.«
Davids Gedanken rasten. »Ich bin erst in Schp–«, wieder unterbrach er sich. Die Christen nannten die Stadt Spira, nicht Schpira. »Ich bin erst in Spira zu dem Heer gestoßen«, erklärte er.
»Und schon verwundet? So ein Pech!« Kunz grinste schief. »Wo willst du eigentlich hin?«
»Nach Jerusalem natürlich«, behauptete David.
»Ach ja? Sieh mal einer an.« Der Bauer wiegte den Kopf.
abe ich etwas Falsches gesagt?, fragte sich David mit aufkeimender Panik. »Wollen wir da nicht alle hin?«, wandte er sich heiser an seinen Retter.
»Ich schon«, entgegnete Kunz. »Deus lo vult – Gott will es! Und einige andere Männer auch. Wir sind nicht von unserer Scholle gewichen, um hier in den christlichen Städten zu wüten. Aber Emicho will weiter nach Coellen und Treveris ziehen. Er hat es sich zur Aufgabe gesetzt, zuerst alle Ungläubigen im Frankenreich zu bekehren oder auszurotten. Aber wenn du willst, kannst du mit mir und den anderen ziehen, wir wollen den Moin hinauf und versuchen, das Heer Peters des Eremiten einzuholen.«
David stöhnte. Sein Kopf schmerzte pochend und er schloss die Augen. Doch das war nicht besser. Vor seinem geistigen Auge erschienen Bilder der gerade erlebten Katastrophe und verschwammen mit dem Anblick der Kreuzfahrer und der Verwundeten neben ihm, bevor ihn ein gnädiges Schwarz umfing.
Als David wieder erwachte, war die Sonne bereits aufgegangen und es roch nach Essen. Erst jetzt bemerkte er, wie hungrig er war, und schlug die Augen auf. Er sah, dass er sich noch immer auf dem improvisierten Krankenlager unter den Arkaden zwischen St. Johannis und St. Martin befand. Auch Kunz, die gute Seele unter den Mördern, war noch da, drehte ihm aber den Rücken zu und sprach mit einem anderen Mann. David konzentrierte sich, um etwas zu verstehen.
»Wir haben sie nicht alle erwischt. Einige sind mit dem Bischof nach Rüdesheim entkommen, es verstecken sich aber sicherlich auch noch welche in der Stadt! Manche Christen gewähren ihnen sogar Unterschlupf.« David erstarrte. Er kannte die Stimme. Das war Gerold. Als hätte er nicht schon genug Schaden angerichtet! Wieder erschien das Bild Rubens vor Davids innerem Auge, mit seiner toten Rebecca im Arm. Tränen stiegen ihm in die Augen und beinahe hätte er laut geschluchzt, aber er durfte sich nicht zu erkennen geben! Der Verräter suchte nach ihm und den überlebenden Geschwistern! Er rollte sich zusammen und spielte den Schlafenden. Ob sie ben Levi bereits erwischt hatten? Der gut laufende Laden des Goldschmieds war sicherlich eines der ersten Ziele von Leuten wie Gerold gewesen. Endlich verstummten die Stimmen, aber auch sein Hunger war David vergangen. Was sollte er bloß tun? In der Stadt würde ihn früher oder später einer dieser Mörder erkennen, denn Gerold war sicherlich nicht der Einzige. Es gab nur eine Möglichkeit: Er musste sich Kunz und den Männern anschließen, die weiter nach Jerusalem ziehen wollten. Kaum hatte er die Entscheidung getroffen, begann sich sein aufgewühltes Gemüt zu beruhigen. Er hatte ein Ziel. Langsam rollte er sich wieder auf den Rücken und blinzelte hinauf in das Gewölbe des Ganges. Kunz war immer noch da und beschäftigte sich mit dem Kochfeuer. Von Gerold war nichts mehr zu sehen. David setzte sich auf. »Kunz«, rief er leise.
Der Bauer fuhr herum. »Da wirst du ja endlich wach. Ich habe mich schon gefragt, ob bei dir vielleicht mehr nicht stimmt als die paar Tritte gegen den Kopf.« Er grinste, offensichtlich erleichtert, seinen Schützling weitgehend wohlauf zu sehen.
»Wann wollen wir denn nun weiterziehen?«, fragte David unvermittelt. »Es ist mir zuwider, hier im Frankenreich den Schwachen aufzulauern. Ich will Größeres vollbringen!« Der erste Teil der Aussage war zumindest vollkommen wahr.
»Ganz meine Gedanken«, rief Kunz begeistert. »Morgen schon ziehen wir weiter. Der lange Heinrich führt uns an. Er kennt sich mit so etwas aus, denn er war Vorarbeiter auf einem Zehnthof. Ich mache euch heute Abend bekannt.«
»Gut«, bestätigte David. »Und noch etwas.«
»Ja?«, fragte Kunz und hob die Brauen.
»Kann ich etwas von deinem Eintopf haben?«
Ansaldo
Genua, Juni 1097
Die Sonne brannte bereits unbarmherzig auf den Strand und in den Bäuchen der unfertigen Schiffe stand die Luft. Der Schweiß lief Ansaldo, der sich gerade vom Voranschreiten der Arbeiten an einer großen Galera überzeugt hatte, in Strömen von Stirn und Nacken. Noch schlimmer musste es den Arbeitern gehen, die hier in der Hitze auch noch mit Beil und Hammer hantierten. Doch sie taten ihre Pflicht, nicht nur gegenüber der Compagnia und der Stadt, sondern Gott selbst gegenüber. Leider reichte das nicht und es war absehbar, dass die Schiffe erst im Spätsommer einsatzbereit sein würden. Ansaldo wischte sich die verschwitzten Haare aus der Stirn und stieg den Aufgang hinauf zur Steuerplattform. Dankbar bemerkte er, dass inzwischen eine leichte Brise von der See her wehte. Der Rauch der Feuer, auf denen Pech zum Kalfatern der Schiffe erhitzt wurde, stieg noch immer fast senkrecht in den Himmel.
»Gott zum Gruß, Consul Ansaldo«, rief eine Männerstimme von unten herauf. Er drehte sich um. Vom Strand winkte Primo, der jüngere der Embriachi-Brüder. »Wie steht es bei euch?«
»Die Donna Maria hier kann in zwei oder drei Tagen zu Wasser gelassen werden. Und die Magdalena dort drüben wird bereits kalfatert«, er zeigte zu dem schlanken Schiff hinüber.
»Hast du Neuigkeiten? Vielleicht von euren immer so gut unterrichteten Amalfitanern?«
Primo grinste. »Allerdings. Basileus Alexios hat die Kreuzfahrer nicht nach Konstantinopel hineingelassen, sondern gleich über den Bosporus befördert. Sie sollen sich schließlich mit den Seldschuken, nicht mit seinen eigenen Leuten schlagen. Er hat wohl die Nase voll von dem Bauernheer, welches vorher durch sein Land zog.«
»Ich glaube, er misstraut auch Bohemund und den Normannen. Immerhin ist es noch keine zwanzig Jahre her, dass Guiskard den Griechen Dyrrachion abgenommen hat, um sein Sizilianisches Normannenreich bis vor die Tore Konstantinopels auszudehnen«, versetzte Ansaldo lachend.
»Das ist richtig«, bestätigte Primo. »Und Alexios oberster Feldherr ist immer noch derselbe von damals: General Tatikios. Er hat die Kreuzfahrer auch gezwungen, einen Lehnseid auf sich ablegen lassen. Alle Gebiete, die sie den Heiden entreißen, sollen dem griechischen Kaiser gehören!«
»Und die Herren haben dem alle zugestimmt?«, fragte Ansaldo ungläubig. »Können sie uns dann überhaupt Handelsprivilegien erteilen?«
Aber Primo lachte. »Ist doch egal, ob der Kaiser Alexios oder ein Kreuzfahrer uns die erteilt. Hauptsache ist, dass die heiligen Stätten befreit werden. Und ohne diese Einigung wäre der Kreuzzug ebenso schnell beendet wie der Zug der Bauern!«
Ansaldo nickte widerwillig. Im Prinzip würden Handelsprivilegien des griechischen Kaisers sogar den Handel mit Konstantinopel einschließen. Auf der anderen Seite müsste man sich diese Profite sicherlich mit Venezia teilen, das von alters her mit Konstantinopel eng verbunden war. Er sprang vom Bordrand der Donna Maria in den Sand. Und bereute es sofort. Sein rechtes Knie, welches ihn bereits so lange in Ruhe gelassen hatte, dass er kaum noch daran dachte, machte sich mit einem Stechen bemerkbar und er knickte ein. Primo sprang herzu, doch Ansaldo verbiss sich den Schmerz und winkte verärgert ab. »Bin nur umgeknickt«, murmelte er und richtete sich trotz der Schmerzen auf. »Erst mal müssen wir hier fertig werden. Aber ich danke dir für die Nachrichten. Wenn sich das Heer bereits jenseits des Bosporus befindet, hören wir sicherlich bald von den ersten Siegen!«, behauptete er und bemühte sich, eine unbekümmerte Miene aufzusetzen, die weder seine Sorgen um den Feldzug noch seine Schmerzen verriet. »Ich werde dir berichten«, versprach Primo und wandte sich zurück in Richtung Stadt.
Ansaldo stieß pfeifend die Luft aus und beugte sich über sein Knie. Es war deutlich geschwollen. Zu beiden Seiten der Kniescheibe konnte er Beulen ertasten, die sich jeweils leicht wegdrücken ließen, aber sofort wiederkamen, wenn er die Hand wegnahm. Er überlegte, ob er sich kurz im Meer abkühlen sollte. Das kühle Nass würde auch seinem Knie guttun. Hier bei den Galeras befanden sich nur die Arbeiter, und so würde sich niemand daran stören. Rasch streifte er die Kleidung ab und rannte den Strand hinab. Das Wasser war herrlich kühl. Mit kräftigen Zügen schwamm er auf die tief stehende Sonne zu. Es gab fast keine Wellen und er entfernte sich rasch vom Land, doch hier im Wasser spürte er sein Knie gar nicht mehr und das machte ihm Mut. Es war doch nichts Ernstes. Doch nach einigen weiteren Zügen drehte er um. Es ging ihm ja eigentlich nur um die Erfrischung. Arbeit und Anstrengung hatte er den Tag über auf der Werft gefunden. Mit langen Zügen glitt er durch das nun in der Sonne glitzernde Wasser. Im Rumpf der Donna Maria wurde noch gearbeitet, aber sonst befanden sich nicht mehr viele Menschen auf der Baustelle. Da bemerkte er eine einzeln stehende Person, die sich etwas abseits hinter den Büschen hielt, sodass er sie von der Baustelle aus nicht hatte sehen können. Er versuchte, das Salzwasser aus den Augen zu blinzeln. Wer war das? Konnte das Giulietta sein? Ihre Gestalt war hoch und das Haar glänzte trotz des dunklen Farbtons in der Sonne. Irgendwie war er sich sicher, dass sie es war. Voll Freude zog er kräftig durch und kraulte die letzten zwei Steinwürfe zum Strand. Doch dort angekommen, fiel ihm ein, dass er nackt war. Seine Kleidung lag unordentlich zusammengeknäult unterhalb des Rumpfes der Donna Anna. Er biss sich auf die Lippe. Doch was half es? Schließlich hatte er Giulietta nicht herbestellt. Und hatte sie ihn vielleicht auch schon beim Ins-Wasser-Gehen beobachtet? So schnell er konnte, rannte er aus dem Wasser auf das unfertige Schiff zu. Dort griff er seine Kleider und warf sie sich über. Erst jetzt blickte er auf und suchte mit den Augen nach der geheimnisvollen Figur. Doch wieder sah er nichts. Entschlossen stapfte er auf das windzerzauste Gebüsch zu, hinter dem sie sich befinden musste. Als er darum herum lief, stand sie tatsächlich da. Schöner denn je.