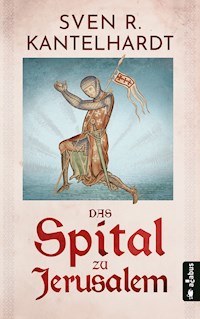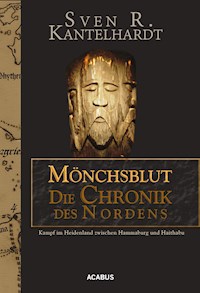Sven R. Kantelhardt
Der Schmied der Franken
Ulfberhts Reise
Historischer Roman
Inhaltsverzeichnis
Der Schmied der Franken
Teil I Im Frankenreich
Sigiberht, Westhang des Odanwaldes, Lenzmonat 792
Ulfberht, Westhang des Odanwaldes, Lenzmonat 792
Sigiberht, Sachsen, Erntemonat 792
Ulfberht, Moguntia, Holzmonat 792
Landfried, Moguntia, Holzmonat 792
Hađuwīħ, Brandthof, Weinmonat 792
Ulfberht, Hruođolfshof, Weinmonat 792
Hludahilt, Hruođolfshof, Weinmonat 792
Ulfberht, Hruođolfshof, Weinmonat 792
Hludahilt, Hruođolfshof, Weinmonat 792
Ulfberht, Lauresham, Weinmonat 792
Hludahilt, Hruođolfshof, Herbstmonat 792
Ulfberht, Lauresham, Weidemonat 793
Landfried, Moguntia, Hornung 793
Hludahilt, Hruođolfshof, Hornung 793
Landfried, Moguntia, Hornung 793
Hludahilt, Hruođolfshof, Ostermonat 793
Landfried, Radantia, Ostermonat 794
Hludahilt, Hruođolfshof, Ostermonat 793
Landfried, Baustelle an der Radantia, Heumonat 793
Landfried, Baustelle an der Radantia, Erntemonat 793
Landfried, Baustelle an der Radantia, Holzmonat 793
Ulfberht, Odanwald, Heiliger Monat 793
Landfried, Franconofurt, Hornung 794
Hludahilt, Lauresham, Ostermonat 795
Ulfberht, Odanwald, Lenzmonat 794
Ulfberht, Lauresham, Weidemonat 794
Landfried, Moguntia, Holzmonat 794
Ulfberht, Lauresham, Holzmonat 794
Ulfberht, Lauresham, Ostermonat 795
Hludahilt, Lauresham, Weidemonat 795
Ulfberht, Lauresham, Holzmonat 794
Ulfberht, Lauresham, Heiliger Monat 794
Ulfberht, Lauresham, Ostermonat 795
Ulfberht, Lauresham, Weidemonat 795
Ulfberht, Lauresham, Wintermonat 796
Teil II Der Awarenfeldzug
Landfried, Moguntia, Lenzmonat 796
Landfried, Danuvius, Ostermonat 796
Mundarik, Lager bei Wenia am Danuvius, Weidemonat 796
Landfried, vor Wenia, Weidemonat 796
Landfried, Wenia, Weidemonat 796
Landfried, Puszta zwischen Danuvius und Tissus, Heumonat 796
Landfried, der Ring, Erntemonat 796
Teil III Zwischenspiel
Ulfberht, Lauresham, Heumonat 796
Hludahilt, Lauresham, Heumonat 796
Landfried, Danuvius, Heumonat 796
Hludahilt, Lauresham, Weidemonat 796
Ulfberht, Lauresham, Weinmonat 796
Ulfberht, Hehiddesheim, Herbstmonat 796
Hludahilt, Lauresham, Herbstmonat 796
Landfried, Ingilinheim, Heiliger Monat 796
Ulfberht, Hathisheim, Hornung 797
Landfried, Ingilinheim, Hornung 797
Hludahilt, Lauresham, Lenzmonat 797
Ulfberht, Ingilinheim, Lenzmonat 797
Landfried, Ingilinheim, Lenzmonat 797
Hludahilt, Lauresham, Ostermonat 797
Ulfberht, Ingilinheim, Ostermonat 797
Teil IV Die große Reise
Ulfberht, Ingilinheim, Ostermonat 797
Hludahilt, Lauresham, Weidemonat 797
Ulfberht, Wormatia, Weidemonat 797
Landfried, Bodensee, Weidemonat 797
Ulfberht, Septimerpass, Weidemonat 797
Landfried, Italien, Brachmonat 797
Ulfberht, Civitas Classis, Weidemonat 797
Landfried, Caesarea, Brachmonat 797
Ulfberht, Caesarea, Brachmonat 797
Landfried, Caesarea, Heumonat 797
Ulfberht, Jerusalem, Heumonat 797
Ulfberht, Betlehem, Heumonat 797
Landfried, Jerusalem, Holzmonat 797
Ulfberht, Jerusalem, Erntemonat 797
Ulfberht, Nablus, 797
Landfried, Bagdad, Hornung 798
Ulfberht, Bagdad, Lenzmonat 798
Landfried, Bagdad, Ostermonat 798
Ulfberht, Bagdad, Ostermonat 798
Landfried, Bagdad, Heumonat 797
Ulfberht, Bagdad, Heumonat 798
Landfried, Bagdad, Heumonat 798
Ulfberht, Balsora, Erntemonat 798
Teil V Im Land der Wunder
Ulfberht, Muziris, Holzmonat 798
Landfried, Muziris, Holzmonat 798
Ulfberht, Muziris, Heiliger Monat 798
Landfried, Muziris, Wintermonat 799
Ulfberht, Hochland von Dekkan, Wintermonat 799
Landfried, Muziris, Wintermonat 799
Ulfberht, Muziris, Wintermonat 799
Ulfberht, Bagdad, Lenzmonat 800
Teil VI Nachspiel
Ulfberht, Reichenau, Heumonat 800
Ulfberht, Paderborn, Erntemonat 800
Ulfberht, Lauresham, Erntemonat 800
Hludahilt, Lauresham, Erntemonat 800
Ulfberht, Odanwald, Erntemonat 800
Hludahilt, Lauresham, Erntemonat 800
Ulfberht, Odanwald, Erntemonat 800
Ulfberht, Odanwald, Holzmonat 800
Ulfberht, Lauresham, Holzmonat 800
Historische Anmerkungen
Einige interessante Artikel und Bücher zum Thema:
Personenverzeichnis
Ortsverzeichnis
Danksagung
Impressum
Orientierungsmarken
Cover
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Impressum
Teil I
Im Frankenreich
Sigiberht, Westhang des Odanwaldes, Lenzmonat 792
Das breite Eisen schnitt durch die vom Winterregen noch weiche Erde. Das Feld hatte ein Jahr geruht, um dem Boden neue Kraft zu geben, nun kam es wieder unter den Pflug. Sigiberht setzte seine Füße sicher im gleichmäßigen Takt hinter die Pflugschar. Ein eisernes Blatt war nicht billig, aber sehr viel robuster als die alten hölzernen Hakenpflüge, wie sie selbst auf dem Herrenhof im Tal noch benutzt wurden. Kein Wunder, dass sein junger Sohn Ulfberht geradezu versessen darauf war, seinem Vater beim Pflügen zur Hand zu gehen. Er lief den beiden Ochsen voran und lockte die Tiere mit seiner hellen Stimme dem dunklen Waldrand entgegen. »Holla Muni, Hui Hramn!« Sigiberhts Augen ruhten einen Moment mild, geradezu liebevoll auf seinem Jungen. Dann senkte er den Blick wieder auf die Ackerfurche. Das Leben war hart, auch wenn es ihm als Köngisfreien noch gut ging. Er bestellte seinen eigenen Grund, war frank und frei und nur dem König zur Heerfolge verpflichtet. Ein echter Franke. Durch diese Sichtweise hatte er allerdings unter den Hörigen des nahegelegenen Herrenhofs nur wenige Freunde gewonnen. Sigiberht lächelte grimmig und wandte sich wieder seiner Arbeit zu. Ein Blick in den schmalen Himmelsstreifen, welchen der düstere Wald, der das Feld von drei Seiten einschloss, frei ließ, zeigte ihm, dass er sich beeilen musste. Gerade hatte die Sonne noch geschienen, doch nun ballten sich die Wolken bedrohlich zusammen. Die Rinder brüllten nervös, doch Ulfberhts lockender Ruf beruhigte sie rasch wieder. Bald begann es zu regnen, aber Sigiberht ließ sich nicht aus dem Takt bringen. Als er schließlich die letzte Furche gezogen hatte, regnete es bereits Bindfäden. Er wuchtete den schweren Pflug auf die Schulter des stärkeren der beiden Ochsen, während sein Sohn sich an die warme Flanke des Tieres drückte. »Na komm schon«, brummte Sigiberht. »Wollen die Mutter nicht ewig warten lassen.« Gemeinsam traten sie den Heimweg an.
»Wenn ich groß bin, werde ich auch Bauer«, plapperte Ulfberht noch voller Begeisterung. Bewundernd sah er zu, wie das Regenwasser vom blanken Eisen der Pflugschar abperlte und schließlich im Fell des Ochsen versickerte. Vorsichtig strich er mit der Hand darüber. »Das Eisen ist kalt, obwohl Hramns Seite ganz warm ist«, wunderte er sich.
Sigiberht hatte schon früher Ulfberhts Liebe zu blankem Eisen bemerkt. Musste man seine Geschwister mit Nüssen oder süßen Beeren locken, so reichte es bei Ulfberht, ihm ein blankes Stück Metall vor die Nase zu halten. Seine Mutter hatte ihn im Scherz daher »meine kleine Elster« genannt. Sigiberht schmunzelte bei der Erinnerung. Warum sollte Ulfberht sich auch nicht daran freuen?
»Ich sag Mutter Bescheid«, rief der Junge und sprang den Weg voran.
Ulfberht, Westhang des Odanwaldes, Lenzmonat 792
Ulfberht kannte sämtliche Äcker und Wege des Hofes gut, auch den Weg hinunter zum Herrenhof und weiter über die offenen Felder bis zum Kloster. Er würde ein freier Bauer werden, ein echter Franke wie sein Vater. Und das war viel besser als ein Knecht oder Höriger. So viel hatte Ulfberht trotz seiner erst zwölf Winter bereits verstanden. Schon ragte das Dach des Hofes vor ihm auf. Das alte Gebälk schimmerte braun unter dem mit Moos und Taubenkot gesprenkelten Stroh hervor. Die Luft war von Feuchtigkeit gesättigt, der Rauch der Feuerstelle zog träge aus dem Windauge unter dem Giebel und hing wie feiner Nebel um den First. Aber etwas war anders als sonst: Ein braunes Pferd stand vor der Hoftür. Hin- und hergerissen zwischen Neugier und Furcht trat Ulfberht langsam heran. Da schnaubte der Gaul laut und versuchte, den Regen aus dem Fell zu schütteln. Ulfberht trat einen Schritt zurück und beschloss, auf den Vater zu warten.
Doch noch bevor dieser kam, trat ein Mann aus der Tür des Hauses. »Heda«, rief er Ulfberht zu. »Lauf los, und hol deinen Vater, Bursche! Ich habe eine wichtige Nachricht vom Vogt!«
Ulfberht machte kehrt und rannte seinem Vater aufgeregt entgegen. »Ein Fremder«, berichtete er atemlos. »Mit einem Pferd!«
Der harte Blick seines Vaters verdüsterte sich, aber er schwieg und setzte seinen Weg fort, ohne seine Schritte zu beschleunigen. »Ein freier Franke rennt nicht, wenn man nach ihm schickt«, erklärte er, auch seine Stimme klang um keinen Deut ungeduldiger oder lauter als gewöhnlich. Schließlich erreichten sie den Hof mit dem wartenden Fremden.
»Sigiberht vom Brandthof?«, fragte der, mit ungeduldig schriller Stimme.
»Der und kein anderer«, antwortete Sigiberht und wuchtete den schweren Pflug auf den Boden. »Kümmere du dich um die Ochsen!«, wies er Ulfberht an.
Der verzog das Gesicht. Zu gern hätte er gehört, was der Bote dem Vater mitzuteilen hatte. Doch der bedeutete dem Fremden mit einem Nicken, ihm zu folgen, und trat ins Haus.
Ulfberht brachte die Ochsen in den Stall, der sich im hinteren Teil des Hauses befand, schirrte sie ab und gab ihnen Heu zu fressen. Trockenreiben würde er sie aber nicht, er wollte viel zu gerne wissen, was der Bote für eine Nachricht brachte. Leise schlich er durch die Stallgasse in Richtung der Stube.
»… und das, wo Widukind doch die Taufe empfangen hat!« Das war die tiefe Stimme seines Vaters. Widukind war ein fast schon mythischer Name. Ein wilder Sachse, der im Eifer für die heidnischen Unholde lange den Franken widerstanden und ihnen viel Leid zugefügt hatte, bis er sich endlich der Macht Gottes und Karls beugte und sich taufen ließ!
Da erklang die Stimme des Fremden. »Die Lage ist ernst, und der König hat den Heerbann einberufen.« Auf einmal war es in der Stube so still, dass Ulfberht schon bangte, man könne seine aufgeregten Atemzüge hören. »Alle freien Franken sollen sich am zwölften Tage des Ostermonats in Moguntia versammeln. Diese verdammten Sachsen müssen ein für alle Mal lernen, dass es keinen größeren König als Karl gibt!«
Ulfberhts Herz machte einen Sprung. Ohne daran zu denken, dass er sich damit verriet, trat er in die Stube. »Darf ich diesmal mit dir ziehen? Im Sommer werde ich dreizehn …« Er kam nicht weiter. Sein Vater war aufgesprungen und verpasste ihm eine schallende Ohrfeige.
»Hat dich jemand gerufen? Geh sofort wieder in den Stall an deine Arbeit!«, fuhr er ihn an.
Doch der Königsbote, der ebenfalls aufgesprungen war, legte die Hand an Ulfberhts Kinn und blickte schmunzelnd auf ihn herab. »Wenigstens einer hier scheint seinem König mit Freude zu dienen«, bemerkte er mit einem Seitenblick auf Sigiberht, der rot anlief. Ob vor Wut über den Ungehorsam seines Sohnes oder aus Scham wegen der Worte des Fremden, vermochte Ulfberht nicht zu sagen.
»Wer aus meinem Hause unsere Pflicht und Schuldigkeit gegenüber Karl erfüllt, entscheide immer noch ich«, stieß er wütend hervor. »Natürlich gehört dem König unsere ganze Treue, aber es ist nun schon das sechste Jahr in Folge, in dem der Heerbann ausgerufen wird. Mal führte uns der Krieg nach Osten gegen Tassilo oder die Awaren und dann immer wieder nach Norden gegen die verdammten Sachsen.«
»Du bist ein erfahrener Krieger und hast deinem König bisher treu gedient. Karl zählt auf dich. Ich muss weiter, ich bin noch zu anderen Höfen gesandt.« Damit erhob sich der Mann, und Sigiberht begleitete ihn hinaus.
Sigiberht, Sachsen, Erntemonat 792
Ein Vierteljahr war es her, dass Sigiberht seine Frau und die Kinder zuletzt gesehen hatte. Während zuhause das Korn reifte, befand er sich im kalten und verregneten Sachsen. Vermutlich wartete sein Getreide vergeblich auf den Schnitter, denn Ulfberht war zwar ein braver Junge, aber noch nicht stark genug für die harte Arbeit, und sein Kopf war voller Flausen. Sigiberht seufzte schwer. Auch hier brachte niemand die Ernte ein. Die Sachsen waren über die Elbe geflohen und hatten Felder und Gehöfte verbrannt. Ein trostloses Land und ein trostloser Feldzug.
Ludabalþ, den es wie Sigiberht als Königsfreien von seinem Hof im Lahntal hier in den öden Norden verschlagen hatte, musste Ähnliches gedacht haben, denn er schimpfte: »Dies ist eine verfluchte Gegend. Damit hat Gott die Heiden doch schon genug bestraft. Was wollen wir da noch?«
Sie befanden sich mit einer kleinen fränkischen Abteilung irgendwo im sumpfigen Gelände zwischen Wirraha und Albis und sicherten eine kleine Burg. Eigentlich war es eher ein Sandbuckel, der sich aus dem umgebenden Matsch erhob, und notdürftig von einer Palisade geschützt wurde. Darauf drückten sich ein paar armselige Sachsenhäuser zusammen. Die meisten Bewohner waren fort, und von den Zurückgebliebenen ging bestimmt keine Gefahr aus. Die einzige wirkliche Bedrohung schien von den üblen Dünsten des Moores und den Tausenden und Abertausenden an Stechmücken herzurühren, die hier brüteten. Bereits mehrere Männer waren am Dreitagefieber erkrankt. Ludabalþ und er waren nun am frühen Morgen mit Ledereimern ausgezogen, um frisches Wasser für die Kranken zu holen, welches der schlammige Bach, der um die Burg herum floss, nicht liefern konnte.
»Dort bei den Erlen ist eine gute Stelle.« Ludabalþ zeigte auf eine Gruppe niedriger Bäume.
Der Hinweis war unnötig, sie gingen den Weg dreimal am Tag. Umständlich reihte Sigiberht die Eimer am Ufer auf, während Ludabalþ in die Knie ging, um das Wasser zu schöpfen, ohne dabei den Matsch aufzuwirbeln. Plötzlich knackte hinter ihnen ein Zweig. Trotz des eintönigen Alltags, der die Franken ermüdet und zermürbt hatte, fuhr Sigiberhts Hand zum Griff seiner Spatha, dem fränkischen Langschwert, welches er am Gürtel trug. Dies war allen Anstrengungen des Königs zum Trotz weiterhin Feindesland. Auch Ludabalþ war sofort auf den Beinen, keinen Moment zu früh. Aus dem Erlendickicht brachen fünf zerlumpte Männer mit wilden, blonden Bärten und verfilztem Haar hervor. Zweifellos sächsische Aufständische auf der Flucht. Vorsichtig kamen sie näher, die langen Klingen der beiden Franken fest im Auge. Drei von ihnen führten Saxe, die kurzen Schwerter, denen ihr Stamm seinen Namen verdankte. Die beiden Übrigen waren nur mit Knüppeln bewaffnet. Abgemagert waren sie, und der eine hatte eine schwärende Wunde am Oberarm. Er blickte Sigiberht aus fiebrigen Augen an.
»Essen! Gebt uns etwas zu essen!«, forderte einer der mit einem Sax Bewaffneten. Ein Hüne, dessen Dialekt für fränkische Ohren fast unverständlich war. Es klang fast wie das Gekrächze der hier allgegenwärtigen Möwen.
Sigiberht blickte dem Hünen in die Augen. »Ihr seid Aufständische!«, rief er. »Ihr habt euch an eurem König und der heiligen Kirche versündigt. Euch geschieht nur, wie ihr es verdient. Seid froh, wenn wir euch laufen lassen. Vielleicht kommt ihr bis zur Albis!« Er war wütend. Das waren die verdammten Kerle, derentwegen er von Haus und Hof getrennt in dieser Einöde ausharren musste. Es waren fünf, zwar von Fieber und Hunger geschwächt, aber in den vergangenen Feldzügen hatte er gelernt, diese Barbaren nie zu unterschätzen. Immer wenn man meinte, sie endgültig zu Boden gerungen zu haben, schöpften sie neue Kraft und schlugen unerwartet zurück. Eine Weile standen sich die Feinde unschlüssig gegenüber. Doch Sigiberht bemerkte, dass zwei der Sachsen versuchten, in ihren Rücken zu gelangen. Gleich würden sie angreifen. Er riss die Klinge hoch und schwang sie mit einem Wutschrei gegen den vordersten Sachsen. Der sprang zurück, doch Sigiberht setzte nach und erwischte stattdessen seinen Nachbarn, den mit dem fiebrigen Blick, an der ohnehin verletzten Schulter. Blut spritzte auf, und der Sachse fiel mit einem scharfen Schrei zurück. Auch Sigiberht trat einen Schritt zurück und tastete nach Ludabalþ, der ihm gefolgt war. Nun standen sie Rücken an Rücken gegen vier Gegner, die allerdings schlechter bewaffnet waren als sie selbst. Wieder schwang Sigiberht sein Schwert, doch diesmal parierte der Anführer der Sachsen mit seinem Kurzschwert. Sein Nachbar zielte mit dem Knüppel auf Sigiberhts Handgelenk, doch der zog die Klinge zurück, und der Schlag glitt am Heft ab. Sigiberht führte einen neuen Hieb aus, diesmal traf er auf den Knüppel des zweiten Sachsen. Tief grub sich das Eisen in das Holz. Einen Augenblick steckte die Klinge fest, und sowohl Sigiberht als auch der Sachse versuchten, ihre Waffen zu befreien. Da traf ein zweiter Knüppel von schräg unten auf die Breitseite von Sigiberhts verkeiltem Schwert. Der verwundete Sachse hatte sich aufgerafft und mit der unverletzten Linken einen Schlag geführt. Er konnte von seiner Position am Boden zwar Sigiberht nicht erreichen, aber die verkeilte Klinge sehr wohl. Mit hellem Klirren brach das bewährte Eisen entzwei, und Sigiberht blickte entsetzt auf den Stumpf seines Schwertes. Mit einem Triumphschrei stürzte sich der Anführer der Barbaren auf ihn. Sigiberht spürte seinen heißen Atem auf der Wange und den kalten Stich des kurzen Eisens im Unterleib. Er schnappte nach Luft, während sein Leben mit dem Blut zu Boden rann. Sein Blick trübte sich. Wie würde sein Weib alleine zurechtkommen? Wer sollte für Hađuwīħ und die fünf Kinder sorgen?
Ulfberht, Moguntia, Holzmonat 792
Es war wieder ein hartes Jahr gewesen auf dem Brandthof. Ohne den Vater kam die Familie kaum über die Runden, aber Ulfberht wurde jedes Jahr stärker, und die Knechte des benachbarten Herrenhofs halfen bei der Ernte und dem Dreschen. So hatten sie es wieder geschafft, und endlich neigte sich die Feldzugszeit ihrem Ende zu. »Ob Vater und die anderen Männer schon in Moguntia angekommen sind?«, überlegte Ulfberht. Er lief mit Điodabalþ, einem älteren Knecht vom benachbarten Herrenhof, den heimkehrenden Kriegern über das Kloster Lauresham und Wormatia entgegen. Vom Brandthof war lediglich Vater Sigiberht aufgebrochen, doch vom Nachbarhof hatte Hruođolf, Điodabalþs gestrenger Herr, seinen ältesten Sohn mit gleich zwei Knechten gestellt. Bis nach Wormatia waren die Wege schmal und schlecht befestigt, dies änderte sich jedoch im Zentrum der von den Römern planvoll angelegten Stadt.
»Das ist der Caput via«, erklärte Điodabalþ stolz, auf einen auffälligen Stein weisend. »Hier beginnt die Straße zur alten Königsstadt Mettis.«
»Gehen wir dorthin?«, fragte Ulfberht mit großen Augen.
Điodabalþ lachte. »Nein, wir nehmen die Straße nach Moguntia. Aber du wirst sehen, die Straße ist fest und gerade, und von nun an kommen wir rasch voran.« Doch kurz hinter dem Stadttor wich das Pflaster immer wieder Abschnitten von Sand und Schotter.
»Wieso besteht nicht die ganze Straße aus Steinen?«, fragte Ulfberht neugierig. Es war das erste Mal, dass er überhaupt eine befestigte Straße zu Gesicht bekam, und es beeindruckte ihn gewaltig.
»Sie war einmal komplett gepflastert, aber die Steine sind vor langer Zeit von den Römern gelegt worden, und Gräser und Moose haben sie zerbrochen und überwuchert.«
An anderen Stellen war die Straße abgesunken, und breite Pfützen hatten sich darauf gesammelt. Um besonders tiefe Stellen machte der Weg einen Bogen und wich von der geraden Linie ab, dort wo der Weg anstieg, hatten die Räder der Wagen tiefe Spuren in den Stein gegraben. So wanderten sie den ganzen Tag mal dichter, mal entfernter vom stark mäandernden Rhein nach Norden. Gegen Abend, kurz hinter einem kleinen Dorfanger, hörte Ulfberht linker Hand ein sanftes Plätschern. Erfreut hielt er nach der Quelle Ausschau, denn er war vom langen Weg verschwitzt und durstig. Aus einer kleinen, in Stein gefassten Quelle floss Wasser in ein zerborstenes Becken. Die Steine sahen geheimnisvoll aus, bemoost, und auf manchen erkannte er Muster oder Figuren. Ulfberht machte Anstalten, den Weg zu verlassen, um sich in dem Becken abzukühlen.
Doch Điodabalþ zog ihn unwirsch weiter. »Riechst du nicht den Teufel?«, fragte er. Ulfberht sah ihn fragend an, auch er roch den Schwefel, hatte sich aber nichts dabei gedacht. Rasch zog Điodabalþ den noch immer zögernden Ulfberht weiter. »In Bouconica sind wir sicher für die Nacht«, erklärte er. »Dort steht eine Kapelle der Gottesmutter, und der Glöckner ist ein gastfreier Mann, den ich von früheren Reisen kenne.«
Hinter der nächsten Wegbiegung schmiegte sich der angekündigte Ort in einen Einschnitt des hier steilen roten Felsens. Eine schwache Palisade umfriedete wenige schiefe Häuser aus Fachwerk und groben Bohlen. Điodabalþ führte seinen jungen Reisegenossen zielstrebig am Weinberg vorbei und zur hölzernen Marienkirche hinauf. »Hier können wir uns von dem Gestank des Bösen reinigen«, schnaufte er, vom Anstieg außer Atem.
»Der Geruch des Bösen?«, erkundigte sich ein dicker Mann in einfacher Kutte, ihnen aus dem Gebäude entgegentretend.
»Bruder Martinius«, rief Điodabalþ erfreut.
»Điodabalþ! Willkommen im Hause unserer Herrin«, antwortete der Mann in der Kutte und reichte dem alten Knecht lächelnd die Hand. »Was redest du da von Gestank und Teufel?«
»Die Quelle vor dem Tor stinkt nach Unterwelt«, erklärte Điodabalþ etwas verlegen. Er schien sich vor dem Kirchenmann ein wenig für seinen Aberglauben zu schämen.
»Das ist eine Heilquelle, hat schon den Römern Linderung bei Gliederschmerzen gebracht!«, lachte der Geistliche, und Điodabalþ wurde noch eine Spur röter. »Aber kommt herein. Zum Gebet und für die Nacht seid ihr willkommen. Mit oder ohne den Geruch des Bösen.« Sie verrichteten ihre Gebete vor dem schmucklosen Altar, und Martinius ließ sie kurz warten. »Ich muss noch rasch zu Abend läuten«, erklärte er. Und schon schallte der helle Klang des Erzes über Dorf und Weinberge und hallte von den roten Felsen zurück. »Hast du schon mal echten Wein getrunken, Junge?«, fragte der Glöckner Ulfberht auf dem Weg zu seinem Häuschen verschmitzt. Dieser schüttelte den Kopf. »Bei uns zuhause gibt es nur Bier, Vater«, erklärte er respektvoll.
»Dann musst du einen Becher nehmen, und dein Vater bekommt auch einen.« In seinem Häuschen angekommen, stellte Martinius drei einfache Tongefäße auf den Tisch. »Der Wein wächst dort draußen rund um die Kirche. Und weil der Zehnt aus dem Weinberg mir, dem Glöckner, zusteht, nennen die Leute den Weinberg die Glöck. Der Wein für den Glöckner!«, lachte er. »Der alte König Pippin hat das so eingerichtet, als er die Kirche dem Bischof von Virteburch schenkte.« Er hob seinen Becher. »Auf den alten König Pippin und Berowelf, unseren Bischof!«
Vater Martinius hatte nicht zu viel versprochen. Der Wein schmeckte süß und köstlich, fast wie Honig. So köstlich, dass es Ulfberht entgegen seiner Gewohnheit am nächsten Morgen in der Frühe schwerfiel, das Lager zu verlassen. Doch Điodabalþ drängte: »Wir wollen Moguntia noch bei Tage erreichen, also beeil dich.«
Sie verließen den gastfreien Bruder und kehrten auf die Römerstraße zurück. Bald zogen sich die roten Felsen vom Rhein zurück, und die Straße schwenkte über eine fruchtbare Ebene auf Moguntia zu. Kurz nach Mittag konnte Ulfberht endlich die Stadt in der Ferne erahnen. Doch bevor sie die erreichten, durchquerte die Straße einen alten Friedhof.
»Das haben die Heiden gebaut, und ihre Geister wohnen immer noch an diesem Ort«, erklärte Điodabalþ und bekreuzigte sich.
Ulfberhts Blick huschte scheu über die grauen, mit Moos und Flechten bewachsenen Grabstellen. Er schluckte und bekreuzigte sich ebenfalls. Doch unvermittelt zerbrach der helle Klang von Eisen auf Stein die Stille. Hinter einer kleinen Anhöhe tauchten Holzgebäude und arbeitende Männer auf. Es waren Steinmetze, die mit ihren Beilen große Kalksteinblöcke bearbeiteten. »Was ist das?«, fragte Ulfberht neugierig. »Das wird die Stiftskirche des Heiligen Albanus«, erklärte Điodabalþ und bekreuzigte sich erneut.
»Wer?«, wollte Ulfberht wissen.
»Der Heilige Albanus wurde von den Wandalen enthauptet und trug sein eigenes Haupt dann von Moguntia bis hierher zu seiner Begräbnisstelle«, erklärte Điodabalþ.
Ulfberht starrte ihn mit offenem Mund an. »Seinen eigenen Kopf?«, fragte er. »Wieso hat er das getan?« Er schüttelte den Kopf. »Ich meine, wenn er trotzdem gestorben ist?«
Điodabalþ blickte ihn unwillig an. »Was weiß denn ich?«, knurrte er. »Er war halt ein Heiliger. Die machen solche Sachen.«
Ulfberht überzeugte diese Antwort nicht, doch schon nach wenigen Schritten fesselte ein neues Wunder seine Aufmerksamkeit. »Was für ein riesiges Tor«, staunte er. »Da können die Wagen ja voll beladen ein- und ausfahren!« Es dauerte aber noch eine halbe Stunde, bis sie das Wunderwerk erreichten. Zwei Krieger standen gelangweilt vor dem Stadttor.
»Ist das Heer aus Sachsen schon heimgekehrt?«, erkundigte sich Điodabalþ. »Einige«, gab einer der Wachtposten mürrisch zurück. »Aber nur diejenigen, die die gefangenen Sachsen bewachen«, ergänzte der andere, offensichtlich der gesprächigere. »Richtige Sachsen?«, staunte Ulfberht.
Der Wächter lachte. »Ja, diejenigen, die keine Ruhe geben wollen, lässt Karl nach Westen ins Welsche Land bringen.«
Sie betraten die Stadt, und Ulfberht kam aus dem Staunen nicht heraus. Vorbei ging es an steinernen Häusern, die manchmal sogar drei Stockwerke übereinander trugen. Alles war voller Menschen, und auf dem Markt trat man sich buchstäblich gegenseitig auf die Füße.
»Lass uns zuerst zum Dom gehen und dem Heiligen Martinius unsere Aufwartung machen.« Điodabalþ zog den Jungen an Marktständen vorbei. »Ich habe noch die alte Kirche gesehen mit ihren drei Bögen, und dann haben sie diese hier darüber gebaut! Sie hat die alte Kirche vollständig umschlossen, und erst, als der neue Dom fertig war, hat man die alten Mauern abgerissen!«
Eine Kirche über einer anderen – das Ganze erschien Ulfberht zuerst ziemlich unglaublich, doch als er schließlich vor dem riesigen steinernen Portal stand und den Kopf in den Nacken legen musste, um den von hohen Pfeilern getragenen Giebel zu betrachten, der fast an den Himmel zu reichen schien, konnte er es sich vorstellen. Zwischen den Pfeilern schied eine breite Tür den heiligen Bau von dem Lärm der profanen Welt. Als sie eintraten, zog ein Kirchendiener hörbar die Luft ein. Điodabalþ wischte Ulfberht unwirsch die Kappe vom Kopf. Es fühlte sich an wie eine Kopfnuss, aber das bemerkte Ulfberht in seinem Staunen kaum. Der Raum, den sie betraten, nahm ihm den Atem. Er war breiter als alle Hallen, die er bisher gesehen hatte. Die Decke wurde von sehr langen Eichenbalken getragen und schwebte hoch über ihren Köpfen. Tageslicht flutete durch hohe, schmale Fenster, über denen nochmals runde Öffnungen prangten. Einzelne Staubflocken tanzten in den Sonnenstrahlen. Dieser Raum allein war ein Wunder, doch nur durch einen schwindelerregend hohen Bogen getrennt, schloss sich noch ein weiterer, gleich großer an! Als sich Ulfberhts Augen an das trotz der Fenster herrschende Dämmerlicht gewöhnt hatten, erkannte er weitere Details. Zur Linken wie zur Rechten waren kleinere Räume durch Bögen abgetrennt, und die Wände waren mit prachtvollen Fresken verziert. Langsam schritten sie nach Osten auf die Apsis zu, in der durch einen mächtigen Lettner vom Kirchenschiff getrennt der Altar mit der Reliquie Martins, des heiligen Bischofs von Tour, stand. Neun Doppelschritte zählte er bis zu dem Bogen zwischen den beiden Räumen. Von der Kuppel der Apsis glänzten gelbe Sterne und darunter ein Bild des thronenden Christi, rechts daneben die Gottesmutter und links der Heilige Martin, wie er seinen Mantel teilte. Ulfberht fühlte sich, als sei er bereits im Himmel.
Da legte sich Điodabalþs Hand schwer auf seine Schulter. »Knie nieder, ungehobelter Bengel!«, zischte er.
Rasch sank Ulfberht auf das rechte Knie. Wie hatte er vergessen können, dass er hier vor dem Angesicht des Heiligen Martinius stand?
»Lass uns zum Hof des Vogtes gehen. Dort werden wir sichere Kunde über den Stand des Feldzugs, und wann die Männer heimkehren werden, erhalten!«, beschloss Điodabalþ, als sie das Gotteshaus schließlich verlassen hatten. Ulfberht setzte seine Kappe auf und folgte ihm durch das Gedränge. »Als ich das letzte Mal in Moguntia war, sah hier alles ganz anders aus«, brummte Điodabalþ unzufrieden und hielt einen Mann an. »Wie kommen wir zum Königshof, guter Mann?«, fragte er höflich.
Der Mann blickte ihn an, schüttelte den Kopf und zeigte auf sich selbst. »Lingua Franca no parlo …« Er wollte rasch weiter, doch Điodabalþ hielt ihn an seinem Umhang fest.
»Nicht so schnell, Freundchen«, rief er und richtete seine gebückte Gestalt zur vollen Größe auf. »Prätorio, dove est?«, radebrechte er.
Der Fremde wandte sich unwillig um, doch dann wanderte sein Blick abschätzend an der ihn um Haupteslänge überragenden Gestalt des Knechtes hinauf, und er überlegte es sich anders. Mit dem Finger zeigte er die Straße hinunter »Ahi!«
»Na also«, brummte Điodabalþ.
»Wieso spricht der Mann kein Fränkisch?«, fragte Ulfberht verwirrt. »Moguntia gehört doch auch zum Frankenreich?« Die Mönche sprachen Latein, und er hatte bereits davon gehört, dass die Menschen jenseits des Frankenreiches noch andere Sprachen hätten, aber hier?
»Die Städter reden eben Welsch. Wie die Menschen an der Mosel oder im Westen des Reiches, in Asturien. Selbst am Hofe unseres Königs gibt es Männer, die lieber Welsch sprechen als Fränkisch wie ihre Väter«, antwortete Điodabalþ missbilligend und lenkte seine Schritte in die gewiesene Richtung. »Hier sind wir«, stellte er schließlich zufrieden fest.
Trotz der hohen Stadtmauer wurde das steinerne Gebäude des Königshofes von einer eigenen Palisade umfriedet. Es war zweifellos ein römisches Bauwerk, aber selbst Ulfberht erkannte, dass das einfache Strohdach nicht recht dazu passen wollte. Điodabalþ wandte sich an den Wachtposten, der, wie Ulfberht bemerkte, Fränkisch sprach. Ohne Umschweife winkte er den beiden Wanderern, ihm zu folgen. In der nördlichen Ecke des Vorhofes entdeckte Ulfberht einen Verschlag, in dem man zuhause auf dem Brandthof kaum ein paar Ziegen gehalten hätte. Darin drängten sich Männer mit verhärmten Gesichtern und struppigen blonden Bärten. »Wer sind denn die?«, entfuhr es ihm.
»Sachsen«, antwortete der Wachtposten leichthin.
Ulfberht konnte es kaum fassen. Diese zerlumpten Geschöpfe sollten die furchtlosen Barbaren sein, die als letzte Menschen auf der Erde halsstarrig König Karls Macht trotzten? Doch ein zweiter Blick verriet ihm, dass nicht alle resigniert und stumpf zu Boden blickten. Die Augen eines großen Mannes schienen gerade auf ihn gerichtet. Sein Blick ließ es Ulfberht kalt den Rücken herablaufen. Schnell folgte er dem Wachtposten in das Halbdunkel des Steingebäudes. Ein grauhaariger Mönch hockte mürrisch hinter seinem Schreibpult. Er wechselte ein paar Worte mit dem Wachtposten, zu Ulfberhts Erstaunen wieder in dem welschen Dialekt, den sie schon auf der Straße gehört hatten.
»Wie heißt dein Herr?«, wandte sich der Mönch schließlich auf Fränkisch an Điodabalþ.
»Hruođolf«, antwortete der Angesprochene.
Nach einem kurzen Dialog in der romanischen Sprache gab der Mönch Auskunft: »Sein Sohn ist gestern zurückgekommen. Er gehört zu den Männern des Grafen Landfried. Sie sind am Hafen untergebracht, links von der Karlsbrücke.« Damit war das Gespräch beendet, und der Mönch wandte sich demonstrativ wieder seinem Pergament zu.
Landfried, Moguntia, Holzmonat 792
»Was wollt ihr?«, fragte Landfried gereizt. Das Jahr war fast um, und er hatte die meiste Zeit davon im sächsischen Sumpf gehockt, ohne die Möglichkeit etwas auch nur im Entferntesten Bedeutungsvolles zu leisten. Auch das Winterquartier in Moguntia ließ keine Abwechslung erwarten. Und nun standen vor ihm zwei Männer, die er noch nie zuvor gesehen hatte. Der eine der beiden, ein älterer Knecht in gebückter Haltung, sah aus, als beuge er lieber fromm die Knie, als das Frankenschwert zu schwingen. Der hoch aufgeschossene Junge neben ihm gefiel ihm besser. Seine scharfen Züge und die schmale Nase unter einem Schopf wilder, blonder Haare verrieten einen echten Franken. Trotz seiner schlechten Laune war der Junge Landfried sympathisch. Aus solchen Jungen wurden die Männer, auf deren Schultern die Macht der Franken ruhte. Umso mehr nagte es ihm an der Seele, als er den Grund für das Kommen dieses ungleichen Paares erfuhr. »Sigiberht?«, fragte er, eher um Zeit zu gewinnen, als weil ihm der Name nichts bedeutet hätte. Sigiberht war ein guter Mann gewesen. Genau so einer, wie sein Sohn zu werden versprach. Treu und fest, einer seiner besten, und es schmerzte ihn, seinen Sohn vom Tod des Vaters unterrichten zu müssen. Noch dazu ein so unnötiger Tod, denn die Sachsen waren damals bereits geschlagen. »Wartet hier«, befahl er den beiden mit rauer Stimme. Eilig schritt er zu einer der hölzernen Hafenbaracken, die als Winterlager dienen sollten. »Mundarik, bring mir Sigiberhts Schwert«, rief er. Der Angesprochene reichte ihm nach kurzem Suchen das in ein Tuch geschlagene Eisen. Landfried nickte und trat zurück in die Sonne.
Einige Krieger hatten sich neugierig um die zwei Fremden geschart. »Điodabalþ!«, rief einer von ihnen freudig. »Schickt dich Vater, um uns abzuholen?«
Der alte Knecht senkte demütig das Haupt.
»Wie geht es dem alten Mann?«, wollte der junge Kerl wissen.
Landfried überlegte kurz, wie sein Name war. Radolf, fiel es ihm sogleich ein. Sohn eines kleinen Edlen, der sich aber mächtig etwas auf seinen Stand einbildete.
»Du bist also Sigiberhts Sohn«, unterbrach er das Gespräch, indem er sich an den Jungen wandte. »Wie heißt du eigentlich?«
»Das ist nur der Sohn eines armen Bauern vom Odanwald«, antwortete Radolf anstelle des Angesprochenen. »Sein Name tut nichts zur Sache!«
Landfried blickte ihn einen Augenblick mit offenem Mund an. Hatte der unverschämte Wichtigtuer ihm tatsächlich gerade erklärt, was er zu tun hatte? Wut stieg in ihm auf. »Wenn ich etwas von dir wissen will, zum Beispiel deinen Namen, der mich allerdings nicht im Mindesten interessiert, dann frage ich!«, wies er ihn mit mühsam unterdrücktem Zorn zurecht. Ohne den knallrot angelaufenen Radolf weiter zu beachten, stellte er sich breitbeinig vor den Jungen, der ihn nun mit weit aufgerissenen Augen anstarrte. »Also, wie heißt du?«
»Ulfberht, Herr«, antwortete er prompt.
Er war flink, stellte Landfried fest. Mit einer ausholenden Geste schlug er das Tuch über dem Schwert zurück. Der junge Ulfberht zuckte zurück. Er hatte die zerbrochene Klinge also erkannt. »Sigiberht ist gefallen. Für König Karl und für Franken«, erklärte er.
Der Knecht schluckte hart, doch der Knabe starrte nur auf das zerborstene Eisen. »Wie … wie ist das passiert?«, fragte der fremde Knecht stockend.
»Er geriet in einen Hinterhalt der Sachsen. Einen hat er verwundet, doch dann zerbrach sein Schwert, und so konnten ihn die Sachsen überwältigen. Die meisten von den Schweinehunden haben es mit dem Leben bezahlt, doch zwei haben wir überwältigt und gefangen genommen. Wenn du willst, Junge, zeige ich sie dir?«
Ohne eine Antwort abzuwarten, schritt Landfried voraus durch das Hafentor und den Weg zum Königshof zurück. Der Wachtposten erkannte ihn und trat respektvoll zur Seite. Ulfberht und Điodabalþ nickte er knapp zu. Landfried trat an den Verschlag mit den gefangenen Sachsen. »Willich«, rief er. »Ich habe mit dir zu reden!«
Der Gerufene hob den Kopf. »Was wollt ihr?«, fragte er mit brüchiger Stimme in ebenso gebrochenem Fränkisch. »Wenn du mich jetzt tötest, bleibt es mir erspart, hier zu verdursten.«
»Du bekommst einen Becher Bier, wenn du dem Jungen hier erzählst, wie sein Vater starb. Du warst dabei. Es war der Mann, dessen Schwert zerbrach, kurz bevor ich euch gefangen nahm«, forderte Landfried mit ruhiger Stimme.
Der Sachse blickte mit zusammengezogenen Brauen auf Ulfberht. Plötzlich schnellte er nach vorn und griff mit beiden Händen durch das Gitter nach dem Hals des Jungen. Landfrieds Hand fuhr zum Griff seines Schwertes, doch Ulfberht trat einen Schritt zurück. Der Sachse lachte laut auf. »Nicht mit der Wimper gezuckt hat er. Eure Kinder sind wenigstens mutig, Franke.«
Landfried schnaubte verärgert und zog sein Schwert eine Handbreit aus der Scheide. »Was soll der Unsinn?«, fragte er scharf.
Doch der Sachse antwortete ruhig und ohne den Blick von Ulfberht zu wenden. »Ich habe ihn nur geprüft. Er ist tapfer wie sein Vater. Wir Sachsen achten Tapferkeit, selbst bei einem Franken. Seinen Vater habe ich auch geachtet, auch wenn ich ihn nach Walhalla geschickt habe. Ich werde dir also erzählen, wie es mit deinem Vater zu Ende ging, Junge. Er starb wie ein Mann, ohne Furcht, mit dem Schwert in der Hand. Ich werde ihn einst in Walhalla wiedersehen, in einer besseren Zeit. Und dafür könnt ihr mir nun einen Becher Bier geben oder es lassen.«
Auf dem Rückweg legte Landfried dem Jungen die Hand auf die Schulter. »Wenn du dereinst zum Heer der Franken stößt, dann frag nach Landfried, dem Sohn des Grafen von Meaux. Du sollst mir immer willkommen sein«, versprach er.
Hađuwīħ, Brandthof, Weinmonat 792
Hađuwīħ hatte gewusst, dass er kommen würde. Seit dem Tag, an dem Ulfberht das zerbrochene Schwert seines Vaters heimgebracht hatte, wartete sie darauf. Sie hatte sich vor diesem Tag gefürchtet, denn nun würde alles noch viel schlimmer werden. Aber vielleicht traf wenigstens Ulfberht ein glückliches Los, denn was aus ihr selbst und den anderen hungrigen Mündern auf dem Brandthof werden sollte, vermochte sie beim besten Willen nicht zu sagen. Ihre Tochter Berhta könnte sie als Magd nach Lauresham zu den Mönchen schicken. Sie hätte ihr gewünscht, einen Mann zu finden und zu heiraten. Aber das war nun ausgeschlossen, sie würde niemals die Mitgift aufbringen, um einen freien Franken zu ehelichen. Vielleicht würde der Abt ihnen für Berhtas Arbeit wenigstens über den Winter helfen. Und wenn Ulfberht sich geschickt anstellte, könnte er die Schuld bei dem reichen Nachbarn bis zum nächsten Jahr abtragen? Doch so lange mussten sie erst einmal durchhalten, und dafür war es nötig, einen kühlen Kopf zu bewahren. Hađuwīħ wischte eine Träne aus dem Augenwinkel, drückte ihr Kreuz durch und trat entschlossen aus der niedrigen Tür, Hruođolf, dem Herrn des Nachbarhofes, entgegen.
Der grüßte knapp und sprang vom Pferd. Die Zügel warf er lässig einem seiner Knechte zu. Es war derselbe, der vor wenigen Tagen den völlig verstörten Ulfberht von seiner ersten Reise nach Moguntia zurückgebracht hatte. »Wir müssen reden«, rief der Hofherr anstelle einer Begrüßung, es klang wie eine Drohung.
»Komm herein und nimm einen Schluck Met«, lud sie ihn ein. Sie legte so viel Freundlichkeit in ihre Stimme, wie sie vermochte, doch Hruođolf ging nicht darauf ein.
»Meine Knechte haben dir den ganzen Sommer über geholfen und auch Saatgut von meinem Korn genommen. Wie willst du diese Schuld nun begleichen?«, fragte er barsch. »Wenn dein Mann noch lebte, hätte ich auf sein Wort bauen können. Aber ohne Mann auf dem Hof …?« Er ließ den Satz in der Luft hängen.
Hađuwīħ senkte den Blick, damit niemand ihre Tränen sehen konnte. Sie war verzweifelt. Und dabei konnte sie dem gierigen Nachbarn eigentlich nichts vorwerfen. Wie könnte er ihr vertrauen? Wie sollte sie als Witwe ganz ohne Hilfe den Hof führen oder gar die Schuld zurückzahlen?
»Ulfberht wird dir dienen, bis die Schuld abgetragen ist«, erklärte sie und versuchte, ihrer Stimme einen festen Klang zu geben. Das hatte sie eigentlich verhindern wollen. Es war das maximale Zugeständnis, das sie machen konnte. Mehr hatte sie nicht.
Doch Hruođolf schüttelte den Kopf. »Das geht nicht. Er ist nur ein Junge und kann kaum für sein eigenes Essen arbeiten. Und dann hast du niemanden, der sich um deinen Hof kümmern kann. Dagaberht ist zu jung.« Er blickte herum, als suche er nach ihrem zweiten Sohn.
»Das ist nicht deine Sorge«, erwiderte Hađuwīħ mit gesenktem Blick.
»Behalte deinen Jungen bei dir, und übergib den Hof in meine Obhut. Ihr könnt unter meinem Schutz dort weiterhin wohnen«, schlug Hruođolf in einem väterlichen Ton vor, doch seine Augen blitzten vor Gier.
»Unsere Freiheit aufgeben?«, brauste Hađuwīħ auf. »Die Sigiberht mit seinem Leben verteidigt hat? Ich mag zwar nur ein Weib sein, aber eher werde ich verhungern, als alles aufzugeben, wofür mein Mann gestorben ist.«
Hruođolf blickte sie eine ganze Weile finster an. Doch Hađuwīħ blieb stumm, und so sog der reiche Hofherr schließlich scharf die Luft ein. »Also gehört der Junge mir«, schloss er, und seine Stimme ließ nichts Gutes erahnen. »Morgen bei Sonnenaufgang erwarte ich ihn drüben auf meinem Hof. Und erklär ihm, dass er nun zu tun hat, was ich ihm sage. Es ist besser für ihn, wenn er das von Anfang an beherzigt!«
Ulfberht, Hruođolfshof, Weinmonat 792
Ein Schatten fiel auf Ulfberht. Er sah sich um. Edolf stand vor ihm und versperrte den Weg zurück auf den Hof. Edolf war Hruođolfs zweiter Sohn, und er hatte sich Ulfberht gegenüber keineswegs freundlicher gezeigt als sein älterer Bruder Radolf. Gehetzt blickte Ulfberht um sich. Er befand sich in einer der Gerätekammern, und außer Edolf war kein Mensch zu sehen. Radolf, der ältere der Brüder, hatte ihn schon auf dem Rückweg von Moguntia bei jeder Gelegenheit gequält und erniedrigt, konnte ihn diese Familie nicht einfach in Ruhe lassen?
»Du hast meinen Bruder und damit meine ganze Familie vor dem Grafen bloßgestellt, du unverschämter Bauernbengel«, fauchte Edolf, das Gesicht nun ganz nah vor Ulfberhts. »Aber nun bist du nicht mal mehr ein unverschämter Bauernbengel, du bist ein Unfreier. Ein Knecht meines Vaters!«
»Bin ich nicht, ich arbeite nur unsere Schuld bei ihm ab … « Ulfberht war den Tränen nahe.
»Die Schuld abarbeiten?«, lachte Edolf. »Das wird dir deinen Lebtag nicht gelingen, und euer mickriger Hof fällt uns auch so in den Schoß. Und auch deine hübsche Schwester!« Er machte mit dem Mund eine Geste, als wolle er ein Weib küssen.
Ulfberht konnte die Tränen nicht zurückhalten, während er innerlich vor Wut kochte. »Du gemeiner Hund«, heulte er.
»Och, jetzt weint er«, spottete Edolf.
Mit einem Schrei sprang Ulfberht Edolf an die Gurgel. Der war für einen Moment so überrascht, dass es Ulfberht gelang, seinen älteren Kontrahenten umzuwerfen, doch dann bekam Edolf Ulfberht seinerseits zu packen und drückte ihn zu Boden.
»Du kleiner, mieser Dreckskerl, das wirst du mir büßen«, zischte er. Laut schrie er: »Zeter und Mordio!« – den Warnruf, mit dem ein unschuldig Angegriffener alle Freien und Hörigen zur Hilfeleistung verpflichtete. Dann schlug er Ulfberht mit der Faust so fest vors Kinn, dass diesem schwarz vor Augen wurde.
Als Ulfberht wieder zu sich kam, lag er am Boden. Um ihn herum standen außer Edolf noch Radolf und mehrere Knechte sowie Hruođolf, der Hofherr, selbst. Vater und Söhne blickten finster auf ihn herab, während die meisten Knechte verlegen wegsahen, wenn sie seinem Blick begegneten. Seinen Vater hatten sie nicht besonders gemocht, wusste Ulfberht, er hatte sich zu viel auf seine Freiheit eingebildet. Aber Hruođolf war ebenfalls kein beliebter Herr.
»Ein Zwölfjähriger hat dich angegriffen«, hörte Ulfberht plötzlich eine bekannte Stimme. Es war Điodabalþ, der über seinem Kopf stand und beschwichtigend auf Edolf einredete. Ulfberht blickte dankbar zu ihm hinauf. Der fromme Knecht hatte ihn schon auf dem Rückweg von Moguntia vor dem Zorn Radolfs zu bewahren gesucht, wenn auch mit wenig Erfolg.
»Er ist bald alt genug für den Heerbann!«, zeterte Edolf.
»Das war ein Angriff auf Leib und Leben seines Herrn!«, pflichtete ihm sein Bruder bei.
Auch ihr Vater blickte sehr ernst. »Ich habe deine Mutter gewarnt«, grollte er an Ulfberht gewandt. »Und außerdem brauche ich weder dein hungriges Maul noch sonst etwas von dir hier auf dem Hof.« Er fuhr sich mit der Rechten durch den Bart, während Ulfberht ihn angstvoll anstarrte.
Er hatte keine Vorstellung, was er von dem hartherzigen Edeling erwarten sollte. Auch schämte er sich ob seiner Hilflosigkeit und Tränen. Der gesamte Haushalt kam, vom Geschrei angelockt, zusammengelaufen, darunter auch mehrere Mägde und Radolfs junge Schwester. Betreten senkte Ulfberht den Blick.
Plötzlich räusperte Hruođolf sich. Ein freudloses Lächeln erschien auf seinen Lippen. »Ich zahle mit ihm einen Teil meiner Schuld beim Abt von Lauresham. Die brauchen immer Knechte bei den Köhlern im Wald.« Ulfberht wusste mit den Worten nichts anzufangen, nur, dass er wohl noch weiter von zuhause weggebracht würde.
Doch Điodabalþ erbleichte. »Aber, aber«, stammelte er. »Das ist ein unehrlicher Beruf, etwas für Halbfreie und Hörige. Und Ulfberht ist und bleibt ein freigeborener Franke …«
»Willst du mit ihm gehen, weil du selbst ein Höriger bist?«, fragte Hruođolf barsch. »Außerdem ist er jetzt kein Freier mehr, sondern mein Eigentum!«
Nun stockte auch Ulfberht der Atem, so jung er war, wusste er doch, dass das nicht rechtens war. »Ich bin kein Höriger … «, brachte er heraus, doch da traf ihn eine schallende Ohrfeige.
»Noch bist du mein Eigentum. Wenn auch bald ein dreckiger Kohlknecht irgendwo tief im Wald, von Gott und den Menschen vergessen!«, rief Hruođolf und funkelte ihn böse an.
»Vater«, mischte sich da die junge Hludahilt, seine Tochter, ein. Ulfberht hatte sie bisher nur bei den Mahlzeiten aus der Ferne gesehen, aber ein warmes Gefühl der Dankbarkeit durchströmte ihn.
»Du auch?«, begehrte der Hofherr auf. »Das besiegelt sein Geschick erst recht. Schafft ihn aus meinen Augen, und morgen geht er nach Lauresham!«
Ulfberht schmeckte Blut im Mund. Wut und Hilflosigkeit schwappten über ihm zusammen, und gegen seinen verzweifelten Willen brach er wieder in Tränen aus. Zwei Knechte packten ihn und schleppten ihn zu dem neuen Schafspferch.
»Da haben wir endlich eine vernünftige Anwendung für das blöde Ding!«, beschied Hruođolf. Er war mit dem unlängst erlassenen Befehl König Karls, der jeden Herrenhof verpflichtete, zur Vermehrung der Wollproduktion im Frankenreich eine Schafherde zu halten, nie einverstanden gewesen. »Der Pferch ist stabil genug, damit uns der Kerl nicht ausbüxt, und leer steht er auch.« Die eigentlichen Bewohner befanden sich wegen der noch milden Witterung auf der Weide.
Erst spät am Abend bekam Ulfberht nochmals Besuch, jedoch nicht, um ihm sein Abendessen zu bringen, wie er vermutete. Edolf stand in der Tür und hinter ihm sein Bruder Radolf. »So Bursche, jetzt wollen wir mal sehen, wer der Stärkere ist«, prahlte der ältere Junge und trat dem überraschten Ulfberht in den Bauch. Ulfberht brach zusammen. Edolf nutzte das, um ihm weitere gezielte Tritte zu versetzen. Vor Schmerz und Zorn ballte Ulfberht die Fäuste, doch da packte ihn Radolf und hielt ihm die Arme fest. »Du willst doch nicht noch einmal deinen Herren schlagen?«, fragte er mit einem gemeinen Grinsen.
Hludahilt, Hruođolfshof, Weinmonat 792
Hludahilt standen die Tränen in den Augen, als ihr Vater dem Jungen vom Nachbarhof die Lippen blutig schlug. Sie kannte diese harte Hand, hatte sie am eigenen Leib erfahren und Vaters Fluchen verhieß auch ihr nichts Gutes. Radolf und Edolf, ihre älteren Brüder, standen selbstgefällig grinsend dabei. Oh, wie ungerecht war die Welt! Ungerecht gegen die Armen wie den Jungen Ulfberht, dessen Namen sie erst am Vortag erfahren hatte, obwohl sie schon immer Nachbarn gewesen waren. Doch der gestrenge Vater ließ sie nicht vom Hof und schon gar nicht zu den armen Nachbarn. Denn ungerecht war die Welt auch gegen Frauen und Mädchen. Ihr selbst ging es kaum besser als einer der Mägde auf dem Hof. Während ihre groben Brüder sich alles erlauben konnten, wurde sie für jedes noch so kleine Vergehen hart bestraft. Hludahilt hatte gelernt, ihr Mitgefühl nicht offen zu zeigen – was sie dazu bewegt hatte, für den armen Jungen Partei zu ergreifen, verstand sie selber kaum.
»Dem habe ich es aber gegeben«, prahlte Edolf am Abend vor seinem älteren Bruder. Hludahilt hörte es, während sie den beiden ihre heiße Grütze vorsetzte.
»Nur, dass der Kleine stärker war als du und Vater dir helfen musste!«, stichelte sie. Es war heraus, bevor sie nachdenken konnte. Sie biss sich auf die Lippe. Doch zu ihrem Erstaunen brauste Edolf nicht auf oder schlug nach ihr, sondern blickte sie nur hasserfüllt an. Der ältere Bruder beobachtete die Szene grinsend. Hludahilt fasste ihren Topf fester und lief rasch zurück zum Herd. Der Blick des gedemütigten Bruders brannte ihr im Nacken, während Radolf leise zu kichern begann. Ein kleiner Triumph, den sie sicherlich teuer bezahlen müsste. Doch irgendwie gelang es ihr, an dem Abend auch dem Vater zu entgehen, und so war der junge Ulfberht der Einzige, der in dieser Nacht Schläge bezog.
Doch mitten in der Nacht erwachte Hludahilt schweißgebadet und mit der Erkenntnis, dass der junge Ulfberht Prügel hatte einstecken müssen, die eigentlich ihr zugedacht war. Eine Träne lief ihr die Wange hinab, und an Schlaf war nicht mehr zu denken. Vielleicht sollte sie den Jungen besuchen? Unruhig wälzte sie sich im Dunkeln hin und her. Sie würde am Ende noch Haltrud wecken, die einen Winter ältere Magd, mit der sie die schmale Schlafbank in der hinteren Ecke der Stube teilte. Entschlossen schob sie die alte Wolldecke zur Seite, die sie ebenfalls mit der Magd teilte, und stand auf. Sie kannte hier jeden Fußbreit und wusste auch, dass die Seitentür, welche direkt von der Wohnstube auf den Hof führte, unheimlich laut knarrte. Daher schlug sie den Weg zur schmalen Diele zwischen den Ställen ein. Sie wusste, dass das Hoftor am Ende bedeutend größer und schwerer war als die Tür der Wohnstube, doch es drehte sich für gewöhnlich geräuschlos in der Angel. Plötzlich stieß ihr Fuß gegen etwas. Scheppernd rutschten Spindel und Wirtel, die eine der Mägde am Abend hatte liegen lassen, über den Boden. Zum ersten Mal in ihrem Leben konnte Hludahilt aus vollem Herzen nachvollziehen, wieso ihre Mutter immer so streng auf Ordnung im Haus bedacht gewesen war. Sie verharrte atemlos und lauschte. Jemand grunzte und drehte sich im Schlaf. Doch dann war wieder alles still, so still, wie es in einem Haus voller Bewohner werden konnte. Es schnarchte und schnaufte, aber zum Glück hatte keiner der Hunde angeschlagen. Sie kannten und liebten Hludahilt ohnehin alle. Langsam schlich sie weiter und erreichte ohne nochmalige Unterbrechung die Tür. Leise schob sie den Riegel zurück und drückte sich nach draußen. Auch dort war alles still, von den üblichen Geräuschen der Nacht und des schlafenden Hofes abgesehen. Sie hielt sich unter den überhängenden Strohdächern, wo nicht einmal das schwache Licht der Sterne hingelangte, und erreichte bald den Schafspferch. Sie würde den Jungen einfach in die Freiheit entlassen. Warum sollte sie ihm auch nicht zur Flucht verhelfen? Immerhin hatte er einen ihrer verhassten Brüder geschlagen und gedemütigt! Vorsichtig tastete sie nach dem hölzernen Riegel, der die Tür verschloss. Doch plötzlich legte sich eine eisenharte Hand um ihren schlanken Arm. Hludahilt erstarrte. Man hatte sie erwischt. Voll panischer Angst blickte sie sich um. Bei der herrschenden Dunkelheit brauchte sie einen Augenblick, bis sie erkannte, wer sie ertappt hatte: Điodabalþ.
»Au, du tust mir weh«, protestierte sie schwach. Doch der Knecht ging gar nicht darauf ein.
»Was glaubst du, was du da gerade tust?«, zischte er sie scharf an.
»Der Junge ist unschuldig«, erwiderte sie trotzig. Ihr eigener Mut erstaunte sie mehr als den Knecht, der ungerührt ihrem Blick standhielt.
»Ich verstehe dich. Glaube nicht, dass ich diese Ungerechtigkeit nicht auch empfinde. Aber du tust dem Jungen keinen Dienst, wenn du ihm jetzt zur Flucht verhilfst. Dann ist er ein entlaufener Knecht, und wenn ihn Hruođolfs Hunde nicht erwischen, ist er vogelfrei und friedlos. Sein Vater ist in Sachsen erschlagen worden, und er hat keinen einzigen freien Mann, der als Eideshelfer seine Unschuld beschwören könnte. Glaub mir, im Kloster bekommt er wenigstens etwas zu essen und ein Dach über dem Kopf. Nimm ihm nicht auch das noch!«
Nun stiegen Hludahilt heiße Tränen in die Augen. »Aber das ist alles so ungerecht«, schluchzte sie, während Điodabalþ sie von dem Pferch fortzog.
»Das Einzige, was du für ihn tun kannst, ist zu unserem Herrn und seiner gebenedeiten Mutter zu beten«, erklärte der alte Knecht sanft.
Ulfberht, Hruođolfshof, Weinmonat 792
Am Folgetag trat Ulfberht zusammen mit Knechten und einem Ochsenkarren voll Getreide und anderer Güter, die für das Kloster bestimmt waren, den Weg nach Lauresham an. Da Ulfberht nun nicht mehr zum Haushalt gehörte, hatte Hruođolf den Mägden befohlen, ihm auch die Morgensuppe zu verweigern. »Warum sollte ich einen Knecht des Abtes füttern?«, fragte er scheinheilig.
Hungrig und matt vom vielen Weinen stolperte Ulfberht auf der schlechten Straße dahin.
»Reiß dich zusammen, was soll dein neuer Herr, der heilige Abt, von dir denken!«, raunzte ihn der jüngere der beiden Knechte an, doch der ältere, ein Mann mit ergrautem Bart wie Điodabalþ, hatte offenbar Mitleid.
Er packte Ulfberht kurzerhand und setzte ihn auf den Karren mit dem Getreide und den übrigen Gütern, die sie zum Kloster fuhren. »Hier, nimm einen Kanten Brot und versuch, dich zu fassen. In diesem Zustand schickt dich der Abt bestimmt direkt in den Wald!«
Ulfberht schluckte. Obwohl der Brandthof am Waldrand lag und sein Vater die Felder teils noch selbst dem Wald abgerungen hatte, fürchtete er sich vor der dunklen Welt, die sich zwischen den alten Stämmen scheinbar endlos ausbreitete. Wölfe, Bären und auch Geister tummelten sich dort, wo die rauschenden Wipfel das Sonnenlicht nur spärlich einließen. Nur wenige Menschen wagten sich in den Wald. Schweinehirten bei der Eichelmast, Jäger, ja, und die unehrlichen Leute. Geächtete, Räuber und dergleichen gottloses Gesindel. Bereits gegen Mittag erblickte Ulfberht die hohe Kirche von Lauresham, der lichte Bau erschien ihm wie ein Bollwerk gegen das Dunkel des Waldes. Vielleicht ließ der Abt Gnade walten und ihn im Kloster bleiben?
Am Tor grüßte sie wieder der helle Klang der Steinbeile. Überall lagen Steine und Holz herum. Der Klostervorplatz glich einer Baustelle. Menschen liefen geschäftig dazwischen umher. Für einen Moment bescherte der Anblick Ulfberht Ablenkung. Fasziniert sah er, wie der harte Stein unter den Schlägen der blitzenden Beile in kleinen Brocken davonstob. Das war die Macht des Eisens! Er musste an Vaters Pflug denken. Doch der Vater war tot und der Brandthof weit weg. Er war ein Knecht in der Fremde. Wieder stiegen ihm heiße Tränen in die Augen.
»Jetzt fang nicht wieder an, zu flennen, sondern hilf gefälligst den Wagen abladen«, riss ihn die raue Stimme des jüngeren Knechtes aus den Gedanken.
»Lass ihn schon in Ruhe, den hat es hart genug erwischt«, brummte sein älterer Begleiter.
»Er hat sich den ganzen Weg hierherziehen lassen, nun soll er ruhig etwas tun dafür«, brummte der Jüngere, doch die Schärfe war aus seiner Stimme gewichen.
Ulfberht hatte aber verstanden. Er stieg vom Wagen und packte mit an, so gut er konnte.
»Das ist der Zehnt von Hruođolf?«, fragte ein älterer Mann in dem Habit eines Mönchs. »Lass sehen!« Murmelnd trat er an den Wagen heran und ritzte mit einem Griffel Symbole in ein kleines Wachstäfelchen. »Scheint zu stimmen«, nickte er und gab einem der Klosterknechte einen Wink. »Helft dem Burschen das Zeug in die erste Scheune zu bringen. Dort wird alles gewogen und eingetragen.« Dann wandte er sich wieder Hruođolfs Knechten zu. »An seine Sonderschuld denkt Hruođolf aber auch noch? Ich muss euch gewiss nicht an die Buße erinnern, die Abt Richbod ihm auferlegt hat?«
Der ältere Knecht seufzte. »Hruođolf schickt Euch den Jungen hier als Zahlung«. Dabei packte er Ulfberht an der Schulter und schob ihn nach vorn. »Er wird für die Schuld arbeiten, wenn es dem ehrwürdigen Abt recht ist.«
Der Verwalter sah ihn prüfend an. »Wie alt bist du, Junge?«, fragte er.
Ulfberht schluckte. »Zwölf Jahre …«
»Das heißt zwölf Jahre, Herr!«, fuhr ihn der Verwalter an.
Ulfberht schluckte wieder. »Ich bin kein Knecht …« Eine neuerliche Ohrfeige traf ihn.
»Du bist jetzt der Knecht des Abtes, und du wirst mich und alle anderen Mönche Herr nennen!«, rief er erbost. »War er schon immer so frech?«, wandte er sich an den älteren von Hruođolfs Knechten.
»Er gehörte bisher nicht zu unserem Hof. Seine Mutter gab ihn als Zahlung einer Schuld an Hruođolf, aber der hatte keine Verwendung für ihn … «
»Also so ehrt Hruođolf unseren ehrwürdigen Abt und den Heiligen Nazarius, den Beschützer unseres Klosters, indem er mit einem Jungen, für den er keine Verwendung hat, seine Schuld begleichen will?«, unterbrach ihn der Verwalter scharf. »Ich nehme ihn, denn wer weiß, wann es Herrn Hruođolf gefällt, sonst zu zahlen, aber die Schuld ist damit nur zur Hälfte getilgt und das auch nur, wenn der Junge nicht krank wird oder sonst wie unfähig ist!« Wieder wandte er sich um. »Hilbert, nimm den Jungen und bring ihn in die Knechtsküche, er soll etwas zu essen bekommen, und dann bring ihn zum Aufseher der Schmiede, der mag entscheiden, wozu er zu gebrauchen ist.«
Ein Knecht sprang herbei und ergriff Ulfberht an der Schulter. »Komm mit«, befahl er kurz.
Ulfberht, der sich immer noch von der Ohrfeige erholte, folgte ihm willenlos. Sie gingen rechts an der Kirche vorbei und auf eine Ansammlung von Gebäuden zu. Der junge Mann führte ihn durch eines der Gebäude hindurch. »Das alles gehört zum Kloster?«, stieß Ulfberht staunend hervor, als sie dahinter eine weitere Reihe ebenso großer Häuser erblickten.
»Ja, das ist der Wirtschaftshof. Das eigentliche Kloster beginnt hinter der zweiten Mauer dort«, erklärte der Knecht. »Lauresham ist das wichtigste Kloster in der ganzen Region und untersteht als Reichskloster nur dem König! Der heilige Nazarius ist hier bei uns im Kloster, der Heilige Papst Paul hat seine Gebeine dem ehrwürdigen Abt Chrodegang, dem Gründer unseres Klosters, geschenkt. Du hast sicher auch gesehen, dass wir ihm zu Ehren vor der Kirche eine neue Kapelle errichten?«, fuhr er stolz fort. »Doch wir sind da.« Er führte Ulfberht zu einer Tür, aus der ihm ein wunderbarer Duft in die Nase stieg. »He, Lotbert«, rief der Junge mit breitem Grinsen nach drinnen. »Du sollst dem Wicht hier etwas zu essen geben! Und wenn du gerade etwas übrig hast … «
Ein dicker Mann mit Leinenschürze und nackten Unterarmen kam durch die Dampfschwaden auf sie zu. »So, will der werte Verwalter das?«, fragte er drohend, doch als er in Ulfberhts vom Weinen noch immer rote Augen blickte, nahm sein Gesicht einen mitleidigen Ausdruck an. »Das ist ja noch ein Kind und fast verhungert!«, rief er. »Komm mit, und setz dich da hinten hin. Etwas Linsensuppe werde ich wohl auftreiben können, und hier, nimm das Brot.« Dann erst streifte sein Blick den Boten, und er konnte sich ein Grinsen nicht verwehren. »Und vielleicht haben wir auch einen zweiten Teller Linsensuppe für einen unnützen Knecht, der seine Aufgabe getan hat.« Ulfberht stopfte alles hastig in sich hinein. »Du hast aber einen Hunger«, kommentierte der Koch, der bei seinen Gästen stehen geblieben war.
»Ich habe seit gestern Morgen nichts gegessen, als ich den Brandthof verließ … «
»Den Brandthof?«, fragte sein Begleiter mit vollem Mund.
»Ich dachte, du kommst von Hruođolf?«
»Hruođolf hat mich hergeschickt, weil ich diesen Sommer bei ihm arbeiten soll, um Mutters Schulden abzubezahlen«, antwortete Ulfberht, und ob des erfahrenen Unrechts stiegen ihm erneut die Tränen auf.
»Is’ ja gut, mal ganz langsam«, beschwichtigte der dicke Koch. »Alles der Reihe nach. Deine Mutter hat dich zum Arbeiten zu Hruođolf geschickt, und der hat dich weiter in die Abtei gesandt, da er selber Schulden hat, ja?« Ulfberht nickte schniefend. »Und anscheinend hat er dir den letzten Tag nichts zu essen gegeben, so wie du die Suppe runterschlingst.« Wieder nickte Ulfberht. »Ein Schweinehund ist das«, brummte der korpulente Mann. »Weißt du, warum er dem Abt etwas schuldet? Als Wehrgeld für einen seiner Knechte, den er erschlug, weil er eine unserer Kühe zurückforderte, die auf Hruođolfs Land entlaufen war.«
Hludahilt, Hruođolfshof, Weinmonat 792
Die Tage nachdem der Vater den Jungen vom Nachbarhof an das Kloster verkauft hatte, waren für Hludahilt eine einzige Seelenqual. Sie hatte es, wie von Điodabalþ vorgeschlagen, mit Beten versucht, aber die gewohnte Ruhe und Andacht stellten sich nicht ein. Sie war viel zu aufgewühlt, was sie selbst wunderte. Schließlich war sie über die Jahre Zeugin und auch Opfer so mancher Grausamkeit geworden, doch irgendwie rührte das Schicksal des Jungen ihr Herz. »Wie konnte Vater so etwas tun? Der Junge hat nichts getan und niemanden, der zu ihm hält. Sein eigener Vater wurde von den wilden Sachsen erschlagen … «, klagte sie Haltrud, der Magd, mit der sie das Lager teilte.
Die junge Magd klatschte die klamme Wäsche ungerührt gegen einen flachen Stein. »Das Leben ist ungerecht, Hludahilt«, antwortete sie kühl. »Wir müssen hier schuften, während die Männer, also dein Vater und seine Söhne, jagen, sich balgen und trinken. Ich bin eine Magd, magst du einwenden und das zu Recht. Die hörigen Männer haben auch ihre Lasten zu tragen. Aber du bist frei geboren und teilst dir doch mit mir dieselbe Arbeit. Überhaupt geht es uns Frauen, seit deine Mutter verstorben ist, noch schlechter als zuvor. Der Junge hat es jedenfalls besser als wir beide zusammen.« Wieder schlug sie die Wäsche heftig gegen den Stein.
Hludahilt, von der Heftigkeit des Ausbruchs ihrer Kameradin überrascht, schwieg nachdenklich. »Aber du bist doch hübsch, hast tolles Haar und schöne weiße Zähne«, wandte sie ein. »Du findest bestimmt einen Mann, der dich heiratet. Dann kannst du Kinder gebären und großziehen.«
Haltrud lächelte kurz über das Kompliment. »Vielleicht hast du recht, und eines Tages holen uns zwei Prinzen von hier weg und heiraten uns«, stimmte sie lachend zu. »Aber nur wenn wir saubere Kleider tragen, also vergiss deine Träumereien und hilf mir mit der Wäsche … «
Ulfberht, Lauresham, Weinmonat 792
»Das ist die Schmiede«, erklärte Ulfberhts junger Führer und zeigte auf ein großes, einzeln stehendes Gebäude, dessen Dach, im Unterschied zu den meisten anderen Gebäuden, nicht mit Reet, sondern mit Holzschindeln gedeckt war. Ulfberht hatte sich immer gewünscht, einen jener geheimnisvollen Orte zu sehen, an dem man das Eisen in seine Form zwang. Viele Söhne von Freien und sogar Edlen begehrten das Handwerk zu erlernen, wie einst der junge Siegfried. Vielleicht meinte es Gott im Himmel am Ende doch gut mit ihm? »Gleich lernst du Gernod kennen«, unterbrach Hilprik seine Träumereien. »Aber wir nennen ihn insgeheim alle Wieland«, kicherte er.
»Warum denn das?«, fragte Ulfberht.