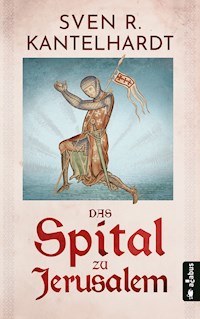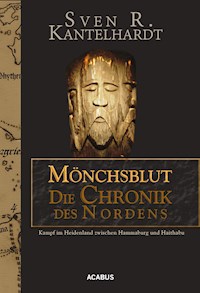Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Acabus Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
1564: Der Türkensturm, eine geheimnisvolle Seuche und weitere Katastrophen treiben vier junge Menschen durch das Europa der Renaissance. Malteserritter Arthur überlebt nur knapp den Ansturm der Türken auf die Insel des Ordens. Nun wagt er eine gefährliche Mission ins Herz des Osmanischen Reiches, während sein eigener Bruder, ein Protestant in Frankreich, ihm den Krieg erklärt. Die junge Elisabeth verliert ihre Mutter und den Zwillingsbruder Franz an eine Seuche. Sie schlüpft in seine Rolle als Corporal und verliebt sich in den Prinzen, der sie für ihren Bruder hält. Schmiedegeselle Peter muss fliehen und findet Zuflucht bei Protestanten in Graz. Als er sich in seinem ersten Einsatz in Ungarn beweisen will, gerät er in die Gefangenschaft der Türken, die ihm große Ehre versprechen, wenn er zum Islam konvertiert. Glaubenskriege, Spionage, Diplomatie und Intrigen: Wie in einer Shakespeare'schen Komödie lösen sich Irrungen und Wirrungen erst, als sich die jungen Leute schließlich im dritten Hugenottenkrieg gegenüberstehen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 538
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Ähnliche
Sven Kantelhardt
Halbmond und Hugenottenkreuz
Inhalt
Impressum
Widmung
Vorwort
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Kapitel 62
Kapitel 63
Kapitel 64
Kapitel 65
Kapitel 66
Kapitel 67
Kapitel 68
Kapitel 69
Kapitel 70
Kapitel 71
Kapitel 72
Kapitel 73
Kapitel 74
Kapitel 75
Kapitel 76
Kapitel 77
Kapitel 78
Kapitel 79
Kapitel 80
Kapitel 81
Kapitel 82
Kapitel 83
Kapitel 84
Kapitel 85
Kapitel 86
Kapitel 87
Kapitel 88
Kapitel 89
Historische Anmerkung
Personenverzeichnis
Author
Impressum
Kantelhardt, Sven: Halbmond und Hugenottenkreuz
Hamburg, acabus Verlag 2024
1. Auflage 2024
ISBN 978-3-86282-866-1
Dieses Buch ist auch als eBook erhältlich und kann über den Handel oder den Verlag bezogen werden.
ePub-eBook: 978-3-86282-867-8
Lektorat: Amandara M. Schulzke, acabus Verlag
Korrektorat: Astrid Standtke, Lanke
Umschlaggestaltung, Buchsatz & Innengestaltung: Phantasmal Image
Landkarten: public domain
Der Verlag behält sich das Text- and Data-Mining nach § 44b UrhG vor, was hiermit Dritten ohne Zustimmung des Verlages untersagt ist.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.de abrufbar.
Der acabus Verlag ist ein Imprint der Bedey & Thoms Media GmbH, Hermannstal 119k, 22119 Hamburg und Mitglied der Verlags-WG:
(www.verlags-wg.de), acabus Verlag (bedey-thoms.de)
©acabus Verlag, Hamburg 2024
Gedruckt in Deutschland
Widmung
GewidmetmeinenhugenottischenFreundenvom JohanniterordenunddenLionsfreunden in Hochheim-Flörsheim und Charenton
Dédiéàmesamishuguenotsdel‘OrdredeSaint-JeanetauxamisLionsdeHochheim- Flörsheim et Charenton
Vorwort
Der Roman spielt in einer Zeit als vieles, was unser heutiges Europa prägt, Gestalt annahm. Die Nationalstaaten etablierten sich und die Reformation führte letztendlich zur allgemeinen Religions- und Glaubensfreiheit.
Die Trennung des Mittelmeeres zwischen einem nördlichen europäischen und einem südlichen und östlichen morgenländischen Ufer spiegelt die damaligen Machtverhältnisse wider. Der große Spieler im Osten war das Osmanische Reich, dessen Herrschaftsgebiet sich vom Balkan über die Türkei, die Levante und Arabien, die nordafrikanische Küste entlang bis zum Atlantik erstreckte. Auf der anderen Seite die europäischen Staaten mit Spanien und dem, ebenfalls von der Familie der Habsburger dominierten, Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation als Führungsmacht. Ein Reich, in dem, wie Karl V. es formulierte, die Sonne nicht untergeht; denn mit der Entdeckung und Inbesitznahme großer Gebiete in Mittel- und Südamerika gewann Spanien ein weltumspannendes Kolonialreich.
Gegen die Umklammerung der Habsburger versucht sich Frankreich zur Wehr zu setzen, während in den italienischen Kleinstaaten die Renaissance – die Wiedergeburt der antiken Kultur – erblüht. Im Norden bricht sich der neue protestantische Glaube Bahn. England unterstützt die um Unabhängigkeit ringenden Niederlande. Sowohl in Frankreich als auch in Deutschland droht ein Bürgerkrieg zwischen protestantischen Fürsten und dem König. Die Protestanten in Frankreich nannten und nennen sich Hugenotten.
All diese Konflikte fokussieren sich im Jahre 1565 auf Malta, als Sultan Suleiman versuchte, die strategisch günstig in der Meerenge zwischen Sizilien und Nordafrika gelegene und damit die Verbindung vom östlichen ins westliche Mittelmeer kontrollierende Insel unter seine Kontrolle zu bringen. Auf diesem kargen Felseneiland hat Karl V. dem heimatlosen Johanniterorden eine neue Bleibe gegeben.
Der Orden ging ursprünglich aus einer Hospitalgemeinschaft hervor, die bereits vor dem ersten Kreuzzug in Jerusalem existierte - siehe dazu auch meinen letzten Roman Das Spital zu Jerusalem. Er überlebte nacheinander die Vertreibung aus Jerusalem, Akko und Rhodos.
Träger des Ordens waren Ritter aus ganz Europa, die sich in acht Landmannschaften oder Zungen gliederten. Sie folgten dem Aufruf zum Kampf für den Glauben und zur Pflege von Kranken in dem Hospital des Ordens. Es war eine Verpflichtung auf Lebenszeit und sie schloss Enthaltsamkeit und Gehorsam ein. Auch dieser Orden, bzw. seine Nachfolgeorganisationen, existieren heute noch. Die Johanniter- und Malteser-Hilfsdienste sind den Meisten bekannt. Sie sind die modernen Träger der hospitalischen Arbeit des Ordens, der sich inzwischen in einen evangelischen Johanniter und katholischen Malteser genannten Zweig geteilt hat. Diese Teilung vollzog sich bei der Neu- bzw. Wiedergründung nach den napoleonischen Kriegen im 19. Jahrhundert. Die Wurzeln reichen ebenfalls zurück in die Zeit des Romans. Sie ging von der im Roman erwähnten Balley Brandenburg aus, deren Träger mit ihrem Landesfürsten zum evangelischen Glauben übertraten.
Mein besonderes Interesse an diesem Orden begründet sich - mancher mag es ahnen – darin, dass ich dem evangelischen Zweig, den Johannitern, angehöre.
Die im Roman beschriebenen geschichtlichen Hintergründe entsprechen, soweit es mir möglich war, diese zu ergründen, den historischen Tatsachen. Die vier handelnden Personen sind fiktive Charaktere, ein Personenverzeichnis am Ende des Romans gibt Auskunft darüber, welche Personen historisch belegt sind.
Zum Schluss möchte ich noch danken: zuerst meiner Lektorin Amandara Schulzke, die nicht nur durch das unermüdliche Ausmerzen von Grammatik- und Rechtschreibfehlern, sondern auch durch zahlreiche inhaltliche Anmerkungen und Vorschläge ganz entscheidend zur Lesbarkeit und hoffentlich auch dem Gefallen des Romans beigetragen hat. Weiterhin danke ich Enrico Frehse für die Gestaltung des Covers und den Buchsatz, Astrid Standtke für das Korrektorat und Björn Bedey, Heike Görtz und dem gesamten Team vom acabus Verlag für die langjährige Zusammenarbeit bei meinen inzwischen sechs historischen Romanen.
Sven Kantelhardt
Berlin im Oktober 2024
Kapitel 1
Arthur, Dodekanes, Sommer 1564
Das Signal«, rief Arthur, ein hochgewachsener junger Ritter, Zweitgeborener eines niederen Adligen aus der Gegend von Sancerre im Osten Frankreichs. Seine blauen Augen blitzten, als er aufgeregt hinüber zur Spitze des felsigen Eilandes zeigte.
»Sieh nach was es gibt und mach Meldung!«, befahl de Calais, der Kapitän der Johanniter- Galeere. Arthur salutierte knapp und rief Ansaldo, den Comite oder Bootsmann der Santa Margareta. Wenige Augenblicke später schoss die Pinasse, gerudert von vier kräftigen Maltesern, über das stille Wasser. Tief atmete Arthur die reine Seeluft, als sie den Gestank der Galeere mit ihren hunderten ungewaschener Rudersklaven und deren in der Bilge modernden Exkrementen hinter sich ließen. Am Ufer sprang er mit seinen Stiefeln ins flache Wasser und watete an Land. Er verzog das Gesicht zu einem humorlosen Grinsen, als unter seinen dicken Ledersohlen Seeigel barsten. Noch gut erinnerte er sich, der weit entfernt vom Meer auf der Burg seines Vaters auf dem Lande aufgewachsen war, an seine erste Begegnung mit dem hinterhältigen Getier. Die Stacheln waren über Wochen aus seiner Fußsohle herausgeeitert.
Rasch erklomm er die hellen Kalkfelsen und erreichte schwer atmend den Posten, der mit einer Blendlaterne das Signal gegeben hatte.
»Was gibt es?«, fragte er Juan, einen gebürtigen Katalanen. Der hob zum Gruß die Hand an die Kappe.
»Dort, Herr«, er wies mit dem Kinn nach Südosten. Als Ritter des St. Johannis-Ordens war Arthur trotz seiner jungen Jahre dem erfahrenen Seemann vorgesetzt. Er blickte in die angegebene Richtung und strich sich eine Strähne seiner halblangen, dunkelbraunen Haare aus den Augen. Zwei oder drei Segel hoben sich, von der bereits sinkenden Sonne beschienen, deutlich von dem dunklen Horizont ab.
»Fette Beute«, nickte er und versuchte den Katalanen seine Aufregung nicht merken zu lassen. In Wirklichkeit hatte er keine Ahnung wer oder was langsam in ihre Richtung segelte. Aber die Segel am Horizont versprachen sein erstes Gefecht auf See.
»Gut gemacht, Juan«, lobte er den Katalanen betont selbstsicher.
»Bleib hier und gib Signal, wenn sie auf zehn Meilen heran sind! Wenn sie ihren Kurs ändern, gib ebenfalls Signal, zwei Lichtblitze kurz hintereinander!« Arthur schaute noch einen Moment zu den Schiffen hinüber. Hier, da stimmten alle Offiziere der Galeere überein, war der perfekte Ort für einen Hinterhalt. Alle Kauffahrer, die entlang der anatolischen Küste nach Istanbul wollten, mussten Kap Knidos, dieses Grab unzähliger Schiffe, runden. Arthur konnte sich gut ausmalen, dass die Meerenge die Aufmerksamkeit der Handelsschiffskapitäne voll inAnspruch nahm und ihnen zudem nicht viel Raum zum Manövrieren ließ. So wurden sie eine leichte Beute für die Korsaren Christi, wie sich einige Johanniter stolz selbst nannten. Arthurs Blick schweifte zurück zur Santa Margareta und der kleineren San Sebastian, der Halbgaleere oder Galeota, eines Malteser Reeders. Reiche Bürger des Inselstaates schlossen sich häufig, auf eigene Rechnung, mit ihren Schiffen den alljährlichen Beutefahrten oder Karawanen des Ordens an.
»Drei Schiffe sagst du?«, fragte de Calais und wiegte den Kopf, als Arthur ihm wenig später auf dem Achterdeck der Santa Margareta Bericht erstattete.
»Wir sind nur zu zweit, aber so eine Gelegenheit dürfen wir uns nicht entgehen lassen. Der alte Georg Schilling von Cannstatt hat mit so einem Streich unseren Großmeister von der Ruderbank einer osmanischen Galeere befreit.«
Wieder eine der alten Geschichten! Arthur unterdrückte ein Stöhnen. Natürlich kannte er diese bereits. Das Schicksal der Rudersklaven erschien Arthur immer die Hölle auf Erden, selbst wenn ein kluger Kapitän stets auf die Gesundheit seiner Ruderer achtete.
»Wie sollen wir sie angreifen?«, riss de Calais ihn aus seinen Gedanken. Arthur merkte, wie sein Mund trocken wurde, während seine Hände schwitzten. Woher sollte er das wissen? Außer ein paar Fischerbooten hatten sie bisher keine fremden Schiffe getroffen und er hatte keinen einzigen Kampf auf See bestanden.
»Sie werden uns kommen sehen und einfach davon segeln«, stammelte er. Die Zunge schien auf einmal an seinem Gaumen zu kleben.
»Was soll das Gefasel?«, wies de Calais ihn scharf zurecht, »Wie sollen sie segeln ohne Wind?«
Arthur stieg die Hitze ins Gesicht. Natürlich, es herrschte fast Flaute. Wie konnte er nur so einen Unsinn plappern? »Wir rudern im Schutz der Dunkelheit heran und entern sie.«
De Calais blickte ihn lauernd an.
»Wann können wir sie entern?«, bohrte er weiter. Arthur versuchte, sich zu konzentrieren. Sie müssten die hohen Schanzkleider der Segler ersteigen. Das würde nur gelingen, wenn der Feind nicht aus der Flanke oder ihrem Rücken auf sie schießen konnte.
»Wenn sie weit genug auseinander liegen und sich nicht gegenseitig beistehen können?«, schlug er fast zaghaft vor.
»Genau«, de Calais nickte, »und wenn sie aufpassen und dicht beieinander bleiben?«
»Dann müssen wir sie zuvor mit unserer Kanone so lange bearbeiten, bis wir in der Übermacht sind«, erklärte Arthur, von der Zustimmung seines Kapitäns ermutigt.
»Sie werden auch Kanonen an Bord haben«, warf de Calais ein. Diesmal kannte Arthur die Antwort gut genug. Darüber hatte er erfahrene Seeleute öfter sprechen gehört.
»Ohne Wind sind sie manövrierunfähig. Wir rudern sie vom Heck her an, wo sie keine Kanonen haben.«
De Calais entließ seinen Schützling mit einem knappen Nicken.
Arthurs Gedanken kreisten um den bevorstehenden Kampf. Würde er sich bewähren und seinem Orden und der Familie Ehre bereiten? Oder würde ihn eine Kugel treffen? Vor dem Nahkampf, Schwert gegen Säbel, fürchtete er sich nicht. Er hatte schließlich auf Vevre, der kleinen Burg seiner Vorfahren, das Handwerk eines Ritters gründlich gelernt. Aber eine Kugel tötete ohne Ansehen von Tapferkeit oder Feigheit.
Das Blinken der Laterne kam für Arthur überraschend. Die Aussicht auf den ersten Kampf hatte ihn die Zeit vergessen lassen, doch den langen Schatten nach zu urteilen, waren bereits etwa vier Stunden verstrichen.
»Wie können sie schon in der Nähe sein«, wandte sich Arthur an Antonio, den Re di Galera, und damit dritthöchsten Offizier an Bord, »wo wir doch fast keinen Wind haben?«
»Eine gute Frage«, antwortete der erfahrene Seemann, »auf dem Meer zwischen den Inseln und der Küste pfeift der Wind oft stärker als hier direkt unter Land im Windschatten der Felsen. So kann es sein, dass die Segler im Kanal genug Wind haben, um sich langsam zu bewegen, wir an der Küste aber nichts davon bemerken.«
»Wir lichten die Anker«, unterbrach sie de Calais, der den Niedergang hinauf zu ihnen auf das Achterkastell stürmte. »Du, junger Vevre, bereite dich vor! Mit etwas Glück wirst du heute deine Feuertaufe erleben.«
***
Mit klopfendem Herzen stieg Arthur die kurze Leiter vom Hauptdeck hinab, dorthin, wo in einem Winkel zwischen den Lagern der übrigen Offiziere seine Waffen und wenigen Habseligkeiten lagen. Auf der Galeere gab es neben der Kabine des Capitano nur einen weiteren geschlossenen Raum, der wahlweise für hohe Gäste, besonders wertvolle Fracht oder zusätzliches Pulver genutzt wurde. Alle anderen Männer suchten sich einen freien Platz an Deck, die Ruderer blieben auf ihren Bänken, die Sklaven sogar in Ketten. Während die Seeleute rasch das große Sonnensegel einholten, das die Galeere beim Ankern oder im Hafen wie ein Zelt überdachte, legte Arthur mit zitternden Fingern seinen Kürass an. Zuerst bekam er die Lederriemen gar nicht durch die Schnallen an den gewölbten Eisenplatten gefädelt. Ein offener Helm, Morion genannt, vervollständigte schließlich seine leichte Rüstung. Auf den schwankenden Planken eines Schiffes waren schwerere Rüstungen, wie Arthur sie aus seiner Heimat kannte, und die ihn besser gegen eine heimtückische Bleikugel schützen würde, leider unbrauchbar. Dann griff er nach dem großen Schwert, das er mit einer oder beiden Händen führen konnte. Das Schwert seines Vaters. Der lederbespannte Griff gemahnte noch an die Zeit der Kreuzzüge, doch die kunstvoll gebogenen Spangen an der Parierstange wiesen bereits in eine neuere Zeit. Sie schützten den Zeigefinger, den der moderne Fechter über die Parierstange legte, damit sich das Schwert nicht aus der Schlagrichtung drehte. Zufrieden kletterte Arthur wieder hinauf auf das Achterkastell, wo ein Knappe de Calais gerade in die Rüstung half. Die Santa Margareta glitt, getrieben von ihren vierundsechzig sich im perfekten Takt aus der See hebenden Riemen, in den Kanal zwischen den kleinen Felseilanden von Gaidouronisi und Telos hinein. Wenig später erreichten sie die offene See. Nun mussten die drei Segler die sich nähernde Gefahr bemerken.
»Eingeklemmt zwischen Skylla und Charybdis«, lachte Antonio. Arthur nickte wissend und stolz. Trotz seiner bescheidenen Herkunft aus der französischen Provinz verstand er den Verweis auf Homer. Die Segler lagen zwischen Kap Knidos und den Korsaren eingekeilt, wie einst das Schiff des Odysseus zwischen den beiden Ungeheuern.
»Zweiundzwanzig«, befahl der Re di Galera und gab damit die Zahl der Ruderschläge pro Minute vor. Der Comite und seine Sottocomites, die Aufseher der Ruderer, gaben den Befehl weiter. Die Santa Margareta glitt durch die wellenlose See auf ihre wehrlose Beute zu wie eine Schlange zum Kaninchen.
»Der Wind nimmt zu, ganz wie Ihr gesagt habt«, staunte Arthur. Antonio, dem de Calais für den Augenblick die Führung des Schiffes überließ, nickte knapp. Immer weiter näherten sie sich den drei Seglern.
»Nimm Kurs auf das hinterste Schiff«, schaltete sich de Calais wieder ein und wies auf die größte der drei Galeonen. An den vorderen zwei Masten hingen große, viereckige Segel schlaff von den Rahen. Der Besan- und der Bonaventura-Mast waren, ähnlich wie der Mast der Santa Margareta, mit dreieckigen Lateinersegeln bestückt.
»Sechsundzwanzig!«, rief der Capitano – volle Geschwindigkeit. Arthur starrte gebannt auf das fremde Schiff. Nur selten kräuselte eine schwache Böe die See und ließ die Segel sacht erzittern. Einmal regte sich die Flagge am Großmast. Das rote St. Georgs Kreuz auf weißem Grund – ein Genuese oder eher noch ein Engländer, der die Flagge der Seerepublik nutzen durfte, um zu zeigen, dass er unter dem Schutz der Seerepublik stand.
»Es sind Christen«, rief Arthur erstaunt.
De Calais winkte unwillig ab: »Christen oder nicht. Sie halten Kurs auf Konstantinopel, also machen sie mit dem Feind Geschäfte. Die dürfen wir angreifen.«
»Aber ...«, begann Arthur. Doch de Calais fixierte ihn mit einem kalten Blick.
»Verräter!«, zischte er.
Arthur schluckte hart. Meinte er mit diesem Wort die Engländer oder ihn selbst? Ihm war ganz und gar nicht wohl bei der Sache, doch an Bord galt das Wort des Kapitäns - gleich nach dem Gottes. Während sie dem Feind entgegenflogen, näherte sich von Norden die nächste Böe. Arthur sah es am Kräuseln des Wassers.
»Dieser verfluchte Nordwind hat schon den Apostel Paulus einst gehindert, Kap Knidos zu runden«, knurrte de Calais. Arthur klappte die Kinnlade herunter. Woher wusste der Kapitän das? An alte Geschichten aus der rhodischen Zeit des Ordens war er ja gewöhnt, aber der Apostel? Ungläubig sah er seinen Herren an, doch der fixierte finster die drei Schiffe vor ihnen.
Arthur blickte zur Mannschaft hinunter. Um sich abzulenken, ging er im Geiste die Positionen der einzelnen Männer durch. Direkt vor ihnen befand sich der Oberaufseher, der Comite. Und ganz innen auf der Ruderbank vor ihm saß der Espaldero, der Schlagmann. Der Comite gehörte zu den Serventi d´armes oder im Ordensjargon einfach Chergeanten. Männer, die, obwohl nicht von Adel, dem Orden als Kämpfer dienten. Der Schlagmann hingegen war ein Schuldner, der keinen anderen Ausweg gesehen hatte, als sich auf einer Galeere zu verdingen. Neben solchen Freiwilligen gab es Dienstpflichtige, obwohl die meisten freien Malteser ihren Dienst für den Orden lieber bei den Turkopolen, der Küstenwache des Inselstaates, denn als Ruderer auf einer Galeere ableisteten. Dazu gab es einige Sträflinge, zu erkennen an den halb geschorenen Häuptern und die, meist muslimischen, kriegsgefangenen Esclavi mit ihren kahlrasierten Schädeln.
»Schneller verdammt! Wir müssen in Schussposition kommen, bevor der Wind ihnen erlaubt zu drehen«, schimpfte de Calais. Er griff die Flüstertüte und rief den Cercamare an, der im Rembate genannten Bugkastell des Schiffes das Kommando führte. Dort stand auch das große Jagdgeschütz der Santa Margareta, ein langer, bronzener Sechsunddreißigpfünder.
»Seid ihr feuerbereit?«
Der Cercamare bestätigte mit einer Geste.
»Geh nach vorn und sieh zu, wie du dich nützlich machen kannst!«, schnauzte de Calais Arthur an. Der salutierte erschrocken. War der Kapitän immer noch verärgert über seinen Einwand? Er biss sich auf die Lippe. Gerade er als jüngster Anwärter des, von seinen Rittern inoffiziell einfach als die Religion bezeichneten, Ordens sollte er seine Zunge besser im Zaum halten. Über die schwankenden Planken des Mittelgangs balancierte er zum Bug. Er erreichte die Rembate, als der Engländer in Reichweite des großen Geschützes kam. Gespannt wartete Arthur, aus welcher Entfernung de Calais das Feuer eröffnen würde. Noch zogen die Ruderer voll durch, doch für den Schuss würden sie aufstoppen, um sicher zielen zu können. An der Kanone selbst ließ sich ohnehin nur der Abschusswinkel und damit die Schussentfernung einstellen. In seitlicher Richtung wurde mit dem gesamten Schiff gezielt. Das schwere Bronzerohr war fest auf einem Schlitten in der Längsachse montiert.
»Ruder haaalt!«, hörte Arthur das erwartete Kommando von achtern. Er zuckte unwillkürlich zusammen, als der Comite und seine Untergebenen die Peitschen knallen ließen.
»Feuer frei!«, erklang der nächste Befehl, kaum dass die Santa Margareta ruhig lag.
Arthur versuchte, nicht im Weg zu stehen, als alle Mann vom Geschütz zurücksprangen. Sergius, der Geschützmeister, wartete einen Moment ab, bis eine der kleinen Wellen die Santa Margareta in die Waagrechte hob, dann hielt er die glimmende Lunte an das Zündloch. Zischend fing das Zündpulver Feuer und einen Wimpernschlag später explodierte die Treibladung im Inneren des Bronzerohrs mit einem ohrenbetäubenden Knall. Die lange Canone di corsia rutschte auf ihrer Lafette zurück und prallte dumpf gegen die Begrenzung. Obwohl erwartet, warf der gewaltige Rückschlag Arthur fast von den Füßen. Beißender Schwefelqualm nahm ihm einen Augenblick die Sicht, dann blies ein frischer Windhauch den Rauch beiseite. Wie alle Männer auf der Rembate verfolgte Arthur gespannt die Flugbahn des Geschosses. Es schlug auf die Wasseroberfläche, prallte ab und versank wenige Schritte vor dem Ziel im Meer. Zu kurz, aber die Gischt-Fontäne hatte bereits gegen das Schanzkleid des Engländers gespritzt.
»Laden!«, schrie der Cercamare, doch Sergius und seine eingespielten Männer waren längst dabei. Einer putzte das Rohr mit einer langen Stange, während der Geschützmeister selbst das Pulver abmaß. Ein weiterer Mann schleppte eine schwere Eisenkugel heran. Zu dritt zogen sie das geladene Bronzerohr auf seiner Schiene wieder in die Schussposition. Der Geschützmeister füllte das Zündpulver aus einem Pulverhorn nach und gab dem Kapitän ein Zeichen. Sie waren feuerbereit. Arthur fragte sich, wieso de Calais ihn eigentlich nach vorn geschickt hatte. Hier stand er nur im Weg. Oder wollte der Kapitän ihn loswerden? Er wandte sich zum Achterkastell und suchte den Blick de Calais‘. Doch der ließ das Schiff ungerührt durch einen halben Schlag der Steuerbordruder wieder richten.
»Feuer!«, brüllte er. Wieder wartete Sergius, bis eine Welle den Bug der Galeere anhob. Wieder zischte das Zündpulver und das Bronzerohr wummerte. Das laute Krachen von Holz und Schreie, die vom Feind herüberklangen, zeigten Arthur an, dass dieser Schuss sein Ziel gefunden hatte. Die Kanoniere jubelten, doch der Cercamare schüttelte missbilligend den Kopf.
»Wir müssen höher schießen, wenn wir nicht die Masten treffen, segeln sie uns davon.«
Tatsächlich flaute der Wind zwischen den einzelnen Böen nicht mehr vollständig ab. Noch half das dem schweren Segler nicht. Arthur erkannte an den flatternden Segeln, dass das Schiff augenscheinlich im Wind stand, der zu schwach wehte, um es zu drehen. Der englische Kapitän, offenbar ein erfahrener Mann, hatte bereits das Focksegel Back gebrasst, also so herum gedreht, dass es den ersten Wind von vorne fangen würde und den Kauffahrer früher oder später nach Steuerbord wenden müsste. Wenn der Wind weiter zunahm, würde die Beute der Galeere doch noch entwischen. Arthur war sich nicht sicher, ob er sich das wünschte oder nicht. Immerhin waren es Christen. Oder fürchtete er sich nur vor seinem ersten Kampf auf See? Zum Glück bemerkte in der allgemeinen Betriebsamkeit niemand, wie ihm das Blut ins Gesicht stieg. Vielleicht war es doch gut, dass de Calais ihn hierhin geschickt hatte. Wieder krachte ein Schuss. Ein reißendes Geräusch und ein gähnendes Loch im Großsegel des Seglers zeigten, dass Sergius sein Handwerk verstand. Der Engländer begann, langsam zu drehen. Immer schneller kam der Bug herum, bis der Segler der schlanken Galeere anstelle des hohen Hecks die Breitseite bot. Gleichzeitig krachten an Deck des Seglers gleich fünf Geschütze. Gebannt wartete Arthur auf die Einschläge.
Ein Kampf mit Schwert und Hellebarde, Dolch und Schild war eine Sache, aber das bange Warten auf den Einschlag der Kugeln eine andere. Er musste all seinen Mut zusammen nehmen, um aufrecht stehen zu bleiben und mannhaft abzuwarten, wo das Schicksal zuschlug. Die feindlichen Kugeln fielen alle zu kurz. Erleichtert atmete Arthur auf, schämte sich aber zugleich seiner Furcht. De Calais war erfahren und hatte eine Gefechtsdistanz gewählt, die nur das schwere Hauptgeschütz der Galeere, nicht aber die leichteren Rohre des Seglers überbrücken konnten. Der nächste Schuss der San Margareta verfehlte ebenfalls sein Ziel, während sich die bauchigen Segel des Engländers mit dem stetig zunehmenden Nordwest füllten.
»Adé Beute«, seufzte Sergius enttäuscht. Arthur wusste immer noch nicht recht, wie er seine Gefühle bewerten sollte. Einerseits hatte er der Gelegenheit, sich endlich in einem Kampf auf See zu bewähren, entgegengefiebert. Andererseits waren seine Knie weich von der gerade durchlittenen Anspannung und Angst.
Er wandte sich um und bemerkte abseits ein anderes Drama. Der Kapitän der San Sebastian hatte, anders als de Calais, darauf verzichtet, seine ohnehin viel leichtere Kanone zum Einsatz zu bringen, und war eines der beiden anderen Handelsschiffe direkt angegangen. Während die Engländer mit Spottgeheul vor dem Wind abrauschten, hatte die Galeota mit einem bewundernswerten Kraftakt ihrer Ruderer ihr Opfer erreicht. Anders als auf der Santa Margareta bestand die Rudermannschaft der San Sebastian ausschließlich aus Freiwilligen, und diese trieb die Hoffnung auf Gewinn. Gegen eine Gebühr und einen Anteil an der Beute erhielten private Schiffseigner vom Konvent des Ordens einen Kaperbrief und das Recht, die Ordensflagge zu führen. Ein gewinnbringendes Geschäftsmodell für den Orden, die maltesischen Unternehmer und ihre Mannschaften gleichermaßen. Außerdem würden die Ruderer der Galeota im Enterkampf selbst zu den Waffen greifen, wusste Arthur.
De Calais hatte ihm einmal erzählt, dass der große Schrecken der Meere, der wegen seines roten Bartes Barbarossa genannte osmanische Admiral, seine Karriere mit solch einer Halbgaleere begann, als er keck und furchtlos im Tyrrhenischen Meer direkt vor der Nase des Papstes dessen Prunkgaleere enterte. Arthur sann über die Vorzüge der kleineren Schiffe nach und die Santa Margareta nahm wieder Fahrt auf. De Calais hatte offenbar beschlossen, dem mutigen Malteser in seinem ungleichen Kampf beizuspringen. Arthur würde doch noch seine Bewährungsprobe bekommen.
Die San Sebastian hatte sich mit ihren Enterhaken fest an die Steuerbordseite des Seglers gehängt. De Calais dirigierte die Santa Margareta daher knapp unter dem Heck des Feindes hindurch an die Backbordseite.
»Steuerbordriemen ein!«, befahl er, als die schlanke Galeere einschwenkte. Augenblicke später schrammte sie am Schanzkleid der Galeone entlang. Schon flogen die Enterhaken und Arthur stürmte hinter Antonio über die Apostis, den Balken, der an der Außenseite der Galeere entlanglief, zu der Stelle, an der die Bordwand des Seglers am niedrigsten war. Weil das Schwert beim Klettern störte, zog er mit der Rechten seinen Dolch und schwang sich, einem Malteser Chergeanten folgend, an den Wanten des Großmastes hinauf an Deck.
Noch bevor er richtig stand, ging ein Mann mit einem kurzen Spieß auf ihn los. Geschickt parierte er den Stoß des ungeübten Angreifers mit seinem Dolch und wich mit seinem Körper nach rechts aus. Hier machte sich das lange, harte Training auf Burg Vevre bezahlt. Er fand seinen Stand. Ein Schlag mit dem Knauf des Dolches verschaffte ihm einen Augenblick Raum, sodass er die Hand wechseln und das Schwert ziehen konnte. Ein mächtiger Hieb entledigte ihn endgültig seines Gegners. Er atmete tief durch und blickte um sich. Immer mehr Männer der Santa Margareta erstiegen das Deck. Es war nur eine Frage der Zeit, bis sie die Verteidiger, die sich mittschiffs zwischen den Männern der Santa Margareta und den Maltesern der San Sebastian eingekeilt sahen, überwältigen würden. Mit frischem Mut wandte Arthur sich zum Achterkastell.
»Mir nach!«, rief er und schlug mit dem schweren Haudegen eine Gasse in die Verteidiger. Endlich befand er sich in seinem Element. Pulverdampf und Arkebusen-Kugeln hatten die Kriegsführung revolutioniert, aber im Kampf Mann gegen Mann war ein Ritter immer noch der Herr der Schlacht! Ermutigt von seinem Beispiel drängte die Mannschaft der Santa Margareta mit Hellebarden und Schwertern in die von ihm gehauene Bresche. Die nächsten Gegner wichen erschrocken vor ihm zurück. Einige ließen ihre Waffen fallen. Das mittlere Deck gehörte ihnen! Die letzten noch kampfwilligen Feinde flüchteten sich auf das erhöhte Achterdeck. Arthur blickte abschätzend die schmale Leiter nach oben, da legte sich eine Hand auf seine Schulter.
»Gut gekämpft, de Vevre, aber nun lass mich ran!« Es war Antonio, der Re di Galera. Der erfahrene Ritter trat an Arthur vorbei. Doch er stürmte nicht auf die Leiter zu, sondern blieb einige Schritte vor dem Aufgang zum Achterkastell stehen.
»Wo ist der Kommandant dieses Schiffes?«, rief er laut auf Italienisch, was Arthur nur leidlich verstand. Oben trat ein Mann mit einem blauen Turban vor, tatsächlich zogen sich Männer um ihn herum zurück. Der Turbanträger blickte hilfesuchend um sich, doch alle seine Mannen schauten zu Boden oder wandten den Blick ab. Mit hochrotem Kopf verbeugte sich der Kapitän vor Antonio und ließ seinen Säbel klappernd auf das Deck fallen. Seine Worte gingen im Siegesgeschrei der Ritter und Malteser unter. Das Schiff war genommen, sie hatten gesiegt! Nicht so eine fette Beute wie es der Engländer gewesen wäre, aber doch wieder ein Nadelstich in die Finger des Sultans. Wie lange, fragte sich Arthur insgeheim, würde Suleiman die Korsaren von Malta gewähren lassen?
***
Kapitel 2
Franz Wolters, Marburg, Oktober 1565
Franz duckte sich hinter einen alten Wagen. Der war im Herbst mit einem gebrochenen Rad auf der Straße liegen geblieben. Zu alt, um sich darum zu kümmern. Nur komisch, dass die Bewohner des Armenviertels ihn noch nicht verheizt hatten! Franz rümpfte die Nase. In der Zwischenzeit hatten sie ihre Notdurft dahinter verrichtet. Doch das durfte ihn nicht kümmern. Wichtig war nur, dass ihn die Wache des Landgrafen nicht fand. Auf Duelle unter den Soldaten standen harte Strafen. Schlimmer noch, er würde unweigerlich aus dem Heer entlassen werden. Er versuchte die Blutung am linken Oberarm zu stillen, indem er die Hand darauf drückte. Es war keine ernsthafte Wunde, aber sie würde ihn verraten, wenn er den Häschern in die Hände fiel. Und das gerade jetzt, wo ihm Philipp von Hessen einen Auftrag erteilt hatte. Er gehörte zu einer Eskorte, die Glückwünsche und ein Geschenk zur Taufe der Enkeltochter des Landgrafen an den Hof seines Schwiegersohns Wolfgang von der Pfalz- Zweibrücken überbringen sollte. Eine große Ehre. Das Geschenk überstieg den Jahressold eines Schwarzen Reiters, wie Franz einer war, bei weitem. Franz wartete etwa eine Stunde in seinem stinkenden Versteck. Die kalte Luft drang ihm unter die Rüstung und bis ins Mark, doch er wagte es nicht, es zu verlassen.
Er war so stolz, im Dienst des Landgrafen zu stehen. Jeder der hessischen Soldaten kannte den Ausspruch Luthers: »Gott hat den Landgrafen recht mitten ins Römische Reich geworfen, denn er hat vier Kurfürsten um sich wohnen und die Herzöge von Braunschweig und fürchten sich doch alle vor ihm. Das macht, er hat den gemeinen Mann an sich hangen, so ist er ein Kriegsmann, der ein sonderlich Glück und Stern hat!« Franz war einer dieser gemeinen Männer. Und nun hatte er alles aufs Spiel gesetzt, nur weil ihn die Kameraden so gereizt hatten. Da steckte bestimmt der verdammte Hannes Meyer dahinter.
Erst im Dunkeln erreichte Franz die eigene Wohnung.
»Wo warst Du so lange?«, begrüßte ihn seine Zwillingsschwester Elisabeth. »Und wie riechst du überhaupt?«
Franz schüttelte unwirsch den Kopf. »Es gab noch zu tun mit den Pferden«, wich er aus. »Hilfst du mir, den Harnisch zu putzen? Übermorgen wollen wir ja schon reiten.« Eigentlich brachte es nichts, denn das billige Eisen des Halbharnischs war, um es vor Rost zu schützen, mit Säure geätzt und komplett schwarz korrodiert, woher der Name Schwarzer Reiter rührte. Und einen anderen Geruch als den von altem Eisen nahm er auch nicht an. Doch Franz wollte jede verräterische Spur seines Duells beseitigen. Elisabeth, die wie die alte Mutter von dem Sold des Bruders lebte, half bereitwillig. Ihre Anstellung bei einer der vornehmeren Familien oben am Markt reichte vorne und hinten nicht, um die Familie oder auch nur sie selbst mit dem Nötigsten zu versorgen.
»Ist es nicht gefährlich, so weit übers Land zu reiten?«, fragte sie ihren Bruder und blickte ihn aus ihren hellgrauen Augen sorgenvoll an. Der winkte ab.
»Unbequem ja. Jetzt im Dezember bei eisglatten Straßen und verschneiten Wäldern. Aber seit der Streit um die Grafschaft Katzenelnbogen entschieden ist, sind die Wege für uns sicher.« Vielleicht ist es sogar weniger gefährlich, als zuhause zu bleiben, dachte er insgeheim. So wäre er weit weg, wenn es wegen des Duells eine Untersuchung gab. In zwei oder drei Wochen, wenn er heimkehrte, krähte sicherlich kein Hahn mehr danach. Er glaubte, seinen Gegner nicht wirklich gefährlich verletzt zu haben und die eigene Schramme am linken Arm, die er auch vor der Schwester verbarg, wäre bis dahin sicherlich verheilt.
»Aber musst du denn so weit weg?«, drang sie weiter auf ihn ein. »Wer weiß, was alles passiert in diesen unruhigen Zeiten.«
Das hieß auch: Musst du mich mit unserer alten Mutter alleine lassen?, wie Franz wohl wusste. Seine Schwester brauchte es nicht auszusprechen. Er kannte ihre Ängste. Beinahe das gesamte Erbe hatten Franz‘ Harnisch und Pferd verschlungen und es war eine Investition, nicht nur in seine Zukunft. Er musste mit seinem Sold das Überleben der kleinen Familie sichern. Seit der Vater verstorben war, hatten sie nur Elisabeths kümmerlichen Lohn und diesen Sold.
»Es herrscht eitler Frieden«, widersprach er mürrisch und wischte sich die langen blonden Strähnen aus dem Gesicht, »und ich kann mich glücklich schätzen, weiterhin im Sold des Landgrafen zu stehen. Viele Männer, Reisige wie Reiter, haben gar kein Einkommen mehr und warten bange auf den nächsten Krieg.«
Wenn der Landgraf herausfindet, wie es meinem Kontrahenten von vor zwei Tagen geht, dann ist die Entlassung noch das Beste, was mir passieren kann, fügte er in Gedanken hinzu. Außerdem stimmte ebenso seine offen geäußerte Sorge: Früher oder später würde auch die kleine Familie Wolters in diese Not geraten. Ohne Krieg war es keine Frage ob, sondern lediglich wann, Landgraf Philipp weitere Männer entließ.
»Ich schickte mein Gesinde von mir, denn es hätte mich zum Bettler gefressen«, so oder so ähnlich hörte man von vielen kleinen Adligen. Elisabeth schwieg. Die Vorhaltungen ihres Bruders hatten sie offenbar verletzt. »Es sind doch nur ein paar Tage«, wandte Franz begütigend ein, »höchstens zwei oder drei Wochen.«
»Und der Landgraf schickt euch Krieger, um seiner Tochter und Enkelin zu gratulieren?«, fragte Elisabeth und Franz merkte, wie sie seine große, etwas hagere Gestalt kritisch musterte. Er musste schmunzeln. Nicht, dass sie viel kleiner wäre, aber mit dem ebenfalls langen blonden Haar und den etwas weicheren Zügen hätte sie in teuren Kleidern wahrscheinlich sogar ein passables Hoffräulein abgeben. Aber er selbst – in der Gesellschaft der Herzogin?
»Natürlich nicht«, lachte er, »wir sind nur die Bedeckung. Ein Herold mit weichen Händen und gepudertem Hintern und zwei Kammerfrauen werden das sehr viel eleganter erledigen.«
Der Gedanke an die Kammerfrauen heiterte Franz zusätzlich auf. Nicht, dass er seiner Schwester so eine Position geneidet hätte, aber er hatte die beiden Jungfern schon
gesehen. Bürgerliche Mädchen, aber in ihren gestärkten Röcken und weißen Schürzen sahen sie für ihn eleganter als Hoffräulein aus. Für einen gemeinen Mann wie Franz kamen sie aus einer anderen, glänzenden und geheimnisvollen Welt. Fast wie Engel. Solch einen Gedanken ließ seine fromme Schwester sicher ebenso wenig durchgehen wie der gestrenge Pfarrherr in der Schlosskapelle. Eine der beiden hieß passenderweise Engel. Engel Clementine.
»Hörst du mir überhaupt zu?«, drang die Stimme seiner Schwester in seinen Tagtraum.
»Ja doch«, antwortete er mürrisch.
»Wann ihr aufbrecht, habe ich gefragt?«
»Bereits übermorgen, hab‘ ich doch gesagt. Und nun gehe ich nochmal nach Balak schauen. Wo ich mich so lange um die Pferde des Landgrafen gekümmert hab‘, verdient auch er etwas Aufmerksamkeit.«
Franz hatte keine Ahnung, wie sein Wallach zu dem seltsamen Namen gekommen war. Er war erst acht oder neun Jahre alt und ausreichend kräftig, um Franz mit seiner leichten Rüstung zu tragen. Ein sogenanntes Ringerpferd, eine Bezeichnung, die sich von Geringer ableitete. Kein Ross für den Landgrafen, aber Franz liebte sein Tier. Balak trabte ausdauernd, setzte leicht Gewicht an und war anspruchslos. Während andere Pferde ständig husteten oder Koliken bekamen, erkrankte er nie. Draußen auf der Straße sog er die kalte Luft ein. Niemand war zu sehen, keine Wachen und auch kein Meier. Doch den würde er spätestens übermorgen sehen.
***
Kapitel 3
Arthur, Fort San Angelo auf Malta, 18. Mai 1565
Arthur stöhnte innerlich. Sie hatten den Bogen überspannt, und das, obwohl alles so klar vor ihnen lag wie die Segel jetzt auf dem Meer.
»Da kommen sie, die Horden Süleimans des Prächtigen.«
De Calais blickte, von Erinnerungen überkommen, auf die unzählbaren Segel. Der Ritter und Capitano hatte sich bereits in jungen Jahren auf der Roseninsel Rhodos dem Orden angeschlossen und die Katastrophe der Vertreibung miterlebt. Auch diese Geschichte kannte Arthur bereits. Nun würde er am eigenen Leibe die Wiederholung erleben oder, wie so viele, dabei sterben. Ihn schauderte. Er wollte nicht sterben. Wieso nur hatte er selbst sich dem Orden angeschlossen? Hatte er in Panik gehandelt? Weil sein Bruder Hercule Cecile heiraten sollte?
Er schüttelte den Kopf und konzentrierte sich auf das Hier und Jetzt. Die Parallelen zwischen der Situation des alten Capitanos damals zu seiner eigenen heute verblüfften ihn. Zum gefühlt tausendsten Mal rechnete Arthur im Kopf zurück. Die Katastrophe von Rhodos hatte sich am 1. Januar 1523 vollendet, das war sage und schreibe zweiundvierzig Jahre her. De Calais war nicht der einzige alte Mann, der sich an diese unruhigen Zeiten, von denen manch einer geglaubt hatte, sie seien die letzten Wehen vor der Wiederkunft Christi, aus eigener Erfahrung erinnerte.
Zum einen war da Jean Parisot de la Valette. Seit 1557 Großmeister des Ordens und damit Arthurs oberster Herr. Zum anderen sein ewiger Gegenspieler Süleiman. Der Sultan hatte in seinem zweiten Amtsjahr den Orden von der Roseninsel Rhodos vertrieben und wieder schickte er sich an, die Christenheit zu unterjochen. Ob Arthur vielleicht, wenn er überleben sollte, mit sechzig Jahren ebenfalls von den Mauern einer Festung, vielleicht auf Mallorca, auf die nächste Welle der herandrängenden Osmanen schauen würde? Gott möge den Orden und die gesamte Christenheit davor bewahren!
»Werden sie in den großen Hafen einlaufen?«, fragte er seinen Capitano, »ohne unsere Schiffe können wir sie kaum angreifen.«
Die Santa Margareta lag zusammen mit den übrigen Ordensschiffen auf dem Grunde des Galeerenhafens zwischen den Landzungen von Birgu und Sanglea. Arthur hatte geholfen, als die Ritter ihre Schiffe selbst versenkt hatten, damit sie unter der Wasseroberfläche vor den osmanischen Kanonen geschützt wären. De Calais schüttelte den Kopf.
»Selbst, wenn sie an San Elmo dort drüben vorbei in den Hafen hineinkämen, würden sie zwischen den Kanonen von San Elmo und San Angelo zerrieben.« Tatsächlich konnte die gesamte Wasserfläche zwischen Fort San Elmo, das sich auf der Landzunge an der Spitze der Halbinsel Sciberras auf der gegenüberliegenden Seite des großen Hafens befand, und ihrer eigenen Position von den Kanonen der beiden Forts komplett bestrichen werden.
»Hätten wir die Galeeren nicht besser Don Garcia überlassen sollen?«, fragte Arthur. Don Garcia Alvarez de Toledo, Marqués de Villafranca del Bierzo, war der Vizekönig von Sizilien und auf den von ihm in Aussicht gestellten Entsatztruppen ruhten die gesamten Hoffnungen der Ritter und Malteser.
»Nein«, beschied de Calais, »auch er hätte die Galeeren bemannen müssen und wir brauchen hier jeden Mann.«
Arthur nickte. Er kannte die Argumente bereits, aber er hielt die Spannung nicht aus, ohne zu reden. »Wo, meint Ihr, gehen sie an Land?«, fragte er daher.
»Ich würde in der Marsamxett-Bucht im Norden ankern«, erklärte de Calais und nickte zu der Sciberras Halbinsel hinüber, die die Marsamxett-Bucht vom großen Hafen trennte, »aber auch dafür müssen sie erst San Elmos Kanonen zum Schweigen bringen.«
Ungeachtet dieser Argumente hielt die in einer breiten Fächerformation heran segelnde Flotte weiter auf den großen Hafen zu. Erst kaum einen Kanonenschuss vor San Elmo wendeten die ersten Schiffe und setzten ihren Kurs nach Süden. Die gesamte Flotte, sicher einhundert Galeeren und ungezählte Transport- und Hilfsschiffe, paradierten so vor den Rittern und Malteser Bürgern vorbei.
»Sie sind in Marxalott vor Anker gegangen«, berichtete ein junger Anwärter abends. Arthur saß bereits in der Auberge de France, der Herberge, in der die jüngeren Ritter, die Anwärter sowie die Chergeanten und Kaplane der jeweiligen Zunge des Ordens wohnten. Chergeanten und Kaplane mussten als Nichtadlige freilich an einem eigenen, niedrigeren Tisch sitzen als ihre ritterlichen Kameraden.
»Wir sollten aufsitzen und sie wie rechte Ritter mit einer Attacke ins Meer zurück fegen«, rief Gerome, ein stämmiger Ritter aus der Picardie. Julien, wie Arthur einer der jüngsten und Arthurs bester Freund, rollte mit den Augen und warf Arthur einen vielsagenden Blick zu.
Gerome träumte immer noch vom Ruhm des Ritters, der hoch zu Ross wie in einem Turnier die Schlachten beherrschte.
»Ich glaube, wir müssen alle zusammenhalten und fest auf die Weisheit le Valettes vertrauen«, antwortete er beklommen.
»Auf einen Provenzalen?«, rief Gerome.
»Entweder er ist besoffen oder er hat die Hosen gestrichen voll«, kommentierte sein Freund Julien leise. Arthur blieb ernst.
»De Calais hat gesagt, dass wir ihm vertrauen können. Hättest du lieber einen Kastilier oder Aragonesen als Großmeister?«
Der Orden umfasste acht Zungen, die in Birgu nicht nur jeweils eigene Herbergen, sondern auch fest zugeordnete Bastionen und Mauerabschnitte hatten, die sie verteidigten. Gerade zwischen den zwei spanischen und den drei französischen Zungen kam es aufgrund der politischen Verhältnisse in den Mutterländern immer wieder zu Streit.
»Oder einen Deutschen«, warf Julien ein, »in Brandonbourg haben sie jetzt angeblich einen Ketzer zum Herrenmeister gewählt.«
»Einen Bürgerlichen, wie man hört.«
»Einen, der es seinen Kommendatoren durchgehen lässt, zu heiraten!«, mischten sich zwei junge Ritter ins Gespräch.
»Oh là là!«, antwortete Julien grinsend. Die Anspannung entlud sich in allgemeinem Grölen und Lachen. Besser sie lachten über die verrückten Deutschen, als dass sie den Spaniern oder sich gar gegenseitig an die Gurgel gingen. Doch das war vermutlich auch nur eine Frage der Zeit.
***
Kapitel 4
Franz Wolters, Marburg, November 1565
Die Sonne blickte gerade über den Horizont und tauchte das Rheintal in ein helles, klares Licht. Die Atemluft von Ross und Reiter stieg als Dampf in die eisige Morgenluft. Die dunklen Mauern des Schlosses schienen von dem schmalen Felssporn, auf dem es errichtet war, in den grauen Himmel zu reichen. Franz trat mit vier weiteren Reitern und Bastian, dem Chergeanten und Führer der kleinen Truppe, in der Kälte von einem Bein auf das andere.
Immerhin hatte Meier noch keine Andeutungen über sein Duell gemacht, sondern pustete sich nur warme Luft in die hohlen Hände. Sobald der Wagen mit dem Herold und den beiden Zofen fertig wäre, würden sie aufbrechen. Franz und seine Kameraden waren freilich schon einige Stunden wach. Sie wohnten mit ihren Pferden in billigen Unterkünften an der Lahn.
Lediglich die Leibgarde des Landgrafen logierte im Schloss. Endlich, lange nach der verabredeten Zeit, rumpelte der Wagen aus dem inneren Schlosshof. Sie fuhren den Schlossberg hinab und durch das südliche Stadttor. Niemand sprach, die Luft war einfach zu kalt, um den Mund aufzumachen. Sie nahmen den Weg über Niederviemar, an dessen Südende auf dem Weinberg tatsächlich ein paar kümmerliche Reben standen.
»Davon werden wir auf der Reise noch mehr finden«, versprach Bastian vollmundig, »als Landgraf Philipp seine Fehde mit dem Reichsritter von Sickingen ausfocht, hat mich mein Vater einmal mit an den Rhein genommen«, erklärte er stolz.
***
Franz und seine vier Kameraden grinsten gehorsam. Natürlich wussten sie, dass am Rhein Wein wuchs, wenn Franz den breiten Strom auch noch niemals mit eigenen Augen gesehen hatte. Mittags hielten sie in Gießen, einer kleinen Festung an der Einmündung eines noch kleineren Baches in die Lahn.
Hier endlich erhaschte Franz einen ersten Blick auf die engelsgleichen Frauenzimmer im Wagen.
»Was gibt es hier zu gaffen? Hilf lieber dem Kutscher mit den Pferden«, schnauzte ihn der Herold an, als er Franz‘ Neugier bemerkte. Das zog die Aufmerksamkeit eines der Mädchen auf ihn. Ihre Blicke trafen sich und sie hob verschwörerisch eine Braue. Das entschädigte Franz für die erhaltene Zurechtweisung. Bereitwillig machte er sich an die Arbeit. So konnte er wenigstens in der Nähe der Kutsche bleiben. Das von ihm in Gedanken Engel genannte Mädchen hielt die Augen nun züchtig gesenkt und, so sehr er sich auch bemühte, er konnte keinen weiteren Blick ergattern.
Als es langsam zu dämmern begann, sandte Bastian Franz und Hannes Meier voraus, um nach einer geeigneten Herberge zu suchen. Warum gerade Meier, fragte sich Franz?
»Du bist wohl sehr stolz auf deine Leistung von vorgestern?«, ätzte der, sobald sie aus der Hörweite des Chergeanten waren.
»Ich hab keine Ahnung, wovon du redest«, kommentierte Franz schmallippig. Obwohl ihn das noch mehr ärgerte, wurde ihm heiß im Gesicht und die Wunde am Arm pochte auf einmal.
»Tu nur nicht so unschuldig«, wies Meier ihn zurecht, »so Kerle wie dich brauchen wir nicht im Heer des Landgrafen. Das wird der Hauptmann auch noch erkennen. Und dann kannst du dir Arbeit im Regiment von irgend so einem verarmten Oberst suchen und deine Haut nach Frankreich tragen.«
Franz würdigte ihn keiner Antwort. Wenn er ihn hätte anschwärzen wollen, dann hätte er es schon getan, aber wie erwartet, hing er wohl selbst mit drin. Schweigend ritten sie weiter.
Am folgenden Tag überquerten sie mit dichtem Wald bestandene Höhenzüge, den Taunus. Am Südrand des Gebirges wurde es zu Franz‘ Erstaunen, trotz der schon tief stehenden Wintersonne, sogleich wärmer. Vor ihnen im Tal glänzte ein breiter Fluss in der Sonne. Um ein Vielfaches breiter als die Lahn. Doch nicht nur das, der gesamte Hang zu ihren Füßen war mit Weinranken bedeckt.
»Na, was hab ich euch gesagt?«, protzte Bastian gleich, »Weinreben, soweit das Auge reicht.« Er machte eine ausladende, fast beschwingte Geste, was Franz bei dem alten Haudegen merkwürdig, fast schon komisch fand, »und das dort im Tal ist die Stadt Eltville.«
Er zeigte auf eine mit starken Mauern bewehrte Siedlung am Fuße des Hangs. »Die alte Zollburg des Erzbischofs zu Mainz. Kein Ort, an dem wir Lutheraner besonders willkommen wären.« Er lachte. »Wir folgen dem Fluss nach Westen. Im Schloss Vollrads bei den Herren von Greiffenclau erwartet uns ein besserer Empfang.«
Sie folgten einem Weg durch die Weinberge, vorbei an einem sich tief in ein Bachtal drückendes Kloster. Als Protestant kannte sich Franz mit Orden und Klöstern nicht gut aus, aber das Fehlen jeglichen Prunks und der Kirchtürme ließ sogar ihn die Zisterzienserabtei erkennen. Wenig später tauchte zwischen den winterlich dürren Weinstöcken die Haube eines Turms und bald darauf die Wehrmauer einer Burg auf. Mit einem Schenkeldruck trieb Franz Balak voran, doch auch das Pferd schien den Stall zu riechen und setzte die Hufe schneller voreinander.
»Wir sind eine Gesandtschaft des Landgrafen Philipp von Hessen und auf dem Weg zu seinem Schwiegersohn Wolfgang von der Pfalz-Zweibrücken«, erklärte Bastian der Schildwache am Tor. Sie ließ die Schar in den geräumigen Hof der Burg.
Franz staunte nicht schlecht, als er erkannte, dass der bereits von weitem sichtbare Turm in der Mitte eines künstlichen Sees lag. Die Wirtschaftsgebäude der Burg duckten sich entlang der Wehrmauer an der Außenseite des geräumigen Hofes. Knechte sprangen hinzu, um Franz und seinen Kameraden mit den Pferden zu helfen. Ein fein gekleideter Herr, der sich als Majordomus des Grafen vorstellte, entführte den sauertöpfischen Herold und die beiden Mädchen ins Hauptgebäude. Während die etwas ältere Frau sogleich auf das Haus zustrebte, drehte sich Engel Clementine noch einmal um. Diesmal war sich Franz ganz sicher: Ihr Blick hatte ihn gesucht. Wie versteinert stand er und starrte ihr hinterher.
»He Franz, sollen wir uns um deinen Gaul kümmern, während du weiter Maulaffen feilhältst?«, riss ihn Meiers beißender Spott aus der Träumerei.
Einer der Knechte führte sie zu ihrer Unterkunft. Zu Franz‘ Enttäuschung lag sie nicht in dem Gebäude, in dem Engel Clementine verschwunden war, sondern geradewegs auf der gegenüberliegenden Seite der Burg. Dort drängten sich Wirtschaftsgebäude und die tief herunter gezogenen Dächer von Scheunen. Vor einem der Eingänge türmten sich leere Weinfässer.
»Jetzt bekommen wir sicherlich den süßen Wein zu kosten«, freute sich Bastian. Als er wenig später in der Gesindeküche seinen Becher an die Lippen führte, musste Franz an sich halten, um nicht laut zu lachen. Zu komisch war der Wechsel aus freudiger Erwartung zu einem sauer verzogenen Gesicht. »Was ist das?«, beschwerte sich der Chergeant lauthals, »das nennt ihr Wein?«
Lachend winkte der Koch ab:
»Ihr glaubt doch nicht, dass wir einfachen Leute den guten Wein zu trinken bekommen? Essigwasser ist das. Löscht den Durst genauso gut. Den Wein verkauft der Herr Greiffenclau für teures Geld.«
»Essigwasser?«, empörte sich Bastian, »wie könnt ihr den tapferen Reitersleuten von Landgraf Philipp so eine Plörre vorsetzen?«
»Gib Ruhe, dann bekommt ihr nach dem Essen einen Humpen Bier! Aber Wein gibt es hier keinen.«
Franz war der Wein nicht so wichtig, er überlegte stattdessen, wie er es anstellen sollte, seinen Engel, wie er Clementine Engel inzwischen in Gedanken nannte, zu treffen. Darum verließ er nach dem Essen mit dem Vorwand, noch einmal nach seinem Pferd sehen zu wollen, die Gesindeküche. Draußen umfing ihn die stockdunkle Nacht. Der Himmel hatte sich zugezogen und es roch nach Schnee. Franz rieb sich die Hände und benötigte einen Augenblick, um sich in der Dunkelheit zu orientieren. Unentschlossen schlenderte er zum See in der Mitte des Burghofes hinüber. Vor ihm erhob sich drohend die schwarze Silhouette des kantigen Bergfrieds. Unschlüssig trat er von einem Bein auf das andere. Die Kälte stach in seiner Wunde am linken Arm. Wenn nur dieser grimmige Herold nicht wäre. Dann würde es ihm schon gelingen, an die beiden Jungfern heranzukommen. Wozu wurde der lästige Kerl überhaupt gebraucht? Konnten sich die Jungfern der Herzogin und ihrer Tochter nicht viel besser nähern? Doch es half nichts. Nur weil er es gerne wollte, würde weder der Herold verschwinden noch sein Engel zu ihm heraus flattern. Missmutig begab er sich stattdessen in den Stall, wo Balak und die anderen Pferde tatsächlich warm und trocken standen.
Schließlich kehrte er in die Küche zurück, wo auch er seinen Humpen Bier erhielt. Bastian war wieder besser gelaunt, anscheinend hatte der Koch zumindest mit dem Bier nicht so gegeizt wie mit dem Wein. Heute war er nicht erfolgreich, aber so leicht ließ sich Franz nicht von seinem Ziel abbringen und bis nach Meisenheim würde es noch ein paar Nächte dauern.
***
Kapitel 5
Arthur, San Angelo, 2. Juni 1565
Wie lange wird Valette die Besatzung noch in San Elmo halten?«, fragte Arthur sorgenvoll. Von den Mauern San Angelos konnten sie die türkischen Batterien auf dem Monte Sciberras gut erkennen. Angeblich waren mehrere Basilisken genannte Riesengeschütze dabei, die Kugeln von hundertsechzig Pfund verschossen. Das Bombardement wurde Tag und Nacht pausenlos fortgeführt. Arthur fragte sich, wie die Kameraden im Fort das ertragen sollten.
Auch eine noch so tapfere Besatzung konnte das auf Dauer nicht durchhalten, er selbst traute es sich jedenfalls nicht zu. Sogleich mischte sich noch ein schlechtes Gewissen in die Angst, die ihm ohnehin schon in den Knochen saß. Die türkischen Pioniere hatten auch die Laufgräben für die Infanterie bis dicht vor die Mauern des Forts getrieben. Es konnte sich nur noch um Tage handeln, bis das Fort fiel.
»Le Valette sagt, San Elmo muss gehalten werden«, erklärte de Calais düster, »die Türken verlieren dort jeden Tag hunderte ihrer besten Truppen und noch wichtiger ist jeder Tag, den sie verlieren.«
»Ja, wenn endlich unsere Verstärkung aus Sizilien eintrifft«, warf Julien, der sich Arthur angeschlossen hatte, ein.
»Auf Don García können wir nicht zählen«, entgegnete de Calais, »auch in Rhodos kam uns niemand zu Hilfe. Wir müssen uns schon selber helfen.«
»Aber der Sohn des Vizekönigs ist doch bei uns«, konterte Julien. Arthur blickte seinen Freund dankbar an. Ohne Hoffnung hatten sie doch erst recht keine Chance. Tatsächlich hatte Don García de Toledo, Vizekönig von Sizilien, den Rittern als Pfand für sein Kommen seinen eigenen Sohn zurückgelassen. De Calais zuckte mit den Schultern.
»Wann hätte man sich schon einmal auf die Spanier verlassen können?«
»Aber in San Elmo sind unsere Brüder und Freunde«, warf Arthur ein, »wir können sie doch nicht ihrem Schicksal überlassen?«
»Wir alle haben unser Leben Christi und dem Orden geweiht«, entgegnete de Calais kalt. Arthur fröstelte. Auch Gerome war in San Elmo.
Wenig später brandete von den türkischen Stellungen her Jubel auf.
»Was ist da los?«, fragte Julien alarmiert. Niemand wusste eine Antwort.
»Über San Elmo weht weiterhin unsere Flagge«, stellte Arthur fest. Da ist nichts passiert. Die Antwort erreichte ihn erst nachts in der Auberge.
»Dragut le brûlé ist bei den Türken eingetroffen.«
Dragut le cruel – ein Ruf des Entsetzens ging durch die Herberge. Selbstverständlich hatte auch Arthur von ihm gehört. Der Mann, um den es ging, eigentlich Turgut Reis geheißen, war der erfahrenste der Korsarenkapitäne der Muselmanen. Sieger der Schlacht um Djerba, und hunderter anderer Gefechte mit christlichen Flotten. Begabtester Schüler des gefürchteten Hayreddin Barbarossa. Kein Wunder, dass seine Ankunft die Türken jubeln und die Christen verzagen ließ. Schon am nächsten Morgen bemerkten die Wachen in San Angelo, dass nun auch von jenseits der Marsamxett-Bucht hinweg auf San Elmo geschossen wurde.
»Turgut muss dort eine neue Batterie aufgestellt haben.«
»Seit gestern Morgen haben wir siebentausend Abschüsse gezählt«, ergänzte Julien, »stell dir mal vor: siebentausend! Das heißt, Moment«, er kniff die Augen zusammen, »das sind fast fünf Einschläge jede Minute. Wer kann so einem Bombardement widerstehen?«
»Es ist Wahnsinn, San Elmo nicht aufzugeben«, pflichtete ihm Arthur bei, auch wenn er sich wunderte, wie der Freund in so einer Situation mit kühlem Kopf rechnen konnte oder viel mehr, wieso ihn das interessierte? Dort verbluteten ihre Kameraden. »Noch kommt nachts im Schutze der Dunkelheit ein Boot hinüber, um Nachschub zu bringen. Aber das wird nicht mehr gehen, sobald wir Vollmond haben. Die Türken stehen direkt unter den Mauern.«
»Vielleicht weiß Capitain de Calais etwas. Lass ihn uns suchen, wenn wir abgelöst werden«, schlug Julien vor. Tatsächlich fanden sie den Kapitän im inneren Hof des Forts San Angelo.
»Wann werden wir San Elmo räumen?«, fragte Arthur erneut, als sie ihren Vorgesetzten fanden. »Jetzt mit der neuen Batterie im Norden haben sie keine Chance mehr.« Arthur erwartete eine scharfe Erwiderung, doch der alte Capitano schüttelte nur müde den Kopf.
»Die Lage ist noch verzweifelter, als ihr ahnt. Gestern Nacht haben die Türken die Besatzung des Ravelin schlafend vorgefunden und ihn erobert.«
Der Ravelin war die vorgeschobene Bastion des Forts zur Seeseite hin, niedriger als die Hauptmauer des Forts aber bereits ein Teil davon, in den die Türken vorgedrungen waren.
»Und unsere Leute sind immer noch dort?«, fragte Arthur entsetzt. De Calais nickte.
»Es gab eine Szene heute Morgen. Der Kommandant von San Elmo ist mit dem Boot herüber gekommen und forderte von Le Valette, den Posten verlassen zu dürfen.«
Arthur und Julien blickten sich an. Es musste für den Kommandanten eine unglaubliche Demütigung gewesen sein. Sie konnten es sich nicht leisten, noch mehr ihrer besten Leute sterben zu lassen. Die würde man für die Verteidigung von Birgu und San Angelo bitter benötigen. De Calais fuhr fort.
»Le Valette nickte und sagte, dann werde er mit den Anwesenden die Verteidigung persönlich übernehmen. Natürlich konnte der arme Kommandant von San Elmo das nicht akzeptieren.
Schamrot verabschiedete er sich und kehrte nach San Elmo zurück. Wir werden unsere Brüder von dort nicht wieder sehen. Zumindest nicht in diesem Leben.«
Arthur bemerkte, wie selbst der meist so ruhige Julien bestürzt schwieg.
Von nun an konnten die Verteidiger San Angelos nur hilflos zusehen, wie der Ravelin im Nordosten von San Elmo jeden Tag um eine oder zwei Steinreihen in die Höhe wuchs. Die türkischen Pioniere bauten ihn höher und höher, um schließlich von dort in das Fort hinein schießen zu können. Bald schon überragte er die Mauern des eigentlichen Forts.
»Nun können die osmanischen Scharfschützen jeden Ort im Inneren der Bastion bestreichen«, entsetzte sich Arthur.
»Ja, die Lage dort muss unerträglich sein«, pflichtete Julien ihm trocken bei. Arthur blickte ihn mit großen Augen an. Fast hätte er lachen müssen. Julien sprach es aus, als würde er eine Bemerkung übers Wetter oder das Essen machen, doch er kannte den Freund inzwischen. Unter der spröden Schale schlug sein Herz am rechten Fleck.
San Elmo fiel am achtzehnten Juni. Die letzten neun Verteidiger wurden von den verbitterten Janitscharen geköpft, auf Holzkreuze genagelt und in den großen Hafen geworfen, damit die Strömung sie nach San Angelo hinübertriebe. Le Valette war so erzürnt, dass er sämtlichen türkischen Gefangenen die Köpfe abschlagen und sie als Kanonenkugeln zu den türkischen Linien hinüber schießen ließ.
»Nun sind sie tot. Und wir sind die Nächsten«, stellte Julien trocken fest. Arthur war ebenfalls niedergeschlagen, aber ganz so schwarz wollte er nicht sehen. Ohne Hoffnung wären sie auch verloren.
»Gerome und die anderen haben die Türken über einen Monat aufgehalten. Sie sollen achttausend Mann verloren haben.«
»Was nützt uns die Verspätung, wenn Don García sowieso nicht kommt?«, fragte Julien mit einem Schulterzucken. »Und was nützen die achttausend Türken, wenn wir selbst über tausendfünfhundert Mann verloren haben? Wir sind viel weniger als sie, wenn ich dich erinnern darf. Das Ganze läuft auf eine einfache Rechnung hinaus.«
Arthur überlegte: »Wie viele Türken sind hier gelandet? Vierzigtausend? Fünfzigtausend? Wir sind mit den maltesischen Hilfstruppen zusammen vielleicht zehntausend. Wenn es weiter so geht, dann gewinnen wir.«
»Ja, wir zwei bleiben vielleicht alleine übrig«, schimpfte Julien, »was ist das alles für ein Wahnsinn? Und für uns hat es nicht einmal richtig begonnen.«
Das war für Julien wohl schon ein richtiger Gefühlsausbruch, überlegte Arthur.
Am Folgetag, während die Türken noch ihre neuen Batterien errichteten, lagen plötzlich vier spanische Galeeren im Hafen.
»Sie müssen nachts durch die Blockade der türkischen Flotte geschlüpft sein«, rief Julien bewundernd. Tatsächlich hatte Don Garcia sie aus Sizilien geschickt. Mit den Schiffen kamen zweiundvierzig Ordensritter und fünfundzwanzig weitere freiwillige Ritter, sechsundfünfzig spanische Kanoniere und sechshundert Mann Infanterie. Ein Tropfen auf den sprichwörtlichen heißen Stein, aber genug, um die Moral der Verteidiger zu heben.
Dennoch sollte Julien Recht behalten. Die Osmanen richteten all ihre Kanonen auf die beiden Halbinseln Sanglea und Birgu mit dem Fort San Angelo an der Spitze. Pioniere und Mineure trieben die Laufgräben am Fuße der Halbinseln auf die Festungswerke zu.
»Es gibt auch etwas Erfreuliches«, bemerkte Julien. Arthur sah seinen Freund erstaunt an.
»Du meinst, dass wir hier in Sanglea sicherer sind?«, fragte er. Die beiden waren bei der Umgruppierung der Truppen nach der San Michaelis Bastion am Fuße der Sanglea Halbinsel, die den Galeerenhafen nach Westen hin vom großen Hafen abschloss, verlegt worden.
Doch Julien schüttelte den Kopf. »Ich habe es auch gerade erst erfahren. Dragut ist an einer Kopfverletzung verstorben, die er sich durch einen Steinsplitter bei der Belagerung von San Elmo zugezogen hat.«
»Was?«, platzte Arthur heraus. »Und das sagst du so beiläufig, als ob den Türken eine Ratte in den Reistopf gefallen wäre?«
Julien zuckte die Schultern.
»Es ist erstaunlich, wie gut wir informiert werden, was bei den Türken vorgeht.«
»Ich nehme an, sie wissen über uns mindestens genauso gut Bescheid«, entgegnete Julien.
»Ich wette, dass mehr Männer von uns desertieren als von den Türken überlaufen«, behauptete Arthur.
Julien wiegte den Kopf: »Da könntest du Recht haben. Andererseits ist sowieso klar, was hier passiert. Dafür brauchen die Türken keine Kundschafter. Wir verteilen uns auf die Mauern von Birgu, San Angelo und San Michaelis.«
»Ja, und hier sind wir wenigstens erst einmal sicher«, bestätigte Arthur zuversichtlicher. Der Tod Draguts war in der Tat eine herausragende Neuigkeit, auch wenn der Freund sie so beiläufig erwähnte. Darüber hinaus war San Michaelis nicht nur eine Bastion, sondern ein eigenes Fort, was ihre Überlebenschancen beim nächsten Sturmangriff deutlich steigerte.
»Verlass dich da mal nicht drauf«, gab Julien zurück, als habe er Arthurs Gedanken gelesen,
»immerhin haben die Türken mit San Elmo einen Außenposten angegriffen und sich nicht gleich an Birgu gewagt.«
»Der schwächste Punkt in unserer Verteidigung ist die kastilische Bastion dort drüben. Und Pierre de Monte ist ein erfahrener Mann.« Pietro del Monte, korrigierte Arthur sich in Gedanken. Der Kommandant ihrer Bastion war Italiener, Pilier, also Vorsteher der italienischen Zunge und damit gleichzeitig Großadmiral des Ordens.
***
Kapitel 6
Franz Wolters, Schloss Vollrads, November 1565
Am nächsten Morgen verließ Franz mit der Gesandtschaft Landgraf Philipps bei Sonnenaufgang Schloss Vollrads. Durch die kahlen Weinberge stießen sie zum Rhein hinunter. In Oestrich bestaunte Franz den großen Verladekran für Weinfässer, doch Bastian führte die kleine Truppe direkt zu einer Fähre, die sie über den Fluss setzte. Für Franz ging das Staunen weiter. Der mächtige Strom wurde von zahlreichen, teils durch die winterlichen Fluten überschwemmten, Inseln geteilt, die sie umschiffen mussten. Zum ersten Mal sah er so ein großes Wasser und Inseln, die groß genug waren, um ein Haus darauf zu bauen. Die Lahn, die durch seinen Heimatort Marburg floss und selbst die Weser, die er in Hannoversch Münden gesehen hatte, waren viel schmaler und wirkten gegen die winterlichen Wassermassen des Rheins geradezu harmlos. Die Straße am Südufer führte sie bis Bingen am Rhein entlang und folgte dann einem kleineren, Nahe genannten, Flüsschen bis Kreuznach zur mächtigen Ebernburg. Die gesamte Landschaft schüchterte Franz ein. Mächtige Ströme und hohe Felsen folgten hinter jeder Wegbiegung aufeinander. Sie ritten am Westufer eines kleinen Flusses entlang. Auf der Ostseite ragten die Felsen so steil auf, dass Franz den Kopf in den Nacken legen musste um die Spitze, die noch dazu von einer Burgruine gekrönt wurde, zu sehen.
***
Weiter im Westen erhob sich eine steile rote Felswand. Vor ihnen beherrschte die Herberge der Gerechtigkeit, auf einem steilen Bergkegel errichtet, das Tal. Den Namen Herberge der Gerechtigkeit hatte der Reformator und Humanist Ulrich von Hutten der Ebernburg verliehen, da sie mehreren Reformatoren Schutz gewährt hatte.
»Mein Vater war dabei, als unser Landgraf Philipp anno dreiundzwanzig den Sickingen in die Knie zwang«, prahlte Bastian. Dennoch vermied er es vorsorglich, auf der Burg Station zu machen. Diesen Abend lagerten sie daher in einer ärmlichen Herberge in einem gottverlassenen Dorf. Da es nur zwei Schlafräume gab, musste der Herold wohl oder übel bei den Reitern in der Gaststube bleiben, während die beiden Jungfern im oberen Stock in den Frauenschlafsaal stiegen. Franz überlegte. Ob es ihm hier vielleicht gelang, endlich einmal mit seinem Engel zu sprechen? Wieder schlich er sich mit einer Ausrede aus der Gaststube.