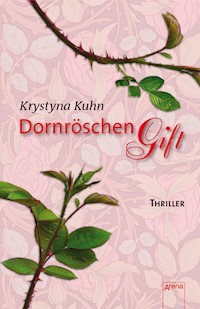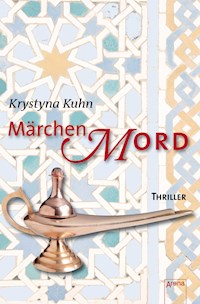5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Arena
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Das Tal
- Sprache: Deutsch
Das Tal ist zur Ruhe gekommen. So scheint es zumindest. Nur Robert ist der Einzige, der der Wahrheit über den versteckten Ort mitten in den Rocky Mountains ein Stück nähergekommen ist. Doch während er verzweifelt versucht, seine Erkenntnisse zu überprüfen, gerät Rose in große Gefahr. Wer ist der Unbekannte, der ständig in ihr Zimmer im College einbricht? Und was hat das mit Roses Vergangenheit zu tun? Während das sonst so ruhige Mädchen mehr und mehr außer sich gerät, entdeckt Robert das Unfassbare...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 269
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Titel
Krystyna Kuhn
DAS TAL – Season 2
__________________
Der Fluch
Band 5 der Serie
Thriller
Impressum
Veröffentlicht als E-Book 2012© 2011 Arena Verlag GmbH, WürzburgAlle Rechte vorbehaltenCovergestaltung: Frauke Schneider ISBN 978-3-401-80137-7www.arena-verlag.deMitreden unter forum.arena-verlag.dewww.das-tal.com
Widmung
Für Rose GardnerDie verstehen sehr wenig,die nur das verstehen, was sich erklären lässt.(Marie von Ebner-Eschenbach)
Dave Yellads Reisetagebuch
Victoria, 10. Mai 1908 Ich kann die Aufregung in meiner Seele kaum zügeln. Das Ziel meiner nächsten Reise steht fest. Ein geheimnisvolles Tal in den Rocky Mountains, das die Cree auch Tawequaesquape nennen, was so viel wie Mitte des Himmels bedeutet. Solomon Shanusk, der diesem Volk angehört, berichtete abends beim Feuer von seltsamen Vorkommnissen oben in den Bergen, weshalb die Cree diese Gegend in der Regel meiden. Shanusk transportiert im Auftrag der Hudson Bay Company Felle über die Rocky Mountains in den Westen. Ich habe beschlossen, mich seinem Treck anzuschließen.
Victoria, 17. Mai 1908 Alle Versuche scheitern, Shanusk zu weiteren Berichten zu verleiten. Seine Miene wird düster und in seine Augen tritt ein Schatten, wenn ich in ihn dringe. Er versucht mit aller Macht, mich von der Reise abzuhalten.
Victoria, 24. Mai 1908 Laut Shanusk ist man diesem Tal ausgeliefert, sobald man es betreten hat. Dieser Ort, sagt er, sucht sich seine Opfer und die Liste der Menschen, die nicht von dort oben zurückgekehrt sind, ist lang. Der Legende nach haben die Götter bis auf den Gott Coyote das Tal verlassen. Er wacht darüber, dass kein Unbefugter diesen Ort betritt.
Ich komme aus der zivilisierten Welt. Ich weiß, dass die Erde eine Kugel ist. Ich weiß, warum es stürmt und regnet. Und Erdbeben und Wirbelstürme sind keine Strafe Gottes, sondern Ergebnis bestimmter Wetterverhältnisse. Ja, ich bin überzeugt, das Geheimnis der Welt und die Existenz des Menschen irgendwann begreifen zu können.
Shanusk und sein Volk leben noch in einer anderen Welt. Sie vermuten eine unsichtbare Kraft und eine Vielzahl von Geistern hinter allen rätselhaften, nicht erklärbaren Erscheinungen. Ihrer Auffassung nach ist die Natur, wie wir sie kennen, nur ein Bild von dem »Großen Geist«, der dahintersteht.
Unterwegs, 10. Juni 1908 Nach langem Überreden hat Shanusk sich bereit erklärt, mich in das Tal zu bringen. Die lange, beschwerliche Reise, die Abende am Lagerfeuer bringen ihn dazu, ausführlicher zu berichten. Es gibt, so erzählt er, eine Möglichkeit, sich den Göttern gleichzustellen. Mithilfe der heiligen Pilze, die die bösen Geister vertreiben. Sie wachsen dort oben im Tal in den unterirdischen Gängen, die den heiligen Berg durchziehen, den die Indianer auch Blue Mind nennen.
Fields, 07. August 1908 Befinde mich seit gut zwei Wochen im Lager der Cree. Es hat mich einige Tage gekostet, das Vertrauen des Schamanen zu gewinnen. Doch dann in der Nacht des großen Vollmonds hat er mich in das Geheimnis der Pilze eingeführt. Was ich in den nachfolgenden Träumen gesehen habe, ist unglaublich. Ich kann seitdem nicht mehr schlafen. Die Bilder beschäftigen meinen Geist Tag und Nacht.
Ich, John Graham Duke of Dunbar, werde als erster Weißer diesen mysteriösen Ort betreten und irgendwann wird das Tal meinen Namen tragen.
Ich bin von Schottland aus aufgebrochen, um als reicher Mann in meine Heimat zurückzukehren. Doch nun erwarte ich etwas viel Wertvolleres. Etwas, wonach jeder Wissenschaftler strebt: Erkenntnis.
Teil I Samstag, 21. Mai 2011
1. Rose
Ich muss eine Entscheidung treffen.
Zitternd kauere ich auf dem blanken feuchten Boden, der mit Moos und Flechten bewachsen ist. Mit der Stille steigt ein muffiger Geruch nach oben. Eine Mischung aus Erde, Staub, Feuchtigkeit und Tod. Das Display meines Handys zeigt mir immer nur Ausschnitte meiner Umgebung. Alle paar Augenblicke muss ich es wieder einschalten. Ich fürchte mich vor dem Zeitpunkt, an dem der Akku seinen Geist aufgibt.
Im schwachen Lichtschein habe ich lediglich ausmachen können, dass ich mich in einer Art Höhle befinde, in die ich über einen schmalen Schacht im Boden der Hütte gelangt bin.
Ich bin nicht allein.
Direkt vor mir liegt Muriel. Ich halte ihre Hand. Ihre weißen Turnschuhe sind verdreckt, auf der Jeans zeichnet sich eine Schlammspur ab, der Wirrwarr ihrer roten Locken verdeckt ihr Gesicht.
»Muriel«, flüstere ich. »Bitte sag doch was.«
Eine Art Gurgeln antwortet mir, dann etwas, das sich anhört wie ein Atemhauch.
Das Licht des Handys lässt ihr Gesicht noch blasser erscheinen. Der Ausdruck ist so starr, als trüge sie bereits die Totenmaske. Aber noch schließt und öffnet sie die Augen. Sie ist am Leben, auch wenn ich spüren kann, wie die Kraft mit jeder Sekunde aus ihr schwindet, die ich länger warte.
Hilflos starre ich auf mein Handy, mit dem ich Hilfe holen könnte, wenn ich Empfang hätte. Ich muss nach oben, muss irgendeinen Weg finden, aus diesem Loch zu klettern, sonst ist es für Muriel zu spät.
»Ich komme wieder«, sage ich laut und versuche, meiner Stimme Sicherheit zu verleihen. »Ich komme gleich wieder.«
Der Griff ihrer kalten Finger wird kräftiger. Sie wendet den Kopf langsam hin und her. Mir scheint, sie will mir eine Antwort geben. Ich beuge mich über sie. Mein Herz schlägt dumpf und schwer und gleichzeitig breitet sich eine nie gefühlte Kälte in mir aus. Ich spüre eine klebrige Flüssigkeit, die über meine Finger rinnt. Muriels Blut. Dennoch lasse ich ihre Hand nicht los.
»Ich habe keinen Empfang, Muriel. Ich muss Hilfe holen. Hör zu, ich versuche, nach oben zu klettern. Keine Sorge, ich bin gleich wieder zurück.«
Wieder diese verneinende Kopfbewegung.
Das Handy geht aus. Ich drücke irgendeine Taste. Der schwache Lichtschein erleuchtet ihr Gesicht. Ich erkenne die Panik darin. Ihre Lippen bewegen sich unaufhörlich.
Warum will sie mich hier treffen, so spät am Abend? Was versucht sie, mir zu sagen?
Ich glaube meinen Namen zu verstehen: »Rose.« Und dann wieder Stille.
Mein Ohr schwebt jetzt dicht über ihrem Mund. Ihre Augen fallen zu.
»Muriel, du musst wach bleiben. Bitte schlaf nicht ein. Ich bin es, Rose.«
Wieder halte ich das Display direkt über ihr Gesicht. Sie blinzelt, als das Licht sie trifft, fährt sich mit der Zunge über die Lippen und dann wispert sie etwas.
Ich kann sehen, wie viel Mühe es sie kostet.
Es ist nur ein Wort.
Nein, kein Wort.
Ein Name.
Der Name, den ich am wenigsten hören will.
Ich schließe die Augen und öffne sie erst wieder, als ich das Röcheln aus Muriels Kehle höre.
Ich muss etwas unternehmen. Ich kann sie nicht einfach hier liegen lassen.
»Muriel, hörst du mich?«
Ihre Augen flattern und sie bewegt langsam den Kopf.
»Ich gehe und hole Hilfe. Du musst nur noch ein bisschen durchhalten.«
Plötzlich kann ich jedes ihrer Worte verstehen. Ihre Stimme ist leise und dennoch habe ich noch nie die Laute der Angst so deutlich vernommen.
Schwer atmend flüstert sie: »Lass mich nicht alleine sterben.«
2. David
Es würde noch Stunden dauern, bis der Mond aufging. Und vielleicht – wenn sie Glück hatten – würde sich dieser unglaubliche Sternenhimmel über dem Tal zeigen, wie David ihn hier draußen im Sperrgebiet schon oft erlebt hatte. In diesen Momenten schienen sich Erde und Himmel zu berühren und der Horizont löste sich in Nichts auf.
Aber noch hingen dunkle Wolken tief über dem See und ein kalter Wind schob unaufhörlich Wellen über die Oberfläche, die ans Ufer schlugen.
Jeder von ihnen hatte einen anderen Grund, hier zu sein. Katie, von der er glaubte, dass die reine Neugierde und Abenteuerlust sie trieb. Robert, der nach einer Begründung für alles suchte, was sie bis jetzt im Tal erlebt hatten. Der Duke, der den Spuren seines Urgroßvaters folgte.
Und er selbst …
David glaubte nicht an Geister, wohl aber an so etwas wie eine dunkle Macht. So etwas wie das Böse. Und eines war sicher: Das Böse lauerte hier draußen in diesen Wäldern, den Bergen und nicht zuletzt auch unter der Oberfläche des Lake Mirror.
Er hatte es mit eigenen Augen gesehen und am eigenen Körper erlebt. Hier oben war vieles anders als in der normalen Welt und vielleicht war das ganz gut so. Denn nur, wenn er diese dunkle Macht akzeptierte, hatte er eine Chance, die Hölle in sich selbst zu überwinden.
»Jungs, wir haben kaum noch Holz.« Katie hielt eine Kartoffel in die Glut, die sie auf einen Stock gesteckt hatte. Im roten Lichtschein des Lagerfeuers sah ihr Gesicht völlig verändert aus, fast so, als stamme sie aus einer anderen Zeit, in der es das College hier oben noch nicht gegeben hatte und das Tal vielleicht noch unberührt gewesen war.
Sie stieß Tim in die Seite. »He, Duke, du bist an der Reihe.«
»Ich schlafe«, seufzte Tim. Er lag ausgestreckt zwischen Katie und David auf seinem Schlafsack und starrte in den Himmel.
»Aber das Feuer geht bald aus.«
»Deine Kartoffel ist inzwischen sowieso schon zu Holzkohle geworden. Du hast es noch nie geschafft, dass sie essbar waren.«
»Verflucht, es wird scheißkalt diese Nacht, und wenn ich mir schon den Arsch abfrieren muss, dann will ich das wenigstens nicht hungrig tun.«
»Ich liebe es, wenn du dich klar ausdrückst, Katie West.«
Dieser Dialog ist typisch für die beiden, dachte David. Es war so etwas wie ein Spiel zwischen ihnen, das immer intensiver wurde, je öfter Tim, genannt der Duke, hier oben auftauchte und je mehr Zeit die beiden miteinander verbrachten. Eine Art Wettbewerb, fast schon ein Kampf.
»Ich gehe.« Robert hob den Kopf von seinem Notizbuch. Er trug es ständig bei sich und kritzelte in regelmäßigen Abständen etwas hinein, obwohl er bei dieser Dunkelheit eigentlich unmöglich etwas erkennen konnte.
Katie protestierte sofort. »Kommt nicht infrage, Rob.«
»Und das hast du entschieden?«, hörte David den Duke murmeln.
»Was, wenn Mr Superhirn sich beim Holzholen im Wald verirrt? Eine Klippe hinunterstürzt? Oder ohne uns einen Eingang entdeckt, das Labyrinth betritt und nicht mehr herausfindet?«
David nickte. »Keiner kennt das Tal besser als Robert. Ohne ihn wären wir hier draußen verloren. Oder weißt du, Tim, wo genau wir uns hier befinden?«
Der Duke zuckte die Schultern.
»C11«, erwiderte Robert ernst. Er hatte das Gebiet in Quadrate aufgeteilt, die sie eins nach dem anderen absuchten. »Und glaubt mir, das mit dem Holzholen schaff ich gerade noch. Ich verirre mich nicht.«
»Na also«, murmelte der Duke.
»Nein, das Risiko ist zu groß«, widersprach Katie erneut. »Rob, du bist so etwas wie unser geistiger Führer. Unser Schutz gegen die bösen Mächte hier oben.«
»Ein Mathematiker und ein Schamane? Das geht nicht.« Der Duke richtete sich auf.
»Ich habe keine übernatürlichen Fähigkeiten.« Robert klappte das Notizbuch zu, legte es zur Seite und starrte in die Flammen. Plötzlich veränderte sich sein Gesichtsausdruck. Es war, als erkenne er im Feuer etwas, was ihnen allen entging. David hätte zu gerne gewusst, was sein Freund dachte.
»Na ja, vermutlich hast du die wirklich nicht«, sagte Katie grimmig. »Denn wärst du wirklich so ein Genie, wie alle glauben, würdest du endlich die anderen Durchgänge zum Labyrinth finden und wir müssten uns nicht hier draußen besagten Arsch abfrieren.«
Die anderen enthielten sich eines Kommentars. »Glaubt ihr nicht auch manchmal«, fragte Katie schließlich in die Runde, »dass alles, was wir im Tal erleben, nicht real ist?«
»Was genau meinst du?« Tim erhob sich, bückte sich und warf einen letzten dürren Ast in die Flammen. »Den künstlichen Wasserfall? Das Labyrinth unter dem See?«
David warf ihm einen langen Blick zu. Tim war der Einzige von ihnen, der die Ereignisse im Februar nicht miterlebt hatte. Aber er hatte keine Sekunde an dem gezweifelt, was sie ihm erzählt hatten.
Ihm allein – denn die anderen hatten sie verschont.
Verschont? Bitter dachte er daran, wie Chris und Julia sich seit Weihnachten abkapselten und ihre eigenen Wege gingen. Sie waren noch nicht aus Seattle zurückgekehrt, wo sie die Ferien verbracht hatten. Angeblich wollten sie für den Grace Chronicle von einem Autorenfestival berichten. Wer’s glaubte!
Nichts sehen, nichts hören, so lautete offenbar ihre Devise, und Julia schien für David unerreichbarer denn je.
Und Rose?
David hatte überlegt, sie ins Vertrauen zu ziehen und ihr zu erzählen, was im Februar wirklich passiert war. Denn obwohl er immer noch in Julia verliebt war, zählte er Rose neben Robert zu seinen einzigen wirklichen Freunden hier oben.
Aber aus irgendeinem Grund glaubte er, dass Rose die Stärkste von ihnen allen war, und er fürchtete, dass sie die Kraft hatte, die einzig mögliche Entscheidung zu treffen: Das Tal für immer zu verlassen und zu fliehen.
Und so war David allein mit seinen Albträumen. In ihnen durchlebte er immer wieder und wieder, wie er, Robert und Katie auf den Eingang zum unterirdischen Labyrinth gestoßen waren, das direkt unter den See führte. Wie die massiven Tore sich öffneten und schlossen, nach einem Prinzip, das nur Robert verstanden hatte. Dazu sein verletztes Bein, das immer schwerer wurde, als sei es aus Stein. Manchmal nachts schreckte er hoch und konnte es wieder fühlen. Und nicht zuletzt der verglaste Kuppelsaal direkt unter dem See, wo sie auf die versteinerte Leiche von Grace, einer Studentin aus den Siebzigern, gestoßen waren.
Und Benjamin wäre fast gestorben, weil er irgendwo dort unten diese sagenumwobenen Pilze gegessen hatte, die sonst nirgendwo auf der Welt zu wachsen schienen.
»Ich verstehe es einfach nicht«, sagte David und er sagte es nicht zum ersten Mal. »Die Eingänge waren da. Der Wasserfall. Und jetzt ist plötzlich alles verschwunden? Vielleicht ist es sinnlos, immer wieder danach zu suchen. Vielleicht offenbart uns das Tal seine Geheimnisse nur, wenn es das will? Und wir können es nicht beeinflussen.«
»Die Eingänge sind noch da«, erklärte Robert in aller Ruhe. »Nur öffnen sie sich nicht.«
»Wie ist das möglich?«
»Wenn diese Formel vollständig wäre …«
Katie rollte mit den Augen. »Diese mysteriöse Formel hängt mir langsam zum Hals heraus!«
Robert ließ sich nicht beirren. »Wenn ich ihre Bedeutung verstehen könnte, dann wüsste ich den Grund.«
Katie zog ihren Stock aus der Glut. »Total verkohlt. Ich schaffe es einfach nicht, den richtigen Moment abzupassen.« Sie ließ die Kartoffel frustriert vor sich ins Gras fallen, wo sie vor sich hin qualmte.
Wieder herrschte eine Weile lang Schweigen, das Katie schließlich brach. »Es gibt eine Möglichkeit, die wir noch nicht versucht haben …«
Niemand antwortete ihr, doch es lag auf der Hand, was sie meinte.
»Ich habe es schon einmal getan. Vor einem Jahr. Als wir Angela Finder gefunden haben.«
»Das war etwas anderes«, erklärte David.
»Warum?«
»Frag Robert.«
Den Blick unverwandt auf den See gerichtet, schwieg Robert.
»Rob? Was meinst du? Wir haben uns diese Glaskuppel unter der Wasseroberfläche nicht eingebildet. Wir müssen nur tauchen.«
»Der See ist unberechenbar«, widersprach David.
»Und was ist dein Vorschlag, David? Willst du das ganze Unternehmen einfach abbrechen?«
»Vielleicht ist es besser, nicht weiter nachzuforschen.«
»Möchtest du es nicht verstehen?«
»Klar möchte ich das. Es sind schon so viele Menschen gestorben …«
»Eben …«
»Und …« David brach ab und holte tief Luft. »Ich … ich konnte nichts dagegen tun.«
Robert hob den Kopf und sah ihn lange an. Es lag so etwas wie Einverständnis in seinem Blick, doch dann sagte er: »Katie hat recht …«
»Na also …«
»Und David hat auch recht. Es sollte niemand mehr sterben … müssen.«
»Und wie willst du das verhindern?«, erklang Tims Stimme. Diesmal war jeder Spott aus seiner Stimme verschwunden.
»Ich kann es nicht verhindern.« Robert erhob sich. Seine schmale Gestalt stand so nah am Feuer, dass David fürchtete, er könnte in Flammen aufgehen. »Aber wir können auch nicht einfach abbrechen. Es ist die Aufgabe, die das Tal uns stellt.«
»Du meinst, wir sind so etwas wie Auserwählte?«, fragte Katie.
Robert schüttelte den Kopf. »Quatsch. Aber ich habe es mir geschworen. Irgendwann werde ich das Tal verstehen.«
»Und wir haben alle vier versprochen, nicht aufzugeben, bis wir das Geheimnis kennen«, erklärte Tim entschieden.
Wieder schwiegen sie und David dachte, dass dieser Schwur ihn von seinen eigenen Plänen abhielt. Dem Schwur, den er sich selbst gegeben hatte. Er sah in die Runde. Aber er würde die anderen nicht im Stich lassen und vor allem nicht – Robert. Er spürte die Verantwortung für ihn.
Er legte sich auf seinen Schlafsack und fühlte die Wärme des Feuers, bemerkte, wie der Duke sich erhob, um frisches Holz zu holen, horchte, wie Robert neben ihm wieder die Seiten des Notizbuches umschlug. Und er war kurz davor, in seine eigene Welt abzudriften, als ein lautes Geräusch die Stille durchbrach.
Ein Telefon.
Erschrocken richtete er sich auf, sah, wie der Duke, den Stapel Holz im Arm, mitten in der Bewegung verharrte, wie Robert sein Notizbuch fallen ließ, wie Katie ihn anstarrte.
Sein Handy klingelte.
Das war unmöglich. Alle bisherigen Versuche, bei ihren Expeditionen in Verbindung zu bleiben, waren ohne Erfolg geblieben. Hier draußen gab es keinen Empfang. Hatte es noch nie gegeben.
Aber … das Klingeln hörte nicht auf.
»Willst du nicht rangehen?«, fragte Katie.
David griff nach seinem Rucksack, der am Kopfende des Schlafsacks lag, und wühlte darin herum, bis er das Vibrieren des Handys in seiner Hand spürte. Das Display leuchtete auf und er konnte den Namen des Anrufers erkennen.
Rose?
David verstand kaum, was die aufgeregte Stimme am anderen Ende sagte, aber eines begriff er: Wieder war jemand gestorben und er, David, hatte es nicht verhindern können.
3. Rose
Im Büro des Sicherheitsdienstes ist es eisig kalt und das Flackern der Bildschirme bringt mich völlig durcheinander. Die Kameras sind nicht ausgeschaltet und ich kann mich selbst beobachten, wie ich auf diesem Stuhl sitze. Der Körper angespannt, das Gesicht ein verängstigtes weißes Oval. Jede meiner Bewegungen ist unsicher, ja geradezu fahrig. Immer wieder versuche ich, Haare, die nicht vorhanden sind, aus dem Gesicht zu streichen. Eine lächerliche Geste. Und – denke ich – man sieht es mir an, dass ich nicht die Wahrheit sage.
Ich bin im falschen Film. Irgendwie hineingeraten und habe keine Ahnung, wie ich wieder herauskommen soll. Schließlich spiele ich so etwas wie die Hauptrolle. Ich bin diejenige, die die Leiche entdeckt hat. Bei dem Gedanken daran spüre ich das klebrige Blut an meinen Fingern und unwillkürlich kontrolliere ich meine Kleidung nach weiteren Blutflecken. Ich möchte mir dringend die Hände waschen, aber ein Blick auf den Beamten sagt mir, dass er es mir nicht schon wieder gestatten wird, den Waschraum aufzusuchen.
Ich werde die Bilder einfach nicht los. Sie haben sich fest in mein Gedächtnis eingebrannt.
Die Dunkelheit in dem Loch.
Das Bewusstsein, dass Muriel dort unten in diesem Schacht gestorben ist und ich ihr nicht helfen konnte.
Die lange Zeit des Wartens, bis die Security endlich eintraf. Und die Erleichterung, als die Männer des collegeeigenen Sicherheitsdienstes vor mir standen.
Nur wenig später kamen die Sanitäter und der Notarzt und am Ende schließlich die Beamten der Spurensicherung, die sich in ihren weißen Overalls und den Plastikhüllen über ihren Schuhen gleichsam in Zeitlupe bewegten. Angestrahlt von den grellen Lampen, die die Dunkelheit erhellten und alles in dieses unwirkliche Licht tauchten, sahen sie aus wie Außerirdische, die gerade im Tal gelandet waren.
Ich konnte meinen Blick nicht von der Trage lösen, die sie aus der Hütte rollten und auf der dieser Plastiksack lag, der leise im Wind raschelte.
In eine warme Decke gehüllt, klammere ich mich an den Stuhl im Büro der Security. Ich bin total erschöpft, doch die unaufhörlichen Fragen prasseln auf mich ein und geben mir keine Chance zum Luftholen. Ein Ende ist nicht abzusehen, aber das Schlimmste ist das Chaos, das sich in meinem Innern ausbreitet, verborgen für Superintendent Richard Harper, der mich keine Sekunde aus den Augen lässt. Unsichtbar für die beiden Beamten, die, ohne eine Miene zu verziehen, auf ihren Stühlen sitzen, als seien sie festgeklebt. Kann man das lernen? Keine Reaktion zu zeigen? Kein Gefühl? Keine Trauer angesichts des Todes?
Mrs Jones, die Vertrauenslehrerin, streicht sich eine dunkelbraune Strähne ihrer langen Haare aus dem Gesicht. Es ist ihr anzusehen, dass sie sich nur schnell etwas übergezogen hat, als man sie benachrichtigt hat. Sonst immer korrekt gekleidet, stehen jetzt zwei Knöpfe ihrer weißen Bluse offen. Zudem trägt sie keinen Schmuck. Und die Wimperntusche unter ihrem rechten Auge ist verschmiert.
»Es ist halb zwei Uhr nachts«, sagt sie mit Blick auf ihre Uhr. »Sie sehen ja selbst, Miss Gardner ist völlig erschöpft. Sie steht unter Schock.«
Nicht zum ersten Mal interveniert Mrs Jones bei dieser Befragung, doch wie die Male zuvor ignoriert Superintendent Harper ihren Protest.
Ich denke an meine Mutter und daran, was sie wohl sagen würde, wenn sie wüsste, was ich hier mache. Sie würde nicht verstehen, wie ich auf den Gedanken komme, ohne Anwalt diese Vernehmung über mich ergehen zu lassen. Aber obwohl ich ganz genau weiß, dass ich theoretisch die Aussage verweigern könnte, hält mich dieses schreckliche Gefühl der Ohnmacht in seinen Klauen. Ich habe einfach nicht die Kraft, mich zu widersetzen.
»Also, Miss Gardner, jetzt erklären Sie uns bitte noch einmal, was sie dort an der Hütte wollten.«
»Ich wollte mich mit Muriel treffen.«
»Muriel Anderson.«
Ich nicke.
»Warum?«
»Sie … sie hat das Treffen vorgeschlagen. Sie wollte mir etwas erzählen.«
»Und was?« Harper lehnt sich zurück, ohne den Blick von mir zu nehmen.
»Das weiß ich nicht.«
»Sie waren also bereit, sich zu Einbruch der Dämmerung mitten im Nirgendwo mit ihr zu treffen, ohne zu wissen, worum es ging?« Verwundert hebt er die Augenbrauen.
»Ich hatte den Eindruck …« Ich halte kurz inne und überlege, wie ich es am besten formulieren soll. »Muriel wollte mir ein Geheimnis anvertrauen.«
Er pfeift durch die Zähne. »Ein Geheimnis?«
»Ja.«
Er lässt nicht locker. »Und Sie haben natürlich keine Ahnung, worum es bei diesem … Geheimnis ging?«
»Nein, als ich dort draußen … an der Hütte ankam … es gab keine Gelegenheit mehr – sie war schon …«
»Tot?«
»Nein …« Ich schüttele den Kopf. »Sie war zu schwach, um zu sprechen.« Wieder höre ich Muriels keuchenden Atem und mir wird klar, dass ich dieses Geräusch niemals vergessen werde. Sekundenlang kann ich dem Gespräch nicht mehr folgen. Aber offensichtlich hat Superintendent Harper bereits die nächste Frage gestellt. Er sieht mich stirnrunzelnd an.
»Entschuldigen Sie, was haben Sie gesagt?«
»Um wie viel Uhr waren Sie genau verabredet?«
»Um acht.«
»Wie lange braucht man, um vom College zur Hütte zu kommen?«
Er kennt die Antwort, aber er will sie immer wieder von mir hören.
»Eine halbe Stunde vielleicht.«
»Und wann waren sie dort?«
»Um halb neun.«
»Sie kamen also dreißig Minuten zu spät?«
»Ja.«
Während ich nicke, jagt mir nicht zum ersten Mal der Gedanke durch den Kopf, ich könnte schuld sein. Vielleicht, wenn ich pünktlich gewesen wäre … und dann … ich denke daran, was die Tage zuvor passiert ist. Soll ich davon erzählen? Ich entscheide mich dagegen. Eine unbestimmte Angst hält mich zurück. Nicht ich bin es, die tot ist, aber was, wenn …
»Warum kamen Sie zu spät, Miss Gardner?«
»Ich habe noch jemanden unterwegs getroffen.«
»Wen?«
»George Tudor.«
»Ach ja, das haben Sie ja bereits zu Protokoll gegeben. Er hat sich mit ihnen unterhalten. Worüber?«
»Nichts Besonderes.«
Noch ein Punkt, in dem ich nicht die Wahrheit sage. Ich fühle mich gefangen in diesem Gespinst aus Lügen und kann mich nicht mehr daraus befreien. Es ist alles zu kompliziert. Mom, denke ich, und wünsche jetzt doch, sie wäre hier.
Aber ich kann mich nicht immer an meine Mutter klammern und sie alles für mich regeln lassen. Ich muss lernen, selbstständig zu werden.
»Und deswegen haben Sie ihre Freundin allein dort draußen warten lassen?«
»Sie war nicht meine Freundin.« Noch während ich es sage, weiß ich, dass es ein Fehler ist.
»Ach ja? Interessant. Sie war gar nicht ihre Freundin. Aber Sie teilen ein Geheimnis.«
Mrs Jones räuspert sich und blickt mich mit ihren schmalen Augen besorgt an. Dann holt sie tief Luft und wendet sich an Harper: »Können Sie das Gespräch nicht morgen fortsetzen?« Superintendent Harper ignoriert ihren Einwand erneut.
»Diese Hütte? Ist sie ein üblicher Treffpunkt für sie oder andere Studenten?«
Warum fragt er, wenn er die Antwort bereits kennt?
Ich schüttele den Kopf. »Nein, ich glaube nicht.«
»Und dann wollten Sie sich ausgerechnet dort treffen? Das hat sie nicht stutzig gemacht?«
Ich antworte nicht.
»Wer hat den Treffpunkt vorgeschlagen?«
»Muriel.«
»Sie schlug also diesen Treffpunkt vor, der außerhalb des Collegegeländes liegt. In einem Gebiet, das laut Collegeverwaltung nicht betreten werden darf? Zu einer Uhrzeit, wo es da oben schon dunkel ist. Das klingt in meinen Ohren ziemlich absurd.«
»Muriel, sie hatte diese Hütte wohl kurz vorher entdeckt und sie … sie wollte offenbar ungestört sein.«
»Warum? Ach ja, ich weiß schon … das Geheimnis.«
»Ja.«
»Das sie jetzt immer noch nicht kennen.«
Ich zögere kurz. Nur den Bruchteil einer Sekunde. Gott sei Dank bemerkt er es nicht.
»Was könnte das gewesen sein, was so wichtig war? Was glauben Sie persönlich?«
»Ich sage doch, ich habe keine Ahnung.«
Meine Zähne schlagen aufeinander, während ich lüge. Inzwischen weiß ich, dass ich das hier nicht durchstehe. Mom hat recht. Ich komme allein einfach noch nicht klar. Harper beugt sich mit der nächsten Frage nach vorne. »Sie sagen, Muriel Anderson war noch nicht tot, als sie bei ihr ankamen …«
Ich nicke.
»Und was …«, er macht eine Pause, »was haben Sie getan, um ihr zu helfen?«
Nichts. Ich habe nichts getan. Nur gewartet, bis sie gestorben ist.
»Ich … ich habe David angerufen.«
»David?«
»David Freeman, er ist in meinem Jahrgang.«
»Warum ihn? Warum nicht gleich den Notruf?«
»Ich weiß es nicht … Vielleicht, weil David näher war?«
»Weil er näher war?«
Warum muss er immer alles wiederholen? Dadurch klingt das, was ich sage, noch einmal so absurd. Konzentrier dich, Rose. Du musst dich konzentrieren. Der Grat zwischen Lüge und Wahrheit ist ziemlich schmal.
»Ich … ich wollte ja den collegeeigenen Sicherheitsdienst anrufen. Aber ich hatte die Nummer nicht auf meinem Handy gespeichert.«
Harper schüttelt den Kopf. »Ihnen war doch klar, dass ihr Freund … dass Mr Freeman auf einem Ausflug war und nicht im College. Sie wussten ganz genau, dass er ihnen gar nicht helfen konnte. Also noch mal: Warum haben Sie nicht den Notruf gewählt?«
»Ich … ich war verwirrt. Ich wollte einfach nur mit jemandem reden. Jemand, den ich kenne und der mir sagen konnte, was zu tun war.«
Eine Weile herrscht Schweigen. Vielleicht ist er jetzt endlich zufrieden.
Nein. Es geht weiter. Er tut nur so, als ob er lange und gründlich nachdenkt.
»Sie fürchteten also, Muriel könnte sterben … oder?«
»Ja.«
»Und da haben Sie natürlich Erste Hilfe geleistet.« Er hebt beide Hände, sieht mich abwartend an.
»Nein«, flüstere ich.
»Nein?«
Ich schüttele den Kopf.
»Warum nicht?«
»Muriel hatte Schmerzen. Ich wollte sie nicht bewegen. Ich hatte Angst, etwas Falsches zu tun.«
»Sie hatten Angst, etwas Falsches zu tun, und haben deswegen gar nichts getan.«
Das ist keine Frage, sondern eine Feststellung und wieder gruselt es mich vor mir selbst. Es ist nicht das Einzige, was ich mir nie werde verzeihen können.
»Deswegen haben Sie … ich wiederhole es noch einmal«, er stoppt kurz, um seine Verwunderung zu zeigen, »gar nichts getan.«
Mir fällt keine Antwort ein, stattdessen schwirren die Fragen in meinem Kopf herum. Seine und die, die ich mir selbst stelle.
Es ist wie ein Déjà-vu.
Es ist noch nicht lange her, dass ich so eine Befragung hinter mich bringen musste. Bei der Staatsanwaltschaft in Boston. Sie sollte zur Festnahme von J. F. führen. Wie damals habe ich das Gefühl, sie wollen mich in die Enge treiben. Sie wollen, dass ich mich in Widersprüche verwickle, wollen irgendetwas Bestimmtes hören, doch ich weiß nicht, was. Und wieder denke ich an den Befehl meiner Mutter, niemals etwas ohne sie, ohne meinen Anwalt zu sagen.
Und ich verstehe nicht, wie das alles zusammenhängt – aber das tut es, ich weiß es jetzt. Mein Ohr an Muriels Mund. Der Name, den sie gehaucht hat, kurz bevor sie gestorben ist. Ich erinnere mich genau an den Ausdruck in ihrem Gesicht, als sie das Treffen vorschlug. Schock, Vorsicht, Angst.
All das müsste ich dem Superintendenten erklären, wenn er die Wahrheit wissen will. Aber wie soll das gehen, wenn ich es selbst nicht verstehe?
»Es tut mir leid.« Das ist alles, was ich hervorbringe.
»Was tut ihnen leid? Dass Sie ihr nicht geholfen haben?«
Mrs Jones nickt mir aufmunternd zu und für den Bruchteil einer Sekunde denke ich, wenn ich es zugebe, wenn ich alles zugebe, ist es vielleicht vorbei und ich kann in mein Zimmer gehen, um endlich zu schlafen.
»Ja.«
Aber ich hätte wissen müssen, dass das nicht funktioniert. Ein leises Lächeln liegt auf seinen Lippen, als er feststellt: »Vielleicht wollten Sie das ja gar nicht.«
Stille.
Ich höre nur meinen Atem und das Ticken einer Uhr, die nicht in meinem Sichtfeld ist.
»Nein«, widerspreche ich.
»Wissen Sie, was ich glaube? Ich glaube, es war Ihnen egal, ob dieses Mädchen stirbt. Sonst hätten Sie das getan, was man in so einem Fall tut. Sie hätten Hilfe geholt. Sie hätten den Notruf gewählt.«
»Nein.« Ich merke, wie eine einzelne Träne die Wange herunterläuft, aber ich werde jetzt nicht weinen. »Ich konnte sie dort unten nicht alleine lassen. Sie hatte Angst. Furchtbare Angst. Ich habe ihre Hand gehalten, ich bin bei ihr geblieben … sie hat mich darum gebeten.«
»Ich kann das nicht länger verantworten.« Mrs Jones springt auf. »Sie sehen, in welchem Zustand sie ist. Sie steht noch immer unter Schock. Brechen Sie ab. Ich muss darauf bestehen.«
Harpers Miene ist unbewegt, doch seine Stimme ändert sich plötzlich. »Wollen Sie das wirklich, Miss Gardner?«, fragt er sanft. »Wollen Sie aufhören, bevor ich wirklich begriffen habe, warum dieses Mädchen gestorben ist? Oder wollen Sie mir helfen, die Wahrheit zu erkennen?«
Ich schaue ihn an und sehe etwas in seinen Augen, das mir Mut gibt.
Langsam nicke ich.
Er lächelt, ganz kurz nur, dann ziehen sich seine Augenbrauen wieder zusammen.
»Also noch einmal von vorne: Wie haben Sie Muriel kennengelernt?«
Teil II Eine Woche zuvor Sonntag, 15. Mai bis Samstag, 21. Mai 2011
4. Rose
Es ist der Sonntag, bevor das neue Studienjahr beginnt. Seit dem Mittag kommt ein Bus nach dem anderen hier oben am Parkplatz an und die neuen Studenten stürmen das Collegegebäude. Überall erwartungsvolle Gesichter, manche voller Hoffnung, andere eher besorgt. Die Eingangshalle dröhnt von den lauten Stimmen. Ständig stolpert man über Koffer, Reisetaschen, Rucksäcke, Plastiktüten und Sportgeräte. Die Unterhaltungen drehen sich immer um dieselben Dinge: wann sie ihre Zimmer zu sehen bekommen, welche Hauptfächer sie gewählt haben und: Wow, ist dieLandschaft toll.
Das Tal ist heute wirklich in Bestform. Die neuen Studenten des Grace College werden mit einem strahlend blauen Himmel begrüßt und einer Sonne, die die Temperaturen nach oben schnellen lässt.
Zusammen mit David und drei Senior-Studenten bin ich dafür verantwortlich, das absolute Chaos zu vermeiden. Der Dean hat mich gefragt, ob ich Studienbetreuerin werden will, und ich habe den Job übernommen. Unter anderem auch deswegen, weil er mir das Gefühl gibt, wirklich angekommen zu sein, hier oben im Tal.
Mrs Jones nähert sich mit einer Gruppe Mädchen, die nervös ihre Koffer hinter sich herziehen, und strahlt mich an. »So, das müssten die Letzten sein.« Sie drückt mir eine Liste in die Hand. »Wollen Sie die Begrüßung übernehmen, Rose?«
Mrs Jones unterrichtet im Department Psychologie und ist dieses Semester als Jahrgangsleiterin für die Freshmen verantwortlich.
Psychologen habe ich mir ehrlich gesagt immer anders vorgestellt. Irgendwie – keine Ahnung – zerstreut, na ja, und ein wenig schlampig. Mit diesem Blick, der tief in die Seele schaut. Mrs Jones erfüllt diese Vorurteile in keiner Weise. Gepflegt und geschmackvoll in eine hellgraue Hose und weiße Bluse gekleidet, erinnert mich ihr eleganter Kleidungsstil an meine Mutter. Eine Frau, die immer alles im Griff hat, besonders sich selbst.
Ich glaube, wir werden gut miteinander auskommen.
»Was meinen Sie, Rose?«, raunt Mrs Jones mir zu. »Am besten, wir schicken sie nach der Begrüßung erst einmal in ihre Zimmer, damit sie auspacken können, und treffen uns anschließend im Foyer zu einer Führung durch das Gebäude?«
Ich nicke.
Sie blickt auf ihre Armbanduhr. »Sagen wir in einer Stunde?«
»Okay.«
Ich wende mich der Gruppe zu. Blicke treffen mich und bleiben an mir hängen.
»Krebs …?« Das Wort wird geflüstert, aber ich weiß sofort, dass ich gemeint bin oder besser gesagt meine Glatze.
»Kann sie keine Mütze tragen oder eine Perücke?«
Ich ignoriere die Stimme.
»Ich meine, das hier ist eine Eliteuni, oder? Da sollte man doch auf sein Aussehen achten.«