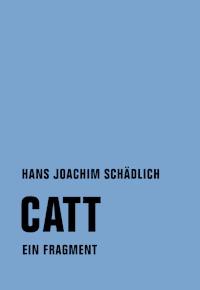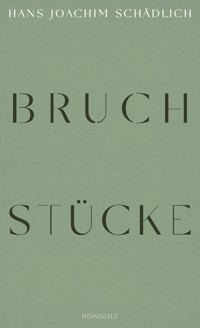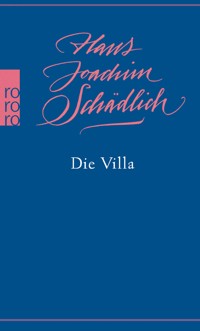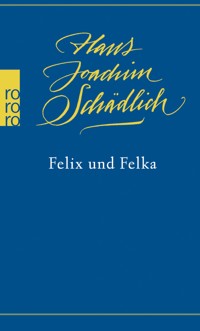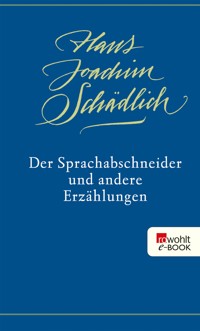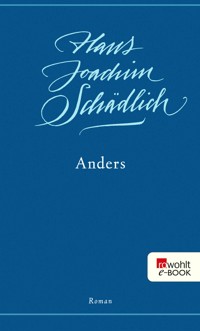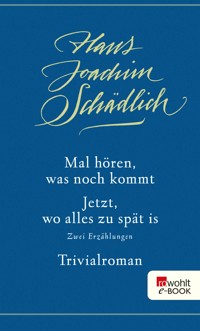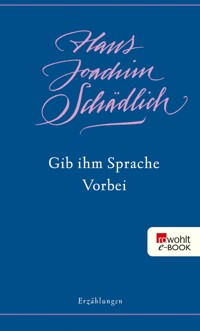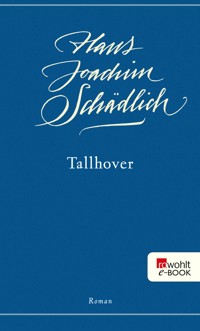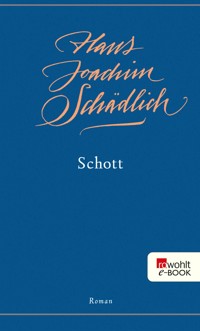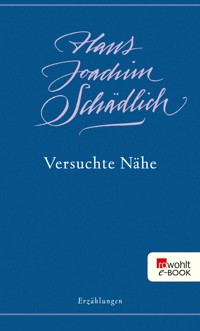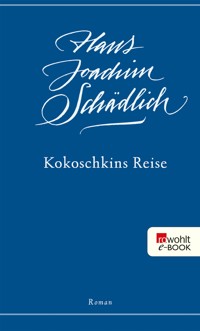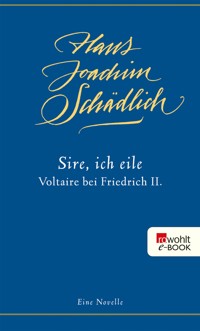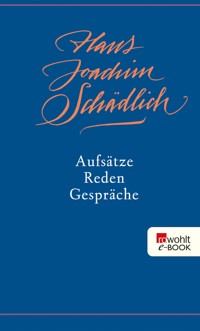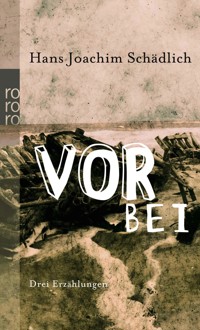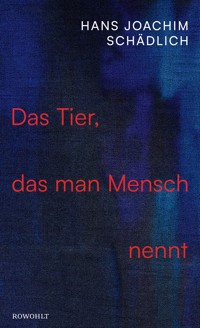
21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
«… hauptsächlich hasse und verachte ich das Tier, das man Mensch nennt, obwohl ich herzlich John, Peter, Thomas usw. liebe.» Unter diesem Credo von Jonathan Swift aus dem Jahr 1725 versammelt Hans Joachim Schädlich in seinem neuen Buch Texte, die wie in einem Kaleidoskop historisch genau recherchierte Verheerungen der letzten Jahrhunderte spiegeln. Verbrechen der Nazizeit, des Stalinismus und totalitärer Systeme und Gewalttaten Einzelner, die an Rohheit kaum zu überbieten sind, werden konterkariert von skurrilen und sanfteren Texten. Voller Achtung vor schöpferischer Genialität, mit einer fast liebevollen Hinwendung zu den kleinen, verzeihlichen menschlichen Schwächen besticht Hans Joachim Schädlich mit einer sprachlichen Knappheit, die Raum lässt für eigene Deutung. Ein wichtiges Buch in einer Zeit, in der die Weltordnung wieder vom Sieg der Gewalt bedroht wird.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 112
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Hans Joachim Schädlich
Das Tier, das man Mensch nennt
Über dieses Buch
«… hauptsächlich hasse und verachte ich das Tier, das man Mensch nennt, obwohl ich herzlich John, Peter, Thomas usw. liebe.» Unter diesem Credo von Jonathan Swift aus dem Jahr 1725 versammelt Hans Joachim Schädlich in seinem neuen Buch Texte, die wie in einem Kaleidoskop historisch genau recherchierte Verheerungen der letzten Jahrhunderte spiegeln.
Verbrechen der Nazizeit, des Stalinismus und totalitärer Systeme und Gewalttaten Einzelner, die an Rohheit kaum zu überbieten sind, werden konterkariert von skurrilen und sanfteren Texten. Voller Achtung vor schöpferischer Genialität, mit einer fast liebevollen Hinwendung zu den kleinen, verzeihlichen menschlichen Schwächen besticht Hans Joachim Schädlich mit einer sprachlichen Knappheit, die Raum lässt für eigene Deutung. Ein wichtiges Buch in einer Zeit, in der die Weltordnung wieder vom Sieg der Gewalt bedroht wird.
Vita
Hans Joachim Schädlich, 1935 in Reichenbach im Vogtland geboren, arbeitete an der Akademie der Wissenschaften in Ost-Berlin, bevor er 1977 in die Bundesrepublik übersiedelte. Für sein Werk bekam er viele Auszeichnungen, u.a. den Heinrich-Böll-Preis, Hans-Sahl-Preis, Kleist-Preis, Schiller-Gedächtnispreis, Lessing-Preis, Bremer Literaturpreis, Berliner Literaturpreis und Joseph-Breitbach-Preis. 2014 erhielt er für seine schriftstellerische Leistung und sein politisches Engagement das Bundesverdienstkreuz. Hans Joachim Schädlich lebt in Berlin.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, März 2023
Copyright © 2023 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
Covergestaltung Anzinger und Rasp, München
Coverabbildung Adobe Stock; steve-johnson/unsplash
ISBN 978-3-644-00926-4
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
In memoriam Alexander V. Isačenko
«… hauptsächlich hasse und verachte ich das Tier, das man Mensch nennt, obwohl ich herzlich John, Peter, Thomas usw. liebe.»
Jonathan Swift, Brief an Alexander Pope vom 29. September 1725
Die Nacht der Poeten
Der Pockennarbige ließ die schweinsäugige Halbglatze rufen und befahl, die Schriftstellerjuden auszurotten.
«Sie schreiben zwei andere Sprachen», sagte der Pockennarbige. «Wurzellose Kosmopoliten. Internationale Verschwörer.»
Schweinsauge legte am nächsten Tag eine Liste mit dreizehn Namen vor:
David Bergelson
Itzik Fefer
David Hofstein
Jossif Jusefowitsch
Leib Kwitko
Solomon Losowski
Perez Markisch
Boris Schimeliowitsch
Benjamin Suskin
Leon Talmi
Emilia Teumin
Chaja Watenberg-Ostrowski
Ilja Watenberg
«Das ist doch nicht alles!», sagte der Pockennarbige.
Schweinsauge sagte:
«Die berühmtesten. Eine erste Charge. Es sind Übersetzer dabei, ein Schauspieler, ein Arzt und ein Ex-Stellvertretender Außenminister.»
Der Pockennarbige machte hinter jedem Namen ein Häkchen.
Schweinsauges Häscher schwärmten aus, die Juden einzufangen.
Der erste, den sie griffen, war David Hofstein, am 16. September 1948. Der letzte war am 3. Juli 1949 Leon Talmi.
In den Kellern mußten die dreizehn eine Schuld bekennen.
Um ihr Bekenntnis zu befördern, wurden sie gefoltert. Sie durften nicht schlafen. Sie wurden geprügelt, mit Fäusten oder Knüppeln. Es wurden ihnen die Fingernägel ausgerissen.
Die Folterungen und falschen Geständnisse waren sinnlos, weil von vornherein feststand, daß sie sterben sollten.
Am längsten brachten Hofstein, Fefer und Suskin in den Kellern zu.
Sie waren schon 1948, im September und Dezember, verhaftet worden. Die anderen 1949.
Als erster bekam Ilja Watenberg eine Kugel in den Kopf, am 12. Januar 1952.
Sieben Monate später, in der Nacht vom 12. zum 13. August 1952, wurden die zwölf anderen erschossen.
Der Schütze war Wassili Blochin.
Von 1924 bis zum Tod des Pockennarbigen im März 1953 war die Ermordung von Häftlingen Blochins Geschäft. Nebenbei nahm er an Fernkursen des ‹Instituts zur Erhöhung der Qualifikation ingenieurtechnischer Arbeiter› teil.
Bei den Erschießungen trug Blochin eine lederne Metzgerschürze, um seine Uniform vor Blut- und Gehirnspritzern zu schützen.
Er schoß mit einer deutschen Walther-Pistole, weil die bei ständigem Feuer nicht klemmte.
Antwort
Philipp II., König von Makedonien, drohte Sparta, der Hauptstadt Lakoniens:
«Wenn ich euch besiegt habe, brennen eure Häuser, und eure Frauen werden Witwen.»
Die Antwort der Spartaner:
«Wenn.»
(Nach Plutarch)
Report
Frau Richter aus der Töpferstraße sagt zu ihrem Nachbarn:
«Wer ist der Kerl mit dem komischen weißen Hut. Der wohnt mit seinen Leuten in der Schlesischen Versicherung. Die haben das ganze Haus.»
Der Nachbar sagt:
«Das ist ein Araber.»
«Was macht ein Araber in Oybin?»
«Weiß ich nicht.»
«Der geht jeden Tag in sein Büro im Haus ‹Charlotte›. Die Kinder laufen ihm hinterher. Der gibt den Kindern Schokolade. Unser Martin hat auch Schokolade von ihm gekriegt. Wo hat der die Schokolade her. Unsereins kriegt keine zu kaufen.»
Der Nachbar sagt:
«Vielleicht von der Wehrmacht.»
«Was hat der mit der Wehrmacht zu tun.»
«Keine Ahnung.»
Mohammed Amin al-Husseini, Großmufti von Jerusalem und Vorsitzender des Obersten Islamischen Rates im britischen Mandatsgebiet Palästina, geboren 1895, stammte aus einer wohlhabenden Familie, die über ausgedehnten Landbesitz verfügte. al-Husseini haßte Juden, und er haßte Briten. Husseinis große Zeit kam 1933. Die Nazis, die in Deutschland 1933 an die Macht gebracht worden waren, hatten die Vernichtung der Juden auf ihre Fahne geschrieben. Kurze Zeit nach der Machtübergabe an die Nazis bot Husseini ihnen seine Dienste an.
Bei dem Aufstand der Araber in Palästina gegen die Juden und die britische Mandatsmacht 1936–1939 spielte Husseini eine führende Rolle. Britische Truppen schlugen den Aufstand nieder.
Husseini floh in den Irak. In Bagdad beteiligte er sich an einem Putsch gegen die britische Kolonialmacht. Am 1. und 2. Juli 1941 nahm er an einem Pogrom gegen irakische Juden teil.
Nach dem Scheitern des Putsches in Bagdad floh Husseini im Oktober 1941 nach Rom. Er traf mit Mussolini und mit dem Außenminister Ciano zusammen.
Am 6. November 1941 flog Husseini nach Berlin.
Er sprach mit Ribbentrop. Am 28. November empfing ihn Hitler.
Husseini ersuchte Hitler um Hilfe beim Aufbau eines arabischen Staates in Palästina.
Er sagte:
«Die Araber sind die natürlichen Freunde Deutschlands, weil sie drei gemeinsame Feinde bekämpfen: die Juden, die Engländer und den Bolschewismus.»
Hitler sagte, Deutschland trete für einen kompromißlosen Kampf gegen die Juden ein. Dazu gehöre selbstverständlich der Kampf gegen die jüdische Heimstätte in Palästina. Das deutsche Ziel sei die Vernichtung des Judentums im arabischen Raum, das unter der Protektion der britischen Macht lebe.
Husseini erhielt in Berlin eine Residenz in einem Haus aus jüdischem Besitz. Es wurde ihm ein Mitarbeiterstab zur Verfügung gestellt. Das Auswärtige Amt zahlte ihm monatlich 90000.– Mark, zum Teil in Valuta.
Husseini betrieb antisemitische Hetze in Deutschland und – über den «Deutschlandsender» Zeesen – in arabischsprachigen Ländern. Der Langwellensender Zeesen bei Königswusterhausen sendete u.a. als «Voice of Free Arabism» (VFA) in arabischer Sprache.
Am 19. Dezember 1941 sagte Husseini bei der Eröffnung des Islamischen Instituts in Berlin:
«Unter denen, die die Muslime am meisten hassen, sind die Juden.»
Anläßlich des Fastenbrechens 1942 sprach er in der Wilhelmsdorfer Moschee.
Nach dem Sieg der West-Alliierten in der zweiten Schlacht von El Alamein über die deutschen und italienischen Truppen im November 1942 rief Husseini zum Dschihad gegen die Juden auf.
In dem von Nazi-Deutschland und Italien besetzten Jugoslawien warb Husseini Anfang 1943 muslimische Bosnier für den Eintritt in die SS. Bis April meldeten sich über 20000 muslimische Freiwillige.
Es kam Husseini entgegen, daß muslimische Politiker auf einen Anschluß Bosnien-Herzegowinas an das Großdeutsche Reich hofften.
Husseini bildete die Imame dieser SS-Truppen aus.
In einem Vortrag sagte er zu den Imamen:
«In der Bekämpfung des Judentums nähern sich der Islam und der Nationalsozialismus einander an.»
Unter dem Kommando deutscher SS-Offiziere bildeten die muslimischen Rekruten einen Verband, aus dem die 13. Waffen-Gebirgs-Division der SS «Hanjar» hervorging. Sie wurde Anfang März 1943 im bayerischen Mittenwald aufgestellt und im Sommer 1943 in Frankreich ausgebildet.
Am 13. Januar 1944 inspizierte Husseini die Hanjar-Division. Er schritt die Front, den Arm zum Hitlergruß erhoben, gemeinsam mit dem Generalmajor der Waffen-SS, Karl Gustav Sauberzweig, ab, der die Division vom August 1943 bis Juni 1944 kommandierte.
Im Februar 1944 wurde die Division nach Bosnien verlegt.
Die Angehörigen der Division trugen schwarze Fese mit Adler und Totenkopf. Der arabische Krummsäbel Hanjar war das Truppenkennzeichen auf dem Kragenspiegel.
Die Division ermordete den größten Teil der bosnischen Juden. Sie verfolgte und ermordete Sinti und Roma und kämpfte gegen die Partisanen Titos.
Am 1. März 1944 rief Husseini die Muslime über den Sender Zeesen auf:
«Tötet die Juden, wo immer ihr sie findet. Das gefällt Gott, der Geschichte und der Religion.»
Himmler ernannte Husseini zum SS-Gruppenführer.
Seit dem Sommer 1944 lebte Husseini als persönlicher Gast Hitlers in Oybin, dem Kurort in der sächsischen Lausitz.
Die Behörden überließen ihm als Wohnsitz das ehemalige Genesungsheim der Schlesischen Provinzial-Versicherungsanstalt Breslau, eine Villa in der Kammstraße und Büroräume im Haus «Charlotte» in der Töpferstraße.
In Oybin blieb Husseini bis Februar 1945.
Bei Kriegsende floh Husseini in die Schweiz. Die Schweizer Behörden lieferten ihn am 8. Mai 1945 an Frankreich aus.
1946 durfte er die französische Haft verlassen. Ägypten gewährte ihm Asyl.
Noch 1946 erreichte er Palästina und organisierte den Kampf gegen die Juden.
Der Führer der Moslembruderschaft, Hassan al-Banna, verkündete 1946:
«Der Mufti ist Palästina, und Palästina ist der Mufti … Deutschland und Hitler sind nicht mehr, aber Amin al-Husseini setzt den Kampf fort.»
Husseini starb 1947 in Beirut.
Geständnis I
Seit neunzehn Jahren hatte Walburga Hausmännin als Hebamme in Dillingen gearbeitet. Die meisten Kinder, denen sie auf die Welt geholfen hatte, lebten gesund und munter. Aber manche Kinder kamen tot zur Welt, und manche Kinder starben bald nach der Geburt.
1587 wurde Walburga Hausmännin angeklagt.
Es wurde ihr vorgeworfen, sie habe Neugeborene erstickt und deren Blut getrunken.
Walburga Hausmännin bestritt den Vorwurf.
Das Gericht ordnete die Folter an. Ihre Arme wurden auf dem Rücken zusammengebunden. An ihre Füße band man Gewichte. Ein Flaschenzug zog sie an den Armen ruckartig in die Höhe. Ihre Schultergelenke wurden ausgerenkt.
Ihre Daumen wurden mit Daumenschrauben, ihre Beine mit Beinschrauben zusammengepreßt, bis Blut austrat.
Schließlich legte Walburga Hausmännin ein erfundenes Geständnis ab:
Als 1556 ihr Mann gestorben war, habe sie mit einem Knecht abgemacht, noch in derselben Nacht Unkeuschheit mit ihm zu treiben. Aber es sei nicht der Knecht zu ihr gekommen, sondern der Böse Geist. Nachdem sie mit ihm Unzucht getrieben, habe sie seinen Geißfuß entdeckt. Sie habe Jesus angerufen, und der Buhlteufel sei verschwunden. Den Lohn, einen halben Taler, habe sie aber weggeworfen.
«In der nächsten Nacht ist der Buhlteufel wieder zu mir gekommen. Er hat mir versprochen, mich für immer vor Armut zu schützen.
Ich habe mit meinem Blut unterschrieben. Der Buhlteufel hat mir die Hand geführt, weil ich nicht schreiben kann. Ich bin mit ihm auf einer Mistgabel aufgefahren zu einer Teufelsversammlung. Dort habe ich den Großen Teufel getroffen. Er hat meine Abmachung mit dem Buhlteufel gutgeheißen. Ich mußte Jesus verleugnen, und der Große Teufel hat mich auf den Namen Höfelin getauft und den Buhlteufel auf den Namen Federlin. Im Kerker kam Federlin öfter zu mir und hat sich fleischlich mit mir vermischt.»
Unter dem Bischof von Augsburg, Marquard vom Berg, wurde Walburga Hausmännin der Hexerei angeklagt und zum Tode verurteilt.
Das Urteil bestimmte, daß der Karren, auf den sie gebunden war, auf dem Weg zur Richtstätte mehrmals anzuhalten hatte.
Bei jedem Halt wurde ihr Leib mit einer glühenden Zange gezwackt.
Vor dem Rathaus ihre linke Brust und ihr rechter Arm.
Unter dem Stadttor die rechte Brust.
Beim Mühlbach ihr linker Arm.
An der Richtstätte ihre linke Hand.
Die rechte Hand, die Eideshand, wurde ihr abgeschlagen.
Walburga Hausmännin wurde in Dillingen bei lebendigem Leibe verbrannt, am 2. September 1587.
Ich spiele nicht
Fürst Karl von Lichnowsky, geboren am 21. Juni 1761, war Kammerherr am kaiserlichen Hof in Wien.
1792 kam Beethoven nach Wien. Es heißt, er habe anfangs im Hause Lichnowskys gewohnt.
Beethoven widmete Lichnowsky 1793 die drei Klaviertrios op. 1 und im Jahr 1798 die Klaviersonate c-Moll op. 13 «Pathétique».
Seit 1800 zahlte Lichnowsky Beethoven ein Gehalt von 600 Gulden jährlich.
1801 widmete Beethoven ihm die Klaviersonate As-Dur op. 26 und 1802 die 2. Sinfonie D-Dur op. 36.
Beethoven nannte Lichnowsky 1805 einen der loyalsten Freunde und Unterstützer seiner Kunst.
Fürst Karl von Lichnowsky gehörte Schloß Grätz, im habsburgischen Mähren, südlich von Troppau.
1806 hielt sich Beethoven im Gefolge Lichnowskys im Schloß auf. Er lernte dort Franz von Oppersdorff kennen und unternahm mit ihm einen Ausflug nach Oberglogau, zum Schloß Oppersdorffs.
Als Gäste des Fürsten verweilten im Schloß Grätz hohe napoleonische Offiziere. Lichnowsky arrangierte für sie eine Soiree. Er bat Beethoven, für die Napoleonischen zu spielen.
Beethoven weigerte sich.
«Ich spiele nicht für die Feinde meines Vaterlandes.»
Lichnowsky, zutiefst verärgert, versetzte Beethoven einen derben Stoß. Beethoven schloß sich in sein Zimmer ein.
Der Kapellmeister Ignaz von Seyfried berichtet:
Karl von Lichnowsky stieß die Tür mit einem Fußtritt auf.
Beethoven ergriff einen Stuhl und wollte dem Fürsten über den Kopf schlagen. Aber Oppersdorff fiel Beethoven in den Arm.
Lichnowsky eilte aus dem Zimmer.
Beethoven verließ mitten in der Nacht das Schloß.
Zu Hause zerschmetterte Beethoven die Büste Lichnowskys.
Fürst Karl von Lichnowsky stellte die Zahlungen an Beethoven ein.
Was hat Charlie gesagt
Charlie hat gesagt: