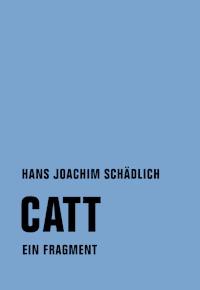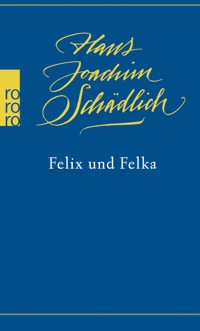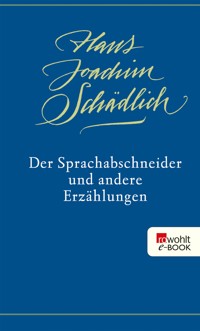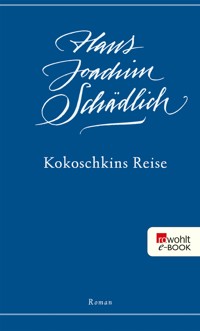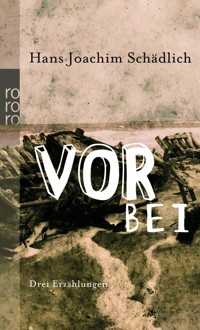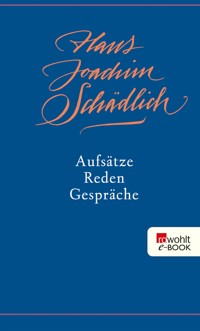
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Schädlich: Gesammelte Werke
- Sprache: Deutsch
«Es gibt keinen Text von Hans Joachim Schädlich, der mit den ethischen Fragen, die er auslöst, irgend etwas zu tun haben möchte. Sie sollen außerhalb der Texte verhandelt werden. (…) Schädlichs Modernität besteht darin, dass er seine Identität nur noch durch deren vollkommene Abwesenheit ausdrücken kann. (…) Die Moral selber ist nach wie vor ein Medium – wir haben kein anderes -, in dem die Menschen ihre Angelegenheiten verhandeln. Besonders dann, wenn sie als normative Instanz so gottlos abwesend ist wie in den Verhältnissen, die zu beschreiben Hans Joachim Schädlich hoffentlich nicht müde wird.» (Wilhelm Genazino) Schädlichs brillante Essays zu historischen, biographischen, gesellschaftlichen oder politischen Fragen begleiten nicht nur sein erzählerisches Oeuvre. Sie geben Auskunft über Leben und Werk und bringen einem den scheinbar so distanzierten Autor näher.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 580
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Hans Joachim Schädlich
Aufsätze Reden Gespräche
Über dieses Buch
«Es gibt keinen Text von Hans Joachim Schädlich, der mit den ethischen Fragen, die er auslöst, irgend etwas zu tun haben möchte. Sie sollen außerhalb der Texte verhandelt werden. (…) Schädlichs Modernität besteht darin, dass er seine Identität nur noch durch deren vollkommene Abwesenheit ausdrücken kann. (…) Die Moral selber ist nach wie vor ein Medium – wir haben kein anderes –, in dem die Menschen ihre Angelegenheiten verhandeln. Besonders dann, wenn sie als normative Instanz so gottlos abwesend ist wie in den Verhältnissen, die zu beschreiben Hans Joachim Schädlich hoffentlich nicht müde wird.» (Wilhelm Genazino)
Schädlichs brillante Essays zu historischen, biographischen, gesellschaftlichen oder politischen Fragen begleiten nicht nur sein erzählerisches Oeuvre. Sie geben Auskunft über Leben und Werk und bringen einem den scheinbar so distanzierten Autor näher.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, Oktober 2015
Copyright © 2015 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Umschlaggestaltung any.way, Walter Hellmann
ISBN 978-3-644-53861-0
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Inhaltsübersicht
«Ich bin mit den Unmächtigen»
Literatur und Widerstand
Meine Gedichte
Selbstverständlich: Doppelstrategie
Polizeigeschichte als Universalgeschichte
Nicolas Born
Verraten und verkauft
Ausdrücke der Verlorenheit und Findung
Im Gespräch
Deutsche im deutschen Exil?
Über systematische Irrtümer
Export der Zensur
Vom Erzählen erzählen
Tanz in Ketten
Traurige Freude
Über Dreck, Politik und Literatur
Die Stunde Null oder Ist heute gestern?
Der andere Blick
Heinrich Maria Ledig-Rowohlt zu Ehren
Jeder ist klug, der eine vorher, der andere nachher
Der Roman
Die Aufklärung der Stasi-Verbrechen und die Chancen der demokratischen Kultur
Literaturwissenschaft und Staatssicherheitsdienst
Von der heillosen Liebe zur Unwirklichkeit
«Der Schutz der Früchte der Arbeit des Volkes»
Für Gewalt der Demokratie gegen die Gewalt der Nazis
«Ein Schriftsteller schafft nichts aus dem Nichts»
Zwischen Schauplatz und Elfenbeinturm
Entscheidung für die demokratische Welt
Literatur und Politik
Vertrauen und Verrat
Zwei Abschnitte im Leben eines Botschafters
«Tallhover» – ein weites Feld
Leipzig, «Auerbachs Keller»: «90 Jahre Rowohlt, 90. Geburtstag von HMLR»
Jürgen Fuchs in memoriam
Was ich gerne ändern möchte
Sarah
Auf freiem Fuß
Islamistische Internationale
Hans Sahl
«Ich kann euch nicht sagen, was ich denke. Aber ich erzähle euch eine Geschichte»
«Unterst Stuf von menschliche Geschlecht»
«Der Inhalt dieser Gedichte hat als ein durchaus verwerflicher erkannt werden müssen»
«Ich bin nur ein Leser …»
«Schreibend ergründen»
«Die Abgründe des Geistigen bleiben Geheimnis»
Der Sandwich-Insulaner
Quellenverzeichnis
«Ich bin mit den Unmächtigen»
Gespräch mit Nicolas Born
Nicolas Born: Hans Joachim Schädlich, Sie sind Anfang Dezember 1977 mit Ihrer Familie von Ostberlin nach Hamburg umgezogen. Sie wollten das, und schließlich wollten die Herren in Partei, Kulturministerium und im Schriftstellerverband das auch. Nach Ihrer Übersiedelung haben Sie zunächst nicht reagiert auf alle freundlichen Angebote, Umstände und Hintergründe Ihres Umzugs darzulegen. Jetzt, wo wir hier ein erstes für die Veröffentlichung bestimmtes Gespräch führen, ist vielleicht das Interesse an Ihrer Person auf ein Maß geschrumpft, das sich vergleichen läßt mit dem Interesse an Ihrem Buch, an Ihren Erzählungen. Kann man das so sagen?
Hans Joachim Schädlich: Ich habe mich vor allem deshalb geweigert, schnelle Erklärungen oder Interviews abzugeben, weil ich in diesem Moment, aber auch früher am Beispiel anderer, genau gespürt habe, daß das Interesse vorwiegend oder hauptsächlich auf meine Person, oder auf die Person anderer, gerichtet war, und wie ich anzunehmen Grund habe, erst in zweiter Linie auf die Texte dieser Leute oder auf die Arbeit dieser Personen. Zwar läßt sich beides nicht voneinander trennen, und es ist auch nicht getrennt aufgefaßt worden, aber ich glaube doch, daß zunächst auf Grund der Konstellation in den beiden deutschen Staaten das Interesse an den persönlichen Umständen der Autoren, die aus der DDR in die Bundesrepublik gekommen sind, überwog. Und ich möchte mein Literaturverständnis eher so interpretiert wissen, daß die Arbeit, die Texte der Leute von größerem Interesse sein sollen und sein müssen als die persönlichen Umstände. Es kommt noch hinzu, daß ich nicht dazu neige, die Lebens- und Arbeitsumstände in der DDR oder die Umstände der Ausreise in die Bundesrepublik oder während der ersten Wochen des Aufenthalts in der Bundesrepublik auf dem Markte wohlfeil anzubieten, sondern daß ich wie in anderen Dingen, die ich beobachte und erfahre, eher dazu neige, meine Erfahrungen zu verarbeiten in meiner Arbeit als Schreiber.
N. B.:Wie ist es zu dem Titel «Versuchte Nähe» gekommen? Können Sie den Titel erklären?
H.J. S.: Der Buchtitel ist der Titel einer Erzählung, die in dem Band enthalten ist. Aber ich glaube, daß der Buchtitel und der Titel dieser Erzählung im Ganzen gesehen auch meine Beobachterposition oder meine Position als Schreiber im weiteren Sinne erklären. Im engeren Sinne fasse ich den Titel, und das zum Teil im nachhinein, nicht etwa von vornherein konstruiert, so auf: Es handelt sich um die Bestimmung des Verhältnisses zwischen der Figur eines Würdenträgers, der in dieser Titelgeschichte eine Rolle spielt, und den Leuten, die ihn umgeben, und seinem Volk. Und diese Bestimmung besagt, daß dieser Würdenträger den Versuch unternimmt, sich denen, die ihm gegenüberstehen oder ihm gegenüber vorüberziehen, zu nähern. Zugleich enthält der Titel auch den Gedanken der Versuchung, die für den, der diesen Versuch unternimmt, in dem Versuch enthalten ist. Die Versuchung, die durch die Nähe zu denen entsteht, denen er sich gegenübersieht. Und diese Bestimmung gilt auch für mein Verhältnis zu dieser Erzählfigur oder im weiteren Sinne für mein Verhältnis zu den gesellschaftlichen Realitäten und Umständen, die mein Gegenstand in diesem Buche waren. Zuletzt enthält der Titel «Versuchte Nähe» durch die Kombination dieser beiden Begriffe auch den Begriff des Scheiterns, also des mißglückten Versuchs.
N. B.: Des Scheiterns auch in der Perspektive des Autors oder nur in der Perspektive der Person?
H.J. S.: In der Titelgeschichte in der Perspektive der Erzählfigur, bezogen auf den Gesamtgegenstand in gewisser Weise auch bezogen auf den Autor.
N. B.:Es ist auffällig, wie unauffällig in manchen Erzählungen die Personen handeln, wie betont unauffällig. Es macht den Eindruck, als ob diese Personen fast in einer perfekten Tarnung leben, anonym sind oder geworden sind bis zum Verschwinden, bis sie es zu einem Zeitpunkt einmal wagen, sich persönlich gegen alle Behauptungen zu behaupten – gegen alle Behauptungen von Institutionen, von sogenannter Realität, sich selbst zu behaupten, zu behaupten, daß sie nicht verschwunden, sondern da sind, als Wesen da sind, als Personen da sind. Das geht in Einzelbeispielen bis zum Affront oder zum versuchten Skandal, hier haben wir wieder das Wort. Wie absichtlich ist die Empfindlichkeit dieser Personen?
H.J. S.: Ich glaube, das ist nicht absichtlich, sondern es hat sich aus der Sache im einzelnen jeweils ergeben. Das hängt mit der Sicht auf die Gegenstände zusammen, und das hängt natürlich auch mit der sprachlichen Form zusammen, die ich selber wahrscheinlich nicht besonders gut bestimmen kann. Allgemein gesagt hat es mich immer berührt und interessiert, Dinge, die uns gewissermaßen vertraut erscheinen, durch die Suche von Worten oder Konstruktionen fremder zu machen, als sie uns erscheinen, nämlich so fremd, wie sie in Wirklichkeit sind, obgleich sie uns vertraut erscheinen. Wenn ich mich im nachhinein darüber äußern soll, habe ich für mich selbst das Gefühl, daß ich nach fremden Namen für scheinbar vertraute Dinge gesucht habe, um sie für mich selbst so fremd erscheinen zu lassen, wie sie mir in Wirklichkeit sind, und dadurch aber auch zu erkennen, wie sie eigentlich sind.
N. B.: Damit sind wir an einem Punkt angekommen, wo man es vielleicht nicht länger hinauszögern kann, von einer bestimmten Bewußtseinsdrangsalierung zu reden, die von gesellschaftlichen Institutionen und Personen und irgendwelchen inthronisierten Spitzbuben in aller Welt, in allen Systemen ausgeht. Diese Realität und diese Erfahrung haben doch auch einen Niederschlag in den Geschichten gefunden. Könnte man das vereinfachend auf die alte Polarität Geist und Macht zurückführen?
H.J. S.: Es ist mir gesagt worden, mein Ansatz als Schreiber in der DDR sei der Ansatz eines Mannes, der im Widerstand schreibe, im Widerstand gegen Verhältnisse, gegen Umstände. Ich akzeptiere zwar die Motivation der Frage, wie es denn nun sein solle, nachdem ich in einem anderen Land unter anderen gesellschaftlichen Voraussetzungen lebe.
Obwohl ich die Motivation dieser Frage verstehe, finde ich die Frage dennoch falsch gestellt. Denn das Moment des Widerstands ist nicht der Impuls für meine Arbeit gewesen und wird es in dieser vordergründigen Form auch nie sein. Der eigentliche Impuls für die beobachtende und schreibende Tätigkeit ist in erster Linie das, was ich meine Wirklichkeit nenne, also die Wirklichkeit, in der ich mich befand oder jeweils befinde. Aber das ist keine Haltung, die auf die Arbeit eines Schriftstellers in der DDR beschränkt ist, sondern das ist eine generelle Grundhaltung, die ich für mich in Anspruch nehme und die sich in einer anderen Gesellschaft für mich in gleicher Weise realisiert. Denn, das versteht sich ja von selbst, die Gesellschaft in der Bundesrepublik enthält in vergleichbarer Weise, allerdings auf andere Art und auf anderer Ebene, Konflikte genug, also auch Stoffe, nämlich Konfliktstoffe, die dem Beobachter und Beschreiber mittelbar oder unmittelbar aufgehen.
N. B.: Sicher, es kann ja nicht sein, daß jemand nur aus Wut über die Gesellschaft oder über Institutionen zum Schreiben kommt. Doch glaube ich, daß bei uns die Zwänge immer größer, auch vernichtender werden, und daß dagegen immer größere natürliche Energien sich mobilisieren.
H.J. S.: Ein Schreibimpuls für mich war zunächst einfach das Bedürfnis, Gegenstände oder Umgebungen oder Zusammenhänge oder Verhältnisse, die ich nicht genau zu erkennen vermochte, durch den Schreibvorgang für mich persönlich durchschaubar und erkennbar zu machen. Das ist natürlich bei weitem nicht alles, aber ein wesentlicher Aspekt, daß es sich bei dem Schreibvorgang um einen Erkenntnisvorgang handelt. Aber damit wäre nicht genügend gesagt. Es kommt hinzu, daß ich mich, ich nenne es mit den Unmächtigen, nicht mit den Ohnmächtigen, sondern mit den Unmächtigen im Verhältnis zu den Mächtigen, identifiziere, und das im Grunde genommen unabhängig von dem Ort, an dem ich mich jeweils befinde, daß ich im Grunde genommen daraus einen starken Impuls beziehe, nicht im Sinne einer hinausgeschrienen Wut oder irgendeiner vordergründigen anklägerischen Gesellschaftskritik, sondern im Sinne einer ganz persönlichen Identifikation mit denen, die man die Betroffenen nennen könnte.
N. B.: Ich meine, daß in den Geschichten, jedenfalls was meine Lektüre anbetrifft, doch so etwas wie eine kalte Wut manchmal durchgreift, die für mich eine viel größere humane Substanz enthält als alle vordergründigen Solidaritätsbekenntnisse. Es ist ja alles sehr distanziert, es ist so, als habe der Autor überhaupt nichts zu tun mit dem, was in den Erzählungen vorgeht, als ob er selber aus der Tarnung heraus schriebe, aus der Tarnung heraus nicht nur beobachtete, sondern auch schriebe, um ja nicht aus der Rolle, in der sich die Personen befinden, die alle Rollen spielen, sich in eine bessere Position zu begeben als Autor. Habe ich das richtig gesehen?
H.J. S.: Ja. Das, was man die Wut nennen könnte, die man da heraushören oder herauslesen kann, die kommt, glaube ich, nicht in erster Linie von mir, sondern aus den Gegenständen, aus den Sachen. Von mir kommt eigentlich nur der Beschreibungsvorgang oder der Beschreibungsakt; alles andere kommt aus den Leuten, die beschrieben sind, aus den Sachen, aus den Verhältnissen.
N. B.: Was machen Sie jetzt, da Sie nicht mehr in der DDR leben? Sie können auch nicht gleich, niemand kann sich das vorstellen, neue Widerstände hier in der Realität der Bundesrepublik finden. Was ist das für eine Erfahrung, plötzlich in der Bundesrepublik zu sein, in Hamburg herumzulaufen?
H.J. S.: Ich muß jetzt für mich versuchen, zur Arbeit zurückzufinden. Das setzt die Kenntnis der hiesigen Umstände und Verhältnisse voraus. Diese Kenntnis muß ich erwerben. Aber das ist nicht in einem vordergründigen oder direkten Sinn von der unmittelbaren Kenntnis oder von unmittelbaren Erfahrungen dieser Umstände abhängig, denn ich habe mir ein Thema gewählt, das nach meiner Vorstellung, ohne daß ich es jetzt im einzelnen erklären oder gar vorbringen könnte, das nach meiner Vorstellung in gewisser Weise unabhängig von unmittelbarer Erfahrung in der DDR oder in der Bundesrepublik für mich und für die Leute, die sich für meine Texte interessieren, relevant ist. Und das kann ich, glaube ich, auch an einem dritten Ort bewältigen.
N. B.: Es könnte ja theoretisch auch ganz ohne Relevanz auskommen, ohne daß man darauf insistiert, daß es relevant sein muß für ein bestimmtes Publikum. Was ist überhaupt diese Relevanz, Zeitgenossenschaft, und Hier und Jetzt, und Aktualität? Was sind all diese Überhänge, die eigentlich nicht elementar und substantiell Literatur ausmachen?
H.J. S.: Ja, das ist natürlich die Frage nach der Wirklichkeit als Gegenstand des Schreibenden überhaupt, und es ist sehr die Frage, was ein Schreibender unter Wirklichkeit und unter Relevanz zu verstehen hat. Die Wirklichkeit, die ich für mich meine, das ist in erster Linie die Wirklichkeit, die ich begreife, eigentlich meine Wirklichkeit. Und es kann sein, daß mein Verständnis von Wirklichkeit, also meine Wirklichkeit, für andere ohne jede Bedeutung ist, für andere völlig irrelevant ist. Es kann aber sein, daß ich in die glückliche Lage versetzt bin, daß sich das, was ich meine Wirklichkeit nenne, mit dem, was andere ihre Wirklichkeit nennen, deckt, und insofern relevant wird, aber nicht in einem trivialen unmittelbaren Bezug auf gesellschaftliche oder politische Erfahrungen und Konflikte.
N. B.: Es könnte ja eine völlig fiktive Realität sein, es könnte sich in der Konstellation einer literarischen Realität viel mehr Übereinstimmung und sogenannte Relevanz zwischen einem Leser und dem Autor herstellen als mit einem realistischen Vorwurf.
H.J. S.: Ich selber bin, glaube ich, doch stärker bezogen auf Realität, die sich nicht nur aus mir ergibt. Die sich nicht nur auf mein Bedürfnis zu schreiben reduziert, sondern die eine Identifikation mit einem Leser oder Hörer über eine gemeinsam erkennbare Realität herstellen läßt.
N. B.: Ich meine einfach, was passiert mit der Realität?
H.J. S.: Einerseits habe ich den Eindruck, daß die Realität, deren ich mich bemächtige, einfach nur aus sich selbst zum Sprechen gebracht wird, das klingt zwar sehr anspruchsvoll, aber das ist eigentlich auch eine Bescheidenheit. Andererseits habe ich schon den Eindruck, daß durch einen solchen Vorgang eine Realität sozusagen aus sich selber herausgenommen wird, daß damit die Realität in einer bestimmten Weise über diese Realität erhoben wird und eine zweite Realität für mich oder vielleicht auch für den, der das liest, entsteht.
N. B.: Demnach kann es auch nichts geben, was mit den Geschichten bezweckt sein könnte oder werden könnte. Das muß völlig außerhalb liegen, wenn ich das richtig verstanden habe.
H.J. S.: Ja, jedenfalls keinen unmittelbaren Zweck. Wenn diese Bemächtigung für sich selbst einen Zweck zum Ausdruck bringt, dann muß es der sein, der sich aus der beobachteten Konstellation ergibt. Vom Standpunkt des Schreibers ist das, so merkwürdig das klingen mag, zunächst eine unbewertete oder sozusagen ziellose Beschäftigung. Und es muß, wenn etwa ein Leser oder ein Kritiker daraus etwas zu benennen in der Lage ist, was als Absicht oder als Ziel oder als Tendenz oder als Aussage sich herstellt, an dem Vorgang liegen, an der Konstellation oder an dem Konflikt oder an der Situation, deren man sich bemächtigt hat. Das ist schwer zu beschreiben für mich.
Bestimmt ist natürlich die Wahl der Gegenstände nicht zufällig. Die liegt einfach in der Veranlagung einer Person für gewisse Konflikte begründet, also in der Neigung einer Person, sich mit gewissen Konflikten auseinanderzusetzen. Aber das hat nichts mit der Art und Weise der Auseinandersetzung zu tun. Die Art und Weise der Auseinandersetzung, die muß sich sozusagen kalt aus dem gewählten Gegenstand selbst hervortun und nicht durch irgendeinen Appell dessen, der diese Gegenstände wählt.
N. B.: Können Sie sich Ihre Zukunft als Schriftsteller hier in der Bundesrepublik schon vorstellen?
H.J. S.: Ich möchte mir gerne vorstellen, daß es in der Bundesrepublik im Verhältnis zu meinen Kollegen und Freunden eine solche Atmosphäre der kritischen Auseinandersetzung geben möge, wie ich sie mit eben diesen Freunden in der DDR erfahren habe. Ich denke an die vielen Gespräche, die es unter uns, also zwischen Kollegen aus der Bundesrepublik und mir, gegeben hat, an Gespräche über Manuskripte, über Texte, mit Günter Grass, mit Christoph Buch, Rolf Haufs, Uwe Johnson, um nur einige zu nennen.
Natürlich kann ich mir die Fortsetzung dieser Arbeit vor allem auch deshalb vorstellen, weil ich eigentlich kontinuierlich gearbeitet habe und die Übersiedlung in die Bundesrepublik für mich keinen Bruch in meiner Produktion darstellt.
Neu ist die Erfahrung eines Lesepublikums, die ich bisher nie machen konnte. Als ich in der DDR war und das Buch erschienen war, hatte ich oft, wenn über das Buch berichtet wurde oder wenn ich von der Kritik an diesem Buch hörte, das Gefühl, daß das etwas sei, was außerhalb meiner Person, außerhalb meiner Selbst stattfindet und im Grunde genommen gar nichts mit mir zu tun hat. Und daß ich hier in der Bundesrepublik ein Lesepublikum gefunden habe, das verdanke ich zum großen Teil der Solidarität meiner Freunde, meiner Kollegen: Nicolas Born und Hans Christoph Buch waren die ersten, die Texte von mir im «Literaturmagazin» veröffentlicht haben; Günter Grass verdanke ich es, daß er sein Publikum und das Publikum in der Bundesrepublik auf mein Buch hingewiesen hat in, glaube ich, über 50 Lesungen, die er mit seinem Roman Der Butt veranstaltet hat und auf denen er auch einen Text von mir vorlas.
1978
Literatur und Widerstand
Literatur und Widerstand – was haben Literatur und Widerstand miteinander zu tun? Was, wenn schon nicht unbefangen gefragt werden kann, was Literatur sei, was ist Widerstand? Die philologische Bestimmung der Wortbedeutung enthält: 1. Weigerung, 2. Widerstreben, 3. Behinderung, 4. Gegenwehr, die als ein Tun und Verhalten von Personen entweder als ein Widerstreben mit Körperkraft erscheinen oder, in jenen zahlreichen Fällen, in denen nicht vom Widerstreben mit physischer Kraft und Waffen die Rede sein kann, ein mehr aktives Entgegenwirken oder ein mehr passives, beharrendes, nicht nachgebendes Widerstreben, eine Widersetzlichkeit meinen. So auch heißt es von dem Verb widerstehen, es meine als ein Tun und Verhalten entweder physisch standhalten, zur Gegenwehr greifen, oder, ohne physische Kraft, ein mehr aktives Widerstreben oder ein mehr passives Beharren, ein Nicht-folgen, ein Sich-verschließen. Soweit die Philologie, genauer: das Deutsche Wörterbuch der Brüder Grimm in des Vierzehnten Bandes Erster Abteilung zweitem Teil aus dem Jahr 1860.
Zweifellos hat Literatur mit so etwas zu tun, mit Widerstand. Und zwar sowohl mit physischem Widerstand als auch mit Widerstand ohne physische Kraft, wie Philologen sagen. Wie das? Es sind Fälle bekannt geworden, in denen Bücher direkt widersetzliches Tun und Verhalten von Personen ausgelöst, also physischen Widerstand bewirkt haben; sei es im Sinne der Verfasser, sei es entgegen der Verfasserabsicht, wozu zuletzt auch gehören mag, daß ein Buch fortgeworfen oder verbrannt wird.
Vor allem ist öfter bemerkt worden, daß Literatur indirekt Wirkung in Köpfen tut und das Verhalten von Personen derart beeinflußt, daß von unnachgiebigem Beharren auf Ansichten und Meinungen gesprochen werden kann, die in einem Gegensatz zu öffentlichen oder sogar zu befohlenen Ansichten und Meinungen stehen können. Ja, es kann sogar von Fällen aktiver geistiger Widersetzlichkeit gesprochen werden.
Insofern haben Literatur und Widerstand etwas miteinander zu tun. Das ist zwar nicht alles, doch von anderem später. Zunächst noch: Was ist Widerstand. In Artikel 20, Absatz 4, des Grundgesetzes der Bundesrepublik ist sogar ein Widerstandsrecht verankert: «Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung (nämlich die verfassungsmäßige) zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist.»
Auch in Landesverfassungen der Bundesrepublik wurden Widerstandsrechte vorgesehen. In Artikel 147 der Hessischen Verfassung steht: «Widerstand gegen verfassungswidrig ausgeübte öffentliche Gewalt ist jedermanns Recht und Pflicht.»
In Artikel 23, Absatz 3, der Berliner Verfassung steht: «Werden die in der Verfassung festgelegten Grundrechte offensichtlich verletzt, ist jedermann zum Widerstand berechtigt.» In Artikel 19 der Bremer Verfassung steht: «Wenn die in der Verfassung festgelegten Menschenrechte durch die öffentliche Gewalt verfassungswidrig angetastet werden, ist Widerstand jedermanns Recht und Pflicht.»
Also sogar Pflicht zum Widerstand in den Verfassungen von Hessen und Bremen.
Es ist die Frage gestellt worden, ob die Widerstandsrechte zu den allgemeinen Menschenrechten gehören, und der Rechtsphilosoph und Strafrechtler Ulrich Klug hat geantwortet: «Die allgemeinen Menschenrechte enthalten Gebote und Verbote, aus denen ein entsprechendes Widerstandsrecht von gleichem Geltungsrang … abzuleiten ist. Das Widerstandsrecht ist daher selbst ein allgemeines Menschenrecht» (U. Klug, S. 22).
«Widerstand ist ein Teil des natürlichen Rechts zur Gegenwehr», sagt Heinrich Böll (S. 87); an anderer Stelle: «Widerstand ist kein Recht; er ist eine Pflicht, jedem Menschen mitgegeben» (S. 88). Und, unter ausschließlichem Bezug auf die Bundesrepublik: «Die Grenze des Widerstandes ist nicht die Blockade, nicht die Verweigerung: die Grenze ist die Gewalt, jedenfalls in unseren Breiten» (S. 88).
Oft waren und sind es Autoren, die zu einem Widerstand gegen etwas aufriefen und aufrufen. Die Aufrufe waren und sind meist keine literarischen Produkte, sondern direkte Aufrufe. Die Aufrufe werden gehört wegen der literarischen Reputation ihrer Verfasser.
Aber abgesehen davon. Wie hat Literatur im eigentlichen Sinn zu tun mit Widerstand. Was könnte das sein in der Literatur: widerstehen.
Das kann das Beharren auf einem Stoff, einem Gegenstand sein, der der leichten Sagbarkeit widersteht. Also der Widerstand gegen – je nach den Verhältnissen – Modisches oder Genehmes, ein Widerstand, der mehrfaches Risiko, politisches, menschliches, kommerzielles, einschließt.
Das kann der Widerstand der sprachlichen Form gegen billige Konsumierbarkeit sein, ein Widerstand, der durch Arbeit an der Sprache geleistet wird.
So daß – Stoff und Sprachform zusammengenommen – gesagt werden kann: ein literarischer Text bietet Widerstände.
Daß also Mißtrauen am Platz ist, wo das Widerständische fehlt, wo glatte Sprachfassade und beflissene stoffliche Übereinstimmung mit dem herrschenden Geschmack der Zeit oder mit dem Geschmack der zur Zeit Herrschenden auszumachen ist.
Aber es ist noch von etwas anderem zu reden. Wenn es wahr ist, daß Literatur direkt oder indirekt das Tun und Verhalten im Sinne physischer oder geistiger Widersetzlichkeit bestimmen kann, muß dann gewaltig von Politik gehandelt sein? Aus der Betrachtung der deutschen Exilliteratur in den Jahren 1933 bis 1945 wissen wir: «Literarische Texte werden», wie Manfred Durzak es ausgedrückt hat, «auf der einen Seite zu moralischen Dokumenten und können auf der anderen Seite auch als Illustrationsmaterial für bestimmte gesellschaftliche und politische Zusammenhänge … eine Bedeutung annehmen, die man am besten mit Relationswert beschreibt. Aber Relationswert und literarischer Wert können durchaus inkongruent sein. Das Problem besteht nicht darin, wieviel ein bestimmter Text zur Kenntnis einer bestimmten historisch-politischen Situation beiträgt, sondern wie diese Situation den Text bestimmt, strukturiert und seine sprachliche Aussage beeinflußt hat, wie sie letztlich in ihm aufgehoben ist» (S. 12/13). Und weiter: «Es geht also darum, den komplizierten Vorgang der Vermittlung von historischer Situation im sprachlichen Text aufzuschlüsseln. Und so gewiß die Kenntnis der historischen Materialien zur Erkenntnis dieses Vermittlungszusammenhanges beiträgt, so wichtig ist zu betonen, daß der Text mehr ist als die Summe dieser historischen Fakten» (S. 13). Soweit Durzak.
Anders, aus der Sicht des Autors und unmittelbar auf das Thema Literatur und Widerstand bezogen, gesagt: Die «Widerstandsgeste» (Durzak, S. 14) ist noch lange nicht der literarische Ausdruck des Widerstands.
Und auf die Gegenwart angewandt: Der – nach einem Ausdruck von Thomas Mann – «Zwang zur Politik» bleibt zumeist trockene Forderung, wandelt sich selten zum literarischen Ausdruck des Politischen, endet häufig im Plakativen.
Diese Skepsis ist aber kein Plädoyer für Politiklosigkeit, etwa im längst widerlegten bildungsbürgerlichen Sinn. Die Skepsis ist nur eine Form der dringlichen Frage nach dem literarischen Ausdruck des Politischen.
Gibt es politische Texte, die überhaupt nicht von Politik handeln? Man weiß schon, daß es sie gibt.
Es ist die Rede von Literatur als einem autonomen Feld. Nicht vorsätzliche oder aufgeschwatzte Politisierung, die wie ein Spruchband aus dem Text flattert, sondern innere Verwirklichung eines Textes ist gemeint. Es ist die Rede von unausgesprochener Anstiftung zu etwas, zum Beispiel, im natürlichsten Fall, durch eine natürliche Erscheinung wie «des Himmels Luft», die, mit Hölderlin zu reden, «der Knechtschaft Schmerzen» «löst» (Hölderlin, Der Neckar).
Es ist die Rede von einem subversiven Strom, der in einem Text fließt und eine das Denken befreiende oder eine zum Denken zwingende Helle bewirken kann, also eine Stärke im Kopf eines Lesers oder Hörers.
«Das freie Urteil der Vernunft» zu bewahren, welches «der Besitz von Macht unvermeidlich verdirbt», wie es bei Immanuel Kant heißt, soll nach den Worten des Propheten Amos «das Recht offenbart werden wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein starker Strom» (Amos 5,24) (I. Kant zitiert nach E. Bloch, S. 89).
1985
Ernst Bloch: Widerstand und Friede. Aufsätze zur Politik. edition suhrkamp 257.
Heinrich Böll: Steht uns bei, ihr Heiligen. Wider die trügerische heidnische Göttin Sicherheit. In: Widerstand und Staatsgewalt. Gütersloh 1984.
Manfred Durzak: Die deutsche Exilliteratur 1933 bis 1945. Stuttgart 1973.
Ulrich Klug: Das Widerstandsrecht als allgemeines Menschenrecht. In: Widerstand und Staatsgewalt. Gütersloh 1984.
Meine Gedichte
Immer, seit ich vor einigen Jahren aus dem östlichen Teil des Landes, wo ich von Geburt an gelebt hatte – erst im Nazistaat, später in der Sowjetischen Besatzungszone, schließlich in der DDR –, in den westlichen Teil des Landes kam, habe ich unter dem Eindruck der lange währenden Empfindung von Fremdheit nach dem Ausdruck dieser Art von Fremdheit in der Dichtung gesucht. Bald hatte ich so viele Zeugnisse dafür gefunden, daß ich glauben wollte, es sei der Ausdruck dieser Fremdheit eines der geheimen oder offenen Haupt-Themen aller Dichtung. Dies nicht nur, weil Dichter von der Fremdheit handeln, die andere Menschen außerhalb eines ihnen vertrauten Bezirks – vertrauter Menschen, des vertrauten Ortes, vertrauter Arbeit, des vertrauten Landes – empfanden oder empfinden, sondern weil Dichter selbst – aus einsichtigem Grund – so oft zu den Fremdlingen gehörten und gehören und ihrer eigenen Fremdheit Ausdruck geben.
Tu Fu, einer der berühmtesten Dichter der Tang-Zeit, der bei den Chinesen «Ahnherr» oder «Heiliger» der Dichtung heißt – er wurde im Jahre 712 geboren und starb 770, also vor 1214 Jahren –, Tu Fu, 715 vom Kaiser an den gelehrten Han-Lin-Hof berufen, 757 sogar zum sogenannten «Zensor der Linken» ernannt, wurde wegen Unbeugsamkeit 758 entlassen und verbannt. Den Rest seines Lebens verbrachte er unter ärmlichen Umständen in der Provinz Sechuan (William Hung: Tu Fu. China’s Greatest Poet. Cambridge, Harvard University Press, 1952; Chinesische Dichter der Tang-Zeit. Übersetzung, Einleitung und Anmerkungen von Günther Debon. Stuttgart, Reclam, 1975).
«Die Großen Klagen des Tu Fu (Nachdichtungen von Werner Helwig. Bremen, Carl Schünemann Verlag, 1956), der bekannte, daß er «schon auf ebener Erde / ganz leicht strauchle» (Helwig, 18), handeln immer wieder von den Nöten der Verbannung, von Sehnsucht nach der Heimat.
«Ruhelos ziehe ich mit meinem Reiseboot von Ort zu Ort» (Helwig, 67) heißt eine der Klagen, und in einer anderen, «Krank von Heimweh» (Helwig, 56) heißt es:
«Das Schiff, das mich nach der Heimat tragen soll, liegt als ferne
Wolke überm Horizont, ewig, ewig unerreichbar. Mein Sohn versteht schon
die Sprache der hiesigen Barbaren»
«Als Flüchtling altere ich in fremdem Land», klagt er in dem Gedicht «In trauriger Stimmung» (Helwig, 34), und in einer anderen Klage, geschrieben in der Stadt Kuei-dschu, am oberen Yang-dse, die den Titel «Herbststimmung» trägt (Debon, 35), lautet die dritte Strophe:
«Die Chrysanthemen blühn zum zweitenmal –
aus andern Tagen sind die Tränen.
Legt einmal an ein Boot am Steg,
eilt in den alten Gärten heim mein Wähnen»
Der Begriff des «alten Gartens» aber ist in China mit dem Begriff des Heimathauses identisch.
Eine der Großen Klagen heißt «Ich lächle im Elend»
(Helwig, 68), und in der Klage «In Kweh Dschou» (Helwig, 31) sagt Tu Fu:
«Das Bild der alten Heimat, unerreichbar
erscheint es vor meinen traurigen Augen.
Langgezogene Töne vor mich hinsingend,
wird meine Betrübnis mir deutlich im klaren Herbste»
Selten sind Momente des Trostes, aber die Einfachheit und große Schönheit des Bildes, das Tu Fu findet, vermitteln einen Trost von berührender Stärke:
Da der Gärtner mir Melonen bringt
Beim Leeren des Korbes den der Gärtner brachte,
sättigt sich mein Auge
an der lichtgrünen Farbe der Früchte.
Ich trage sie zum Brunnentrog,
den Bambusrohre speisen aus der Felsenquelle.
Ich lasse die Früchte auf- und niedersteigen
Im eisig klaren Wasser.
Ihr Glanz erinnert an Bergkristall.
Ich freue mich ihrer, als ob es Wunderpilze wären.
Ich durchschneide eine Frucht
Und koste ihr Fleisch, das kalt ist wie Eis.
In meinem düstern Verfall erreicht mich ihr Trost.
Du, o Gärtner, bist nicht berühmt.
Aber wieviel Mühe nahmst du dir,
diese Melonen zu züchten.
(Helwig, 33)
Und lese ich in Tu Fu’s Gedicht «Am Ufer» (Helwig, 60) die Zeilen
«Auf dem durchsichtigen Grund des Baches
nähert sich das Bild der ziehenden Wolke
dem Bild der am Ufer wachsenden Blume»
so mag ich mich durch den Rat Tu Fu’s an seinen Sohn «Über die dunkle Marmorplatte deines Tisches gebeugt, summe Gedichte vor dich hin, bis sie sich dir enthüllen» (Helwig, 60) selber hinweggetröstet fühlen über Tu Fu’s Satz vor dem Sohn: «Wenn ich nun dir, dem jugendlichen Schüler mit dem blauen Kragen, Ratschläge erteile, schäme ich mich ein wenig, daß ich es im Leben nicht weiter gebracht habe als bis zu dieser Holzbank, auf der ich sitze» («Verse, die ich meinem Sohn zeige», Helwig, 60).
Alle Einsicht und Resignation des Alters in der Fremde drückt Tu Fu aus in dem Gedicht «Ich äußere meinen Kummer» (Helwig, 53):
Ich äussere meinen Kummer
So nähre ich denn,
hinter der aus Reisig geflochtenen Tür,
das Gefäß der Torheit, meinen Leib,
Aber die Tür, wohin öffnet sie sich?
Da erstreckt sich vor mir
bis zu dem Wu-Berge hin
der große Strom.
Ich aber, hinter ihr behaust,
betraure mein sich wandelndes Gesicht,
das die Fremde altern macht
und das Altern fremd …
so daß ich befürchten muß,
es gibt keine Heimkehr mehr für mich.
O Krieg, o Wirren ohne Ende,
die ihr mich an den Rand gespült:
verstört schau ich zurück.
Der Ausdruck der Sehnsucht nach der unerreichbaren Heimat verbindet sich in Tu Fu’s Gedicht «In Kweh Dschou» (Helwig, 31) mit dem Bild des Herbstes; die Trauer, die «Betrübnis» wird richtig erst «deutlich im klaren Herbste». Und an anderer Stelle, in Tu Fu’s Gedicht «Am 9. Tag des 9. Monats» (Helwig, 55), ist auch der Gedanke an Heimat, an verschollene, vielleicht verlorene Angehörige, geliebte Menschen, verknüpft mit dem Herbstbild. Es heißt in der 1. Strophe:
«Zu Haus feiern sie jetzt das Chrysanthemen-Fest.
Ich aber, die Hände im Ärmel, stehe allein auf der Zinne»
In der 3. Strophe heißt es:
«In meiner Heimat sind um diese Zeit schon eingetroffen
die weißen Wildgänse aus dem hohen Norden.
Von meinen Verwandten habe ich lange keine Nachricht mehr.
Werde ich je wissen, wohin sie geflohen sind?»
Und in der 4. Strophe dann:
«Über dem weißen Sand des Ufers fließen und zerfließen
die durchsichtigen Herbstwasser, von Vögeln überkreist»
Das Gedicht «Herbststimmung» von Tu Fu, in dem die schon gesagten Zeilen stehen «Legt einmal an ein Boot am Steg, /eilt in den alten Garten heim mein Wähnen» (Debon, 35), bindet auch Herbst und Heimweh zusammen.
Am deutlichsten tritt mir in altchinesischer Lyrik die Verknüpfung von Sehnsucht nach Heimat mit dem Bild des Herbstes in Tu Fu’s Gedicht «Das Flötenlied des Herbstes» entgegen (Hans Bethge: Die chinesische Flöte. Leipzig, Inselverlag, 1920, S. 48), die Verknüpfung aber von Erinnerung an die ferne Geliebte, von Sehnsucht nach der fernen Geliebten mit dem Herbstbild in dem Gedicht «Herbst» von Wu-Ty, der von 186 bis 140 vor Christus lebte (Bethge, 9).
Tu Fu’s «Flötenlied des Herbstes»
Du armer Wandrer! Fern dem Vaterlande
Und müd und ohne Freunde, sehnst du dich
Umsonst nach deiner Heimat Mutterlaut.
Zwar blüht der Sommer so verschwenderisch,
Dass du noch reich scheinst. Auch der Vögel Sang
Ertönt wie in der Heimat dir vertraut.
Doch wehe! Wenn das Flötenlied des Herbstes
Dein Ohr trifft: das Gezirpe der Zikaden. –
Und wenn der Sturmwind durch die Wolken wühlt!
Dann wirst du das Gesicht in beide Hände
Vergraben, und dein Aug wird überfliessen,
Und deine Seele wird sich heimwärts wenden
Und Wu-Ty’s «Herbst»
Der Herbstwind tobt, die weissen Wolken jagen
Mit Schwärmen wilder Gänse um die Wette,
Vergilbte Blätter taumeln durch die Luft.
Die Lotusblumen welken ab, die Rosen
Stehn ohne Duft. Mich martert die Erinnerung
An Eine, die ich nicht vergessen kann.
Ich muss sie wiedersehn! Ich mache eilig
Das Boot los, um in ihm das andre Ufer
Des Flusses zu erreichen, wo sie wohnt.
Der Strom geht stark, das Wasser rauscht wie Seide
Und quillt empor und kräuselt sich im Winde, -
Trotz aller Mühe komm ich nicht vom Fleck.
Mir Mut zu machen, heb ich an zu singen,
Doch wehe! meine Schwäche bleibt dieselbe,
Und traurig und in Qualen stirbt mein Lied.
O Liebesglut! Du drängst zu ihr hinüber,
Die mich erfüllt, – ich aber kann nicht folgen.
Ich bin im Herbste, meine Kraft ist aus.
In einem Gedicht von Tschang-Tsi, der um 800 lebte, nämlich in «Die Einsame im Herbst» (Bethge, 59) fällt der Herbst der umgebenden Natur mit dem Herbst des Herzens zusammen, das nach der Sonne der Liebe fragt. Es will scheinen, als sei mit der Müdigkeit des Herzens, das sich noch einmal regt, der Gedanke an den Tod gemeint:
«Ja, gib mir Schlaf …»
Die einsame im Herbst
Herbstnebel wallen bläulich überm Strom,
Vom Reif bezogen stehen alle Gräser,
Man meint, ein Künstler habe Staub von Jade
Über die feinen Halme ausgestreut.
Der süsse Duft der Blumen ist verflogen,
Ein kalter Wind beugt ihre Stengel nieder;
Bald werden die verwelkten goldnen Blätter
Der Lotosblüten auf dem Wasser ziehn.
Mein Herz ist müde. Meine kleine Lampe
Erlosch mit Knistern, an den Schlaf gemahnend.
Ich komme zu dir, traute Ruhestätte, –
Ja, gib mir Schlaf, ich hab Erquickung not!
Ich weine viel in meinen Einsamkeiten,
Der Herbst in meinem Herzen währt zu lange;
Sonne der Liebe, willst du nie mehr scheinen,
Um meine bittern Tränen aufzutrocknen?
Es ist das Gedicht, das dem 2. Satz von Gustav Mahlers «Lied von der Erde» zugrunde liegt, in welchem erschütternd der Dualismus von Todesnähe und Lebenshunger zum Ausdruck gebracht ist.
Gustav Mahler hat den Text des Gedichtes, wie es in der Übertragung von Hans Bethge vorliegt, an einigen Stellen geändert – in Zeile 1 heißt es bei Mahler «See» statt «Strom», in Zeile 4 «Blüten» statt «Halme», in Zeile 10 «es gemahnt mich an den Schlaf» statt «an den Schlaf gemahnend», und in Zeile 16 ist nach dem Wort «Tränen» das Wort «mild» hinzugefügt; die beiden wesentlichen Änderungen aber betreffen den Titel und die Zeile 12. Gustav Mahler hat den Titel «Die Einsame im Herbst» – das Gedicht auf sich selbst beziehend – zu «Der Einsame im Herbst» verändert, und in der 12. Zeile – «Ja, gib mir Schlaf, …» – das Wort «Schlaf» durch das Wort «Ruh» ersetzt, das eher noch den Gedanken an den Tod nahelegt.
Ein unvorstellbarer Zeitraum – der einem, will man ihn benennen, beinahe den Mut zum Sprechen nimmt –, ein Zeitraum von über zweitausend Jahren liegt zwischen dem Gedicht «Herbst» von Wu-Ty und einem Gedicht, das, im ersten Entwurf, den Titel «Der Herbsttag» trägt – dem im Herbst 1799 ausgearbeiteten, im alkäischen Silbenmaß gehaltenen Gedicht «Mein Eigentum» von Hölderlin. Und noch immer eintausend Jahre liegen zwischen den Herbstgedichten Tu Fu’s oder Tschang-Tsi’s «Die Einsame im Herbst» und Hölderlins Gedicht.
Bemerkenswert ist aber nicht, daß als etwas Gemeinsames in den genannten altchinesischen Gedichten und in Hölderlins «Mein Eigentum» der Herbst benannt werden kann; bemerkenswert ist, daß in Hölderlins Gedicht – wie in den altchinesischen Gedichten – das Bild vom Herbst verknüpft ist mit dem Schmerz über die Trennung von der Geliebten und mit der Frage nach der – wie es bei Hölderlin heißt – «bleibenden Stätte», der «rühmlichen Heimat». Doch Hölderlin, anders, verharrt nicht in der Klage.
Mein Eigentum
In seiner Fülle ruhet der Herbsttag nun,
Geläutert ist die Traub und der Hain ist roth
Vom Obst, wenn schon der holden Blüthen
Manche der Erde zum Danke fielen.
Und rings im Felde, wo ich den Pfad hinaus,
Den stillen, wandle, ist den Zufriedenen
Ihr Gut gereift und viel der frohen
Mühe gewähret der Reichtum ihnen.
Vom Himmel bliket zu den Geschäfftigen
Durch ihre Bäume milde das Licht herab,
Die Freude theilend, denn es wuchs durch
Hände der Menschen allein die Frucht nicht.
Und leuchtest du, o Goldnes, auch mir, und wehst
Auch du mir wieder, Lüftchen, als seegnetest
Du eine Freude mir, wie einst, und
Irrst, wie um Glückliche, mir am Busen?
Einst war ichs, doch wie Rosen, vergänglich war
Das fromme Leben, ach! und es mahnen noch,
Die blühend mir geblieben sind, die
Holden Gestirne zu oft mich dessen.
Beglükt, wer, ruhig liebend ein frommes Weib,
Am eignen Heerd in rühmlicher Heimath lebt,
Es leuchtet über vestem Boden
Schöner dem sicheren Mann sein Himmel.
Denn, wie die Pflanze, wurzelt auf eignem Grund
Sie nicht, verglüht die Seele des Sterblichen,
Der mit dem Tageslichte nur, ein
Armer, auf heiliger Erde wandelt.
Zu mächtig, ach! ihr himmlischen Höhen, zieht
Ihr mich empor, bei Stürmen, am heitern Tag
Fühl ich verzehrend euch im Busen
Wechseln, ihr wandelnden Götterkräfte.
Doch heute laß mich stille den trauten Pfad
Zum Haine gehn, dem golden die Wipfel schmükt
Sein sterbend Laub, und kränzt auch mir die
Stirne, ihr holden Erinnerungen!
Und daß mir auch zu retten mein sterblich Herz,
Wie andern eine bleibende Stätte sei,
Und heimathlos die Seele mir nicht
Über das Leben hinweg sich sehne,
Sei du, Gesang, mein freundlich Asyl! sei du,
Beglükender! mit sorgender Liebe mir
Gepflegt, der Garten, wo ich, wandelnd
Unter den Blüthen, den immerjungen,
In sichrer Einfalt wohne, wenn draußen mir
Mit ihren Wellen allen die mächtge Zeit,
Die Wandelbare, fern rauscht und die
Stillere Sonne mein Wirken fördert.
Ihr seegnet gütig über den Sterblichen,
Ihr Himmelskräfte! jedem sein Eigentum,
O seegnet meines auch, und daß zu
Frühe die Parze den Traum nicht ende.
(F. Beißner, Große Stuttgarter Ausgabe)
Das Gedicht wurde – 1799 – in jener Jahreszeit geschrieben, die ein Jahr zuvor, am 25. September 1798, die Trennung von Susette Gontard gebracht hatte: der Herbst als jene Zeit, die den Jahrestag des Abschieds einschließt. Hölderlin wohnte seitdem in Homburg.
Der Verlust Susettes bestimmte gewiß die innere Situation, aus der das Gedicht hervorging. Davon spricht die 5. Strophe. Glücklich?
«Einst war ichs, doch wie Rosen, vergänglich war
Das fromme Leben, ach! und es mahnen noch,
Die blühend mir geblieben sind, die
Holden Gestirne zu oft mich dessen»
Aber Hölderlin gibt aus der Zeit des Herbstes – wie gesagt – keine Klage, sondern ein Herbstlied der «Fülle», der Reife, des «Reichtums»: «In seiner Fülle ruhet der Herbsttag nun», «Und rings im Felde, … /… ist den Zufriedenen / Ihr Gut gereift und viel der frohen / Mühe gewähret der Reichtum ihnen»
Es ist wie eine Feier der Erde, des Himmels, des goldenen Lichtest und der segnenden Luft – der Kräfte, die die «Frucht», das «Gut» zur Reife gebracht haben. «denn» – sagt Hölderlin – «… es wuchs durch / Hände der Menschen allein die Frucht nicht».
Sogar Hoffnung auf das Licht und die segnende Luft äußert sich, wenn auch in der Gestalt einer – zugleich zweifelnden – Frage.
Licht –
«Und leuchtest du, o Goldnes, auch mir, und wehst
Auch du mir wieder, Lüftchen, als seegnetest
Du eine Freude mir, wie einst, und
Irrst, wie um Glückliche, mir am Busen?»
Aber aus der Empfindung des Herbstes als einer Zeit der «Fülle», aus der Wahrnehmung der «Zufriedenen», denen «ihr Gut gereift» ist, wächst Hölderlin die Erkenntnis, daß ihm nicht das Glück des «sichren Mannes» gewährt ist, der «ruhig liebend» «am eigenen Herd in rühmlicher Heimat lebt», dem «über vestem Boden» «schöner sein Himmel» «leuchtet».
Und aber doch, sagt Hölderlin, bedarf ein jeder «Sterblicher» der «heiligen Erde», des «eigenen Grundes», soll seine «Seele» nicht «verglühen» wie die Seele dessen, «Der mit dem Tagelichte nur, ein / Armer, … wandelt».
Er, Hölderlin, ist nicht eingefügt in den ruhigen «gesegneten» Wechsel der Kräfte der Natur:
«Zu mächtig, ach! ihr himmlischen Höhen, zieht
Ihr mich empor, bei Stürmen, am heitern Tag
Fühl ich verzehrend euch im Busen
Wechseln, ihr wandelnden Götterkräfte»
Er kann nur noch auf andere Weise Ruhe erlangen.
Wo aber soll ihm eine «bleibende Stätte» sein? Damit seine «Seele» nicht «verglühe»?
«Auf Erden heimatlos», abgetrennt von dem Ziel «sorgender Liebe», bestimmt Hölderlin in einer beinahe ungeheuerlichen Zusammenfassung aller seelischen Kräfte die Dichtung selbst, den «Gesang» zu seinem «Asyl»:
«Und daß mir auch zu retten mein sterblich Herz,
Wie andern eine bleibende Stätte sei,
Und heimathlos die Seele mir nicht
Über das Leben hinweg sich sehne,
Sei du, Gesang, mein freundlich Asyl! sei du,
Beglükender! mit sorgender Liebe mir
Gepflegt, der Garten, wo ich, wandelnd
Unter den Blüthen, den immerjungen,
In sichrer Einfalt wohne, wenn draußen mir
Mit ihren Wellen allen die mächtge Zeit,
Die Wandelbare, fern rauscht und die
Stillere Sonne mein Wirken fördert»
Mit einer Anstrengung seiner Kraft, die menschliches Vermögen zu übersteigen scheint, will er – sein Dasein «zu retten» – im «Gesang» «bleibende Stätte», «vesten Boden» und «Liebe» finden. «Beglükender» «Gesang» – «freundlich Asyl» – ist der «Garten», «mit sorgender Liebe … / Gepflegt», wo er «sicher wohnt» wie der Mann, der «ruhig liebend ein frommes Weib, / Am eignen Heerd in rühmlicher Heimath» «Beglükt» «lebt». «Gesang» – das sei sein «Eigentum». In diesem «Garten» wohnend, mag «draußen» ihm «… die mächtge Zeit / Die Wandelbare, fern» «rauscht». Die drei Strophen, in denen Hölderlin den Gesang als sein Asyl, sein Eigentum aufruft, sind ein einziger beschwörender Satz.
Es ist nahegelegt, Hölderlins Kommentar zu seiner Übersetzung des Pindar-Bruchstückes «Die Asyle» zu erinnern, in dem es heißt:
«Themis, die ordnungsliebende, hat die Asyle des Menschen, die stillen Ruhestätten geboren, denen nichts Fremdes ankann, weil an ihnen das Wirken und das Leben der Natur sich konzentrirte, und ein Ahnendes um sie, wie erinnernd, dasselbige erfähret, das sie vormals erfuhren» (F. Beißner, Große Stuttgarter Ausgabe, Band 5, S. 288).
Die «Asyle des Menschen», die «stillen Ruhestätten» im Hölderlinschen Kommentar zu dem Pindar-Fragment (nach 1800), das «freundlich Asyl», die «bleibende Stätte» im Gedicht «Mein Eigentum» (1799) und die «Ruhestätte auf Erden» in dem Satz aus dem «Hyperion» (1797/99): «Daß man werden kann wie die Kinder, daß noch die goldene Zeit der Unschuld wiederkehrt, die Zeit des Friedens und der Freiheit, daß doch eine Freude ist, Eine Ruhestätte auf Erden!» – alle diese Stellen dürfen in einen Zusammenhang gebracht werden.
Schließlich gehöre hierzu auch die Stelle aus einem Brief Hölderlins an die Schwester vom 11. Dezember 1800: «Ich kann den Gedanken nicht ertragen, daß auch ich, wie mancher andere, in der kritischen Lebenszeit, wo um unser Inneres her, mehr noch als in der Jugend, eine betäubende Unruhe sich häuft, daß ich, um auszukommen, so kalt und allzunüchtern und verschlossen werden soll. Und in der That, ich fühle mich oft, wie Eis, und fühle es nothwendig, so lange ich keine stillere Ruhestätte habe, wo alles was mich angeht, mich weniger nah, und eben deßwegen weniger erschütternder bewegt.» (F. Beißner: Hölderlins Übersetzungen aus dem Griechischen. Stuttgart, Metzlersche Verlagsbuchhandlung, 1933)
In der Schlußstrophe des Gedichts «Mein Eigentum» bittet Hölderlin die «Himmelskräfte» um den Segen für seine «Ruhestätte auf Erden», für sein «Asyl» «Gesang», für sein «Eigentum»:
«Ihr seegnet gütig über den Sterblichen,
Ihr Himmelskräfte! jedem sein Eigentum,
O seegnet meines auch, und daß zu
Frühe die Parze den Traum nicht ende.»
1985
Selbstverständlich: Doppelstrategie
Die Politik der Entspannung vertrage keine Systemkritik an totalitären Staaten und keine Einforderung demokratischer Grundrechte für diese Staaten, hört man gelegentlich sagen. Die Forderung nach Gewährung der Bürgerrechte diene als ein Mittel, die Entspannungspolitik zu stören, sie setze insgeheim den Frieden an die zweite oder dritte Stelle. Entspannungspolitik sei nur mit Regierungen betreibbar, nicht mit Oppositionsbewegungen. Diejenigen, die von Systemkritik und Bürgerrechten sprechen, betrieben eine Politik der Re-Ideologisierung, wo es doch um den Kräfteausgleich zwischen Mächten gehe.
So wird von Als-ob-Regierenden oder von Regierenden gesprochen, die zu Regierenden sprechen. Die Worte sind nicht an die Regierten in totalitären Staaten gerichtet.
Andererseits hört man: Die Systemkritik an totalitären Staaten und die Einforderung demokratischer Grundrechte vertrage sich nicht mit Entspannung. Die Entspannungspolitik führe dazu, die Forderung nach Gewährung der Bürgerrechte zu vernachlässigen. Diejenigen, die von Entspannung sprechen, betrieben eine Politik der Entideologisierung, wo es doch um die Auseinandersetzung mit aggressiven, menschenverachtenden Mächten gehe.
Die Führungen zum Beispiel kommunistischer Staaten haben keine Probleme mit diesem Gegensatz der Ansichten. Sie vertreten das Prinzip der friedlichen Koexistenz von Staaten mit unterschiedlicher Gesellschaftsordnung und heben ausdrücklich hervor, daß es allerdings keine ideologische Koexistenz geben könne. Der ideologische Kampf, heißt es, wird unvermindert fortgeführt.
Ich befürworte dieses Prinzip. Es bedarf von seiten demokratischer Politiker einer Art Doppelstrategie, die die Entspannungspolitik und die Systemkritik an totalitären Staaten miteinander vereinbart.
Manche Autoren, die aus totalitären Staaten in die Bundesrepublik umgezogen sind, neigen aus psychologisch verständlichen Gründen dazu, den Gegensatz zwischen totalitärer Staatsordnung und der demokratischen Staatsordnung der Bundesrepublik zu betonen. Die kritische Auseinandersetzung mit demokratiegefährdenden Erscheinungen in der Bundesrepublik tritt in den Hintergrund.
Umgekehrt neigen manche bundesdeutschen Autoren dazu, über der Auseinandersetzung mit demokratiegefährdenden Erscheinungen in der Bundesrepublik die Notwendigkeit der Kritik an der totalitären Staatsordnung zu unterschätzen. (Ich rede nicht von solchen, die in demokratiefeindlichen Ordnungen wünschenswerte alternative Möglichkeiten zur Demokratie entdeckt zu haben glauben.)
Es lohnt sich, den grundsätzlichen Unterschied beider Ordnungen hin und wieder hervorzuheben, besonders im Zusammenhang mit der Erörterung von Zensur: während totalitäre Staaten eine der Voraussetzungen schriftstellerischer Arbeit, die freie Meinungsäußerung, systematisch unterdrücken, sogar mittels eigens zu diesem Zweck geschaffener Gesetze, kann in der Bundesrepublik von Zensur nicht die Rede sein, lediglich von manchen Versuchen, die Meinungsfreiheit zu beschneiden.
Übrigens: Die kritische Auseinandersetzung mit totalitären Staatsordnungen bedarf zu ihrer Legitimierung nicht der gleichzeitigen Kritik an Erscheinungen in demokratischen Staaten. Und umgekehrt: Die kritische Auseinandersetzung mit Erscheinungen in demokratischen Staaten bedarf zu ihrer Legitimierung nicht der gleichzeitigen Kritik an totalitären Staatsordnungen.
Die Befürchtung, Systemkritik an totalitären Staaten und die Einforderung demokratischer Grundrechte für deren Bevölkerung gefährde die Entspannung und den Frieden, bleibt eine Antwort schuldig auf die folgende Frage: Ist es nicht vorstellbar, daß zum Beispiel gerade die Einforderung demokratischer Grundrechte zu der Stärkung des kritischen Bewußtseins in den Bevölkerungen totalitärer Staaten führt, die die dort Regierenden vielleicht veranlaßt zu Verständigung im Interesse einer relativen Beruhigung im eigenen Machtbereich? Oder anders gesagt: Müssen die Regierenden in totalitären Staaten nicht zu Verständigung neigen, weil das beunruhigte und beunruhigende Bewußtsein ihrer Regierten sie dazu im eigenen Interesse veranlaßt? Ein gewisser Schein der Legitimiertheit will doch erlangt sein. Also: Annäherung durch starken Wandel – nämlich des Bewußtseins der Regierten.
Übrigens ist diese Überlegung von dem Gedanken geleitet, daß innerer und äußerer Frieden einander bedingen, also an erster Stelle geleitet von dem Gedanken an Frieden.
Als gelernter Ostwestdeutscher bin ich von der Beobachtung bestimmt, daß eine Entspannungspolitik, die über die Köpfe der Regierten hinweggeht, bei den Regierten immer zu Zweifeln an der Verständigungspolitik führt, die doch aber von den Regierten größtenteils gewollt wird.
Was geht das alles die Schriftsteller an? Schriftsteller gehören in der Regel nicht zu den Regierenden (von Ausnahmen ist abgesehen). Eine Art Doppelstrategie, die Entspannungspolitik und systematische Kritik an totalitären Staaten miteinander vereinbart, bedarf auch einer Art Arbeitsteilung. Demokratische Politiker, die beileibe beide Aspekte im Auge haben müssen, sind erfahrungsgemäß geneigt, je nach Lage den einen oder anderen Aspekt zu betonen. Schriftsteller, die keine Verhandlungen mit Regierungen führen, keine staatlichen Verträge abschließen können, die nichtsdestoweniger beide Aspekte im Auge haben sollten, können ohne Verletzung staatspolitischer Aufträge den Aspekt systematischer Kritik betonen.
Es ist selbstverständlich nicht ausgeschlossen, daß Schriftsteller die Politik von Regierenden betreiben. Dieser Fall ist häufiger bei manchen Schriftstellern aus totalitären Staaten zu beobachten; sie gefallen sich darin, als Handlungsreisende ihrer Regime in Sachen Propaganda Besuche in demokratischen Ländern zu zelebrieren. Nicht selten verwundern sie sich, daß ihre Ware wenig Anklang findet.
Brauchen Schriftsteller in demokratischen Ländern Schriftsteller-Organisationen? Meine Antwort ist zweiseitig: Schriftsteller brauchen Organisationen, um gemeinschaftlich soziale Belange und politische Rechte zu vertreten. Sie brauchen keine Organisationen, die unterschiedliche politische und literarische Positionen von Schriftstellern auf einen ausschließenden Nenner zu bringen trachten. (Solche Organisationen existieren in den kommunistischen Staaten.) Sie brauchen keine Organisationen, die über der Auseinandersetzung mit Erscheinungen im eigenen Land, über wirklicher oder vorgeblicher Entspannungsbemühung die Kritik an totalitären Staatsordnungen, die Einforderung demokratischer Rechte in totalitären Staaten und somit die Solidarität mit nichtkonformen Schriftstellern in solchen Staaten vergessen; und umgekehrt: die über die Kritik an totalitären Staatsordnungen die kritische Auseinandersetzung mit Erscheinungen im eigenen Land und die Entspannungsbemühungen vergessen.
1986
Polizeigeschichte als Universalgeschichte
«In ihr liegt die halbe moralische Welt» Dankrede anläßlich der Verleihung des Marburger Literaturpreises 1986
Die Frage, warum einer «das große weite Feld»[1] der besonderen Geschichte deutscher politischer Polizei für seine Wanderungen wähle, mag auch beantwortet werden können mit dem Grund: weil dieses Feld «dem denkenden Betrachter so viele Gegenstände des Unterrichts», «dem Philosophen so wichtige Aufschlüsse» eröffne[2]. Weder der Verächter noch der Liebhaber politischer Polizei müßte sich ob dieser Antwort grämen. Die Geister des Liebhabers und des Verächters scheiden sich bei der Antwort: weil dieses Feld «dem tätigen Weltmann so herrliche Muster zur Nachahmung» und «jedem ohne Unterschied so reiche Quellen des edelsten Vergnügens» eröffne[3]. Es zeigt sich schnell: «das Gebiet» der politischen Polizei ist «umfassend»; «in ihrem Kreise liegt die halbe moralische Welt»[4].
Dem praktischen Kopf, dem Liebhaber, den es auf dieses Feld zieht, mag es zuweilen nur darum zu tun sein, «die Bedingungen zu erfüllen, unter denen er» selber «zu einem» politisch-polizeilichen «Amte fähig und der Vorteile desselben teilhaftig werden kann»[5]. Da er früh bemerken wird, daß seine Fertigkeit universal nutzbar ist, mag er sich der Prüfung entheben, welcher Herrschaft er sich andient. «Seinen Lohn erwartet er von Anerkennung» seiner Fertigkeit[6], nicht von Übereinstimmung zwischen einer eigenen Weltansicht und den Gründen seiner Herrschaft. Nicht, daß solcher politischer Polizist allein in der Welt stünde; es bestärken ihn manche Inhaber anderer universal nutzbarer Fertigkeiten: Politiker, Bosse, Generäle, Richter, Gelehrte, Mediziner, Journalisten, Künstler, Dichter und so weiter.
Mein politischer Polizist aber ist von allen der reinste.
Mag der Politiker nichts weiter sagen müssen, denn er ist ja gewählt; mag der Boss sich hinter dem Weltruf einer Firma einrichten; mag der General sich auf den Notstand eines Befehls berufen; mag der Richter noch sagen müssen, er habe treulich dem vormals gültigen Recht gedient; mag der Gelehrte sich der reinen Wissenschaft verschrieben haben wollen; mag der lebenswerte Mediziner vorzubringen haben, daß er gutgläubig und aus Liebe zum Menschen gehandelt habe, als er die Todesspritze ansetzte; mögen Journalisten, Künstler, Dichter erklären wollen, daß sie Kinder der Zeit gewesen und sensible Opfer von Fehldeutung – mein politischer Polizist ist ehestens über diese und jene Berücksichtigungen hinweggesetzt; denn er hat die Herrschaft an sich zum Herrn, die Herrschaft als solche. Er kann sie alle, die vormaligen Mitwirkenden, und vor allem alle anderen, im nachmaligen Ordnungsgefüge unter Kontrolle nehmen, wie er die Vorvormaligen, und vor allem alle anderen, im vormaligen Gefüge unter Kontrolle genommen hat. Die anderen aber besonders, und zu jeder Zeit – die nämlich, welche jeglicher Herrschaft je wie harte Kiesel unter den Füßen sind oder wie schwere Steine im Weg.
Mein politischer Polizist ist die makelloseste Verkörperung von Kontinuität: am vielseitigsten verwendbar, am vielseitigsten erwünscht, und also überlegen allen verwandten Mitwirkenden.
Ist aber damit schon etwas gesagt über den Charakter der Ordnungsgefüge und Herrschaften, denen politische Polizeiapparate zu dienen haben? Ist schon etwas gesagt über den Charakter der politischen Polizeiapparate, denen mein politischer Polizist zu dienen wünscht?
Noch nichts. Daß politische Polizei dem Schutz gegebener Ordnungsgefüge diene, ist das allgemeinste. In der Mitte des vorigen Jahrhunderts und weiter als Mittel der «Staatsbürokratie, die das fürstlich-monarchische Herrschaftsmonopol» gegen die Umsturzpartei, das sind: die Demokraten, später: die Sozialisten «verteidigen wollte»[7].
In der Weimarer Republik als «Staatsschutzorgan der liberalrechtsstaatlichen Ordnung»[8].
In der totalitären Nazidiktatur als ein Macht- und Unterdrückungsinstrument des herrschenden Regimes.
In einer anderen totalitären Diktatur – über die Arbeiter und Bauern – als ein anderes Macht- und Unterdrückungsinstrument des herrschenden Regimes.
Mein politischer Polizist durchschreitet die Ordnungen in Deutschland von der Mitte des 19. bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts und sieht sich unterschiedlich vergnügt. Am wenigsten vergnügt in der parlamentarischen Demokratie der Weimarer Republik, in welcher die «parteipolitische Neutralität, die Legalität und Integrität» der politischen Polizei von den führenden Vertretern der republikanischen Polizei betont wurde[9]. Es steht auf einem anderen Blatt, daß zum Exempel in der Weimarer Republik die überwältigende Zahl aller von rechtsradikaler Seite begangenen politischen Morde – und fast alle politischen Morde wurden von rechtsradikaler Seite begangen – unbestraft geblieben ist[10].
Ohne blind zu sein für die allfällige Neigung politischer Polizeiapparate, sich abzuschließen und sich zu verselbständigen, so daß gar in der parlamentarischen Demokratie, die doch die parlamentarische, das heißt ja: die öffentliche Kontrolle der politischen Polizei vorsieht, die furchteinflößende Kuriosität zu beobachten sein kann, wie diejenigen, die der Kontrolle zu unterliegen haben, danach trachten, jene zu kontrollieren, denen die Kontrolle obliegt – ohne also blind zu sein für solche Gefährdung der Demokratie, ist es doch geboten, den ganz anders gearteten Charakter der politischen Polizeiapparate in Diktaturen zu benennen: diese Apparate unterliegen gar keiner öffentlichen Kontrolle. Sie schalten und walten einzig im Interesse dieser Regime. Wo es keine Demokratie gibt, kann Demokratie nicht gefährdet werden.
Mein politischer Polizist schert sich gar nicht um den Charakter der Ordnungsgefüge und Herrschaften, um den Charakter der politischen Polizeiapparate. Er dient in reiner Form, jederzeit und jedem.
Der Geschichtenschreiber aber macht sich unbeliebt, denn er ist unzufrieden. Etwas will er doch erwarten, etwas Altmodisches – nämlich eine, zwar vielmals belächelte, verantwortete Verknüpfung von persönlicher Weltansicht und den Gründen der Herrschaft. Das «Zeitalter … worin wir leben» – bietet es nicht jedem «das unschätzbare Recht, sich selbst seine Pflicht auszulesen»?[11] Der Geschichtenschreiber erwartet von seinem politischen Polizisten nicht, daß er kein politischer Polizist sei. Nur, daß er seine persönliche Weltansicht an eine Herrschaft, seine Herrschaft knüpfe. Und – dieses folgt sogleich – sich ganz und gar verantworte vor anderer Ansicht und anderer Ordnung.
Wie! Soll er nicht politischer Polizist bleiben dürfen sein Leben lang, bloß, weil die Zeiten, Ansichten, Ordnungen sich ändern? Soll er einen anderen Beruf ergreifen müssen im Fall von Veränderungen?
So erwartungsvoll ist der Geschichtenschreiber, der sich unbeliebt macht.
Mein politischer Polizist legt unvermittelt eine Frage nahe: könnte ich, könnten Sie so sein wie er? Was wäre mit mir, mit Ihnen gewesen, wenn etwas, das man Erziehung, Zeitumstand undsoweiter nennt, so und so gewesen wäre. Oder: was ist, wenn etwas so und so ist? Zu welchem Ende gelangt es? Was heißt Polizeigeschichte?
Der Polizeigeschichtenschreiber steht vor einer «langen Kette von Begebenheiten»[12]. «Ganz und vollzählig überschauen kann sie nur der unendliche Verstand»; dem Polizeigeschichtenschreiber «sind engere Grenzen gesetzt»[13]. «… viele dieser Ereignisse … sind durch kein Zeichen festgehalten worden».[14] Wer führt denn auch, zum Exempel, Folterprotokolle?
«Die Schrift … selbst ist nicht unvergänglich».[15] Wie anfällig ist sie für Feuer und Reißwolf?
«Unter den wenigen» «Denkmälern» «endlich, welche die Zeit verschonte» und welche uns zugänglich, «ist die größere Anzahl durch die Leidenschaft» «ihrer Beschreiber verunstaltet und unkennbar gemacht».[16] Herr Polizeirat Stieber hat sich seine eigene Geschichte zurechtgeschrieben.
«Die kleine Summe von Begebenheiten, die nach allen … Abzügen zurückbleibt, ist der Stoff der» Polizeigeschichte.[17] «Was und wieviel von diesem … Stoff gehört nun» dem Polizeigeschichtenschreiber?[18] Anders gefragt: zu welchem Ende studiert man Polizeigeschichte?
Der Polizeigeschichtenschreiber hebt diejenigen Begebenheiten heraus, «welche auf die heutige Gestaltung der Welt und den Zustand der jetzt lebenden Generation einen wesentlichen … und leicht zu verfolgenden Einfluß gehabt haben. Das Verhältnis eines historischen Datums zu der heutigen Weltverfassung ist es also, worauf gesehen werden muß»[19].
Aber Bruchstücke der Polizeigeschichte vor Augen, würden doch einzelne Polizeigeschichten nie etwas anderes «als ein Aggregat von Bruchstücken werden»[20]. «Jetzt … kommt» der Polizeigeschichtenschreiber mit einer poetischen Idee «zu Hilfe», «und indem er diese Bruchstücke»[21] unter seine poetische Idee stellt, und Wirkliches, das ihm noch fehlt, der vorgefundenen Wirklichkeit gemäß hinzudenkt, also erfindet, und erfundene Wirklichkeit mit wirklich Gefundenem derart verknüpft, daß selbst ein Gelehrter schwer zu unterscheiden vermag, wo die Grenze zwischen Erfindung und Wirklichkeit verläuft, weil solcherart Wirklichkeit, der allgemeinen Erfahrung gemäß, wie wirklich ist, nämlich denkbar – indem also der Polizeigeschichtenschreiber derart verfährt, «erhebt er das Aggregat zum» poetischen «System»[22]. «Seine Beglaubigung dazu liegt in der Gleichförmigkeit … des menschlichen Gemüts».[23]
Vielleicht, daß ein Gedanke hervorgerufen wird über den bemerkenswerten Unterschied zwischen Diktatur und Demokratie, welcher mangels lebendiger Anschauung öfter übersehen oder aus mächtigen Gründen frech geleugnet wird; vielleicht, daß der denkbaren Ansicht weitergeholfen wird, es sei von besserem Nutzen, auf die bestallten Aufpasser aufzupassen anstatt das Kind Demokratie mit dem Bade auszuschütten, weil doch in letzterem Fall nur noch auf diejenigen aufgepaßt werden würde, die aufzupassen gehabt hätten.
Während der Polizeigeschichtenschreiber seine kleine Arbeit tut, geht «der Kampf der Diktatur, die sich auf die politische Polizei stützt … wie seit Jahrzehnten gegen Millionen von Menschen in vielen Ländern der Erde ununterbrochen weiter»[24]. Zu welchem Ende führt er?
Sie und Friedrich Schiller werden es mir unterdessen nachgesehen haben, daß ich den Begriff der Polizeigeschichte für den der Universalgeschichte genommen habe; dies, um etwas allgemeiner zu benennen, erstlich, was Polizeigeschichte heißt, zwotens, zu welchem Ende sie der Geschichtenschreiber studiert.
1986
Nicolas Born
In angestrengter Lage, beschäftigt mit einem Roman, einem Gedicht, einem Aufsatz, die Anstrengung auf der Stirn, war Nicolas Born immer beschäftigt mit anderer Leute Roman, Gedicht, Aufsatz. Nicht Wasschreibstdu, Wieweitbistdu, sondern Lies vor, Laß sehen, und: strenge Gespräche über die Arbeit. Die Schnellen mochten einhalten, die Langsamen mochten Schritt halten. Woher sein Gefühl und Wissen, eine Arbeit sei falsch, dürftig, aufgesetzt, heischend? Aber er wollte selber geprüft werden. Rasche Zustimmung, faules Lob zweifelte er an. Durften andere seine Arbeit mit leichteren Gewichten messen als er seine Arbeit maß und die Arbeit anderer?
Sein Wissen und Gefühl kamen aus rigoroser Aufrichtigkeit. Womöglich empfindet jemand es als lästig, von der Aufrichtigkeit zu sprechen. Das Wort werde allzu leicht gebraucht, zumal für jemanden, der tot sei. Mancher hat Grund, das Wort Aufrichtigkeit für Nicolas Born zu gebrauchen.
Nicht anders als mit den Arbeiten anderer ging Nicolas Born mit anderen und mit sich selber um. Schwäche hieß Schwäche, Stärke Stärke. So konnte Nicolas Born Freundschaft gewinnen und Freundschaft verlieren.
Einen Gegner konnte Nicolas Born sich machen, wenn er ahnte oder wußte, und es sagte, daß jemand eines teueren Erfolges wegen billig von Wichtigerem absah. So war Nicolas Born radikal.
Welche, die ihm vorschlugen, einen Freund zu verraten, wies er fort und verriet sie dem Freund. So war Nicolas Born treu. Jemandem, der ahnungslos war, zeigte Nicolas Born einen Weg. Jemandem, der hilflos war, kochte Nicolas Born ein Essen. So war Nicolas Born brüderlich.
In verzweifelter Lage, beschäftigt mit unheilbarer Krankheit, beschäftigt mit einem Roman, einem Gedicht, auf der Stirn Not, war Nicolas Born noch beschäftigt mit anderer Leute Krankheit, Roman, Gedicht. Die Gesunden schwiegen manchmal. Die Kranken sollten gesund werden. So war Nicolas Born verantwortlich.
In trostloser Lage, beschäftigt mit dem Ende, Angst auf der Stirn und Zorn, lehnte Nicolas Born Mitleid ab. So war Nicolas Born tröstlich.
1987
Verraten und verkauft
Verraten in der Sprache älterer Lexikographen (nämlich des Grimmschen Wörterbuches) heißt: «bekennen, was unbekannt bleiben sollte»; in ursprünglicher engerer Bedeutung: «etwas nicht auf den weg der mittheilung gehöriges unbefugter weise mittheilen».
Verrat ist: «verkündung von etwas zu verschweigendem».
Daß dasjenige, was bekannt wird oder verkündet, etwas sei, das «eigentlich unbekannt hätte bleiben sollen», sagt nichts über den ideellen oder materiellen Wert des «zu verschweigenden», drückt nur aus wie verraten und Verrat in der Sprache bewertet sind.
Die älteren Lexikographen entdecken eine – wie sie es nennen – «gehässige Nebenbedeutung». Sie haftet logisch auch dem Wort Verräter an, und der Verräter selbst sieht sich gekennzeichnet.
Die älteren Lexikographen unterscheiden natürlich für das Neuhochdeutsche zwischen Verrat an einer Person und Verrat an einer Sache.
Verraten «heiszt zunächst ‹einen einem andern durch falschen rat bekannt machen und in die hände liefern›». Es heißt aber auch: «object, eine sache, bekannt machen, was geheimnis bleiben soll».
Die sogenannte «gehässige Nebenbedeutung» von verraten, Verrat, Verräter findet bei jüngeren Lexikographen (nämlich des Wörterbuches der deutschen Gegenwartssprache) einen direkteren Ausdruck, und zwischen Person und Sache wird säuberlich unterschieden: verraten heißt: «jmdm.», – Komma, und ich setze statt des nachfolgenden Kommas ein «und/oder» – und/oder «einer Sache die Treue brechen».
Verrat