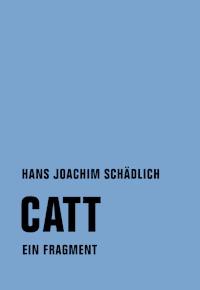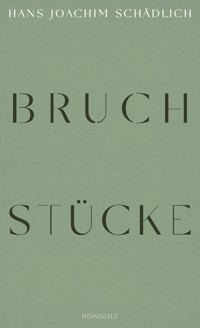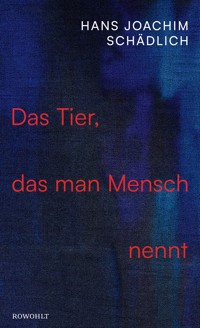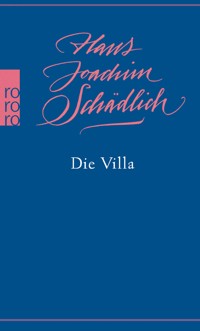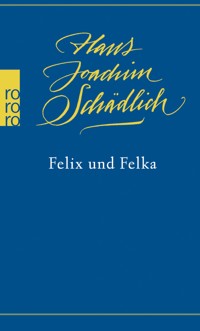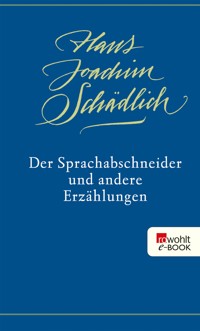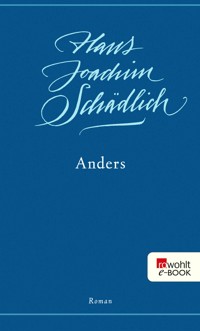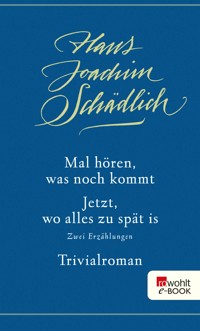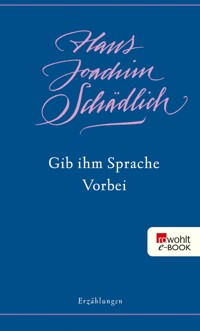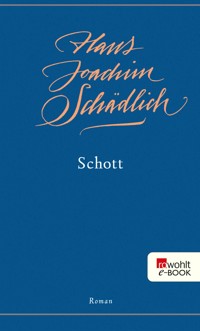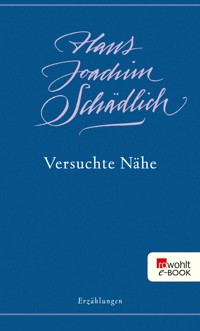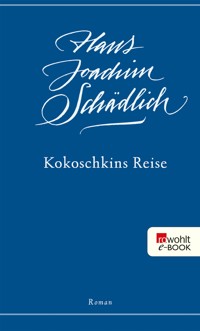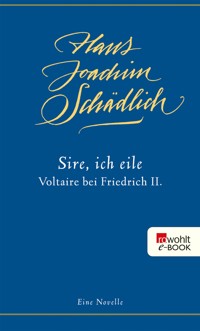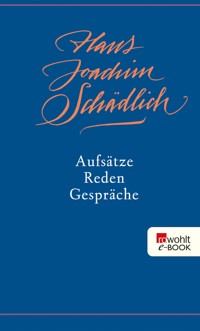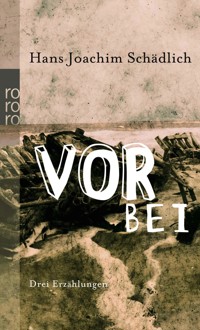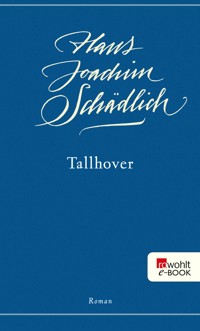
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Schädlich: Gesammelte Werke
- Sprache: Deutsch
Ein General muss wissen, wie man Schlachten gewinnt, nicht, für wen. «Die Politik müssen sie schon selber machen», sagt Tallhover. Er ist Mitglied der politischen Polizei. Während aller historischen Ereignisse des 19. und 20. Jahrhunderts in Deutschland bleibt er, unabhängig vom jeweils herrschenden System, seiner Sache treu: dem Schutz des Staates vor den Aufsässigen. «Hans Joachim Schädlich ist ein geradezu zirzensisches Kunststück geglückt: ein Buch, das ausschließlich auf (offenbar gründlich recherchierten) Fakten beruht – und das dennoch einen eigenen Stil hat. Ein oft atemberaubender Balanceakt, den Schädlich mit den Mitteln eines perfekten Artisten besteht.» (Fritz J. Raddatz in der ZEIT)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 370
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Hans Joachim Schädlich
Tallhover
Roman
Über dieses Buch
Ein General muss wissen, wie man Schlachten gewinnt, nicht, für wen. «Die Politik müssen sie schon selber machen», sagt Tallhover. Er ist Mitglied der politischen Polizei. Während aller historischen Ereignisse des 19. und 20. Jahrhunderts in Deutschland bleibt er, unabhängig vom jeweils herrschenden System, seiner Sache treu: dem Schutz des Staates vor den Aufsässigen.
«Hans Joachim Schädlich ist ein geradezu zirzensisches Kunststück geglückt: ein Buch, das ausschließlich auf (offenbar gründlich recherchierten) Fakten beruht – und das dennoch einen eigenen Stil hat. Ein oft atemberaubender Balanceakt, den Schädlich mit den Mitteln eines perfekten Artisten besteht.» (Fritz J. Raddatz in der ZEIT)
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, April 2015
Copyright © 1986 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Umschlaggestaltung any.way, Walter Hellmann
Kalligraphie: Frank Ortmann
ISBN 978-3-644-53811-5
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Inhaltsübersicht
Für Ursula Plog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
59. Kapitel
60. Kapitel
61. Kapitel
62. Kapitel
63. Kapitel
64. Kapitel
65. Kapitel
66. Kapitel
67. Kapitel
68. Kapitel
69. Kapitel
70. Kapitel
71. Kapitel
72. Kapitel
73. Kapitel
74. Kapitel
75. Kapitel
76. Kapitel
77. Kapitel
78. Kapitel
79. Kapitel
80. Kapitel
81. Kapitel
82. Kapitel
Für Ursula Plog
1
Der Lehrer Sänger, der nur ein Mensch ist, eine Ordnung muß sein, damit die Arbeit, Belehrung der Neunjährigen, getan werden kann, reißt immer die Tür auf, das ist auffällig genug, daß die Neunjährigen hinsehen, Sänger kommt, er spart sich die Stimme. Bis die Neunjährigen an ihren Plätzen stehen, geht der Lehrer Sänger bloß zu seinem Platz für den Morgengruß, einen Meter vor der mittleren Bankreihe. Zwei Worte sind der Gruß, aber der Lehrer Sänger läßt von jedem Wort etwas fort, das Ende vom ersten, vom zweiten den Anfang, die Reste tut er zusammen. Das tun die Neunjährigen, wie sie es hören von Sänger.
Aufmunterung am Morgen kommt von Kopfrechnen. Die Neunjährigen stehen an ihren Plätzen, Sänger, daß er selber folgen kann, sagt schnell,
Drei mal zwölf plus vier durch zwei mal fünf minus neunundzwanzig, ist?
und Schüler Böttcher, der es weiß, darf sich setzen.
Vierundzwanzig Neunjährige, vierundzwanzig Rechenaufgaben schickt Sänger aus, daß jeder sich setzen könnte, wäre jeder nur schnell wie Böttcher. Zwei und Tallhover bleiben aber stehen, das sind die Langsamen. Daß sie dastehen vor den anderen, muß ausgebügelt werden, bald, nämlich in der Pause, sagen sie sich.
Eine Ordnung muß auch sein in der Pause, der Lehrer Sänger will in dem Lehrerzimmer sitzen in der Pause und nicht in dem Klassenzimmer, aber in dem Klassenzimmer muß eine Ordnung sein. Sänger hat ausgedacht, daß der erste, der sich setzen darf wegen schnellen Kopfrechnens, das ist Böttcher, zu wichtigem Amt komme in der Pause. Böttcher stehe neben der Tafel, die Schulklasse im Auge, wer Unordnung stiftet oder Lärm ausruft, und schreibe die Namen der Täter auf die Rückseite der Tafel. Was Lärm sei oder Unordnung, bestimme nur Böttcher.
Untersagt ist es, sagt Böttcher, nachzulesen auf der Rückseite, wen Böttcher notiert.
Kloss, der nicht rechnen kann, und Sörgel, der nicht rechnen kann, achten das Amt gering, das Böttcher antritt neben der Tafel. Das Butterbrotpapier, in Fetzen gerissen, zu Kugeln gekaut und fortgeschnellt von geschickter Zunge, trifft die Tafel neben Böttcher oder trifft Böttcher. Nur hinter der Tafel, solange Böttcher die Namen Kloss und Sörgel schreibt, wird Böttcher nicht getroffen, aber er sieht nichts. Muß sich also treffen lassen von speichelnassem Papierklump. Das kostet es, daß er stehen darf neben der Tafel.
Schmitz, der rechnen kann, ruft trotzdem Schlag um Schlag auf Böttchers Ohr, daß Böttcher wer ist, der
Schleimer! Schleimer! Schleimer!
gerufen werden muß, daß Böttcher zu schreiben hat: Schmitz.
Die Namen von Kube und Ringmann, die nicht wissen, daß sie in Ungnade fallen, weil sie auf die Bank kritzeln, das ist verboten, kritzeln sie Böttchers Namen?, schreibt Böttcher auf die Rückseite der Tafel.
Lohmüller ist dumm genug, daß seine Tat sichtbar bleibt ohne Böttchers Notiz, Lohmüller taucht den Federhalter in das Tintenfaß, hält den Federhalter als Speer, wirft fast, aber hält den Federspeer fest, nur die Tinte fliegt in Tropfen, die ersten groß, die letzten kleiner und winzige Punkte zuletzt, gegen die Wand. Das ist sogar eine Geschicklichkeit, daß Tintenpunktreihe und Tintenpunktreihe sich zu dem Muster fügen, das wehende Fahne darstellt oder Rauch im Wind.
Tallhover nutzt die Pause anders. Auf einem Blatt Papier notiert er Rechenaufgaben für seinen Kopf. Die Zahlen, die er schreibt, murmelt er, Zwölf plus siebzehn, und sagt das Ergebnis, ehe er murmelnd schreibt, wie es fortgeht: Minus acht, und sagt, ehe es wieder fortgeht, das Ergebnis. Schneller schreibt er und murmelt schneller, den Nachbarn, der ihn anstößt, stößt er weg mit dem Ellenbogen. Vor dem Ende der Pause läßt er Papier und Federhalter aus, spricht sich nur vor, was zu rechnen ist, sagt das Ergebnis und spricht sich vor. Nur der Lehrer Sänger rechnet schneller als Tallhover. Die erste Aufgabe, die Sänger hersagt, löst Tallhover als erster. Tallhover steht neben der Tafel, sein Auge entdeckt Unordnung, sein Ohr entdeckt Lärm. Tallhover schreibt Namen, daß Sänger sie vorfinde am Ende der Pause.
Sänger reißt die Tür auf, Tallhover vergißt die Rechenaufgabe, die er sich aufgegeben hat, sieht hin, und sieht Sänger, der zu Böttcher geht. Böttcher, dem Sänger die Hand auf die Schulter legt, soll vorlesen: die Namen auf der Rückseite der Tafel, aber nicht alle auf einmal. Zuerst nur einen: Kloss.
Kloss, komm her, sagt der Lehrer Sänger.
Kloss geht zu Sänger, Kloss grinst.
Das vergeht dir, sagt Sänger. Dreh dich um.
Kloss dreht sich um.
Bück dich, sagt Sänger.
Die Neunjährigen sehen Kloss gebückt.
Sänger nimmt einen Stock, der auf seinem Pult liegt, holt hoch aus, schlägt Kloss, daß Kloss sich aufrichtet, der Stock rutscht ab in die Kniekehlen.
Bück dich, sagt Sänger.
Kloss bückt sich, Sänger holt hoch aus.
Du sollst dich bücken, sagt Sänger und holt hoch aus.
Kloss grinst nicht.
Lies vor, sagt Sänger zu Böttcher.
Sörgel, liest Böttcher.
Sörgel, komm her, sagt der Lehrer Sänger.
Sörgel geht zu Sänger, Sörgel grinst nicht.
Zeig deine Hände her, sagt Sänger.
Sörgel streckt seine Hände aus.
Die Handflächen nach oben, sagt Sänger.
Sänger, der geübt ist, holt aus mit seinem Stock und zielt auf die Handflächen, so daß, da Sörgel die Hände zurückzieht, das weiß Sänger, der Stock die Fingerkuppen trifft, wie Sänger es will.
Weiter, sagt Sänger zu Böttcher.
Schmitz, liest Böttcher.
Schmitz, sagt Sänger, natürlich Schmitz.
Weiter, sagt Sänger.
Kube, liest Böttcher.
Weiter, sagt Sänger.
Ringmann, liest Böttcher.
Schmitz, Kube, Ringmann, sagt Sänger. Kommt her. Kommt her, meine Guten.
Schmitz, Kube und Ringmann stellen sich auf. Sänger gibt Schmitz seinen Stock, sagt, Kube, bück dich, sagt, Schmitz, schlag zu. Aber schlag zu.
Schmitz schlägt zu.
Sänger sagt, Schmitz, gib Kube den Stock, Ringmann, bück dich.
Kube schlägt zu.
Sänger sagt, Kube, gib Ringmann den Stock, Schmitz, bück dich.
Ringmann schlägt zu.
Schön, sagt Sänger. Weiter, sagt Sänger.
Lohmüller, liest Böttcher.
Lohmüller, sagt Sänger. Was machen wir denn mit dir? Komm her. Sag der Klasse, was du bist. Sag, daß du ein dreckiger Kerl bist.
Lohmüller sagt, daß er ein dreckiger Kerl ist.
2
Daß etwas zu sehen ist, was nur er sähe, Tallhover, aber nicht sehen soll, bringt Tallhover zu der Tür, er geht leise, bleibt stehen, daß es, wenn er sich nur schnell genug aufrichtet aus gebückter Haltung, aussehen kann, als ginge er, das rechte Auge ist scharfsichtiger, also gerichtet auf die Stelle, die sehen läßt, das linke Auge geschlossen, Tallhover sieht Knie knapp neben Knie, abwärts Wade und Wade, aber abgeschnitten vom unteren Rand des Durchgucks. Auf die Knie Ellenbogen gestützt. Auf die Hände der Kopf. In dem Gesicht Ruhe, die will Tallhover sehen. Die Augen, die er sieht, geschlossen. Die Zunge leckt die Oberlippe, die Unterlippe. Die Spitze der Zunge geht an den Schneidezähnen entlang von der Mitte nach links, von links nach rechts. Die Augen öffnen sich. Der Kopf erhebt sich aus den Händen. Die linke Hand stützt sich auf das Knie, die rechte Hand reißt Reinigungspapier ab. Sie schiebt sich unter den rechten Oberschenkel, der sich von dem Sitz abhebt handbreit. Geräusch der Reinigung. Die rechte Hand kommt hervor, reißt Reinigungspapier ab, schiebt sich unter den Oberschenkel. Die rechte Hand kommt hervor.
Daß nur er sieht, was zu sehen ist, wenn er Mut aufbringt zu dem Blick, macht Tallhovers Auge älter, das will er. Die Mutter, die älter ist dreimal, weiß nichts von dem Alter seines Auges. Tallhover ist in seinem Zimmer, ehe sie die Tür öffnet, die Mutter kommt heraus.
3
Tallhover, der zu alt ist für den Kauf eines Puzzle-Spiels, aber der zu jung ist für den Kauf eines Puzzle-Spiels für einen Sohn, betritt einen Laden für Spielwaren und fragt in Verlegenheit nach einem Puzzle-Spiel.
Zwei kleinere Spiele, die der Ladeninhaber auf den Tisch legt, schiebt Tallhover ohne Geduld beiseite. Greift nach den größeren Spielen, die der Ladenbesitzer vorzeigt, und findet eines, das er nicht besitzt. Flüchtiger Blick genügt ihm und muß genügen, damit das Bild sich nicht einprägt.
Abends, nach langer Schreiber-Arbeit, die ihm zur Last geworden ist nach kurzer Zeit, verschließt er sich in seinem Zimmer. Die Mutter, die ihm das Essen gerichtet hatte und gegessen hat mit ihm, sitzt in der Stube allein. Behutsame Anfrage, ob es nichts zu reden gebe über den Tag, beantwortet Tallhover kaum. Da es der Mutter lieber ist, daß er, wenn auch wortarm, in ihrer Wohnung wohnt anstatt irgendwo in der Stadt, schweigt sie. Unerklärlich ist es ihr, daß er, in solchem Alter, Kinder-Spiele nach Hause bringt von seinem Lohn, der ihr doch gelegen käme für den Kauf von Brot, von welchem er viel verlangt morgens und abends.
Vor einem Holzregal, das er selber gebaut hat mit Eifer, weil es die Spiele aufnehmen soll, die ihm gelingen, bleibt Tallhover kurze Zeit stehen. Zufrieden sieht er auf die Spiele, die ihm gelungen sind. Platz ist aber noch für viele.
Tallhover geht zum Tisch. Er öffnet das neue Spiel, schließt die Augen und stülpt den Karton um. Ein kleiner Berg Pappteilchen liegt vor ihm. Nur auf dem Tisch ist es hell. Tallhover schiebt den Berg bis zum oberen Rand des Tisches und setzt sich nieder zur Arbeit. Beide Hände greifen zu, und Tallhover betrachtet, was er in Händen hält. Öfter schon hat er bei erstem Zugriff zwei Bildstücke ertappt, die zusammengehörten und also sich frühzeitig verraten hatten. Die Genugtuung macht ihm die Suche nach hunderten Stücken, die sich verbergen, vergnüglich. Tallhover weiß es von früherer Arbeit und weiß es wieder, daß er besonders ausgerüstet ist für Suche und Auffindung. Den winzigen Fetzen eines verzweigten Plans in der Hand zu halten und in dem Wirrwarr winziger Fetzen zu suchen nach dem passenden Stück, das dem anderen lückenlos sich anfügt und unwiderlegbar! Zu sehen, wie Stück für Stück der Teil eines großen Bildes zusammentritt. Und, an anderer Stelle der Fläche, ein anderer Teil, und, an dritter Stelle, ein dritter! Und wie die Teile des Bildes, der erste Teil und der zweite, der zweite und dritte unverhinderbar zusammenrücken zu übersehbarem Zusammenhang der Tat-Sachen. Die aber verborgen bleiben, wenn Tallhover sie nicht ans Licht bringt mit Kraft und Lust.
Über solcher Anstrengung, die Tallhover von Stunde zu Stunde ermuntert, so daß er am Ende der Arbeit frisch ist, vergißt er die Uhrzeit, sorgt sich zuletzt doch, daß nur vier Stunden Schlaf bleiben bis zum Morgen. Die Tagesarbeit ermüdet ihn vor ihrem Anfang, und an ihrem Ende ist er in seinem Kopf gelähmt. Die Lähmung ist aber größer, je besser die Suche voranging am Abend in seinem Zimmer. Und dringender eilt er nach Hause zu belebender Arbeit, je größer die Lähmung am Tag.
Tallhover paßt die letzten Stücke in das Bild ein, das endlich sich ausbreitet vor seinem Blick; in müden Augen hat Tallhover Freude. Er holt noch Klebstoff aus der Schublade, verteilt ihn mit einem Läppchen gleichmäßig über den Anblick, so daß die Fugen sich füllen und Teil mit Teil dauerhaft verzahnt bleibt.
Die letzte Sorge vor kurzem Schlaf: daß er den anderen Tag ein neues Zusammensetzspiel finde in einem Laden.
4
Wem soll Tallhover es sagen? Er bleibt, wie das Handwerk, das er erlernen will, es nach seiner Ansicht verlangt, streng für sich. Einen Freund hat er in der großen Stadt Berlin nicht, weil er keinen haben will. Aus gleichem Grund keine Freundin. Niemandem will er Antwort geben müssen auf Fragen nach seiner Beschäftigung, damit er verläßlich sein kann. Mit keiner Freundin sich einlassen auf vertrauliches Gerede.
Die, denen er es sagen dürfte, wissen es ohnehin. Er will es aber der Mutter sagen. Er will es ihr schreiben. Daß er das Vertrauen eines Kriminalkommissars gewonnen habe durch pünktliche und ordentliche Schreiber-Arbeit bei dem Kriminalgericht. Daß ihm der Herr Kriminalkommissar eine Bitte erfüllt, welche er lange mit sich herumgetragen, nämlich den Herrn Kriminalkommissar begleiten zu dürfen auf dessen Gängen in die Viertel des Verbrechens. Daß er dem Herrn Kriminalkommissar manchen Dienst habe erweisen können dank seiner Konnexionen in manchen Stadtvierteln, über welche er aber nichts Näheres schreiben dürfe. Daß er, nach allen Erlebnissen auf diesem Gebiete, nur noch wünsche, in die Kriminalabteilung des Polizeipräsidiums einzutreten, den erfolgreichen Abschluß als Referendar vorausgesetzt. Der Herr Kriminalkommissar sage ihm Erfolg bei einer eventuellen Bewerbung voraus. Ich hoffe voller Zuversicht, daß ich angenommen werde. Mein Lebensziel ist eine fruchtbare Tätigkeit bei der Kriminalpolizei; ich will auch Kriminal-Kommissar werden.
5
Das kann Tallhover niemandem sagen, auch der Mutter nicht. Daß die Kriminalabteilung des Polizeipräsidiums, in welche er aufgenommen wurde am ersten August Achtzehnhundertzweiundvierzig als ein Anwärter auf die Stellung eines Kriminalkommissars, ihn bestimmt hat zu einer politischen Aufgabe. Die Mutter weiß zwar von seiner Anstellung, und wußte, als sie von Tallhover davon erfuhr, nicht sicher, ob sie sich freuen sollte, weil es Tallhover gelungen war, seiner Neigung einen beruflichen Rahmen zu geben, oder ob sie das Glück des Sohnes fürchten sollte für den Sohn.
Tallhover steht unter der Leitung und Obhut des Königlichen Polizei-Inspektors Hofrichter.
Das, sagt Tallhover, ist ein Glück. Denn Herr Polizei-Inspektor Hofrichter ist Vertrauter des Herrn Polizei-Präsidenten von Puttkamer. Er ist also sowohl ein erfahrener Mann des Faches als auch einflußreich; er kann mich, sagt Tallhover sich, in zweifacher Weise fördern. Ich will alle Kraft daransetzen, sein Vertrauen in mich, seine Neigung zu mir zu rechtfertigen, oder besser: durch geneigte, vertrauensvolle Leistung eigentlich zu begründen.
Sie reisen nach Köln, sagt Polizei-Inspektor Hofrichter. Ein erfahrener Vertrauensmann unseres Präsidii, Herr Friedrich Goldheim, ist bereits dort eingetroffen. Zwar bedarf er Ihrer Mithilfe nicht. Aber zum Zweck Ihrer Einweihung in die Observation Verdächtiger sind Sie Herrn Goldheim ab sofort als eine Art Co-Inquirent beigegeben.
Sie reisen morgen. Am Sonntag ist in Köln die Grundsteinlegung für den Fortbau des Domes durch den König. Die Feier der Grundsteinlegung soll von überschwenglicher Begeisterung getragen sein. Die Rheinländer sollen von unserem König entzückt und begeistert sein. Freude soll an diesem Tag durch die Stadt wogen. Der König wird von einem einzigen, großen und mächtigen Deutschland sprechen, das unblutig den Frieden der Welt erzwingt. Die Rheinufer werden übrigens in einer Illumination von ungesehenem Glanz erstrahlen. Eine große Feier. Es gibt viel Arbeit.
Was habe ich zu tun?, sagt Tallhover.
Sie mischen sich unter die Menge und achten auf Störenfriede. Sie werden nicht allein sein.
Das andere ist der Freundeskreis der Rheinischen Zeitung. Trachten Sie nach einem irgendwie gearteten Anschluß. Herr Goldheim wird Ihnen helfen. Sie bleiben in Köln, bis ich persönlich Sie zurückrufe. Der Gedanke einer Verfassung, der in der Rheinischen Zeitung zum Ausdruck gebracht wird, widerstrebt durchaus der Ansicht des Königs. Überhaupt, die Rheinische Zeitung strebt danach, durch Einbürgerung des Geistes und der abstrusen Phraseologie einer neuen Philosophie ein der Sinnesweise der Bevölkerung bisher fremdes Element einzupflanzen.
Noch etwas. Nur besonders zuverlässige und tüchtige Beamte werden von mir mit Recherchen dieser Art betraut. Ich rechne Sie zu denjenigen, die ich tüchtig und zuverlässig nenne. Sie nehmen durch meinen Auftrag eine bevorzugte Stellung ein, und ich sage Ihnen voraus, daß der Neid mancher Kollegen Ihnen diese Stellung mitunter recht erschweren wird. Sie werden wohl daran tun, Ihre Tätigkeit in politischen Untersuchungen so wenig als möglich hervortreten zu lassen.
Ich verstehe, sagt Tallhover. Es entspräche gar nicht meiner Art, viel Aufhebens zu machen.
Gut, sagt Polizei-Inspektor Hofrichter. Sie wissen auch, daß derjenige Polizeibeamte, der für die politische Sicherheit sorgt, leider gehässig angesehen wird. Ich kann Ihnen deshalb nicht Vorsicht genug empfehlen bei der Erledigung Ihrer Arbeit. Überhaupt, das sollen Sie wissen, werden politische Polizei-Beamte in aller Regel mit Undank belohnt; deshalb schätze ich es besonders, daß sich noch Männer zu solcher Tätigkeit bereitfinden.
Ich wünsche mir doch solche Arbeit, sagt Tallhover.
In Ordnung, sagt Polizei-Inspektor Hofrichter. Sie berichten mir separat, durch unsere Kölner Kuriere, direkt in die Dorotheenstraße. Herrn Goldheim treffen Sie im Frankfurter Hof, wo auch Sie Quartier nehmen.
Danke, Herr Polizei-Inspektor, sagt Tallhover.
Herrn Friedrich Goldheim trifft Tallhover im Frankfurter Hof nicht an. Er sei seit dem Morgen nicht im Haus gewesen, sagt der Portier. Da es noch leidlich hell ist, macht Tallhover sich auf den Weg. Weil aber von dem Fest der Grundsteinlegung noch nichts zu bemerken ist, geht Tallhover bis in die Schildergasse, wo, wie Herr Polizei-Inspektor Hofrichter gesagt hat, im Haus Nummer neunundneunzig die Redaktion der Rheinischen Zeitung für Politik, Handel und Gewerbe ihren Sitz hat. Das also sind sie, sagt Tallhover. Morgen und immer will ich mir diese Zeitung kaufen, damit ich nach meinem Urteil Herrn Polizei-Inspektor Hofrichter mitteilen kann, woran es diesem Blatt mangelt, wovon es zuviel bietet und welche Schlüsse aus polizeilichem Gesichtswinkel ich daraus ziehe, nur unterstellt, ich hätte leitend verantwortlich zu handeln.
Im Frankfurter Hof trifft Tallhover endlich auf Herrn Goldheim, dem er, als einem Vertrauten von Herrn Polizei-Inspektor Hofrichter, Vertrauen entgegenbringt.
Goldheim will eine Tasse Schokolade trinken, Tallhover sagt, er wolle dies auch. Ehe sie sich an einen Ecktisch setzen, hat Tallhover, wie es seit einiger Zeit zu seiner Gewohnheit zählt, ein Signalement seines Gegenüber im Kopf: Mittlere Statur, zirka sechs Fuß; Haare schwarz, kurz; Schnurrbart dito; Gesicht leicht gedunsen, Gesichtsfarbe gelb; trägt schwarze Hosen, einen weißgelben Rock.
Goldheim sagt, es werde Tallhover gefallen in Köln. Das sei doch etwas anderes als das trockene Berlin. Bis zum Sonntag sei nichts weiter zu tun als Ausschau zu halten und fleißig die Rheinische Zeitung zu lesen.
Die Leute von der Rheinischen Zeitung sind öfter im Königlichen Hof am Thurnmarkt zusammengekommen, sagt Goldheim; ob sie es noch immer tun, weiß ich nicht. Da kämen wir nicht heran. Noch weniger kommen wir in die Häuser von Georg Jung und Ignaz Bürgers, wo diese Leute sich auch treffen. Die Schwester von Jung ist ein schönes Weib, wer die kennenlernen könnte. Am ehesten ist vielleicht etwas zu machen beim Montagskränzchen der Zeitungsleute im Laacher Hof. Das überlassen Sie aber mir, sagt Goldheim.
Herr Goldheim weiht Tallhover nicht in die Observation verdächtiger Personen ein, so daß Tallhover selber zusehen muß. Aber die Kölner bei der Feier des Domfestes sind keine lohnenden Objekte der Beobachtung. Tallhover läßt sich treiben. Ein Sonntag in der Stadt am Rhein. Zwar hatte Tallhover gehört, der Freundeskreis der Rheinischen Zeitung werde auch den Tag der Grundsteinlegung für den Fortbau des Domes festlich begehen. Wo aber die Festlichkeit stattfinden sollte, hatte er nicht erfahren. Und wie hätte ich Einlaß finden sollen?, sagt Tallhover sich am Flußufer, während der Illumination, die tatsächlich, wie Herr Polizei-Inspektor Hofrichter es vorausgesagt hat, von unerhörtem Glanz ist.
Soviel schreibt er jedoch an Herrn Polizei-Inspektor Hofrichter:
Wie zu hören ist, veranstalten die Leute der Rh. Ztg. seit dem Sommer ein Montagskränzchen im Laacher Hof, das der Erörterung der sozialen Frage dienen soll. Herr Goldheim hat sich diesen Gegenstand persönlich vorbehalten.
Unterdessen ist bekannt, daß dem König am Sonntag, dem 11. September, ein allgemeines Bürgerfest auf dem Neumarkt gegeben werden soll. Die Adligen, heißt es, wollen für den König ein Rheinisches Ritterfest in Godesberg stattfinden lassen, am Dienstag, dem 13. Wie bei dem Dombaufest werde ich mich am 11. und 13. unter der teilnehmenden Bevölkerung aufhalten.
Ich habe mein Augenmerk ansonsten auf die Rh. Ztg. gerichtet.
Selten trifft Tallhover im Frankfurter Hof Herrn Goldheim. Herr Goldheim ist nicht gesprächig. Er sagt aber zum zweiten Mal, Immer schön die Zeitung lesen, Tallhover.
Über Bürger- und Ritterfest berichtet Tallhover nichts nach Berlin.
6
Nach vierzehntägigem Aufenthalt in Köln und regelmäßiger Lektüre der Rheinischen Zeitung für Politik, Handel und Gewerbe schreibt Tallhover seine Ansicht nieder für den Königlichen Polizei-Inspektor Herrn Hofrichter, Wohlgeboren in Berlin, Dorotheenstraße Numero achtundzwanzig:
Ich erlaube mir, Ihre Aufmerksamkeit zu schärfen für die Rheinische Zeitung, die hierorts alle Blicke auf sich lenkt. Wäre das Wort Sensation in meinem Gebrauche nicht reserviert für etwas Positives, so müßte ich, was das Aufsehen, die Bewegung, ja die Gärung, die diese Zeitung erregt bzw. hervorruft, angeht, sagen, daß sie viel Sensation macht. Es gibt meines Erachtens nur eine preußische Zeitung, welche neben der Rh. Ztg. noch das Interesse zu fesseln vermag, das ist die Königsberger.
Die Rh. Ztg. weckt in den Lesern das Gefühl, eine von unserem König gnädig gewährte Mitwirkung des Volkes an der Gesetzgebung sei nichts als Abhängigkeit von Willkür. Die Rh.Ztg. mißachtet durchaus, daß sich die Idee allgemeiner und gleicher Bürgerrechte nicht mit der Vorstellung unseres Königs von der natürlichen Zertrennung unseres Volkes in unterschiedliche Stände verträgt. Es kann unseren König nur schädlich reizen, daß er durch Zeitungsdebatten in seinem Souveränetätsgefühl, dem die Idee bindender Bürgerrechte zuwider sein muß, beeinflußt werden soll.
Ich kann mich einer Bemerkung nicht enthalten, die leicht die Gefahr des Mißverständnisses in sich bärge, wüßten Sie, Wohlgeboren, sich meiner Überzeugung von dem ruhigen Lebenszustand unseres Volkes nicht sicher. Gäbe es nämlich im Volk ein Tat-Bewußtsein, das zwar noch schlummerte, so wäre das Tun der Rh. Ztg. dazu angetan, dieses Bewußtsein zum entschlossenen Hervortritt aufzuwecken. Eine entfesselte Presse könnte leicht Zustände heraufbeschwören, die noch ganz außerhalb der polizeilichen Berechnung liegen. Die denkende und handelnde Fürsorge des Königs und der Regierung für das Volk erscheint in der Rh. Ztg. geradezu als eine öffentliche Bevormundung des Volkes, aus der es Entlassung zu beantragen hätte. So, als wäre für die große Menge nicht physisches Wohlbehagen der Inhalt des Lebens, sondern irgendeine Wahrheit. Ich muß allerdings einschränkend hinzufügen, daß sowohl nach meinem eigenen Eindrucke als auch nach den Berichten mir Gleichgesinnter die Auffassung von der politischen Gleichheit aller Bürger nicht nur in der Rheinischen Zeitung zum Ausdrucke kommt, sondern hier am Rhein auch in der Bevölkerung verbreitet zu sein scheint. Die Anschauung des Königs und unserer Regierung, daß allgemeine und gleiche Bürgerrechte im Prinzip abzulehnen sind, steht offenbar im Gegensatz zu Teilen der öffentlichen Ansicht in der Westprovinz. Ich schreibe Ihnen das, Wohlgeboren, in gebotener Offenheit, da Abhilfe nur geschaffen werden kann, wenn das Übel erkannt ist.
Es kann nicht sein, daß eine Zeitung das Bekenntnis eines anderen leitenden politischen Prinzips als das der Regierung und des Königs ablegt.
Von Anhängern der Rh. Ztg. kann man hier hören, es sei unerträglich, daß die Zensur die besten Gedanken der Schriftsteller aus lichtscheuer Vorsorge unterdrücke, weil diese Gedanken nicht in das Regierungssystem sich einfügten.
Wie ich jedoch im Obigen bereits dargetan, muß vom ungezügelten Walten einer öffentlichen Meinung die schlechteste Wirkung für das Gemeinwohl erwartet werden. Die Frage, ob irgendeine Wahrheit überall und von jedem soll ausgesprochen werden dürfen, ist für denjenigen, der es ernst meint mit der Bewahrung einer sicheren und gesitteten Ordnung, keineswegs müßig. Die Antwort kann nur Nein! lauten. Die Rh. Ztg. beweist ja mit jeder Nummer, daß die Erweckung von Mißvergnügen mit dem existierenden gesetzlichen Zustande, die Aussaat von Mißtrauen zwischen den Organen des Herrschers und den Untertanen auf eine Erschütterung des monarchischen Prinzips und der ständischen Ordnung abzielt.
Es steht nach meinem Urteil nur der Regierung und dem König zu, über Mittel zu verfügen, die ein begründetes Urteil in den Staatsdingen zulassen. Diese Mittel sind die ausreichenden Berichte der Beamtenschaft. Mit Betreff der Rh. Ztg. kann dies nur bedeuten, daß die Regierung, statt den Kulminationen der Unzulässigkeit von zum Drucke gelangten Äußerungen zuzusehen, dieses Oppositionsblatt unverzüglich dem Verbote unterwerfen sollte.
Unter den Verfassern von Artikeln in der Rh. Ztg. sind die Doktoren Prutz, Robert, Marx, Karl, Bauer, Bruno, Heß, Moses u.a.
Hochachtungsvoll, Euer Wohlgeboren ergebenster
Tallhover.
Köln, den 15ten September 1842
Polizei-Inspektor Hofrichter sagt bei Gelegenheit zu dem Herrn Polizei-Präsidenten von Puttkamer, Ich habe einen Mann nach Köln geschickt, der mich sehr zufriedengestellt hat mit einer persönlichen Ansicht über die Rheinische Zeitung. Wenn wir nicht längst Bescheid wüßten, besser könnten wir Bescheid nicht bekommen. Der Mann heißt Tallhover. Er ahnt nicht, daß seine Schlüsse in eine Richtung gehen, die unweigerlich einzuschlagen sein wird. Der Mann ist prädestiniert.
Herr Polizei-Präsident von Puttkamer sagt, Wir brauchen gute Leute.
7
Aus Berlin, aus der Hand des Polizei-Inspektors Hofrichter, erhält Tallhover am zwanzigsten September geheime Ordre, weiterhin in Köln zu verweilen. Man habe sichere Nachricht, daß der Herwegh, Georg, Verfasser der gegen die bestehende Ordnung des Landes umstürzlerisch gerichteten Gedichte eines sogenannten Lebendigen, in Mainz sich aufhalte und die Absicht habe, Ende des Monats nach Köln zu reisen sowie im ferneren durch ganz Deutschland. Es stehe zu vermuten, daß er die Rheinische Zeitung besuche, welcher er bisher aus der Schweiz korrespondiert habe. Tallhover möge mit Tatkraft und Geschick eine Konnexion zu erlangen suchen, die Aufschluß liefere über Äußerungen des Herwegh in Köln.
Dieses Schreiben sei nach Kenntnisnahme augenblicklich zuverlässig zu vernichten.
Am selben Tag klopft Herr Goldheim bei Tallhover, sagt, seine Aufgabe in Köln sei erledigt, er reise noch heute nach Berlin zurück, sagt aber nichts sonst, grüßt Tallhover knapp und geht.
Obgleich das Datum der Ankunft des Herwegh noch nicht bekannt zu sein scheint, weiß man im Kreis der Rheinischen Zeitung doch, wie ich zuverlässig erfahren konnte, von seiner Absicht, hierher zu kommen, schreibt Tallhover an Herrn Polizei-Inspektor Hofrichter. Es verlautete auch, daß zu Ehren des Herwegh gewiß ein festliches Essen stattfinden werde. Da es im Verlaufe des Jahres zu einer Regel geworden ist, daß der Kreis der Rh. Ztg. derartige Festivitäten im hiesigen Königlichen Hof am Thurnmarkt abhält, habe ich noch gestern, nur kurz nach der Lektüre Ihres werten Schreibens, das ich der Weisung gemäß verbrannt, mich auf den Weg zum Königlichen Hof gemacht. In der festen Annahme, richtig zu handeln, bin ich im Königlichen Hof vorstellig geworden, und ist es mir auf Grund zweier Referenzen, welche mir durch frühere Tätigkeit als Aushilfs-Bediensteter zugekommen und die ich stets bei mir trage, gelungen, per Samstag, 24. ds.Mts., als Getränkekellner angestellt zu werden. Es ist diese Tätigkeit als Getränkekellner von besonderem Belang, da man stets im Raume zu sein hat zum Zwecke des Nachgießens. Ich will unauffällig alles daransetzen, bei einem etwaigen Essen der Rh. Ztg. eingeteilt zu werden. Da ich mir leihweise Kleidung verschaffen muß, bitte ich um zusätzliche Gewährung einer entsprechenden Geldsumme.
Von einer Bemühung unserer hiesigen Behörde habe ich abgesehen, um mein Vorhaben desto sicherer unentdeckt bleiben zu lassen.
Herwegh ist am Donnerstag, dem neunundzwanzigsten September Achtzehnhundertzweiundvierzig, rheinabwärts kommend, in Köln eingetroffen, begleitet von Gutzkow, mit welchem er am Vortag in Mainz sich aufgehalten hatte. Für Freitag ist ein Festmahl im Königlichen Hof vorgesehen, das der Freundeskreis der Rheinischen Zeitung veranstaltet.
Am frühen Samstagmorgen, noch müde von der Arbeit im Königlichen Hof, schreibt Tallhover an Herrn Polizei-Inspektor Hofrichter, es sei ihm glücklicherweise gelungen, als zweiter Getränkekellner zu dem Festmahle, das tatsächlich zu Ehren von Herwegh und Gutzkow gegeben, und zwar tatsächlich im Königlichen Hof gegeben worden sei, eingeteilt zu werden. Leider zwar sei er nicht ununterbrochen im Raume gewesen, da es ihm als dem zweiten Getränkekellner auch obgelegen habe, weitere Flaschen herbeizuholen.
Soweit ich aber das Gespräch habe verfolgen können, das mit Herwegh und Gutzkow geführt worden, so habe ich außer Herwegh und Gutzkow die Herren von Mevissen, Advokat Fay und Redakteur Heß vernommen.
Beim Mahle sagte Gutzkow: Das politische Lied ist Sache des Moments. In zehn Jahren wird die ganze politische Poesie begraben sein.
Herr von Mevissen sagte: Unter allen politischen Versemachern der Gegenwart sind mir einzig Sie, lieber Herwegh, und Prutz von Bedeutung. Bei den meisten ist doch der Enthusiasmus erlogen und durch den Verstand mit Gewalt hineingezwängt.
Herwegh sagte aufgeregt: Ich schreibe politische Lieder, weil ich nicht anders kann. Ich begreife nicht, wie Sie das poetische Produkt darstellen als eine Mischung aus diesen und jenen Ingredienzien. Ich schreibe nicht, wann ich will, sondern wann ich muß. Die Dichtung muß aus dem Herzen kommen. Nicht der Gegenstand macht die Dichtung, sondern die Begeisterung erhebt den Gegenstand zum Dichterischen.
Herr von Mevissen sagte: Nehmen Sie Hoffmann von Fallersleben. Er ist weder bedeutender Dichter noch großer Charakter. Bloß dem Oppositionsgeist zuliebe wird das kleine Talent zum großen Manne aufgestopft. Erborgte Größe. Ein Gewebe, das allzu leicht zerreißt.
Advokat Fay sagte: Man mußte ihn hier an der Tafel sehen. Wie er siegsgewiß umherschaute, wenn er eine Mine seines Witzes hatte springen lassen.
Beim Dessert wurde von der Negation gesprochen. Redakteur Heß sagte: Negation ist die Hauptsache. Man muß niederreißen, um die Dinge in Bewegung zu bringen.
Herr von Mevissen sagte: Die absolute Negation ist nichts als absolute Leere. Die Grundlage des Negativen muß das Positive sein.
Gutzkow sagte: Ja. Die Negation hat Wert, wenn sie zum Positiven hinleitet. In Deutschland müssen die alten Zustände untergehen; die neue Zeit gärt allerorten in allen Köpfen.
Herr von Mevissen und Gutzkow redeten auch über die Rheinische Zeitung, jedoch ich konnte den größten Teil des Gesprächs nicht hören. Ich hörte aber, daß einer der Herren die Zensur eine Köpfmaschine im Reiche des Geistes nannte.
Ich konnte in Erfahrung bringen, daß Herwegh morgen eine Reise durch ganz Deutschland anzutreten beabsichtigt, während Gutzkow bloß nach Hamburg reist. Herweghs erste Station ist angeblich Düsseldorf. Es heißt, Herwegh sei Hauptredakteur einer Zeitschrift Deutscher Bote o.ä. in Zürich, die ein Hauptstapelplatz für alle politischen Gedanken werden soll, welche in Deutschland nicht gedruckt werden dürfen. Für diese Zeitschrift will er durch persönlichen Auftritt Teilnehmer gewinnen.
Ich hörte noch, ohne angeben zu können, von wem, sagen: Die politischen Gedichtchen von Hoffmann von Fallersleben mit ihren Sticheleien gegen die Regierungen, diese niedlich gedrechselten Sächelchen sind nichts gegen die Gedichte von Herwegh.
Es ist nahe Veranlassung zu der Annahme gegeben, daß, wenn dem Herwegh für seinen Haß gegen die Aristokratie und für seinen glühenden Republikanismus überall in Deutschland solche Triumphpforten erbaut werden wie in Köln von der Rh.Ztg., eine wahre Springflut von Sympathie-Kundgaben sich auftürmen wird.
Wäre es also nicht besser, diesem Lebendigen, dessen Poesie ein gefährliches Mittel ist, weil sie elektrisch rührt und sich sowohl in das Gemüt der Jugend tief prägt als auch die Älteren unmerklich umstrickt, die Reise durch Deutschland rechtzeitig zu verbieten? Herwegh will nicht bloß singen, er will auch handeln.
Dies Euer Wohlgeboren ergebenst zur Kenntnis zu bringen beeilt sich mit Hochachtung
Tallhover.
Köln, den 1ten October 1842
8
Polizei-Inspektor Hofrichter beordert Tallhover sehr zufrieden nach Berlin zurück.
Die weitere Überwachung des Herwegh auf seiner Reise durch Deutschland müssen andere übernehmen, sagt Polizei-Inspektor Hofrichter zu Tallhover. Ihre Berichte über die Rheinische Zeitung und über Herwegh haben gefallen, Tallhover.
Polizei-Inspektor Hofrichter findet wenig Grund, die Acta des Königlichen Polizei-Präsidii zu Berlin, betreffend den Doktor Georg Herwegh, die in der Geheimen Präsidial-Registratur angelegt wurden, besonders aufmerksam zu beachten. Besonderes ist nicht vorgefallen. Daß der Herwegh in Jena über acht Tage bei Prutz gewohnt und sich von Professoren und Studenten hat huldigen lassen; daß Prutz mit neidischen Augen auf die Anerkennung sieht, die Herwegh findet, Nun gut, sagt Polizei-Inspektor Hofrichter. Daß der Herwegh im November in Berlin mit der Tochter Emma des Königlichen Hoflieferanten, Manufaktur- und Modewarenhändlers Siegmund, der an der Ecke vom Schloßgarten wohnt, sich verloben konnte, nennt Polizei-Inspektor Hofrichter eine Geschmacklosigkeit des Hoflieferanten. Schön, sagt Polizei-Inspektor Hofrichter, die Dame ist nicht mehr die jüngste. Und für Herwegh ist sie eine reiche Frau. Daß die Ruhmsucht und Eitelkeit einen Herwegh durch Deutschland treibt, darin kann ich noch nichts Gefährliches erblicken. Zwar haben schon viele minder begabte Dichter, Dichterlinge, von der politischen Poesie sich anstecken lassen und reimen nun auch patriotisch. Aber die echten deutschen Dichter halten sich von diesen Bestrebungen fern. Die politische Poesie erledigt sich von selbst. Es will schon keiner mehr politische Gedichte lesen, weil eines dem anderen gleich ist. Ob durch die Poesien von Herwegh und Konsorten der Kommunismus gefahrdrohende Fortschritte macht, bezweifle ich sehr. Viel gefährlicher ist die journalistische Verschwörung in Köln und Leipzig.
Sogar der Audienz, die Seine Majestät dem Herwegh am neunzehnten November gewährt hat, mißt Polizei-Inspektor Hofrichter unter polizeilichem Gesichtswinkel keine besondere Bedeutung bei. Er ist es zufrieden, daß die Liberalen über Herweghs Gang ins Schloß untröstlich sind und neuerdings einen Fürstendiener in ihm sehen. Er erfreut sich sogar daran, daß böswillig gesagt worden ist, wo möglich werde Herwegh sich unter den Schutz des Königs stellen, da er doch neuerdings durch Bande der Liebe an die preußische Residenz gefesselt sei. Es genügt Polizei-Inspektor Hofrichter, daß man sich, wie er in den Acta gelesen hat, allenthalben lustig über Herwegh, den glühenden Republikaner macht. Sein Deutscher Bote aus der Schweiz, für den er in Deutschland werben wollte, ist, während er noch für ihn wirbt, schon für Preußen verboten. Polizei-Inspektor Hofrichter bewundert rückhaltlos das Talent des Königs; den Herwegh auf die liberalen Gesinnungen in Ostpreußen zu verweisen und doch zu wissen, daß Maßregeln getroffen sind, damit dem Herwegh in Ostpreußen keine liberale Bezeugung von Ehre zuteil wird, welche gegen die Ordnung verstößt, das ist komödiantisch exzellent, sagt Polizei-Inspektor Hofrichter.
Erst der Bericht von Friedrich Goldheim, den Polizei-Inspektor Hofrichter am Donnerstag, dem fünfzehnten Dezember, in die Hand bekommt, unterbricht seinen Gleichmut:
Nach einer aus Königsberg in Preußen hierher gelangten privat Correspondens soll während der Anwesenheit des Herwegh sich besonders eine allgemeine Gemüths-Aufregung gegen unsere Regierung kundgegeben haben. Namentlich soll es bei dem dem Herwegh gegebenen Festmahle im Ausdruck der Freude wegen dem verehrten Gast fast tumultuarisch hergegangen sein.
Der Ober Landes Gerichts Rath Crelinger, welcher jedoch nur als Advokat in Königsberg fungirt, hat namentlich in sehr freien Worten die bei Feste anwesende academische Jugend angeredet und schloß seine Rede ungefähr mit den Worten: Daß wenn kein anderer Weg zur Erlangung der Freiheit übrig bliebe, sie entschloßen sein mögen, sich für diese mit dem Schwert zu gürten.
Außer daß Herwegh in sehr freien Worten sein Interesse dem Dr. Jacoby zuwandte und von diesem wiederum bekomplimentirt wurde, benahmen sich beide während des Festmahles sehr ruhig.
Der Besuch des Herwegh bei Sr Majestät dem Könige, welcher nur aus einer persönlichen Neugierde entstanden sein soll, ist von der ihm anhängenden Partei mehr für eine Kränkung des Herwegh beurtheilt worden und soll diesen deshalb veranlaßt haben, noch folgendes Schreiben (deßen Inhalt ich ungefähr nur dem Sinn nach mitzutheilen vermag) an Se Majestät den König abzuschicken, welches man in Abschriften sowohl hier zu verbreiten bemüht ist als auch in auswärtigen Blättern mitzutheilen gedenkt.
Der flüchtigen Mittheilung nach lautet dasselbe ungefähr jedoch ohne wörtliche Verbürgung:
«Wenn mein Besuch bei Euer Majestät keinen anderen Zweck gehabt haben sollte, als die Allerhöchste Neugier zu befriedigen, so muß ich nur die kostbare Zeit bedauern, welche Euer Majestät und ich dabei verloren haben. – Nicht also die freie Rede des Mannes wollten Sie in meiner Person ehren – denn das Decret Ihrer Diener dokumentirt mir hinreichend wie illusorische Hoffnungen ich an die Folgen dieses Besuches für die Freiheit Deutschlands geknüpft hatte. – Durften diese Diener nach meinem Besuche bei Euer Majestät ein Verbot meines Blattes wagen, wenn es ihnen nicht geboten worden wäre? – Laßen Euer Majestät daher ruhig die freundlichen Gesinnungen für meine Person fallen, wenn Euer Majestät nicht die Bahn freigeben wollen, welche ich zu wandeln gedenke. Lassen Sie uns Feinde sein – Feinde der Gesinnungen – aber offen, denn
Wer wie ich mit Gott gegrollt
darf auch mit einem König grollen.»
Noch bemerke ich, daß die hier verzweigten Anhänger des Herwegh nach dessen Eintreffen in Berlin beabsichtigen, demselben in engerem Privatkreise sogenannten politischen Thee zu geben, welcher von Dr. Meyen und Rutenberg arrangirt werden soll.
Wahrscheinlich werde ich im Stande sein zur Zeit Näheres hierüber mitzutheilen.
Berlin, den 14. December 1842.
Gldhm
Schleunigst beordert Polizei-Inspektor Hofrichter Tallhover zu sich.
Da Sie von der Sache und der Person her vertraut sind mit dem Gegenstand und ich zudem wünsche, daß Sie die Tätigkeit im Amte kennenlernen, sollen Sie mir in der Sache Herwegh ab sofort assistieren, Tallhover.
Jawohl.
Alles mit Bezug auf Herwegh, das bei uns einlangt, halten Sie zusammen und erstatten mir Bericht. Auch sorgen Sie für anschließende Weiterleitung aller Herwegh-Sachen an die Präsidial-Registratur. Vergessen Sie schließlich nicht die Zeitungen, insonderheit die Rheinische Zeitung, die Deutschen Jahrbücher und die Leipziger Allgemeine Zeitung. Ich selbst kann nicht alles lesen.
Zur Sache noch. Das Schreiben Herweghs an den König, wenn es bereits zirkuliert, können wir nicht aufhalten. Daß es aber in Königsberg doch zu einer ordnungsstörenden Ehrbezeugung gekommen ist, ist sehr ärgerlich. Das soll dem Jakobyner Crelinger schlecht bekommen und dem Vier-Fragen-Mann Jacoby selber auch. Wir wollen auch feststellen, ob die Herren Meyen und Rutenberg sich bereits in Berlin aufhalten. Das erste aber ist: ich muß wissen, wo der Herwegh sich im Moment befindet.
Am Dienstag, dem zwanzigsten Dezember, hat Tallhover dem Polizei-Inspektor Hofrichter etwas zu melden. Der Wachtmeister Zwicker hat soeben rapportiert:
Dr. Georg Herwegh ist gestern Abend hier angekommen, logirt im Hotel de Russie, und ist durch den gehorsamst beigefügten Paß legitimirt.
Polizei-Inspektor Hofrichter besieht sich den Paß. Zu Tallhover sagt er nur, Etwas stimmt nicht, und geht.
Eine Stunde später kommt er ins Zimmer, sagt, Tallhover, Sie gehen in das Hotel de Russie und stellen fest, wann der Herwegh im Russie abgestiegen ist.
Jawohl.
Im Hotel de Russie erfährt Tallhover, der Herwegh sei am Mittwoch, dem vierzehnten Dezember, angekommen. Er wolle bis Ende des Monats bleiben.
Warum der Doktor Herwegh nicht umgehend angemeldet worden sei.
Seine Anmeldung sei vergessen worden.
Polizei-Inspektor Hofrichter ist ungehalten und diktiert in Gegenwart Tallhovers für den Polizei-Präsidenten von Puttkamer:
Der Dichter Herwegh wohnt im Hotel de Russie, wird das Fest über hier verweilen und war bis gestern abend noch nicht angemeldet.
Er ist mit einem Reisepaße der Cantons Polizei Direktion des Cantons Bern versehen, welcher unter dem 7ten d.M. in Königsberg i.Pr. und unterm 14ten d.M. in Stettin visirt worden ist. Seit dem 14ten, wo er nach Inhalt des letzten Paßvisum von Stettin bereits abgereist war, hat er sich ungemeldet in Berlin aufgehalten.
Soviel ich ferner aus verläßlichen Quellen entnommen, findet das zu Ehren Herweghs projectirte Subscriptions-Eßen wenig oder gar keinen Anklang, da sich Herwegh durch sein stolzes Benehmen die hiesigen Literaten entfremdet haben soll.
Berlin, den 20ten December 1842
So, sagt Polizei-Inspektor Hofrichter.
Der Polizei-Präsident, Herr von Puttkamer, läßt eine Stunde vor dem Ende der Dienstzeit Polizei-Inspektor Hofrichter rufen und sagt, Den Herwegh sürveillieren lassen und sein Treiben genau verfolgen.
Am andern Morgen sagt Polizei-Inspektor Hofrichter zu Tallhover, Sürveillance des Herwegh. Es gibt Arbeit. Auch für Sie. Ich habe soeben Anweisung erhalten, dem Herrn Jagor, Besitzer des Hotel de Russie, bekannt zu machen, daß er die Vorschriften betreffs des An- und Abmeldens der bei ihm logierenden Fremden künftighin pünktlich zu befolgen und seine Leute demgemäß anzuweisen hat, widrigenfalls er zur Verantwortung und Strafe gezogen werden wird.
Kommen Sie mit zu Jagor.
Jawohl.
In der Nacht zum vierundzwanzigsten Dezember schneit es manchmal. Am Morgen geht Tallhover unter grauem Himmel zum Polizei-Präsidium. Der graue Himmel über der dünnen weißen Decke auf der Straße, die kalte Luft, die aber trocken, also klar ist, beruhigen Tallhover und beleben ihn. Die Aussicht auf die warme Amtsstube mit ihrem Geruch der Akten versetzt Tallhover in eine heitere Stimmung.
Polizei-Inspektor Hofrichter ist noch nicht da. Er kommt heute überhaupt später, hört Tallhover.
Am Dienstag liegt auf Tallhovers Tisch im Polizei-Präsidium auch die Leipziger Allgemeine Zeitung, die täglich abends erscheint, vom Sonnabend, Heiligabend. Immer stört Tallhover sich an dem Spruch unter dem Zeitungstitel, weil er fordernd betont, was doch nicht strittig ist für Tallhover, nur zu allgemein: Wahrheit und Recht, Freiheit und Gesetz! Für wen denn?
Bevor Polizei-Inspektor Hofrichter eintrifft, hat Tallhover in der Beilage zur Leipziger Allgemeinen Zeitung die Überschrift: Herwegh’s Brief an den König von Preußen entdeckt.
Fast entsetzt liest Tallhover den Brief wie etwas Verbotenes. Er ist vom Tisch aufgestanden, liest, hört die Tür aufgehen, Polizei-Inspektor Hofrichter tritt ins Zimmer, sagt, Guten Morgen, Tallhover, was gibt
Es ist etwas Furchtbares passiert, sagt Tallhover laut, hält Polizei-Inspektor Hofrichter die Zeitung entgegen, aber der wehrt Tallhovers Bewegung ab, legt seinen Hut auf den Tisch, sagt, So reden Sie doch, Mann!, zieht seine Handschuhe aus, wirft sie in den Hut, sagt, Lesen Sie!
Herwegh’s Brief an den König von Preußen.
Königsberg, im December 1842
Majestät!
Wir wollen ehrliche Feinde sein, lauteten die Worte, die Preußens König jüngst an mich gerichtet; und diese Worte geben mir ein Recht, ja, legen mir die Verpflichtung auf,
erlegen, sagt Polizei-Inspektor Hofrichter,
ja, sagt Tallhover, hier steht aber legen,
weiter, sagt Polizei-Inspektor Hofrichter,
offen und unumwunden, wie ich einst mein Vertrauen auf Ew. Maj. ausgesprochen, nun auch meine Klage, meine bittere Klage vor Ihren Thron zu bringen, ohne eine Devotion zu heucheln, die ich nicht kenne, oder Gefühle, die ich nicht empfinde und nie empfinden werde. Wir wollen ehrliche Feinde sein – und an demselben Tage, da Ew. Maj. diese Worte auszusprechen geruhten, gefällt es einem hohen Ministerium, den Buchhändlern den Debit eines von mir erst zu redigirenden Journals, von dem unter meiner Redaction noch keine Sylbe erschienen ist, und dessen Debit vor zwei Monaten, ehe diese Uebernahme der Redaction durch mich bekannt gewesen, erlaubt worden war, lediglich meines Namens wegen zu verbieten. Daß dieser, mein Name, auch bei Ew. Maj. einen so schlimmen Klang habe, kann und darf ich nicht glauben, nach Dem, was Sie vor wenigen Tagen an mich geäußert. Ohne Zweifel haben Ew. Maj. von diesem Verfahren gar keine Kunde, und der Zweck dieses Briefes ist auch nur, diese einfache Thatsache zu Ihrer Kenntniß zu bringen, damit Ew. Maj. weiter beschließen mögen, was Rechtens ist. Ich bitte nicht um Zurücknahme des Verbots, denn ich weiß, daß mein beschränkter Unterthanenverstand, mein Bewußtsein einer neuen Zeit, auf ewig widersprechen muß dem alternden Bewußtsein und dem Regiment der meisten deutschen Minister, denen ich das Recht der Opposition gern einräumen möchte, wenn sie überhaupt nur Notiz nehmen möchten von Dem, was um sie her vorgeht, aber vorgeht in den Tiefen der Menschheit, statt sich mit ein Bisschen Schaum und Wind zu zanken, die auf der Oberfläche spielen. Wenn diese Minister in dem Widerspruche gegen sie auch zuweilen die Elemente einer neuen Religion zu entdecken, nicht blos Polissonnerie und Frivolität zu wittern im Stande wären, kurz, wenn diese Minister außer dem Zufall ihrer Geburt und ihrer oft schätzenswerthen administrativen und polizeilichen Talente auch das Talent und den guten Willen besäßen, sich auf einen ehrlichen Kampf mit ihren Feinden einzulassen, statt dieselben erst vornehm zu ignoriren, dann, ohne sie zu kennen,