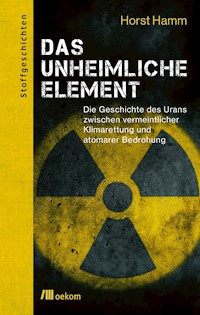EINLEITUNG
Uran – ein zwiespältiges Verhältnis
Uran hat heute einen sehr ambivalenten Ruf. Das Element, das 1789 aus dem damals alltäglichen Bergbauabfallprodukt Pechblende extrahiert wurde, läutete ein neues Zeitalter ein – das Atomzeitalter. Die Radioaktivität war zu dieser Zeit noch nicht bekannt und Uran verwendete man lange vor allem dazu, Glasgefäßen eine schillernde Farbe zu geben. Erst mit den Entdeckungen von unter anderem Marie Curie wurde die zerstörerische Kraft von Uran nach und nach offensichtlich – was in der Entwicklung der Atombombe gipfelte.
Der erste Grund für den ambivalenten Ruf von Uran ist also schlicht die Bombe. Ohne Uran gäbe es keine menschengemachte Kernspaltung und keine Atombombe. Seit die USA mit den Bomben auf Hiroshima und Nagasaki der Welt ihr Zerstörungspotenzial vor Augen geführt haben, leben wir Menschen mit der Möglichkeit, uns selbst auszulöschen. 70.000 bis 80.000 Menschen wurden nach einer Schätzung von US‐Experten am 6. August 1945 von der Hiroshima-Bombe sofort getötet1, Greenpeace spricht sogar von 140.000 Sofort-Toten und Hunderttausenden, die »in den darauffolgenden Monaten, Jahren und Jahrzehnten den Folgen der Strahlung« erlagen.2
Was Uran so zerstörerisch macht, sind seine physikalischen Eigenschaften. Denn Uran gehört zu den Elementen, die – ohne jedes Zutun von Atomphysiker*innen – ganz natürlich zerfallen. Mit jedem Zerfall setzen Uran und seine ebenfalls instabilen Zerfallsprodukte gefährliche radioaktive Strahlung frei. Das Zerfallsprodukt Radon etwa gilt als zweithäufigste Ursache für Lungenkrebs. Thorium, das in der Zerfallsreihe an zweiter Stelle steht, erhöht die Krebsgefahr für Lunge, Lymphknoten, Knochenmark, Leber und Milz und ist wahrscheinlich auch für Tumore von Bauchspeicheldrüse und Dickdarm verantwortlich. Polonium wiederum ist nicht nur radioaktiv, sondern gleichzeitig extrem toxisch. Das Element mit der Ordnungszahl 84 bestimmte die Berichterstattung in den Medien, als der russische Kreml-Kritiker Alexander Litwinenko im Jahr 2006 auf rätselhafte Weise damit vergiftet wurde und kurz darauf daran starb. Der russische Geheimdienst FSB soll den Mord in Auftrag gegeben haben, berichtete der Spiegel Jahre später und zitierte dazu einen britischen Untersuchungsbericht: »Die FSB-Operation zur Tötung von Herrn Litwinenko ist wahrscheinlich von Herrn Patruschew [seinerzeit Leiter des FSB und seit 2008 Sekretär des Sicherheitsrats der Russischen Föderation] und auch Präsident Putin gebilligt worden.«3 Nicht die politischen Verstrickungen, die der Agentenmord nach sich zog, sind an der Stelle entscheidend, sondern die Giftigkeit des Uran-Zerfallsprodukts Polonium. Denn Bergarbeiter*innen kommen damit alltäglich in Kontakt, wenn auch nicht in der hohen Konzentration wie der russische Ex-Spion – und auch nicht übers Essen oder Trinken. Alexander Litwinenko soll das Gift in den Grüntee gemischt worden sein.
Bis zum Ende der 1950er-Jahre wurde Uran fast ausschließlich militärisch genutzt, sprich zum Aufbau der Atomwaffenarsenale, mit denen sich Ost und West gegenseitig in Angst und Schrecken versetzten. 1986 hatten die USA und die Sowjetunion 23.254 beziehungsweise 40.723 atomare Sprengköpfe in ihren Arsenalen4 – so viel wie in keinem Jahr zuvor und danach. Beide Länder verfügten über die Möglichkeit, ihren Gegner zigfach restlos zu vernichten – und die gesamte Menschheit gleich mit. Dieses Zerstörungspotenzial schwingt beim Blick auf den Rohstoff Uran immer mit. Die atomare Aufrüstung war nach dem Zweiten Weltkrieg die treibende Kraft für den Uranbergbau in Afrika und Nordamerika, aber auch in Asien und Europa – und machte damit die atomare Abschreckung in den Jahrzehnten des Kalten Krieges überhaupt erst möglich. Mit den Drohungen des russischen Präsidenten Wladimir Putin, die Atombombe auch im Krieg gegen die Ukraine einzusetzen, ist ein Atomkrieg schlagartig wieder in unser Bewusstsein gerückt.
Mit Uran verbindet man in der heutigen Zeit aber nicht nur die Atombombe. Auch für die Energiegewinnung in Atomkraftwerken wird das Element benötigt. Mit seiner Rede Atoms for Peace am 8. Dezember 1953 skizzierte der damalige US‐Präsident Dwight D. Eisenhower die Atomkraft für den Frieden: eine Welt, in der mithilfe einfach zu gewinnender und billiger Energie durch Atomkraft paradiesische Zustände herrschen sollten. Die Rede löste eine heutzutage unvorstellbare Atomeuphorie aus. Politiker*innen in allen Industriestaaten sahen ein goldenes Atomzeitalter kommen und bemühten sich, die Atomkraft in ihren Ländern zu ermöglichen (siehe Kapitel 3). Am 25. März 1957 gründeten Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg und die Niederlande deshalb zeitgleich mit der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft EWG (dem Vorläufer der heutigen EU) die Europäische Atomgemeinschaft, kurz EURATOM. Ihr Ziel war es, die friedliche Nutzung der Atomkraft in den Mitgliedsstaaten der EWG zu etablieren, um mit ihrem Energiereichtum Wohlstand für alle zu schaffen. Dementsprechend begann in Deutschland die kommerzielle Nutzung der Atomkraft nur wenige Jahre später: 1962 mit dem Versuchsatomkraftwerk Kahl in Unterfranken. Sein Bau kostete umgerechnet 17 Millionen, sein Rückbau später 150 Millionen Euro.5 Seine Leistung betrug 15 Megawatt. So viel erbringt heute eine moderne Offshore-Windturbine.
Bereits in den 1970er-Jahren wich diese Anfangseuphorie für Atomkraft der Ernüchterung – billig war die Energie aus den Atomkraftwerken nicht und sie hatte das Potenzial für große Umweltkatastrophen, was Tschernobyl der ganzen Welt vor Augen führte. Heute neigt sich die Atomwirtschaft ihrem Ende zu und führt derzeit eher einen verzweifelten Abwehrkampf – gegen die wachsende Schar der Atomkritiker*innen und vor allem gegen die erneuerbaren Energien, die ihr überall auf der Welt den Rang ablaufen. Selbst im autoritären China, dem einzigen Land, das in den letzten Jahren in großem Stil neue Atomkraftwerke gebaut hat und in dem es keine Hemmnisse durch Behörden und keine Proteste auf den Straßen gibt, hat sich der Wind gedreht: Es werden keine neuen AKWs mehr geplant. »Ausgestrahlt«, könnte man sagen, wäre da nicht die Bombe. Weil derzeit alle Atommächte ihre Nuklearwaffen modernisieren und dafür auch Atomkraftwerke und Uran brauchen, setzen sie weiter auf diese immens teure Technik. »Es gibt drei Gründe, warum weiter an Atomkraft festgehalten wird«, sagte Alex Rosen, Vorstand von IPPNW-Deutschland (Internationale Ärzt*innen für die Verhütung des Atomkrieges) im Jahr 2019, »die Bombe, die Bombe und nochmals die Bombe«.
Während die Atomkraft umstritten ist und es seit den 1970er-Jahren mindestens so viele Kritiker*innen wie Befürworter*innen gibt, ist die Nuklearmedizin bis heute ausschließlich positiv besetzt. Und das ist einfach zu erklären. Auch die Nuklearmedizin benötigt Radioaktivität und atomare Zerfallsprodukte oder die dabei frei gesetzten Neutronen, sie hat also ebenso viel Potenzial für Umweltkatastrophen wie die Atomkraft. Aber sie hilft vor allem, Krebsdiagnosen zu stellen und Tumore zu behandeln – und verspricht damit Heilung oder zumindest ein längeres Leben (siehe Kapitel 4).
Entscheidend bleibt, dass Uran ein sehr zwiespältiges Image hat: Uran ist Heilsbringer und medizinisches Hilfsmittel, hat aber ein hohes Zerstörungspotenzial und ist der Rohstoff für Atombomben. Das Element steht damit gleichzeitig für Leben und Tod. Außerdem liefert Uran enorme Mengen an Energie, die zivile Atomkraft ist aber eine Hochrisikotechnologie. Dass Uran irgendwo abgebaut werden muss und Bergarbeiter*innen mit ihren Familien in den Abbaugebieten ionisierender Strahlung ausgesetzt sind, ist in der hiesigen Öffentlichkeit praktisch kein Thema. Auch nicht, dass 70 Prozent des weltweit bislang geförderten Urans vom Land indigener Völker stammen und deren Lebensgrundlagen durch den Abbau zerstört werden. Die ungelöste Endlagerfrage dagegen, das Ende der atomaren Kette, polarisiert unsere Gesellschaft. Eine eigens dafür gegründete Bundesgesellschaft für Endlagerung soll bis 2031 einen Standort für ein deutsches Endlager festlegen – im Konsens mit der dann ausgesuchten Region. Und irgendwann Mitte des Jahrhunderts soll mit dem Bau dieses Endlagers, das vor allem die radioaktiven Überreste von Kernenergiereaktoren beinhalten wird, begonnen werden. Ob das so kommt? Zukunftsmusik!
Dieses Buch zeigt die verschiedenen Facetten von Uran und die damit verbundene Spaltung unserer Gesellschaft: von seiner Entdeckung bis heute, von seiner Verwendung als Verschönerungselement bis hin zur Atombombe.
KAPITEL 1
Die Entdeckung des Urans
Die Entdeckung des Rohstoffs Uran geschah zufällig – durch den Abbau eines anderen Elements. Silber war über Jahrhunderte ein Schatz, der im Mittelalter in verschiedenen Regionen Europas zu Wohlstand und Entwicklung führte. »Silberrausch und Berggeschrey« löste auch im östlichen Erzgebirge eine Silberader aus, die Kaufleute 1168 bei Christiansdorf in der Nähe des heutigen Freiberg in Mittelsachsen entdeckt hatten. Mit der industriellen Entwicklung kamen ab 1600 weitere Metalle hinzu, die dem Erzgebirge über Jahrhunderte den Bestand als Bergbauregion sicherten, wenn Silberadern ausgeschöpft waren: Wismut, Zinn, Kupfer und Eisen.
Immer wieder stießen die Bergleute auf grünlich-schwarze bis schwarz schimmernde Gesteinsschichten. Mitunter wiesen sie einen fettigen Glanz auf, meistens wirkten sie ziemlich matt. Und gleichgültig, ob sie in Nierenform daherkamen oder als würfelförmige oder auch oktaedrische Kristalle: In jedem Fall waren sie nicht sehr beliebt, denn sie signalisierten das Ende einer wertvollen Erzader. Die Kumpels nannten das Gestein »Pechblende« und verwiesen damit auf die pechartige Farbe des Minerals. Man könnte auch schlicht sagen: »Pech gehabt, Männer! Sucht gefälligst woanders weiter.« Schluss, Aus und Ende der gewinnbringenden Förderung. Was damals niemand wusste: Pechblende enthält das heute sehr wertvolle Element Uran, weshalb das Gestein später auch unter dem Namen Uraninit bekannt wurde.
Pechblende kann heutzutage beispielsweise im Mineralogischen Museum der Universität Bonn besichtigt werden: Unter der Inventarnummer 40.326 ist ein faustgroßer und grau-schwarzer Mineralienbrocken ausgestellt, der von roten Dolomit-Adern durchzogen ist. Nicht offen und zum Anfassen, sondern in einer Vitrine aus Bleikristallglas, die die schwache Strahlung abschirmen soll, die von allen uranhaltigen Mineralien ausgeht.1 Das Exponat stammt aus Jáchymov, dem ehemals böhmischen St. Joachimsthal, in dem die erste europäische Uranmine entstand. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass dieses eher unscheinbare Stück Erz auch den Beginn des Uranbergbaus markiert.
Die etwa 2,30 Meter hohe und einen Meter breite Uran-Vitrine enthält noch etliche andere Stücke, die Fachleute und Laien gleichermaßen in Staunen versetzen. Da sind gleich drei uranhaltige Gesteinsbrocken aus der Shinkolobwe-Mine ausgestellt (siehe Abschnitt »Der Kongo – ein gigantisches Zwangsarbeiterlager«). Unter anderem in jener Mine, die seit Anfang der 1900er-Jahre bis 1960 unter belgischer Kolonialherrschaft stand, wurde Uran für die erste Atombombe der USA abgebaut.
»Wir haben gerade zum Thema Uran aber auch einige ganz besondere Stücke zu bieten«, betont Museumsleiterin Anne Zacke voller Stolz, als sie mich durch die Museumsräume führt und auf einen Fulgurit aufmerksam macht, ein sogenanntes »Blitzröhrchen«, das ich ohne den direkten Hinweis kaum eines Blickes gewürdigt hätte. Fulgurite – von Lateinisch fulgur, Blitz – entstehen vor allem durch Blitzeinschläge oder große Energieentladungen in Gestein oder Sand und bilden sich in Bruchteilen einer Sekunde. Das Exponat in der Vitrine gehört wahrscheinlich zu einer Vielzahl kleiner Fulgurite, die am 16. Juli 1945 entstanden sind, als die USA bei Alamogordo in der Wüste New Mexicos ihre erste Atombombe zündeten. Das aus einem Fingerhut voller Sand geformte Kieselglas in der Vitrine mit Uranexponaten trägt damit den Beginn des atomaren Schreckens in sich.
Direkt neben der Vitrine mit dem Fulgurit und nicht zu übersehen ist ein Uranwürfel mit einer Seitenlänge von etwa fünf Zentimetern ausgestellt. Das Exponat an sich ist zwar auch nicht besonders auffällig. Allerdings ist es in einem eigenen Panzerschrank ausgestellt, der vorne – vergleichbar einer modernen Eingangstür – eine eingelassene Glasscheibe hat. »Kritische Stücke« besagt dann auch noch sein Titel. Die Erklärung offenbart seine Bedeutung: Der unscheinbare Kubus ist einer von ehemals 664 Würfeln, die im Rahmen des Uranprojekts zur Atomforschung und möglichen Entwicklung einer deutschen Atombombe von der sogenannten »Urangruppe« um Werner Heisenberg am Kaiser-Wilhelm-Institut in Berlin-Dahlem während des Zweiten Weltkriegs genutzt wurden. Die dortige Anlage wurde aufgrund der ständigen Bombardierungen und des Vorrückens der Roten Armee 1944/45 nach Süddeutschland verlagert und unter einem Bierkeller in der Nähe der Schlosskirche in Haigerloch, 25 Kilometer südwestlich von Tübingen, wieder aufgebaut. Anfang März 1945 lief der letzte Großversuch, ohne dass die Urangruppe damit einen »kritischen Zustand« erreicht hätte. Vor Kriegsende versteckten die NS‐Wissenschaftler*innen die noch verbliebenen Uranwürfel und das schwere Wasser, das sie für ihre Forschung benötigten. »Eine amerikanische Geheimdienstmission, die seit 1943 und bis Oktober 1945 klären sollte, wie weit Nazi-Deutschland mit seiner Kernforschung vorangekommen war, entdeckte den Keller schließlich und fand auch die verbliebenen Würfel«, weiß Museumsleiterin Zacke. »Die Wissenschaftliche Abteilung der Militärverwaltung in Koblenz hat dem Museum 1954 den Würfel übergeben, der jetzt bei uns ausgestellt ist.« Er ist einer von fünf Würfeln, die es heute noch gibt und die beispielhaft dafür stehen, dass Nazi-Deutschland kurz vor Kriegsende um Jahre hinter der US‐amerikanischen Atombombenentwicklung zurückstand und noch lange keine Atombomben hätte bauen können (siehe Kapitel 2).
Zurück ins ausgehende Mittelalter. Damals waren Erzadern mit Pechblende, von der wir heute wissen, dass es sich um eine uranhaltige Schicht handelt, wertlos. Wie hätten die Bergleute auch ahnen können, dass Jahrhunderte später genau an denselben Orten Geolog*innen und Ingenieur*innen alles tun würden, um auch noch den letzten Rest Uran aus dem Boden zu holen? Entsprechend den mittelalterlichen Lehren ging man damals noch davon aus, dass die Welt ausschließlich aus den vier Elementen Erde, Wasser, Luft und Feuer bestand.
Das änderte sich erst mit der Entdeckung der chemischen Elemente. Hennig Brand machte 1669 mit Phosphor den Anfang. Der Hamburger übte sich in verschiedenen Berufen – als Soldat, Apotheker und schließlich Chemiker. Der alchemistischen Lehre folgend suchte er, wie viele seiner Zeit, den Stein der Weisen: Er hoffte, einen Weg zu finden, um aus unedlen Metallen edle zu machen, vor allem Gold. Eher durch Zufall entdeckte er dabei Phosphor.2 Wie Uran ist auch Phosphor ein Element, das gleichermaßen Leben und Tod bringen kann. Als Bestandteil von Pestiziden oder Brandbomben wirkt das Element tödlich, als essenzieller Nährstoff versorgt es alle Lebewesen mit Energie.3
Martin Heinrich Klaproth entdeckt Uran
1789, über hundert Jahre später, isolierte Martin Heinrich Klaproth aus dem dunklen Mineralgestein Pechblende erstmals das Element Uran. Das allerdings war kein Zufall. Klaproth hatte zwar nie studiert und kam aus ärmlichen Verhältnissen. Aber mit etwas Glück und der Heirat einer Frau, die aus einer vermögenden Familie stammte, konnte er seinen Wissensdurst befriedigen und sich selbst viel Wissen aneignen. »›Martin Heinrich Klaproth […] ist ein sprechender Beweis, wieviel ein kräftiger Geist durch ruhige, aber gewissenhafte und beharrliche Thätigkeit einem Geschicke abgewinnen kann, was ihn zur Mittelmäßigkeit oder Niedrigkeit bestimmt zu haben schien‹«, fasste sein Zeitgenosse, der Chemiker und Mathematiker Ernst Gottfried Fischer (1754–1831), Klaproths Leben in einer Denkschrift der Berliner Akademie der Wissenschaften zusammen.4 Überspitzt könnte man sagen, dass Klaproth ein lebendes Exemplar des Doktor Faust ist, den Johann Wolfgang von Goethe in seinem großartigen Drama als Kunstfigur mit einem nicht enden wollenden Wissensdrang unsterblich gemacht hat: »Wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen«, stellt der Chor der Engel letztendlich fest, ehe er dem unendlich Suchenden ein Leben in höheren Sphären verheißt.5
Martin Heinrich Klaproth hatte einen vergleichbaren Wissensdurst. Er lernte zunächst das Apothekerhandwerk und die Grundlagen der Chemie als Lehrling in Quedlinburg und arbeitete als Apothekergehilfe in Hannover, Berlin und Danzig, ehe er 1780 mit dem Geld seiner Frau die Löwen-Apotheke im heutigen Nikolai-Viertel in Berlin kaufte.6 Die Selbstständigkeit erlaubte es ihm, wann immer er wollte seinem Entdeckerdrang nachzugehen. Und der war groß.
Bereits 1788 war Klaproth, der nicht eine Vorlesung an einer Universität besucht hatte, Mitglied der Akademie der Wissenschaften in Berlin geworden. Damit verbunden war eine Professur für Chemie an der Berliner Artillerieschule. 1789 gelang es ihm, aus Pechblende, das als Abfallprodukt aus der Erzgrube Georg Wagsforth bei Johanngeorgenstadt im Erzgebirge stammte, Uran zu isolieren. Er führte dazu etliche Versuche mit Salzlösungen, Essig- und Schwefelsäure durch, stellte nebenbei zitronengelbe Salze her und machte die Entdeckung, dass Uran »der Phosphorsalzperle bei der Verglasung eine grüne Färbung verleiht«.7 Diese Beobachtung führte später dazu, dass Glasmanufakturen Farben aus Uran herstellten und Uran somit erstmals genutzt wurde.
Klaproth stellte auch fest, dass das Material, das er aus der Pechblende isoliert hatte, »was auch immer es war, mit Blei vergesellschaftet war. Als er die Lösung erhitzte, entstand eine Art gelbes Kristall, das der Apotheker noch nie gesehen hatte. Klaproth fügte Wachs und ein wenig Öl hinzu, um einen schweren, grauen Rückstand zu isolieren.« Er betrachtete das neue Element als eine seltsame Art von Halbmetall.8 »Die Zahl der bisher bekannten 17 Metalle hoffe ich anjezt durch ein neues vermehrt zu haben, welchem ich den Nahmen Uranit beylege«, schrieb Klaproth selbst über seine Entdeckung.9 Dem neu entdeckten Element gab er ein Jahr später nicht etwa seinen Namen, um sich damit zu schmücken oder für immer bekannt zu machen, sondern er benannte es nach dem wenige Jahre zuvor entdeckten Planeten Uranus: Uranium.
Nach der Entdeckung von Uran entschlüsselte Klaproth weitere Elemente oder trug zumindest dazu bei: Zirconium, Titan (Wiederentdeckung), Cer, Tellur (erste Darstellung) und Strontium (parallel mit dem schottischen Arzt und Apotheker Thomas Charles Hope).
Uran als Rohstoff in voratomarer Zeit
Zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurde Uran erstmals als Nebenprodukt in englischen, böhmischen und sächsischen Minen gewonnen. Mit dem Schwermetall konnten Keramiken bemalt und sogenanntes Vaselineglas hergestellt werden. Die Zugabe von Uran machte die bemalten Gegenstände besonders, denn unter UV‐Licht, das für das menschliche Auge nicht sichtbar ist, beginnen Urangläser zu fluoreszieren und zu leuchten. Dann erscheint eine sonst eher farblos wirkende Glasdose plötzlich in grellem Neongrün oder ein zunächst unscheinbares Wein-Set mit einem faden braun-grünen Stich unter dem UV‐Einfluss des Sonnenlichts orangefarben mit wogendem Grün. Eine Verwandlung, die vermutlich häufig für staunende Gesichter sorgte. Uran erfüllte dadurch den uralten Wunsch, sich den Alltag etwas zu verschönern und sein Zuhause kulturell aufzuwerten.
Die böhmischen und sächsischen Glashütten, die sich die Erkenntnis zunutze machten, dass Glas und Gläser durch Uranverbindungen gelb-grün leuchtend in Szene gesetzt werden konnten, professionalisierten im Laufe des 19. Jahrhunderts die Nutzung der Uranfarben. Mal war es ein blaßgelb, dann ein eher bernsteingelb oder ein dunkles apfelgrün gefärbtes Glas, das Käufer*innen und Kund*innen in Verzückung versetzten.
Franz Xaver Anton Riedel hat der Nachwelt eine besonders schöne Geschichte hinterlassen, wie seine Glasfarben zustande kamen: Sein Großvater hatte bereits Mitte des 18. Jahrhunderts in Nordböhmen eine Glashütte gegründet. Franz Xaver Anton war wohl nicht nur ein exzellenter Graveur und Glasschleifer, ihm war es auch als Erstem in der Geschichte der Glasherstellung gelungen, verschiedene Glasfarben herzustellen: zwei fluoreszierende Farben – Gelb und Grün. Als Zugabe waren Uranoxid und ein paar weitere Elemente entscheidend, die dazu führten, dass der Farbton mal eher gelb oder eher grün ausfiel. Das Rohmaterial Uran stammte aus den böhmischen Bergwerken in Sankt Joachimsthal und aus Příbram, die damals beide noch zur Habsburger Monarchie gehörten.
Der Entdecker der neuen Glasfarben war wohl auch ein Romantiker: Seine Frau hatte die beiden Töchter Anna und Eleonore zur Welt gebracht. Nun kam dem Glasfachmann die charmante Idee, seinen strahlend schönen Glasfarben die Namen Anna-Gelb und Eleonoren-Grün zu geben und damit auch seine Töchter zu verewigen.
Urangläser wurden nicht nur in Böhmen und Sachsen hergestellt. Auch in Frankreich, Belgien, England und in den Vereinigten Staaten nutzten Glasereien die Vorteile von Uranoxid und machten leuchtende Glasprodukte zu einem Verkaufsschlager. Es gibt auch heute noch wunderbar geschliffene und verschnörkelte Trinkgläser aus dieser Zeit, kunstvoll verzierte Karaffen, Glasfläschchen mit Zerstäubern, edle Schalen, gläserne Zitronenpressen, Glasknöpfe, Edelsteinimitationen und schließlich ganz normale Vasen und Teller aus Uranglas. Die Glasmanufakturen kreierten eine Vielzahl von Alltags- und Kunstgegenständen, die den Haushalt verschönerten und zum Leuchten brachten.
Bis 1898 wurden an die 15.000 Tonnen Uranglas hergestellt, allein im Jahr 1896 waren es 600 Tonnen. Der großen Menge und der faszinierenden Farbenpracht entsprechen die verschiedenen Namen, die sich mit der Zeit entwickelten: »Im angloamerikanischen Raum gibt es zum Beispiel Canary (aus cornischem Erz) oder Vaseline glass, dem das französische Verre canari oder Verre d’urane entspricht. Im deutschen Sprachraum werden neben Bein-, Alabaster-, Opal-, Bernstein- und Topasgläsern auch die Bezeichnungen Annagrün-, Eleonoren-, Jade-, Reseda-, Erbsen-, Pompadour-, Seladon-, Smaragd- und Chrysopras-Glasschmelzen benutzt.«10
Über ihre Rezepturen bewahrten die Glashütten zumeist Stillschweigen. Jede hatte ihren eigenen Chemiker, dessen Aufgabe nicht nur darin bestand, bei jeder neuen Charge für die richtige chemische Zusammensetzung des Glases zu sorgen, sondern auch die Rezeptur von einer Generation an die nächste weiterzugeben. Wobei auch hier gilt: keine Regel ohne Ausnahme. »Vermutlich im Jahr 1890 gab der Chemiker Otto Matzialek dem Glasfabrikanten Franz Welz in Klostergrab bei Teplitz-Schönau den Hinweis, Selen für die Färbung von Glas zu verwenden. Eine neue Farbe, die so genannte Changeant-Farbe, entwickelte dieser aus dem Gemenge von 120 Gramm Selen und 225 Gramm Uranoxid. Die Rezepturen ließ er patentieren und verkaufte sie an Glashersteller bis nach England.«11 Dort wurde dann folgendes Rezept für changeantfarbenes oder gelbrosa schillerndes Glas weitergegeben: 100 Kilogramm Sand, 12 Kilogramm Pottasche, 19 Kilogramm Soda, 14,5 Kilogramm Marmor, ½ Kilogramm Salpeter, 300 Gramm Uran, 160 Gramm Selen und 250 Gramm Arsenik. Alles gut verrührt und entsprechend erhitzt und geschmolzen, verbunden mit dem Hinweis: »Mehr Selen verstärkt die rosa und orange Farbe.«
Wenn die Glasmanufakturen keine anderen Substanzen als Uran beimischten, fluoreszierten Gläser und Karaffen jedoch ausschließlich grün. Dafür gibt es eine einfache Erklärung: Uranatome schwingen mit einer Frequenz von 612,5 bis 522,5 Terahertz und senden dementsprechend eine elektromagnetische Strahlung mit der Wellenlänge von 490 bis 575 Nanometer aus – die Wellenlänge der Farbe Grün.12
Über Radioaktivität und eine mögliche Gefahr, die von den Urangläsern ausgehen könnte, war damals noch nichts bekannt. Da die Strahlung der Urangläser nicht höher ist als die natürliche Strahlung der Umgebung, besteht durch sie in der Regel keine Gefahr einer radioaktiven Kontamination. Die Stärke der Uranglasstrahlung, gemessen mit einem Geigerzähler, ergibt nur schwache Werte. Gefährlich ist allerdings, dass alpha- oder betastrahlende Atome durch organische Säuren, wie sie in Getränken und Speisen vorkommen, aus dem Glas herausgelöst werden, sich in menschlichen Organen absetzen und dort krebserregend wirken können. Man sollte also eher den Anblick genießen und nicht unbedingt aus Urangläsern trinken oder essen. Und wenn doch, dann am besten nur ein Glas Wasser.13
Das Geheimnis der Radioaktivität
Nachdem Martin Heinrich Klaproth 1789 das Uran entdeckt hatte, blieben die Eigenschaften des Elements noch rund anderthalb Jahrhunderte ein Geheimnis. Es zu entschlüsseln, begann mit einem Versuch von Henri Becquerel. Der Pariser Physikprofessor glaubte, dass Uranmineralien und Urangläser auch Röntgenstrahlen aussenden können, wenn man sie mit Sonnenlicht beleuchtet. Also verpackte er eine Fotoplatte lichtdicht, legte ein Uranmineral darauf und platzierte es im Sonnenlicht. »Und siehe da: Das Urankalziumsulfat schwärzte die Fotoplatte.«14 Die Tage darauf war der Himmel über Paris bedeckt. Becquerel ließ seine Versuchsanordnung in einer Ecke liegen, entwickelte die Fotoplatte »in der Erwartung, er würde sehr schwache Umrisse finden«, und schrieb in einem Bericht: »›Die Umrisse zeigten sich im Gegenteil mit großer Intensität.‹ Die Schwärzung hatte also auch ohne viel Licht stattgefunden – ja, Becquerel zeigte kurz darauf, dass sie auch im völligen Dunkel stattfindet.« Nicht die Sonne hatte die Strahlen verursacht, sie kamen direkt aus dem Stoff selbst. »Dies war die Entdeckung der Radioaktivität«, fasst Jens Soentgen die Erkenntnis Becquerels zusammen.15
Die Fachwelt nahm von Becquerels Erkenntnis jedoch kaum Notiz. Ganz anders die aus Polen stammende Physikstudentin Marie Curie. Die junge Frau suchte nach einem Dissertationsthema und entschied sich für die geheimnisvollen Strahlen Becquerels, von denen sie gehört hatte. Ihr Mann Pierre entwickelte die notwendigen Messgeräte, um das Mineral Pechblende genauer zu untersuchen. »Nach wenigen Wochen ist sie sicher, dass die Intensität der Strahlung der in den Proben enthaltenen Uranmenge entspricht und von nichts anderem beeinflusst wird.«16 Am 12. April 1898 trug sie ihre Erkenntnisse der Französischen Akademie der Wissenschaften vor.
Marie Curie und ihr Mann Pierre gaben der Strahlung den Namen »Radioaktivität« – vom lateinischen radius, Strahl – und wurden 1903 gemeinsam mit Henri Becquerel mit dem Physik-Nobelpreis ausgezeichnet. Nebenbei identifizierte Marie Curie während ihrer Arbeit 1898 auch zwei neue Elemente, denen sie den Namen Radium (wegen seiner Radioaktivität) und Polonium (zur Ehre ihrer polnischen Heimat) gab. Beide sind als natürliche Zerfallsprodukte von Uran in der Pechblende enthalten. Dafür erhielt Marie Curie wenige Jahre später den Nobelpreis für Chemie. Sie ist bis heute die einzige Frau mit zwei Nobelpreisen und neben dem US‐amerikanischen Chemiker Linus Pauling der einzige Mensch, der diese Auszeichnung in zwei verschiedenen Kategorien erhalten hat.
Mit der Entdeckung von Radium vermutete Marie Curie, dass das radioaktive Material eine große Wirkung in der Krebstherapie haben könnte. Sie gründete deshalb 1911 das Institute du Radium in Paris, das heutige Curie-Institut – ein Forschungszentrum, das seit Jahrzehnten in Biophysik, Zellbiologie und Krebsforschung zu den führenden der Welt gehört. In den Anfangsjahren verfügte das Institut lediglich über zwei separate Laboratorien. Eines hatte die Aufgabe, die Physik und Chemie radioaktiver Elemente zu erforschen. Das zweite sollte die medizinischen Anwendungsmöglichkeiten der Radioaktivität voranbringen. Marie Curie wird deshalb immer wieder als die »Mutter der Strahlentherapie« bezeichnet. »Es wurden Institute gegründet, die nach der neuen Heilmethode arbeiteten«, schrieb Marie Curie in ihrer 1922 erschienenen Selbstbiographie. »Es ist leicht zu begreifen, wie wertvoll für mich die Überzeugung ist, daß […] dank dieser Erfindung menschliches Leid gelindert werden kann.«17
»Radium galt fast als Allheilmittel, sogar gegen Krebs«, schreibt auch die Journalistin Stephanie Cooke in ihrem Buch über die Geschichte des nuklearen Zeitalters. »Im Jahr 1916 behauptete die Zeitschrift Radium, das Material sei ›absolut ungiftig‹, und obwohl nicht alle daran glaubten, kamen die Warnungen vor den Strahlungsrisiken für ihre Opfer zu spät, darunter die ›Radium-Girls‹, die Ziffernmalerinnen der United States Radium Corporation, Forscher und Patienten. Marie Curie selbst erlitt wegen der Strahlenvergiftung eine Fehlgeburt, und schließlich erlagen sie und später auch ihre Tochter Irène den Folgen der Strahleneinwirkungen.«18 Beide starben an Leukämie. 1929 bezeichnete der Literary Digest Radium als den »gefährlichsten Stoff der Welt«. Inzwischen nimmt wahrscheinlich Plutonium diesen zweifelhaften Spitzenplatz ein.
Die Erforschung von Uran und seinem Zerfallsprodukt Radium kann in seiner Bedeutung für den Fortschritt von Wissenschaft und Menschheit nicht hoch genug eingestuft werden: Sie »hat zu einer neuen Chemie und zu einer neuen Physik geführt, sie erneuerte die Astronomie, sie half geologische Fragen zu lösen, sie ist für die moderne Archäologie unentbehrlich. […] Indem wir das Uran, das Thorium, das Polonium, das Radon und schließlich das Radium und sein Verhalten verstehen lernten, erschloss sich der innere Zusammenhang des periodischen Systems der Elemente. Zahlreiche alte Rätsel der Naturwissenschaft konnten nach der Entdeckung der Radioaktivität gelöst werden.«19
Die Eigenschaften von Uran und seinen Zerfallsprodukten
Heute wissen wir, warum Uran und seine Zerfallsprodukte von ganz alleine zerfallen, also radioaktiv sind. Im Periodensystem ist Uran mit der Ordnungszahl 92 gelistet. Warum? Weil im Kern jedes Uranatoms 92 elektrisch positiv geladene Protonen enthalten sind. In der Atomhülle schwirren außerdem gleich viele negativ geladene Elektronen. Hinzu kommt eine dritte Gruppe winzig kleiner Teilchen, die sich ebenfalls im Atomkern befinden: die Neutronen. Sie sind elektrisch neutral und stoßen sich deshalb weder ab, noch ziehen sie sich an.
Alle Elemente, die mehr Protonen enthalten und eine höhere Ordnungszahl als Uran haben, werden Transurane genannt. Sie alle sind von Natur aus radioaktiv, weil sie – wie Uran – ohne jedes Zutun zerfallen. Von Neptunium und Plutonium, die nur noch in Spuren vorkommen, gibt es auf der Erde aber keine natürlich vorkommenden Transurane mehr. Der Grund: ihre extrem kurze Halbwertszeit von wenigen Sekunden bis zu einigen Minuten, in denen sie ganz zerfallen. Uran ist damit praktisch das größte natürlich vorkommende Element.
Warum verhält sich Uran aber nicht wie Sauerstoff oder Kupfer, die beide nicht radioaktiv sind? Der Grund ist schlicht die Größe des Elements. 92 positiv geladene Proton-Teilchen sind auf engstem Raum zusammengepfercht. Sie alle sind positiv geladen und stoßen sich gegenseitig ab – wie die beiden gleichpoligen Seiten von zwei Magneten. Jedes einzelne Proton ist sozusagen des nächsten größter Feind. Und jedes drückt und schubst das andere so gut es kann, bis es schließlich zum Zerfall kommt. Dabei brechen Teilchen aus dem Atomkern aus, um es diesem zu ermöglichen, in einen stabileren Zustand zu wechseln (was bei Uran allerdings eine Zerfallskette nach sich zieht, da die nachfolgenden Elemente, in die sich Uran wandelt, selbst wiederum instabil sind). Man kann es auch so sagen: Ein Uranatom ist schlicht zu groß und allein deshalb instabil.
Dass nicht mehr passiert und es nicht schon im Normalzustand zur Explosion kommt, liegt an den Neutronen, die sich ebenfalls im Kern befinden. Sie vergrößern zwar die Enge im Urankern, aber gleichzeitig schaffen sie auch Stabilität, denn sie wirken wie ein Puffer zwischen den sich abstoßenden Kräften. Man kann es sich vielleicht wie in einem überfüllten indischen Reisebus vorstellen: Alle Insassen werden nicht gerührt, aber kräftig geschüttelt, sorgen aber durch die Enge gegenseitig dafür, dass die meisten ihren Sitz- oder Stehplatz beibehalten und so am Ziel ankommen, ohne während der Fahrt aus dem Bus geschleudert zu werden. Und wenn dann doch ein Proton abhandenkommt, entsteht aus Uran Protactinium – mit nur noch 91 positiv geladenen Protonen.
Zurück zu den Neutronen: Ihre Zahl im Kern eines Uranatoms ist nicht gleich, aber entscheidet darüber, um welches Isotop es sich handelt. Isotope sind Atome mit der gleichen Anzahl an Protonen, aber unterschiedlich vielen Neutronen. Es gibt drei verschiedene Uranisotope: Uran-238, Uran-235 und Uran-234. Wie kommt es zu dieser Namensgebung? Ganz einfach: Uran-238 hat 146 Neutronen, zählt man die 92 Protonen hinzu, kommt man im Kern auf 238 Elementarteilchen, daher der Name Uran-238. Die beiden anderen Uranisotope haben dementsprechend drei beziehungsweise vier Neutronen weniger. Im Uranerz kommen diese Isotope im immer gleichen Verhältnis vor. Uran-238 dominiert mit einem Anteil von rund 99,3 Prozent, Uran-235 kommt auf rund 0,7 Prozent und Uran-234 nur auf verschwindend geringe Spuren. Der große Anteil der Uran-238-Atome ist jedoch nicht spaltbar. Sie können also durch von Menschen angestoßene Prozesse nicht in ein anderes Element verwandelt werden, sondern nur Uran-235 mit seinem Anteil von 0,7 Prozent. In sogenannten Anreicherungsanlagen (siehe Kapitel 8 / Lingen und Gronau) wird dessen Anteil daher auf 3 bis 5 Prozent für die zivile Nutzung in Atomkraftwerken erhöht. Und für Atombomben auf rund 90 Prozent.
All das wusste Marie Curie noch nicht, als sie erkannte, dass mit Uran beziehungsweise seinem Abbauprodukt Radium Krebserkrankungen geheilt werden können. Mit Radium wurden jedoch nicht nur neue Erkenntnisse gewonnen und menschliches Leid gelindert, es wurde auch eine Menge Geld gemacht: »Amerikanische Ärzte bezeichneten es als Wundermittel gegen Krebs, und einige rieten ihren Patienten, eine schwache Radiumlösung zu trinken, die unter dem Namen Liquid Sunshine verkauft wurde«, umschreibt der Wissenschaftsjournalist Tom Zoellner die Geburtsstunde der Radium-Therapie. »Für ein Gramm davon konnte man 175.000 Dollar erhalten, das Dreißigtausendfache des Goldpreises.«20 Radium gehörte damals zu den wertvollsten Stoffen der Welt.
Gibt man bei Google die Stichworte »Liquid Sunshine« und »Radium« ein, stößt man sofort auf ein altes Plakat, das Zeugnis für diese ungeheure Nachfrage abgibt: »World’s greatest health drink«, kann man dort lesen, »der beste Gesundheitstrunk der Welt«. Wer ihn einmal getrunken hat, wird nicht mehr davon lassen, suggerierten die damaligen Werbefachleute. Man kann es auch einfach dadurch auf den Punkt bringen, dass diejenigen, die nach einer Krebsdiagnose den baldigen Tod vor Augen hatten, sich zumindest erhofften, einige Lebensjahre mehr zu erhalten. Dass Radium selbst krebserregend war und gesunde Menschen damit erst Krebs bekamen, war zu Beginn des 20. Jahrhunderts noch nicht bekannt.
Der Kongo – ein gigantisches Zwangsarbeiterlager
Um überhaupt Radium als Zerfallsprodukt von Uran nutzen zu können, mussten die Nuklearmediziner*innen erst an den Ausgangsstoff herankommen. Dazu bot sich Belgisch-Kongo an. 1915 wurde in einer Savannenlandschaft, die von sanften Hügeln und Akazienbäumen geprägt ist, ein Uranvorkommen entdeckt, das seinesgleichen sucht: Das Erz der Shinkolobwe-Mine enthielt einen Anteil von bis zu 65 Prozent Uran, so viel wie keine andere Mine auf der Welt, die seither eröffnet wurde, und machte die lukrativen Geschäfte mit Radium überhaupt erst möglich.21
Betrieben wurde die Shinkolobwe-Mine von der 1906 von englischen und belgischen Unternehmen gegründeten Bergbaufirma Union Minière du Haut Katanga. Binnen weniger Jahre entwickelte sich das neu gegründete Unternehmen zu einem Bergbaugiganten, der die Schätze hob, die es in der afrikanischen Savanne fand: Kupfer, Wismut, Kobalt, Zinn, Zink und schließlich Uran in geringer Tiefe. »Unter einem Teppich aus Gras lag ein goldener Boden«, schreibt der Journalist Tom Zoellner.
Im Süden des Kongo entstand damals eine kleine Bergbauindustrie. Während bisher einzig der Fluss Kongo den Transport von Gütern über größere Strecken ermöglichte, bauten die Belgier zwischen 1898 und 1912 die Boma-Tshela-Bahn, die den Atlantik mit dem Landesinneren verband, und später weitere Bahnverbindungen.
Die dampfenden Kolosse im Herzen Afrikas erleichterten die Ausbeutung von Mensch und Natur: Um Shinkolobwe aus- und das Uranerz abzubauen, »riss Union Minière den Hügel ab und begann mit dem Tunnelbau unter Tage, wobei mehr als tausend afrikanische Arbeiter gezwungen wurden, nach dem reinsten Uranerz zu graben, das je auf der Erde gefunden wurde. Die Arbeiter mussten Säcke mit dem samtschwarzen Gestein mehr als zwanzig Kilometer weit zum Eisenbahnknotenpunkt tragen, von wo aus die Säcke zum Hafen und dann per Ozeandampfer nach Belgien verschifft wurden.«22