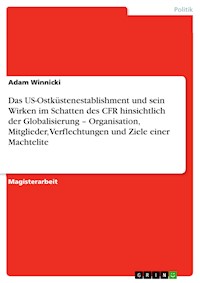
Das US-Ostküstenestablishment und sein Wirken im Schatten des CFR hinsichtlich der Globalisierung – Organisation, Mitglieder, Verflechtungen und Ziele einer Machtelite E-Book
Adam Winnicki
36,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2004
Magisterarbeit aus dem Jahr 2004 im Fachbereich Politik - Region: USA, Note: 1,5, Universität Kassel (Fachbereich Gesellschaftswissenschaften), Sprache: Deutsch, Abstract: Einleitung Die momentane weltweite Entwicklung verleitet zum Nachdenken über Ursachen und Akteure des politischen Geschehens vor dem Hintergrund der viel diskutierten Globalisierung. Augenfällig wird dabei, daß die USA als einzige aktiv verbliebene Supermacht in der Politik das Tempo zu bestimmen weiß. Wer oder was macht diesen Zustand aus? Ein Land wird nicht ohne bestimmte leitend-einflußreiche soziale Kräfte in Verbindung mit anderen politisch-wirtschaftlichen Faktoren zu dem, was es ist. Mit dieser Annahme soll im Rahmen dieser Arbeit der Versuch unternommen werden, einen möglichen Teilaspekt dieses gesellschaftlichen Spektrums und ihrer Form abzudecken. Sollten konkrete Gruppen eine besondere Rolle im US-Gesellschaftssystem spielen, dann erweist sich die Annahme bezüglich ihres Einflusses auf die Geschehnisse der US-Politik als berechtigt. Daher bildet ein elitentheoretisches Modell die Grundlage dieser Ausführungen. Ein Klassiker der politischen Wissenschaften von Geatano Mosca mit dem Namen „Die herrschende Klasse“ liefert den einführenden theoretischen Rahmen, der im ersten Kapitel der vorliegenden Arbeit dargestellt wird. Es folgt eine Auseinandersetzung mit dem Hegemonieansatz des Antonio Gramsci. Stärken und Schwächen der beiden Denkansätze sollen die „technische“ Zweckmäßigkeit im Bezug auf die Anwendung dieser zur Lösung des dargestellten Problemfeldes verdeutlichen. Daß beide Autoren nicht der gleichen politischen Ausrichtung angehören, macht die Sache um so interessanter. Im Anschluß folgt der Hauptteil der Ausführungen, der in die Form und Strukturen einer gesellschaftlichen Erscheinung/Formation einführt: der US-Machteliten im Bereich der Ostküste. Was macht sie aus und was sind ihre besonderen Merkmale und Verflechtungen? Und schließlich: Wo befinden sich ihre organisatorischen Schnittstellen? Fragen, die hier den Schwerpunkt bilden und nach klaren Antworten verlangen. Einzeln aufgegliederte Organisationen dieser Kreise unterstreichen ihre Besonderheiten und zeigen ihre gemeinsamen bzw. gegensätzlichen Interessen auf. Den ersten Bezugspunkt bildet der Council on Foreign Relations (CFR), dem folgen der Reihe nach die sogenannten Bilderberger, die Trilaterale Kommission und schließlich die seltsam anmutende Sektion 322. Bei dieser Gelegenheit werde ich nachzuweisen versuchen, wie stark und bedeutsam solche Gremien sein können...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Page 1
Page 3
1. Einleitung
Die momentane weltweite Entwicklung verleitet zum Nachdenken über Ursachen und Akteure des politischen Geschehens vor dem Hintergrund der viel diskutierten Globalisierung. Augenfällig wird dabei, daß die USA als einzige aktiv verbliebene Supermacht in der Politik das Tempo zu bestimmen weiß. Wer oder was macht diesen Zustand aus? Ein Land wird nicht ohne bestimmte leitend-einflußreiche soziale Kräfte in Verbindung mit anderen politisch-wirtschaftlichen Faktoren zu dem, was es ist. Mit dieser Annahme soll im Rahmen dieser Arbeit der Versuch unternommen werden, einen möglichen Teilaspekt dieses gesellschaftlichen Spektrums und ihrer Form abzudecken. Sollten konkrete Gruppen eine besondere Rolle im US-Gesellschaftssystem spielen, dann erweist sich die Annahme bezüglich ihres Einflusses auf die Geschehnisse der US-Politik als berechtigt. Daher bildet ein elitentheoretisches Modell die Grundlage dieser Ausführungen. Ein Klassiker der politischen Wissenschaften von Geatano Mosca mit dem Namen „Die herrschende Klasse“ liefert den einführenden theoretischen Rahmen, der im ersten Kapitel der vorliegenden Arbeit dargestellt wird. Es folgt eine Auseinandersetzung mit dem Hegemonieansatz des Antonio Gramsci. Stärken und Schwächen der beiden Denkansätze sollen die „technische“ Zweckmäßigkeit im Bezug auf die Anwendung dieser zur Lösung des dargestellten Problemfeldes verdeutlichen. Daß beide Autoren nicht der gleichen politischen Ausrichtung angehören, macht die Sache um so interessanter.
Im Anschluß folgt der Hauptteil der Ausführungen, der in die Form und Strukturen einer gesellschaftlichen Erscheinung/Formation einführt: der US-Machteliten im Bereich der Ostküste. Was macht sie aus und was sind ihre besonderen Merkmale und Verflechtungen? Und schließlich: Wo befinden sich ihre organisatorischen Schnittstellen? Fragen, die hier den Schwerpunkt bilden und nach klaren Antworten verlangen. Einzeln aufgegliederte Organisationen dieser Kreise unterstreichen ihre Besonderheiten und zeigen ihre gemeinsamen bzw. gegensätzlichen Interessen auf. Den ersten Bezugspunkt bildet der Council on Foreign
Page 4
Relations (CFR), dem folgen der Reihe nach die sogenannten Bilderberger, die Trilaterale Kommission und schließlich die seltsam anmutende Sektion 322. Bei dieser Gelegenheit werde ich nachzuweisen versuchen, wie stark und bedeutsam solche Gremien sein können. Die Darstellung der Involvierung von verschiedenen wichtigen
Persönlichkeiten aus diesen Gruppen im sozial-politisch-wirtschaftlichen Gefüge ist von großer Relevanz; nur so läßt sich ein Verflechtungsschema deutlich kennzeichnen.
Um gemeinsame Leitlinien oder das Fehlen solcher feststellen zu können, erscheint anschließend an den oben genannten Unterteil der Arbeit eine Darstellung von ein paar ausgesuchten Handlungsleitlinien und ideologischen Inhalten der aufgezählten Organisationen. Sie spiegeln in gewisser Weise den leitenden Geist dieser Schicht wider. An dieser Stelle wird die gesamte Spannbreite und die Komplexität in der Betrachtung des thematischen Gesamtbaus der aufgeführten Teile des Politischen inklusive ideologischer Unterbauten und ihrer einzelnen Vertreterreihen erkennbar.
Nacheinanderfolgend beleuchtet die Untersuchung den Rahmen für die außenpolitische Durchsetzungskraft der US-Insider im Bereich der wirtschaftlichen und politischen Aspekte des weltweiten Einflusses derselben. Anhand eines konkreten Falls werden die Verflechtungen in der Ölbranche und damit die Wichtigkeit der Macht-Eliten im globalen Gefüge unterstrichen. Hierbei steht die Ölkrise in den 70er Jahren explizit zur Einsicht - mit ihren Unstimmigkeiten und den daran beteiligten Schlüsselpersönlichkeiten dieser Zeit. Hier erkennt man den Stellenwert und die Rolle des amerikanischen Establishment, nicht nur für die internen Belange der USA, sondern auch im globalen Maßstab. Um die Übereinstimmung und die möglichen Berührungspunkte zwischen den theoretischen Annahmen von Mosca und der dargestellten Establishmentempirie feststellen zu können, soll ein kurzer vergleichender Blick auf die beiden präsentierten Bereiche geworfen werden. Zuletzt wird ein vorsichtiger Ausblick auf die weitere Entwicklung des Establishment vollzogen und dessen Rolle auf dem internationalen Parkett bewertet.
Page 5
2. Der theoretische Ansatz
Bevor wir zur Empirie übergehen, werden wir uns in diesem Kapitel dem System wissenschaftlich begründeter Aussagen im Kontext dieser Arbeit zur Beleuchtung der hier vorgestellten Problematik widmen. Ausgehend von der Elitentheorie, der die Hegemonietheorie gegenübergestellt ist, wird man die Kernauseinandersetzung innerhalb des dargestellten Problemfeldes erkennen und die Komplexität der thematisierten Materie zur Geltung bringen.
2.1. Gaetano Mosca und sein Elitenansatz
Gaetano Mosca (1858-1941), der konservative Gelehrte und Politiker des italienischen Parlaments (ab 1909) und spätere Senator (ab 1919), ist nicht nur einer der Begründer politischen Wissenschaften, sondern Gedankenträger der Theorie von der „politischen Klasse“. Auf diesem letzteren Aspekt basiert auch meine Absicht, die Theorie, als einen vergessenen Klassiker innerhalb der politischen Wissenschaft, in Erinnerung zu rufen und sich seiner theoretischen Strukturen für die Lösung meines Problemfeldes zu bedienen. Mosca verfasste im Jahre 1895 das Werk „Elementi di Scienza Politica“, das als 3. überarbeitete Auflage in deutscher Sprache unter dem Titel „Die herrschende Klasse“ im Jahre 1950 erschienen ist.
Der deutsche Titel von Moscas Hauptwerk stellt eine Verengung des Gegenstandes dar. Sein Werk ist ein Plädoyer für die Grundlegung einer neuen Politikwissenschaft. „Moscas Ansicht nach beruhen die Hauptwerke der politischen Theoretiker bis hin zu Rousseau oder Montesquieu auf einer zu geringen Kenntnis des empirischen Materials, das die Geschichtsforschung zur Verfügung stellt. Er hält die Zeit für gekommen, die Ergebnisse der positivistischen Epoche durch Theoriebildung zu
Page 6
ordnen. Dabei ist er sich der Schwierigkeiten beim Herausarbeiten von Gesetzesmäßigkeiten in der Sozialwissenschaft bewußt.“1Moscas Werk gehört zu den Entwürfen, die die Erschaffung einer objektivistisch-werturteilsfreien „Wissenschaft von der Politik“ aufzubauen versuchen. Dadurch versucht der Autor Vorurteile zu überwinden und auch die ideologischen Rechtfertigungen für herrschende Klassen, Politiker und Minoritäten zu beseitigen. Mosca übt scharfe Kritik an rassistischen und darwinistischen Lehren, er beklagt bei diesen den „aggressiven Einfluß“ auf die Sozialwissenschaften. Die
Sozialwissenschaft könne sich methodisch, aber nicht inhaltlich an der Naturwissenschaft orientieren.
„Der sogenannte Genius der Rasse hat also nichts Zwangsläufiges und Unausweichliches an sich, wie manche gern glauben möchten. Selbst angenommen, daß die verschiedenen „höheren“ Rassen, die eigene Hochkulturen hervorbringen können, untereinander organisch verschieden sind, so ist es doch nicht die Summe ihrer organischen Verschiedenheiten, welche die Verschiedenheit ihrer Gesellschaftsformen ausschließlich oder auch nur vorwiegend bedingt; vielmehr beruhen diese auf der Verschiedenheit ihrer sozialen Kontakte und auf anderen geschichtlichen Umständen, wie solchen keine Nation und kein sozialer Organismus, geschweige denn irgendeine Rasse ausweichen kann.“2Demnach ist das Auf und Ab von Kulturen eine Frage der geschichtlichen und nicht der natürlichen Entwicklung des Menschen. Die Grundlagen für Politik und Geschichte sieht er in einem Kampf der Menschen um den Vorrang sowie in psychischen Dispositionen des jeden Einzelnen innerhalb einer Gemeinschaft.
Für Mosca ergibt sich, „wenn die Wissenschaft der Politik auf der Beobachtung und Interpretationen der Tatsachen des politischen Lebens aufgebaut werden soll, dann müssen wir zu der alten historischen Methode zurückkehren.“3
1Eberle, Friedrich M.: Gaetano Mosca, in: Theo Stammen (Hg.): Hauptwerke der politischen Theorie,
Stuttgart 1997, S. 357.
2Mosca, Gaetano: Die herrschende Klasse, Bern 1950, S. 34f.
3Ebd., S. 45.
Page 7
Sein Elitenkonzept basiert - wie er es selbst bemerkt - auf den Ausführungen von Saint-Simon und Ludwig Gumplowicz, „allerdings ohne den Sozialismus Saint-Simon und ohne die Rassenlehre Gumplowicz. Dieses Konzept will den in jeder - also auch in der demokratischen -Gesellschaftsordnung vorhandenen Unterschied zwischen den
Regierenden und den Regierten aufzeigen.“4Die Hauptthese seines Werkes stellt Mosca am Anfang des zweiten Kapitels auf:
„In allen Gesellschaften, von den primitivsten im Aufgang der Zivilisation bis zu den vorgeschrittensten und mächtigsten, gibt es zwei Klassen, eine, die herrscht, und eine, die beherrscht wird. Die erste ist immer die weniger zahlreiche, sie versieht alle politischen Funktionen, monopolisiert die Macht und genießt deren Vorteile, während die zweite, zahlreichere Klasse von der ersten befehligt und geleitet wird.“5Demnach gibt es eine Herrschaft der Minorität über die Mehrheit, und zwar in Hinsicht auf alle Gesellschaften, ohne Ausnahme. Der Autor operiert dabei mit Verben wie befehlen und leiten. Diese unterstreichen das Prinzip des Regierens „von oben nach unten“, also ein Machtprinzip in der machiavellistischen Tradition, Macht als ein Instrumentarium der Wenigen über Viele. Die Trennung von Elite und Nichtelite soll dabei die Erhaltung der Macht der herrschenden Kreise absichern.6Dabei ist ihm bewußt, daß Machiavelli in der „Politik weniger eine Wissenschaft als eine Kunst, die dem einzelnen die nötige Einsicht vermitteln will, wie man an die Macht kommt und an der Macht bleibt“, sieht.7Des weiteren sagt Mosca zu der Funktionsweise der „herrschenden Klasse“:
„Diese Leitung ist mehr oder weniger gesetzlich, mehr oder weniger willkürlich oder gewaltsam und dient dazu, den Herrschenden den Lebensunterhalt und die Mittel der Staatsführung zu liefern. Im
4Röhrich, Wilfried: Eliten und das Ethos der Demokratie, München 1991, S. 56.
5Ebd., S. 53.
6Vgl. auch: Beyme, Klaus von: Die politischen Theorien der Gegenwart, Wiesbaden 2000, S. 219.
7Mosca, Gaetano: Das Aristokratische und das Demokratische Prinzip, In: Wilfried Röhrich (Hg.):
Demokratische Elitenherrschaft. Traditionsbestände eines sozialwissenschaftlichen Problems,
Darmstadt 1975, S. 33.
Page 8
praktischen Leben anerkennen wir alle die Existenz dieser herrschenden Klasse.“8
Mosca räumt mit der Fiktion auf, daß es die Herrschaft eines Einzelnen geben kann, eines Monarchen oder Diktators. Autokraten sind auf einen privilegierten Unterstützungsapparat angewiesen. Helfer bei der Verwaltung und Armee spielen dabei eine wichtige Rolle. Daraus resultiert automatisch die Existenz eines Kreises von Personen, der „die politische Klasse“ bzw. „herrschende Klasse“ bildet und sie zugleich sichert. Seine Ausführungen bezieht er auch - und vor allem - auf die repräsentativen Demokratien. „In der Behauptung, die Wahl drücke den Willen der Wähler aus, erkennt der konservative Gelehrte und Politiker bereits eine Unwahrheit; jedes sich darauf berufende System beruht Mosca zufolge auf einer „Lüge“.“9Auch in diesem Fall gibt es eine „classe dirigente“ am Werk.
Dieser Fall bildet für ihn keine Ausnahme, hier ist ebenfalls die organisierte Minderheit gegenüber einer unorganisierten Mehrheit durchsetzungsfähiger.
Außer dem Aspekt der Organisiertheit „der herrschenden Klasse“ haben folgende Indikatoren eine entscheidende Rolle: Grundbesitz, Reichtum, Bildung und Prestige.10
Der letzte Punkt bedarf besonderer Beachtung. Dabei bieten Le Bons Passagen zum Begriff des Prestige´s bzw. Nimbus´ einen interessanten Einblick in diese doch so mächtige Kraft, die nur wenigen einzelnen vorbehalten bleibt und bei Mosca zu den wichtigsten Elementen gehört, die „die herrschende Klasse“ mit ihrer Ideologie ausmachen. Le Bon schreibt dazu: „Eine große Macht verleiht den Ideen, die durch Behauptung, Wiederholung und Übertragung verbreitet wurden, zuletzt jene geheimnisvolle Gewalt, die Nimbus heißt. Alles, was in der Welt geherrscht hat, Ideen oder Menschen, hat sich hauptsächlich durch die unwiderstehliche Kraft, die sich Nimbus nennt, durchgesetzt. Wohl erfassen wir alle Bedeutung des Ausdrucks Nimbus (prestige), aber man
8Mosca [wie Anm. 2 ], S. 53.
9Röhrich [wie Anm. 4], S. 58.
10Vgl.: Mosca[wieAnm. 2], S. 55.
Page 9
wendet ihn in so mannigfacher Weise an, daß er nicht ganz leicht zu umschreiben wäre. Der Nimbus verträgt sich mit gewissen Gefühlen wie Bewunderung oder Furcht, er beruht sogar auf ihnen, kann aber sehr wohl ohne sie bestehen. Am meisten Nimbus haben die Toten, also Wesen, die wir nicht fürchten, wie Alexander, Cäsar, Mohammed, Buddha. (...) Der Nimbus ist in Wahrheit eine Art Zauber, den eine Persönlichkeit, ein Werk oder eine Idee auf uns ausübt. Diese Bezauberung lähmt alle unsre kritischen Fähigkeiten und erfüllt unsre Seelen mit Staunen und Ehrfurcht. Die Gefühle, die so hervorgerufen werden, sind unerklärlich wie alle Gefühle, aber wahrscheinlich von der selben Art wie die Suggestion, der ein Hypnotisierter unterliegt. Der Nimbus ist der mächtige Quell aller Herrschaft. (...)
Man kann die verschiedenen Arten des Nimbus auf zwei Grundformen zurückführen: auf den erworbenen und den persönlichen Nimbus. Als erworbenen Nimbus bezeichnet man den durch Namen, Reichtum und Ansehen entstandenen Nimbus. Er kann vom persönlichen Nimbus unabhängig sein. Der persönliche Nimbus ist dagegen etwas Individuelles und kann mit Ansehen, Ruhm und Reichtum zusammen bestehen oder durch sie verstärkt werden, aber auch sehr wohl unabhängig davon vorhanden sein.“11
Auf dieser Erscheinung wird auch die „Legitimationsideologie“ durch die Machteliten begründet; sie ist wiederum der Schlüssel zum Herrschen innerhalb des jeweiligen politischen Systems. Sie erleichtert die Durchsetzung eigener Pläne und führt zum Erreichen der Kontrolle über das Machtgefüge im Kreise der sozialen Schichten mit ihren Handlungsmöglichkeiten und Kompetenzen.
Die „herrschende Klasse“ bezieht ihren Machtanspruch auf die jeweilige „Legitimationsideologie“, diese basiert wiederum auf den durch die „in der Gesellschaft allgemein anerkannte Lehren und Glaubenssätze.“12Davon leitet der Theoretiker „die politische Formel“(formula politica)13ab, mit ihr beherrsche die „classe dirigente“ das Bewusstsein der Menschen.
11Le Bon, Gustave: Psychologie der Massen, Stuttgart 1982 (15-e Auflage), S. 92 f.
12Mosca [wie Anm. 2], S. 68.
Page 10
„Die formula politica muß Mosca zufolge in ihrem Inhalt als wahr empfunden werden; sie ist rational unbeweisbar, sie wendet sich an die Gefühle, nicht an die Überzeugungskraft.“14Zwei zusätzliche Aspekte spielen für den Autor - in Hinsicht auf die Funktionsweise der Eliten - eine wichtige Rolle:-Es wird die besondere Kraft der Religion, um politische Formeln abzustützen, betont und
-obwohl „die politische Formel“ die Macht sichert, wird „die herrschende Klasse“ durch Rivalen immer angreifbar bleiben können. Es ist schließlich auch sein zentrales Anliegen herauszufinden, „wie Menschen Macht über andere bekommen, wie sie ihre Macht ausüben, und wie sie sie wieder verlieren.“15Also auch die „Elitenkonkurrenz undzirkulation“ und „die sozialen Bezugsgruppen der Teileliten“ finden in seinen Untersuchungen ihre Berücksichtigung.16Mosca betrachtet die politische Freiheit als „Überlegenheit der Gesetze und Verordnungen über alle privaten Begierden.“17Die Diktatur wird als Krankheit bezeichnet und gleichzeitig abgelehnt. Er erhebt auch „seine mahnende Stimme vor den überhandnehmenden diktatorischen Tendenzen im Mussolini-Regime - als einziger Senator im damaligen Italien mit einer mutigen Rede gegen das erste Gesetz derleggi fascistissimi,die auf die Umwandlung des Montecitorios in einer Parteiversammlung gerichtet waren.“18
Als eine besondere Gefahr entlarvt der Autor die Konzentration des Reichtums, die Allmacht eines stehenden Heeres, die Vereinigung von religiöser und weltlicher Gewalt und schließlich die Kontrolle der Gütererzeugung durch die politische Macht.
13Vgl. auch: Herzog, Dietrich: Politische Führungsgruppen. Probleme und Ergebnisse der modernen
Elitenforschung, Darmstadt 1982, S. 14.
14Röhrich [wie Anm. 4], S. 59.
15Röhrich [wie Anm. 4], S. 12.
16Klingemann, Hans-Dieter/Stöss Richard/Weßels, Bernhard: Politische Klasse und politische
Institutionen, In: Hans-Dieter Klingemann/Richard Stöss/Bernhard Weßels (Hg.): Politische Klasse
und politische Institutionen. Probleme und Perspektiven der Elitenforschung, Wiesbaden 1991, S. 28.
17Mosca [wie Anm. 2], S. 359.
18Röhrich [wie Anm. 4], S. 60.





























