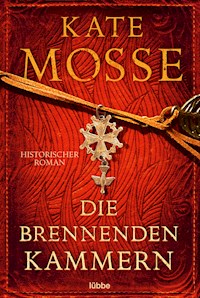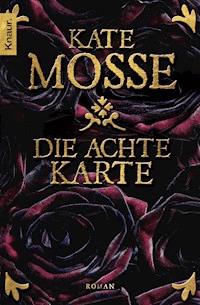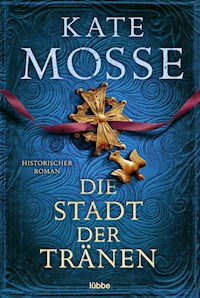4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Bei Ausgrabungen in einer Höhle des Languedoc entdeckt Alice Tanner zwei Skelette und eine labyrinthische Wandmalerei. Der Hauch des Bösen, den sie an dieser Stätte spürt, weckt dunkle Vorahnungen in ihr. Als sich die Polizei einschaltet, verstärkt sich Alices Gefühl, dass an dem rätselhaften Ort etwas geschehen ist, das im Verborgenen hätte bleiben sollen. Etwas, das weit in die Vergangenheit zurückreicht ... Achthundert Jahre zuvor erhält die junge Alaïs am selben Ort ein Buch mit fremdartigen Zeichen, deren schicksalhafte Bedeutung sie kennt. Sie weiß, dass sie das Geheimnis des Buches hüten muss – um jeden Preis. Verlust, Intrige, Gewalt und Leidenschaft prägen fortan das Leben beider Frauen. Und immer wieder werden ihrer beider Schicksale durch das Labyrinth auf geheimnisvolle Weise miteinander verknüpft …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 945
Veröffentlichungsjahr: 2012
Sammlungen
Ähnliche
Kate Mosse
Das verlorene Labyrinth
Roman
Aus dem Englischen von Ulrike Wasel und Klaus Timmermann
Knaur e-books
Inhaltsübersicht
Für meinen Vater, Richard Mosse,
einen rechtschaffenen Mann –
ein chevalier unserer Tage
Für Greg, wie immer, für alles –
Vergangenes, Gegenwärtiges und Zukünftiges
Und ihr werdet die Wahrheit erkennen,
und die Wahrheit wird euch frei machen.
Evangelium des Johannes, 8:32
L’histoire est un roman qui a été,
le roman est une histoire qui aurait pu être.
Geschichte ist ein Roman, der gelebt wurde,
ein Roman ist Geschichte, wie sie hätte sein können.
E. und J. de Goncourt
Tên përdu, jhamâi së rëcôbro.
Verlorene Zeit findet sich niemals wieder.
Mittelalterliches okzitanisches Sprichwort
Prolog
1
Pic de SoularacSabarthès-BergeSüdwestfrankreich
Ein dünner Blutfaden läuft die blasse Innenseite ihres Arms wie ein roter Saum auf einem weißen Ärmel hinunter.
Zuerst hält Alice es für eine Fliege und achtet nicht weiter darauf. Insekten gehören zum Berufsrisiko bei einer Ausgrabung, und aus unerfindlichen Gründen sind weiter oben auf dem Berg, wo sie arbeitet, mehr Fliegen als unten an der Hauptausgrabungsstätte. Dann fällt ihr ein Tropfen Blut auf das nackte Bein und zerspritzt wie ein Feuerwerkskörper am nächtlichen Silvesterhimmel.
Diesmal schaut sie auf ihren Arm und sieht, dass der Schnitt innen am Ellbogen wieder aufgegangen ist. Es ist eine tiefe Wunde, die einfach nicht heilen will. Sie seufzt, drückt dann das Pflaster mit dem Mull darunter fester auf die Haut. Dann, weil keiner da ist, der es sehen könnte, leckt sie sich das Blut vom Handgelenk.
Einzelne Haarsträhnen, die die hellbraune Farbe von Karamell haben, sind aus dem Pferdeschwanz unter ihrer Mütze gerutscht. Sie streicht sie sich hinter die Ohren und wischt sich mit einem Taschentuch über die Stirn, ehe sie das Gummiband ihres Pferdeschwanzes wieder festzieht.
Aus ihrer Konzentration gerissen, steht Alice auf und streckt die langen Beine, die von der Sonne leicht gebräunt sind. Sie trägt eine abgeschnittene Jeans, ein enges weißes T-Shirt, eine Baseballmütze und sieht kaum älter aus als ein Teenager. Früher hat sie das gestört. Jetzt, wo sie älter wird, weiß sie, dass es auch Vorteile hat, jünger auszusehen, als man ist. Der einzige Hauch von Eleganz sind ihre zarten, sternchenförmigen Silberohrringe, die wie Pailletten glitzern.
Alice schraubt ihre Wasserflasche auf. Das Wasser ist warm, aber sie ist durstig und trinkt es in langen Zügen. Unterhalb von ihr flimmert der Hitzeschleier über dem rissigen Asphalt der Straße. Über ihr ist der Himmel endlos blau. Die Zikaden singen unermüdlich im Chor, versteckt im Schutz des trockenen Grases.
Sie ist das erste Mal in den Pyrenäen, aber sie fühlt sich hier richtig zu Hause. Man hat ihr erzählt, dass die zerklüfteten Gipfel der Sabarthès-Berge im Winter schneebedeckt sind. Im Frühling lugen zarte Blumen mit rosa und mauvefarbenen und weißen Blüten aus ihren Verstecken auf den gewaltigen Felsflächen. Im Frühsommer sind die Weiden grün und mit gelben Butterblumen übersät. Jetzt jedoch hat die Sonne das Land in die Knie gezwungen und alles Grün in Braun verwandelt. Es ist schön hier, denkt sie, und doch irgendwie ungastlich. Es ist ein Ort voller Geheimnisse, einer, der zu viel gesehen und zu viel verborgen hat, um wirklich mit sich selbst im Reinen zu sein.
Im Hauptlager weiter unten am Hang sieht sie ihre Kollegen unter dem großen Sonnenzelt stehen. Sie kann Shelagh in ihrem für sie typischen schwarzen Outfit erkennen. Sie wundert sich, dass unten bereits keiner mehr arbeitet. Es ist noch sehr früh für eine Pause, doch das ganze Team ist ein bisschen demoralisiert.
Die Arbeit ist die meiste Zeit mühselig und monoton, das Graben und Kratzen, das Katalogisieren und Aufschreiben, und die bisherige Ausbeute rechtfertigt kaum die ganze Strapaze. Sie haben ein paar Scherben von frühmittelalterlichen Töpfen und Schalen und zwei Pfeilspitzen aus dem späten 12. oder frühen 13. Jahrhundert gefunden, aber eben noch keine einzige Spur von der paläolithischen Siedlung, um die es bei der Ausgrabung eigentlich geht.
Alice überlegt, ob sie hinunter zu ihren Freunden und Kollegen gehen und sich den Arm neu verbinden lassen soll. Die Wunde brennt, und die Beine tun ihr vom ständigen Hocken weh. Ihre Schultermuskeln sind verkrampft. Doch sie weiß, wenn sie jetzt aufhört, verliert sie den Schwung.
Vielleicht hat sie ja bald Glück. Am frühen Morgen hat sie ein Blinken unter einem großen Felsbrocken gesehen, der sauber und ordentlich am Berghang lehnt, fast so, als hätte ihn eine riesige Hand absichtlich so hingestellt. Sie kann zwar nicht erkennen, um was es sich bei dem Gegenstand handelt, nicht einmal, wie groß er ist, doch sie gräbt schon den ganzen Morgen und müsste bald am Ziel sein.
Sie weiß, dass sie einen von den anderen dazuholen sollte. Oder zumindest Shelagh Bescheid sagen, ihrer besten Freundin und Assistentin des Ausgrabungsleiters. Alice ist keine ausgebildete Archäologin, nur eine Freiwillige, die einen Teil ihres Sommerurlaubs mit etwas Sinnvollem verbringen möchte. Aber es ist ihr letzter Tag bei der Ausgrabung, und sie will sich beweisen. Wenn sie jetzt ins Hauptlager geht und den anderen erzählt, dass sie vielleicht etwas gefunden hat, wollen alle mitmachen, und dann wäre es nicht mehr ihre Entdeckung.
In den nächsten Tagen und Wochen wird Alice an diesen Augenblick zurückdenken. Sie wird sich an das besondere Licht erinnern, an den metallischen Geschmack von Blut und Staub im Mund, und sie wird sich fragen, wie anders alles gekommen wäre, wenn sie sich entschieden hätte, ins Camp zu gehen und nicht zu bleiben. Wenn sie sich an die Regeln gehalten hätte.
Sie saugt den letzten Tropfen Wasser aus der Flasche und wirft sie zurück in ihren Rucksack. Gut eine Stunde arbeitet sie weiter, während die Sonne am Himmel höher steigt und die Temperatur klettert. Die einzigen Geräusche sind das Schaben von Metall auf Stein, das Sirren der Insekten und das gelegentliche Brummen eines kleinen Flugzeugs in der Ferne. Sie spürt die Schweißperlen auf der Oberlippe und zwischen den Brüsten, aber sie macht weiter, bis die Lücke unter dem Felsen schließlich so groß ist, dass sie die Hand hineinschieben kann.
Alice kniet sich auf die Erde und presst Wange und Schulter gegen den Felsen, um sich abzustützen. Dann streckt sie die Finger mit einem aufgeregten Beben in die dunkle, verborgene Erde. Sie weiß sofort, dass sie den richtigen Instinkt hatte, dass sie etwas gefunden hat, das es wert ist, gefunden zu werden. Es fühlt sich glatt und schmutzig an, Metall, kein Stein. Entschlossen greift sie danach und ermahnt sich, nicht zu viel zu erwarten, zieht dann den Gegenstand ganz langsam ans Licht. Die Erde scheint zu erschaudern, als wollte sie ihren Schatz nicht hergeben.
Alice nimmt kaum wahr, dass der satte, süßliche Geruch von nasser Erde ihr in Nase und Kehle dringt. Sie ist jetzt in der Vergangenheit versunken, fasziniert von dem Stück Geschichte in ihrer Hand. Es ist eine schwere, runde Verschlussschnalle für Mäntel oder Gewänder, eine so genannte Scheibenfibel, die vom Alter und von der langen Zeit unter der Erde schwarz und grün gefleckt ist. Alice reibt mit den Fingern darüber und lächelt, als unter dem Schmutz allmählich die Silber- und Kupferverzierungen zum Vorschein kommen. Die Schnalle könnte aus dem Mittelalter sein, sie hat solche Schnallen schon einmal gesehen.
Ihr ist bewusst, dass sie keine voreiligen Schlüsse ziehen oder sich von ersten Eindrücken verleiten lassen sollte, trotzdem kann sie nicht anders, als sich den Besitzer vorzustellen, den das Leben einst hierher geführt hat und der nun schon so lange tot ist. Ein Fremder, dessen Geschichte sie erst noch erkunden muss.
Alice ist so von der Vorstellung gefangen, dass sie nicht merkt, wie sich der Felsbrocken bewegt. Dann lässt sie irgendetwas, eine Art sechster Sinn, aufschauen. Für den Bruchteil einer Sekunde scheint die Welt in der Schwebe zu sein, raumlos, zeitlos. Gebannt starrt sie auf den uralten Stein, der ins Schwanken geraten ist, dann kippt und anmutig auf sie zufällt.
Im allerletzten Moment zersplittert das Licht. Der Bann ist gebrochen. Alice wirft sich gerade noch rechtzeitig zur Seite, halb stolpernd, halb schlitternd. Um ein Haar wäre sie zerquetscht worden. Der Felsbrocken schlägt mit dumpfer Wucht auf dem Boden auf, wirbelt eine blassbraune Staubwolke hoch und rollt dann wie in Zeitlupe weiter, bis er ein Stück tiefer am Hang zum Stillstand kommt.
Alice hält sich verzweifelt an Büschen und Sträuchern fest, um nicht weiter nach unten zu rutschen. Einen Moment lang bleibt sie ausgestreckt auf der Erde liegen, benommen und ohne Orientierung. Als ihr klar wird, wie knapp sie dem Tod entgangen ist, wird ihr kalt. Haarscharf, denkt sie. Sie atmet tief durch. Wartet ab, bis die Welt um sie herum aufhört sich zu drehen.
Allmählich lässt das Dröhnen in ihrem Kopf nach. Die Übelkeit im Magen legt sich, und alles wird wieder halbwegs normal, zumindest kann sie sich aufsetzen und erste Bilanz ziehen. Ihre Knie sind aufgeschürft und blutig, und sie hat sich beim Aufprall das Handgelenk angeschlagen, weil sie die Schnalle festgehalten hat, aber ansonsten ist sie bis auf ein paar Kratzer und Prellungen glimpflich davongekommen. Ich bin nicht ernsthaft verletzt.
Sie steht auf und kommt sich völlig idiotisch vor, als sie sich den Staub abklopft. Wie konnte sie nur so einen grundlegenden Fehler machen und den Felsen nicht absichern? Sie blickt hinunter zum Hauptlager, verwundert und auch erleichtert, dass anscheinend niemand etwas gehört oder gesehen hat. Sie hebt die Hand und will gerade rufen, als sie an der Stelle, wo der Felsbrocken gelehnt hat, eine schmale Öffnung sieht. Wie ein Eingang, der in den Felsen geschlagen wurde.
Da es hier in den Bergen von Geheimgängen und Höhlen nur so wimmeln soll, ist sie nicht sonderlich überrascht. Und doch, denkt Alice, muss sie irgendwie gewusst haben, dass dieser Eingang da war, obwohl er hinter dem Felsen versteckt war. Besser gesagt: geahnt.
Sie zögert. Alice sollte jemanden holen. Es ist unvernünftig, vielleicht sogar gefährlich, ohne Begleitung in die Höhle zu gehen. Sie weiß, was alles passieren kann. Aber sie hätte schon gar nicht allein hier oben arbeiten dürfen. Shelagh weiß nichts davon. Doch da ist irgendetwas, das sie geradezu hineinzieht. Nur sie. Immerhin ist es ihre Entdeckung.
Alice redet sich ein, dass es nichts bringt, die anderen aufzuscheuchen, ihnen grundlos Hoffnungen zu machen. Falls es da drinnen irgendetwas zu erkunden gibt, wird sie ihnen Bescheid geben. Sie wird schon nichts anfassen. Sie will nur einen Blick hineinwerfen.
Ich bleibe nur kurz drin.
Alice steigt wieder den Hang hinauf. Vor dem Eingang der Höhle, dort, wo der Felsbrocken Wache gestanden hat, ist eine tiefe Mulde. In der feuchten Erde herrscht ein aufgeregtes Gewimmel von Würmern und Käfern, die nach langer Zeit plötzlich dem Licht und der Hitze ausgesetzt sind. Alice sieht ihre Mütze am Boden liegen. Auch ihre Kelle ist da, wo sie sie zurückgelassen hat.
Alice späht in die Dunkelheit. Die Öffnung ist höchstens anderthalb Meter hoch und nicht ganz einen Meter breit, die Kanten sind unregelmäßig und rau. Es scheint eher ein natürlicher als ein von Menschen geschaffener Eingang zu sein, doch als sie mit den Fingern den Stein abtastet, spürt sie da, wo der Felsbrocken angelehnt gewesen war, seltsam glatte Flächen.
Langsam gewöhnen ihre Augen sich an die Düsterkeit. Samtschwarz weicht einem Schwarzgrau, und sie erkennt, dass sie in einen langen, schmalen Tunnel blickt. Sie spürt, wie sich ihr die Härchen im Nacken sträuben, wie eine Warnung, dass dort in der Dunkelheit etwas lauert, das besser ungestört bliebe. Aber das ist bestimmt nur kindischer Aberglaube, und sie schüttelt das Gefühl ab. Alice glaubt nicht an Geister oder Vorahnungen.
Die Schnalle wie einen Talisman fest in der Hand atmet sie einmal tief durch und betritt den Gang. Sofort umhüllt sie der Geruch von seit langer Zeit abgeschotteter, unterirdischer Luft, dringt ihr in Mund, Kehle und Lunge. Aber es ist kühl und feucht, keine Spur von den trockenen, giftigen Gasen wie in den hermetisch verschlossenen Höhlen, vor denen man sie gewarnt hat; daher vermutet sie, dass es irgendwo eine Frischluftzufuhr geben muss. Doch für alle Fälle kramt sie in den Taschen ihrer abgeschnittenen Jeans nach ihrem Feuerzeug. Sie zündet es an und hält es hoch in die Dunkelheit, um sich zu vergewissern, dass genügend Sauerstoff vorhanden ist. Die Flamme flackert in einem Lufthauch, geht aber nicht aus.
Nervös und mit einem Anflug von schlechtem Gewissen wickelt Alice die Schnalle in ein Taschentuch und schiebt sie in die Hosentasche. Dann geht sie vorsichtig weiter. Das Licht der Flamme ist schwach, doch es erhellt den Boden unmittelbar vor ihr und wirft Schatten auf die zerklüfteten grauen Wände.
Sie spürt, wie sich die kühle Luft um ihre nackten Beine und Arme schmiegt wie eine Katze. Der Weg ist leicht abschüssig. Sie spürt deutlich, dass sich der unebene und kiesige Boden unter ihren Füßen neigt. Das Knirschen von Steinen und Schotter klingt laut in dem engen, stillen Gang. Sie merkt, dass das Tageslicht in ihrem Rücken mit jedem Schritt schwächer wird.
Auf einmal will sie nicht mehr weitergehen. Sie will überhaupt nicht hier sein. Und doch hat das alles etwas Unvermeidliches an sich, da ist etwas, das sie tiefer und tiefer in den Bauch des Berges zieht.
Nach weiteren zehn Metern ist der Tunnel zu Ende. Alice sieht, dass sie an der Schwelle einer höhlenartigen geschlossenen Kammer steht, auf einer natürlichen, steinernen Plattform. Direkt vor ihr führen ein paar breite, flache Steinstufen in den Hauptraum, wo der Boden glatt und eben ist. Die Höhle ist etwa zehn Meter lang und rund fünf Meter breit, und sie ist offensichtlich nicht allein ein Werk der Natur, sondern wurde eindeutig auch von Menschenhand geschaffen. Die Decke ist niedrig und gewölbt, wie das Dach einer Krypta.
Alice steht staunend da. Sie hält die flackernde, einsame kleine Flamme höher und spürt plötzlich eine beklemmende, seltsam kribbelnde Vertrautheit, die sie sich nicht erklären kann. Sie will gerade die Stufen hinuntergehen, als ihr auffällt, dass in der obersten Stufe Buchstaben eingemeißelt sind. Sie bückt sich und versucht zu lesen, was dort steht. Nur die ersten drei Wörter und der letzte Buchstabe – ein N oder vielleicht ein H – sind lesbar. Die anderen sind erodiert oder abgebröckelt. Sie reibt den Schmutz mit den Fingern weg und liest die Buchstaben laut vor sich hin. Das Echo ihrer Stimme klingt in der Stille irgendwie feindselig und bedrohlich.
»P-A-S A P-A-S … Pas a pas.«
Schritt für Schritt? Schritt für Schritt was? Eine schwache Erinnerung kitzelt die Oberfläche ihres Unterbewusstseins wie ein längst vergessenes Lied. Dann ist sie wieder verschwunden.
»Pas a pas.« Diesmal flüstert sie, aber es sagt ihr nichts. Ein Gebet? Eine Warnung? Ohne zu wissen, was da sonst noch steht, ist es unverständlich.
Sie ist jetzt nervös, als sie sich wieder aufrichtet und vorsichtig die Stufen hinuntergeht. Neugier kämpft gegen eine dumpfe Vorahnung, und sie weiß nicht, ob sie aus Angst oder von der kalten Höhle Gänsehaut auf den nackten Armen hat.
Alice hält das Feuerzeug hoch, um sehen zu können, wo sie hintritt, damit sie nicht ausgleitet oder gegen irgendetwas stößt. Unten angekommen, verharrt sie einen Moment. Sie atmet erneut tief durch und macht dann einen Schritt in die schwarze Finsternis. Sie kann die hintere Wand nur mit größter Mühe erkennen.
Auf diese Entfernung ist schwer zu sagen, ob es nicht nur eine optische Täuschung oder ein Schatten ist, den die Flamme wirft, aber es sieht ganz so aus, als wäre auf dem Felsen ein großes kreisrundes Muster aus Linien und Halbkreisen aufgemalt oder in die Wand eingemeißelt. Davor steht ein steinerner Tisch, etwa einen Meter zwanzig hoch, der wie ein Altar aussieht.
Den Blick zur Orientierung auf das Symbol an der Wand geheftet, geht Alice langsam weiter. Jetzt kann sie das Muster deutlicher sehen. Es sieht aus wie eine Art Labyrinth, obwohl ihr Gedächtnis ihr sagt, dass irgendwas daran nicht ganz stimmt. Es ist kein richtiges Labyrinth. Die Linien führen nicht, wie es sein müsste, in die Mitte. Das Muster ist falsch. Alice kann nicht sagen, warum sie sich so sicher ist, aber sie weiß genau, dass sie Recht hat.
Ohne den Blick abzuwenden, nähert sie sich dem Labyrinth. Ihr Fuß stößt gegen irgendetwas Hartes auf dem Boden. Sie hört einen schwachen, hohlen Ton und dann ein Geräusch, als wäre ein Gegenstand von seinem Platz gerollt.
Alice blickt nach unten.
Auf einmal zittern ihr die Beine. Die schwache Flamme in ihrer Hand flackert. Der Schock raubt ihr den Atem. Sie steht am Rand eines flachen Grabes, das kaum mehr als eine leichte Vertiefung im Boden ist. Darin liegen zwei Skelette, zwei menschliche Skelette, die Knochen von der Zeit säuberlich freigelegt. Die leeren Augenhöhlen eines Schädels starren zu ihr hoch. Der andere Schädel, den sie weggestoßen hat, liegt auf der Seite, und es sieht aus, als würde er den Blick von ihr abwenden.
Die Körper sind so hingelegt worden, dass sie auf den Altar blicken, Seite an Seite, wie Skulpturen auf einem Grab. Sie liegen symmetrisch und vollkommen parallel zueinander, aber sie strahlen nichts Ruhiges aus, nichts Friedliches. Die Wangenknochen des einen Schädels sind zerschmettert, nach innen gedrückt wie bei einer Maske aus Pappmaché. Etliche Rippen des anderen Skeletts sind gebrochen und ragen nach außen wie die Zweige eines toten Baumes.
Sie können dir nichts tun. Entschlossen, sich nicht ins Bockshorn jagen zu lassen, zwingt Alice sich, in die Hocke zu gehen, ganz behutsam, um nichts zu verändern. Sie betrachtet das Grab genauer. Zwischen den Körpern befinden sich ein Dolch, dessen Klinge im Laufe langer Jahre matt geworden ist, und ein paar Kleiderreste. Daneben liegt ein Lederbeutel mit Zugband, groß genug, dass eine kleine Schatulle oder ein Buch hineinpassen würde. Alice runzelt die Stirn. Sie ist sicher, etwas Ähnliches schon einmal gesehen zu haben, aber ihr fällt nicht ein, wo.
Der runde weiße Gegenstand, der zwischen den klauenartigen Fingern des kleineren Skeletts klemmt, ist so winzig, dass Alice ihn fast übersehen hätte. Ohne zu überlegen, ob es richtig ist, was sie tut, nimmt sie rasch ihre Pinzette aus der Tasche. Sie beugt sich vor, zieht ihn vorsichtig heraus und pustet den Staub weg, bevor sie ihn dicht an die Flamme hält.
Es ist ein kleiner Steinring, schlicht und unscheinbar, mit einer runden, glatten Oberfläche. Auch er kommt ihr seltsam bekannt vor. Alice nimmt ihn genauer in Augenschein. In die Unterseite ist etwas eingekratzt. Zuerst denkt sie, es ist eine Art Siegel. Doch dann erkennt sie es mit einem leichten Schock. Alice blickt zu der Höhlenwand hoch, dann wieder auf den Ring.
Die Muster sind identisch.
Alice ist nicht religiös. Sie glaubt nicht an Himmel oder Hölle, nicht an Gott oder Teufel und auch nicht an die Wesen, die angeblich hier in den Bergen herumspuken. Aber zum ersten Mal in ihrem Leben wird sie von dem Gefühl überwältigt, in Gegenwart von etwas Übernatürlichem zu sein, von etwas Unerklärlichem, von etwas, das größer ist als ihre Erfahrung und ihr Begriffsvermögen. Sie spürt etwas Böses über ihre Haut kriechen, ihren Kopf, ihre Fußsohlen.
Ihr Mut verlässt sie. Die Höhle ist plötzlich eiskalt. Angst schnürt ihr die Kehle zu, lässt ihr den Atem in der Lunge gefrieren. Alice steht hastig auf. Sie sollte nicht hier sein, an diesem uralten Ort. Jetzt will sie nur noch raus aus der Kammer, fort von diesem Anblick der Gewalt und dem Geruch des Todes und zurück ins sichere, helle Sonnenlicht.
Doch es ist zu spät.
Über oder hinter ihr, wo, kann sie nicht sagen, sind Schritte zu hören. Das Geräusch hallt in der kleinen Kammer wider, prallt von den Felswänden ab. Es kommt jemand.
Alice wirbelt vor Schreck herum und lässt in ihrer Panik das Feuerzeug fallen. Es wird dunkel um sie herum. Sie will loslaufen, verliert jedoch in der Finsternis die Orientierung und weiß nicht mehr, wo der Ausgang ist. Sie strauchelt. Die Beine rutschen unter ihr weg.
Sie fällt. Der Ring fliegt zurück in den Haufen Knochen, wo er hingehört.
2
CarcassonneSüdwestfrankreich
Wenige Kilometer Luftlinie nach Osten entfernt, in einem vergessenen Dorf in den Sabarthès-Bergen, sitzt ein Mann in einem hellen Anzug allein an einem Tisch aus dunklem, glänzend poliertem Holz.
Der Raum hat eine niedrige Decke und ist mit großen, quadratischen Fliesen von der Farbe roter Bergerde ausgelegt, die ihn trotz der Hitze draußen kühl halten. Die Läden vor dem einzigen Fenster sind geschlossen, daher ist es dunkel, bis auf den kreisrunden gelben Lichtschein einer kleinen Öllampe auf dem Tisch. Das schwere Wasserglas neben der Lampe ist fast bis zum Rand mit einer roten Flüssigkeit gefüllt.
Auf dem Tisch verstreut liegen etliche Blätter dickes, cremefarbenes Papier, jedes davon Zeile um Zeile mit schwarzer Tinte in einer akkuraten Handschrift beschrieben. In dem Zimmer ist es still, bis auf das Kratzen und Schaben des Stiftes und das Klimpern der Eiswürfel im Glas, wenn er trinkt, hört man nichts. Feiner Duft nach Alkohol und Kirschen. Das Ticken der Uhr markiert das Vergehen der Zeit, wenn er innehält, nachdenkt und dann weiterschreibt.
Was wir in diesem Leben zurücklassen, ist die Erinnerung daran, wer wir waren und was wir getan haben. Ein Abdruck, mehr nicht. Ich habe viel gelernt. Ich bin weise geworden. Aber habe ich etwas bewegt? Ich weiß es nicht. Pas a pas, se va luènh.
Ich habe gesehen, wie das Grün des Frühlings dem Gold des Sommers wich, das Kupfer des Herbstes dem Weiß des Winters, während ich dasaß und auf das Verschwinden des Lichtes wartete. Immer und immer wieder habe ich mich gefragt, warum. Wenn ich gewusst hätte, wie es sein würde, völlig allein zu sein, der einzige Zeuge des endlosen Kreislaufs von Geburt und Leben und Tod, was hätte ich getan? Alaïs, meine Einsamkeit ist eine quälende Last. Ich habe dieses lange Leben mit Leere im Herzen erduldet, einer Leere, die mit den Jahren wuchs und wuchs, bis sie größer wurde als mein Herz selbst.
Ich habe versucht, die Versprechen, die ich dir gab, zu halten. Das eine ist erfüllt, das andere blieb unerfüllt. Bis jetzt. Schon seit einiger Zeit spüre ich deine Nähe. Unsere Zeit ist beinahe wieder da. Alles deutet darauf hin. Bald wird die Höhle geöffnet werden. Ich spüre diese Wahrheit überall um mich herum. Und auch das Buch, das so lange Zeit in Sicherheit war, wird gefunden werden.
Der Mann hält inne und greift erneut nach dem Glas. Seine Augen sind von der Erinnerung getrübt, doch der Guignolet ist stark und süß und belebt ihn.
Ich habe sie gefunden. Endlich. Und ich frage mich, ob es sich vertraut anfühlen wird, wenn ich das Buch in ihre Hände lege. Steckt die Erinnerung daran in ihrem Blut und ihren Knochen? Wird sie sich erinnern, wie der Einband schimmert und die Farbe verändert? Wenn sie die Bänder löst und es öffnet, behutsam, um das trockene, spröde Pergament nicht zu beschädigen, wird sie sich der Worte entsinnen, die durch die Jahrhunderte zurückhallen?
Ich bete, dass ich jetzt, wo mein langes Leben sich dem Ende nähert, endlich die Chance habe, den Fehler, den ich einst beging, wieder gutzumachen, dass ich endlich die Wahrheit erfahre. Die Wahrheit wird mich befreien.
Der Mann lehnt sich auf seinem Stuhl zurück und legt die vom Alter braun gefleckten Hände flach auf den Tisch. Die Chance, nach so langer Zeit zu erfahren, was am Ende geschah.
Das ist alles, mehr will er nicht.
3
ChartresNordfrankreich
Später am selben Tag steht knapp siebenhundert Kilometer nördlich von Carcassonne ein Mann in einem schwach erhellten Durchgang unter den Straßen von Chartres und wartet darauf, dass die Zeremonie beginnt.
Seine Hände sind verschwitzt, sein Mund ist trocken, und er spürt deutlich jeden Nerv, jeden Muskel seines Körpers, spürt an den Schläfen das Pochen in den Adern. Er fühlt sich unsicher und ein bisschen benommen, obwohl er nicht sagen könnte, ob es auf Nervosität und Vorfreude zurückzuführen ist oder auf die Nachwirkungen des Weines. Die ungewohnten weißen Baumwollgewänder hängen schwer von seinen Schultern, und die Hanfstricke liegen unangenehm auf seinen knochigen Hüften. Er wirft einen verstohlenen Blick auf die beiden Gestalten, die schweigend rechts und links von ihm stehen, aber die Kapuzen verbergen die Gesichter. Er kann nicht erkennen, ob sie genauso angespannt sind wie er oder ob sie das Ritual schon oft mitgemacht haben. Sie sind genauso gekleidet wie er, nur dass ihre Gewänder goldfarben sind statt weiß. Außerdem tragen sie Schuhe. Seine Füße sind nackt, und das Kopfsteinpflaster ist kalt.
Hoch über dem geheimen Netz aus Gängen beginnen die Glocken der großen gotischen Kathedrale zu läuten. Er spürt, wie die Männer neben ihm Haltung annehmen. Das ist das Signal, auf das sie gewartet haben. Sofort senkt er den Kopf und versucht sich nur noch auf den Augenblick zu konzentrieren.
»Je suis prêt«, murmelt er, mehr um sich zu beruhigen denn als Feststellung. Keiner seiner beiden Begleiter zeigt irgendeine Reaktion.
Als auch der letzte Nachhall der Glocken verklingt, tritt der Akoluth zu seiner Linken vor und schlägt mit einem Stein, der halb in seiner Hand versteckt ist, fünfmal gegen die massive Tür. Von drinnen ertönt die Antwort: »Dintrar.« Tretet ein.
Dem Mann kommt die Frauenstimme bekannt vor, aber er hat keine Zeit zu überlegen, wo oder wann er sie schon einmal gehört hat, denn die Tür öffnet sich bereits, und er sieht die Kammer, ein Anblick, auf den er so lange gewartet hat.
Die drei Gestalten setzen sich in gemessenem Gleichschritt in Bewegung. Er hat das geübt und weiß, was ihn erwartet, weiß, was er zu tun hat, auch wenn er sich ein wenig unsicher auf den Beinen fühlt. In dem Raum ist es heiß, nach dem kühlen Gang, und er ist dunkel. Das einzige Licht kommt von den Kerzen, die in den Nischen und auf dem Altar aufgestellt sind und tanzende Schatten auf den Boden werfen.
Adrenalin jagt durch seinen Körper, doch zugleich fühlt er sich seltsam losgelöst von dem Geschehen. Als die Tür hinter ihm zufällt, zuckt er zusammen.
Die vier ranghöheren Diener stehen im Norden, Süden, Osten und Westen der Kammer. Er würde so gern die Augen heben und sich umsehen, aber er zwingt sich, den Kopf weisungsgemäß gesenkt und das Gesicht bedeckt zu halten. Er kann die Eingeweihten erahnen, die in zwei Reihen an den Längsseiten der rechteckigen Kammer stehen, sechs auf jeder Seite. Er fühlt die Wärme ihrer Körper und hört das Heben und Senken ihrer Atmung, obwohl niemand sich bewegt und niemand etwas sagt.
Er hat sich den Grundriss anhand der Papiere eingeprägt, die man ihm gegeben hat, und als er auf den Schrein in der Mitte des Raumes zuschreitet und ihre Blicke im Rücken spürt, fragt er sich, ob er vielleicht einige von ihnen kennt. Geschäftspartner, Ehefrauen von Bekannten, jeder könnte ein Mitglied sein. Unwillkürlich schleicht sich ein schwaches Lächeln auf seine Lippen, als er sich für einen Moment der Phantasie hingibt, wie sehr sich sein Leben durch die Aufnahme in die Gemeinschaft verändern wird.
Er wird jäh in die Gegenwart zurückgeholt, als er stolpert und beinahe über die steinerne Kniebank vor dem Altar gefallen wäre. Die Kammer ist kleiner, als er sie sich aufgrund des Planes vorgestellt hatte, enger und klaustrophobischer. Er hatte die Entfernung zwischen Tür und Stein größer geschätzt.
Als er auf dem Stein niederkniet, schnappt irgendjemand ganz in seiner Nähe nach Luft, und er fragt sich, wieso. Sein Herzschlag beschleunigt sich, und als er nach unten schaut, sieht er, dass seine Handknöchel weiß sind. Verlegen presst er die Hände zusammen, doch dann erinnert er sich wieder und lässt die Arme locker herabhängen, so wie es sein soll.
Eine leichte Vertiefung befindet sich in der Mitte des Steines, der hart und kalt durch den dünnen Stoff der Robe zu spüren ist. Er rutscht ein bisschen hin und her, sucht nach einer bequemeren Position. Das Unbehagen ist etwas, worauf er sich konzentrieren kann, und dafür ist er dankbar. Ihm ist noch immer schwindelig, und er hat Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren. Er erinnert sich auch nicht mehr, in welcher Reihenfolge jetzt alles ablaufen wird, obwohl er es im Kopf immer wieder durchgespielt hat.
In der Kammer beginnt eine Glocke zu läuten, ein hoher, dünner Ton. Gleichzeitig setzt ein tiefer Gesang ein, zunächst leise, doch rasch immer lauter werdend, je mehr Stimmen einfallen. Fetzen von Wörtern und Sätzen dringen an sein Ohr: montanhas, Berge; Noblesa, Adel; libres, Bücher; graal, Gral …
Die Priesterin tritt hinter dem Altar hervor und geht durch die Kammer. Er kann das leise Scharren ihrer Füße hören und stellt sich vor, wie ihre goldene Robe im flackernden Kerzenschein schimmert und schwingt. Das ist der Augenblick, auf den er gewartet hat.
»Je suis prêt«, wiederholt er im Flüsterton. Und diesmal meint er es auch so.
Die Priesterin bleibt vor ihm stehen. Er kann ihr Parfüm riechen, dezent und zart unter dem berauschenden Duft des Weihrauchs. Er hält den Atem an, als sie sich vorbeugt und seine Hand nimmt. Ihre Finger sind kühl und manikürt, und ein Stromstoß, fast schon Begehren, schießt ihm durch den Arm, als sie ihm etwas Kleines, Rundes in die Hand drückt und dann seine Finger darum schließt. Jetzt will er – mehr als er je in seinem Leben etwas gewollt hat – in ihr Gesicht blicken. Aber er hält die Augen weiter auf den Boden gerichtet, wie man es ihm gesagt hat.
Die vier ranghöheren Diener verlassen ihre Positionen und treten zu der Priesterin. Sein Kopf wird sacht nach hinten gezogen und eine dicke, süße Flüssigkeit zwischen seine Lippen geträufelt. Er hat damit gerechnet und leistet keinen Widerstand. Als die Wärme sich in seinem Körper ausbreitet, hebt er die Arme, und seine Begleiter legen ihm einen goldenen Umhang über die Schultern. Die Zeugen kennen das Ritual, und doch kann er ihre Beklommenheit spüren.
Plötzlich hat er das Gefühl, als würde sich ihm ein Eisenring um den Hals legen und ihm die Luftröhre zerquetschen. Seine Hände schnellen hoch an die Kehle, und er ringt um Atem. Er will etwas rufen, aber er bringt kein Wort heraus. Der hohe, dünne Glockenklang setzt erneut ein, stetig und beharrlich, übertönt ihn. Übelkeit erfasst ihn. Er glaubt, ohnmächtig zu werden, und umklammert Hilfe suchend den Gegenstand in seiner Hand so fest, dass die Fingernägel sich in die weiche Haut der Handfläche bohren. Der stechende Schmerz hilft ihm, sich aufrecht zu halten. Erst jetzt wird ihm klar, dass die Hände auf seinen Schultern nicht tröstlich sind. Sie stützen ihn nicht, sondern drücken ihn nach unten. Eine weitere Welle der Übelkeit übermannt ihn, und ihm ist, als würde der Stein unter ihm weggleiten.
Alles verschwimmt ihm vor den Augen, und er kann nicht mehr klar sehen, doch er erkennt, dass die Priesterin ein Messer hält, obwohl er sich nicht erklären kann, wie die silberne Klinge in ihre Hand gelangt ist. Er will aufstehen, aber die Droge ist zu stark, hat ihm schon alle Kraft geraubt. Er hat Arme und Beine nicht mehr unter Kontrolle.
»Non!«, will er schreien, aber es ist zu spät.
Zuerst denkt er, er habe einen Schlag zwischen die Schultern bekommen, mehr nicht. Dann dringt ein dumpfer Schmerz durch seinen Körper. Etwas Warmes und Weiches rinnt ihm langsam den Rücken herunter.
Urplötzlich lassen die Hände ihn los, und er fällt nach vorn, sackt wie eine Stoffpuppe zusammen, während der Boden ihm entgegenkommt. Er spürt keinen Schmerz, als sein Kopf auf dem Stein aufschlägt, der sich auf seiner Haut irgendwie kühl und angenehm anfühlt. Jetzt klingt alles ab, die Geräusche, die Verwirrung, die Angst. Seine Augen schließen sich flatternd. Er bekommt nichts mehr mit, außer ihrer Stimme, die aus weiter Ferne zu kommen scheint.
»Une leçon. Pour tous«, scheint sie zu sagen, obwohl die Worte für ihn keinen Sinn ergeben.
In seinen letzten bruchstückhaft bewussten Augenblicken hält der Mann, den man beschuldigt hat, Geheimnisse verraten zu haben, der verurteilt wurde, weil er nicht schweigen konnte, den begehrten Gegenstand fest in der Hand, bis seine Lebenskraft schließlich versiegt und die kleine graue Scheibe, nicht größer als eine Münze, über den Boden rollt.
Auf der einen Seite stehen die Buchstaben NV. Auf der anderen ist ein eingraviertes Labyrinth.
4
Pic de SoularacSabarthès-Berge
Einen Moment lang ist alles still.
Dann zerschmilzt die Dunkelheit. Alice ist nicht mehr in der Höhle. Sie schwebt in einer weißen, schwerelosen Welt, klar und friedlich und still.
Sie ist frei. In Sicherheit.
Alice hat das Gefühl, aus der Zeit hinauszugleiten, als würde sie von einer Dimension in eine andere fallen. In diesem zeitlosen, endlosen Raum zerfließt die Grenze zwischen Vergangenheit und Gegenwart.
Dann spürt sie einen jähen Ruck, als hätte sich die Falltür unter einem Galgen geöffnet, und sie fällt, trudelt durch den offenen Himmel nach unten, tiefer und tiefer, auf die bewaldeten Berge zu. Die frische Luft pfeift ihr in den Ohren, als sie immer schneller und unaufhaltsamer gen Erde stürzt.
Der brutale Aufschlag kommt nicht. Kein Zersplittern von Knochen auf schiefergrauem Gestein und Fels. Stattdessen landet Alice im Laufschritt, sobald ihre Füße den Boden berühren, stolpert einen steilen, holprigen Waldpfad entlang, zwischen zwei hohen Baumreihen hindurch. Die Bäume sind dicht und groß und ragen hoch über ihr auf, sodass sie nicht zwischen ihnen hindurchsehen kann.
Zu schnell.
Alice greift nach Zweigen, um ihre ungestüme Flucht zu dem unbekannten Ort zu bremsen, zu stoppen, doch ihre Hände gleiten einfach durch sie hindurch, als wäre sie ein Geist. Kleine Blättchen bleiben büschelweise in ihren Händen hängen, wie Haare aus einer Bürste. Sie kann sie nicht spüren, aber der Saft färbt ihre Fingerspitzen grün. Sie hält sie sich vors Gesicht, um den feinen, säuerlichen Geruch einzuatmen, aber sie kann nichts riechen.
Sie hat jetzt Seitenstechen, aber sie kann nicht stehen bleiben, weil etwas hinter ihr ist und immer näher kommt. Der Pfad unter ihren Füßen ist abschüssig. Alice spürt das Knirschen von Steinen und Geröll, merkt, dass es nicht mehr über weiche Erde, Moos und Zweige geht. Aber es gibt kein einziges Geräusch. Kein Vogel singt, keine Stimme ruft, nichts, nur ihr eigener hechelnder Atem ist zu hören. Der Pfad schlängelt und windet sich, führt sie mal in die eine, mal in die andere Richtung, bis sie schließlich um eine Biegung kommt und die lautlose Feuerwand sieht, die ihr den Weg versperrt. Eine Säule aus zuckenden Flammen, weiß und gold und rot, die ständig die Gestalt verändert.
Instinktiv hebt Alice die Hände vors Gesicht, um sich gegen die sengende Hitze zu schützen, obwohl sie sie nicht spürt. Sie sieht Gesichter in den tanzenden Flammen gefangen, sieht in stummer Qual verzerrte Münder, während das Feuer liebkost und verbrennt.
Sie will stehen bleiben. Sie muss stehen bleiben. Ihre Füße sind blutig und zerkratzt, ihre Röcke lang und nass, und sie bremsen sie, doch der Verfolger ist ihr jetzt dicht auf den Fersen, und etwas, dem sie nicht widerstehen kann, treibt sie weiter in die tödliche Umarmung des Feuers.
Ihr bleibt keine andere Wahl, als zu springen, um nicht von den Flammen verzehrt zu werden. Sie schraubt sich in die Luft wie eine Rauchfahne, schwebt hoch über den Gelb- und Orangetönen. Der Wind scheint sie noch höher zu tragen, sie von der Erde zu befreien.
Jemand ruft ihren Namen, eine Frauenstimme, aber sie spricht ihn seltsam aus.
Alaïs.
Sie ist gerettet. Frei.
Dann spürt sie an den Fußknöcheln den vertrauten Griff kalter Finger, die sie an die Erde fesseln. Nein, keine Finger – Ketten. Jetzt bemerkt Alice, dass sie etwas in den Händen hält, ein Buch, das von Lederbändern zusammengehalten wird. Sie begreift, dass er genau das haben will. Dass sie genau das haben wollen. Dass sie wegen des verlorenen Buches so zornig sind.
Wenn sie nur sprechen könnte, dann könnte sie vielleicht verhandeln. Doch ihr Kopf ist leer, hat keine Worte mehr, und ihr Mund ist unfähig, sie zu bilden. Sie tritt um sich, will sich befreien, doch die eiserne Umklammerung an ihren Beinen ist zu stark. Sie schreit los, als sie nach unten ins Feuer gezerrt wird, doch es kommt nur Stille.
Sie schreit wieder, spürt, wie ihre Stimme tief in ihrem Innern darum kämpft, gehört zu werden. Diesmal stürzen Geräusche auf sie zu. Alice spürt die reale Welt auf sich einstürmen. Klang, Licht, Geruch, Berührung, der metallische Geschmack von Blut in ihrem Mund. Bis sie für den Bruchteil einer Sekunde innehält, plötzlich von einer klaren Kühle umhüllt. Nicht die bekannte Kälte der Höhle, sondern etwas anderes, intensiv und leuchtend. Und darin kann Alice die flüchtigen Umrisse eines Gesichts erkennen, schön, undeutlich. Dieselbe Stimme ruft noch einmal ihren Namen.
Alaïs.
Ruft zum letzten Mal. Es ist die Stimme einer Freundin. Niemand, der ihr schaden will.
Alice versucht die Augen zu öffnen, denn sie weiß, dass sie verstehen würde, wenn sie sehen könnte. Sie kann es nicht. Nicht richtig.
Der Traum verblasst, lässt sie los.
Zeit zum Aufwachen. Ich muss aufwachen.
Jetzt ist eine neue Stimme in ihrem Kopf, anders als die erste. Das Gefühl kehrt in ihre Arme und Beine zurück, die aufgeschlagenen Knie brennen, und die Abschürfungen von dem Sturz tun weh. Sie spürt die Hand an der Schulter, spürt, wie sie unsanft zurück ins Leben gerüttelt wird.
»Alice! Alice, aufwachen!«
Die Cité auf dem Berge
Kapitel 1
Carcassona
Alaïs erwachte mit einem Ruck, setzte sich hastig auf, die Augen weit geöffnet. Angst flatterte ihr in der Brust wie ein im Netz gefangener Vogel. Sie presste die Hand auf die Rippen, um ihr pochendes Herz zu beruhigen.
Einen Augenblick lang schlief sie weder, noch war sie wach, als wäre ein Teil von ihr im Traum zurückgelassen worden. Sie hatte das Gefühl zu schweben, aus großer Höhe auf sich selbst herabzublicken, so wie die steinernen Wasserspeier am Dach der Basilika Sant-Nasari, die den unten Vorbeigehenden Fratzen schnitten.
Hier war sie sicher, in ihrem Bett, im Château Comtal. Allmählich gewöhnten sich ihre Augen an die Dunkelheit. Das Zimmer wurde schemenhaft erkennbar. Sie war in Sicherheit vor den dünnen, dunkeläugigen Menschen, die sie nachts verfolgten, mit ihren spitzen Fingern, die nach ihr griffen und an ihr zerrten. Jetzt kommen sie nicht an mich heran. Die in die Steine gemeißelte Sprache, eher Bilder als Worte, die sie nicht verstand, alles verschwand wie eine Rauchfahne in der Herbstluft. Auch das Feuer war verblasst, nur noch eine Erinnerung in ihrem Kopf.
Eine Vorahnung? Oder bloß ein Albtraum?
Sie konnte es nicht wissen. Sie hatte Angst, es zu erfahren.
Alaïs griff nach den Nachtvorhängen, die das Bett umschlossen, als würde sie sich weniger durchscheinend und unkörperlich fühlen, wenn sie etwas Stoffliches berührte. Das verschlissene Gewebe, voll mit dem Staub und den vertrauten Gerüchen der Burg, fühlte sich beruhigend rau zwischen den Fingern an.
Nacht für Nacht derselbe Traum. Wenn sie als Kind vor Angst im Dunkeln aufgewacht war, das Gesicht bleich und tränennass, hatte ihr Vater an ihrem Bett gesessen und über sie gewacht, als wäre sie ein Sohn. Während Kerze um Kerze bis auf den Docht herunterbrannte, erzählte er flüsternd von seinen Abenteuern im Heiligen Land, von den endlosen Wüstenmeeren, den schön geschwungenen Moscheen und dem Gebetsruf, dem die gläubigen Sarazenen folgten. Er beschwor die aromatischen Düfte, die leuchtenden Farben und die scharf gewürzten Speisen herauf, den strahlenden Glanz der blutroten Sonne, wenn sie über Jerusalem unterging.
In all den Jahren, in jenen leeren Stunden zwischen Abend- und Morgendämmerung, während ihre Schwester schlafend neben ihr lag, hatte ihr Vater ohne Unterlass geredet, um ihre Dämonen zu verjagen. Er hatte die schwarzen Kutten der katholischen Priester mit ihren abergläubischen Bräuchen und falschen Symbolen nicht in ihre Nähe gelassen.
Seine Worte hatten sie gerettet.
»Guilhem?«, flüsterte sie.
Ihr Mann schlief tief und fest, nahm mit ausgestreckten Armen den größten Teil des Bettes in Beschlag. Sein langes, dunkles Haar, das nach Rauch, Wein und Stall roch, war auf dem Kissen ausgebreitet. Mondlicht fiel durchs offene Fenster, dessen Läden aufgeklappt waren, um die kühle Nachtluft ins Zimmer zu lassen. In dem schwachen Licht konnte Alaïs den dunklen Bartschatten auf seinem Kinn erkennen. Die Kette, die Guilhem um den Hals trug, schimmerte und glänzte, als er sich im Schlaf bewegte.
Alaïs wünschte, er würde aufwachen und ihr versichern, dass alles in Ordnung sei, dass sie keine Angst mehr haben müsse. Doch er rührte sich nicht, und ihr kam es gar nicht in den Sinn, ihn zu wecken. So furchtlos sie sonst war, in der Ehe war sie unerfahren und wusste noch nicht, wie sie ungezwungen mit ihm umgehen sollte, deshalb begnügte sie sich damit, mit den Fingern über seine glatten, gebräunten Arme zu streichen und seine Schultern zu liebkosen, breit und muskulös von den vielen Stunden, die er für das Turnier mit Schwert und Lanze übte. Alaïs spürte, wie sich das Leben unter seiner Haut bewegte, selbst im Schlaf. Und als sie daran dachte, was sie vor dem Einschlafen getan hatten, wurde sie rot, obwohl niemand da war, der sie sehen konnte.
Alaïs war überwältigt von den Gefühlen, die Guilhem in ihr weckte. Manchmal, wenn sie ihn überraschend irgendwo sah, tat ihr Herz einen Sprung, und sie bekam ganz weiche Knie, wenn er sie anlächelte. Aber was ihr nicht gefiel, war das Gefühl von Machtlosigkeit. Sie fürchtete, dass die Liebe sie schwach machte, leichtsinnig. Sie zweifelte nicht an ihrer Liebe zu Guilhem, und doch wusste sie, dass sie ein wenig von sich selbst vor ihm verbarg.
Alaïs seufzte. Sie konnte nur hoffen, dass es mit der Zeit einfacher würde.
Das Licht, das von Schwarz allmählich in Grau überging, und das gelegentliche Zwitschern eines Vogels in den Bäumen im Hof verrieten ihr, dass bald der Tag anbrach. Sie wusste, dass sie jetzt nicht mehr einschlafen würde.
Alaïs schlüpfte durch die Vorhänge nach draußen und schlich auf Zehenspitzen zur Kleidertruhe in der hinteren Ecke des Raumes. Die Fliesen unter ihren Füßen waren kalt, und die Binsenmatte kratzte an ihren Zehen. Sie öffnete die Truhe, entfernte den Lavendelbeutel von dem Kleiderhaufen und nahm ein schlichtes, dunkelgrünes Gewand heraus. Sie fröstelte ein wenig, als sie hineinschlüpfte, die Arme in die engen Ärmel schob. Sie zog den klammen Stoff über ihr Unterkleid, schloss dann den Gürtel in der Taille.
Alaïs war siebzehn und seit sechs Monaten verheiratet, aber ihr Körper hatte noch nicht die weichen Rundungen einer Frau entwickelt. Das Gewand hing unförmig an ihrer schmalen Figur herab, als müsste sie erst noch hineinwachsen. Sie hielt sich mit einer Hand am Tisch fest, schob die Füße in weiche Lederschuhe und nahm ihren roten Lieblingsmantel, der über der Stuhllehne hing. Die Säume waren kunstvoll mit blau-grünen Rechtecken und Karos bestickt, durchsetzt mit winzigen gelben Blüten, ein Muster, das Alaïs für ihre Hochzeit selbst entworfen hatte. Die Stickerei hatte sie etliche Wochen gekostet. Den ganzen November und Dezember hatte sie daran gearbeitet, die Finger schon wund und steif vor Kälte, um rechtzeitig fertig zu werden.
Alaïs schaute in ihren panièr, der neben der Kleidertruhe auf dem Boden stand. Sie vergewisserte sich, ob auch alles da war, Kräutersack und Geldbeutel, die Stoffstreifen, um Pflanzen und Wurzeln zusammenzubinden, und ihr Werkzeug zum Graben und Hacken. Schließlich verschnürte sie ihren Umhang mit einem Band fest am Hals, schob ein Messer in seine Scheide an ihrem Gürtel, zog sich die Kapuze über den Kopf, um ihr langes, ungeflochtenes Haar zu verbergen, und schlich dann leise nach draußen auf den menschenleeren Gang. Die Tür fiel schwer hinter ihr zu.
Es war noch nicht Prim, deshalb rührte sich im Wohntrakt noch keine Menschenseele. Alaïs eilte den Gang entlang zu der steilen, engen Treppe, wobei ihr Umhang leise über den Steinboden raschelte. Sie stieg über einen jungen Diener hinweg, der an die Wand gelehnt vor der Tür zu dem Zimmer eingeschlafen war, das ihre Schwester Oriane mit ihrem Gatten teilte.
Auf dem Weg nach unten drangen ihr aus der Küche im Keller Stimmen entgegen. Die Diener waren schon eifrig bei der Arbeit. Alaïs hörte einen laut klatschenden Schlag, gefolgt von dem Aufschrei eines Küchenjungen, der das Pech hatte, die kräftige Hand des Kochs schon zu spüren zu bekommen, obwohl der Tag noch nicht einmal richtig angefangen hatte.
Im Erdgeschoss kam ein anderer Küchenjunge von draußen hereingewankt. Er schleppte sich mit einem großen Halbfass Wasser ab, das er am Brunnen geholt hatte.
Alaïs lächelte. »Bonjorn.«
»Bonjorn, Dame«, antwortete er vorsichtig.
»Warte«, sagte sie, ging vor ihm hinunter in den Keller und hielt ihm die Tür zur Küche auf.
»Mercé«, sagte er etwas weniger schüchtern. »Grand mercé.«
In der Küche herrschte hektische Betriebsamkeit. Große Dampfschwaden stiegen bereits von dem riesigen Kessel auf, der an einem Haken über dem offenen Feuer hing. Ein älterer Diener nahm dem Küchenjungen das Wasser ab, schüttete es in einen Topf und reichte ihm das Fass erneut, ohne ein Wort zu sagen. Der Junge verdrehte die Augen in Alaïs’ Richtung, als er sich ein weiteres Mal auf den Weg zum Brunnen machte.
Kapaune, Linsen und Kohl in fest verschlossenen Tonkrügen warteten auf dem großen Tisch in der Mitte darauf, verarbeitet zu werden. Daneben standen Töpfe mit Salzheringen, Aal und Hecht. An einem Ende häuften sich fogaça-Pasteten in Stoffbeuteln, Gänsepasteten und dicke Scheiben gepökeltes Schweinefleisch. Am anderen standen große Schalen mit Rosinen, Quitten, Feigen und Kirschen. Ein Junge von etwa neun oder zehn Jahren hatte die Ellbogen auf den Tisch gestützt, und seine finstere Miene ließ unschwer erkennen, wie sehr er sich auf einen weiteren heißen und schweißtreibenden Tag am Bratspieß freute, wo er zusehen konnte, wie das Fleisch knusprig wurde. Neben dem Herd brannte das Kleinholz in dem kuppelförmigen Brotofen lichterloh, und der erste Schub pan de blat, Weizenbrot, lag schon zum Auskühlen auf dem Tisch. Der Duft machte Alaïs hungrig.
»Kann ich mir eins davon nehmen?«
Der Koch blickte auf, erbost, weil eine Frau in seine Küche eingedrungen war. Dann sah er, wer es war, und sein übellauniges Gesicht verzog sich zu einem schiefen Lächeln, das eine Reihe fauliger Zähne zum Vorschein brachte.
»Dame Alaïs«, sagte er erfreut und wischte sich die Hände an seiner Schürze ab. »Benvenguda. Welche Ehre! Ihr habt uns schon eine Weile nicht mehr besucht. Wir haben Euch vermisst.«
»Jacques«, sagte sie herzlich. »Ich wollte dich nicht stören.«
»Mich stören, Ihr!« Er lachte. Als Kind war Alaïs oft in der Küche gewesen, hatte zugeschaut und gelernt. Sie war das einzige Mädchen, dem Jacques je erlaubt hatte, die Schwelle zu seinem ausschließlich männlichen Reich zu überqueren. »Nun sagt, Dame Alaïs, was kann ich Euch geben?«
»Nur ein bisschen Brot, Jacques, und etwas Wein, wenn du welchen erübrigen kannst.«
Auf dem runzeligen Gesicht des Alten erschien ein bekümmerter Ausdruck. Alaïs lächelte unschuldig.
»Verzeiht, aber Ihr wollt doch nicht etwa hinunter zum Fluss? Doch nicht um diese Tageszeit und ohne Begleitung? Eine Frau Eures Standes … Es ist ja noch nicht einmal hell. Man hört so einiges, Geschichten über …«
Alaïs legte ihm eine Hand auf den Arm. »Es ist lieb, dass du dich sorgst, Jacques, und ich weiß, du willst nur mein Bestes, aber mir wird bestimmt nichts passieren. Ich gebe dir mein Wort. Es wird schon bald Tag. Ich kenne mich draußen gut aus. Ich bin wieder zurück, bevor überhaupt jemand merkt, dass ich fort war. Ehrlich.«
»Weiß Euer Vater Bescheid?«
Alaïs legte verschwörerisch einen Finger an die Lippen. »Du weißt genau, dass er nichts weiß«, entgegnete sie. »Aber bitte verrate ihm nichts, Jacques. Das soll unser Geheimnis bleiben. Ich verspreche, ich passe gut auf.«
Jacques schien zwar längst nicht überzeugt, aber da er alles gesagt hatte, was er sich erlauben konnte zu sagen, erhob er keine weiteren Einwände. Er ging langsam zu dem Tisch hinüber, wickelte einen Laib Brot in ein weißes Leinentuch und befahl einem Küchenjungen, einen Krug Wein zu holen. Alaïs beobachtete ihn und spürte einen leisen Stich im Herzen. In letzter Zeit bewegte er sich zusehends langsamer, und er humpelte stark auf dem linken Bein.
»Hast du immer noch Schmerzen?«
»Es geht«, log er.
»Ich kann dir das Bein später neu verbinden, wenn du willst. Die Wunde verheilt anscheinend nicht so gut.«
»So schlimm ist es gar nicht.«
»Hast du die Salbe benutzt, die ich für dich zubereitet habe?«, fragte sie und sah ihm am Gesicht an, dass dem nicht so war.
Jacques hob kapitulierend die dicklichen Hände. »Ich hab einfach zu viel Arbeit – die vielen zusätzlichen Gäste. Es sind Hunderte, wenn man die Diener, écuyers, Reitknechte, Hofdamen mitzählt, von den Consuln und ihren Familien gar nicht zu reden. Und an viele Sachen kommt man heutzutage nur noch schwer. Erst gestern zum Beispiel wollte ich …«
»Das glaub ich dir gern, Jacques«, sagte sie, »aber dein Bein heilt nicht von allein. Die Wunde ist zu tief.«
Auf einmal merkte Alaïs, dass der Lärmpegel gesunken war. Sie blickte sich um und sah, dass die ganze Küche mithörte. Die kleineren Jungen hatten ihre Arbeit unterbrochen und sahen staunend zu, wie ihrem aufbrausenden Herrn und Meister die Leviten gelesen wurden. Und noch dazu von einer Frau.
Alaïs tat, als hätte sie nichts bemerkt, und senkte die Stimme.
»Wie wär’s, wenn ich später wiederkomme und dir die Wunde verbinde, als Gegenleistung hierfür?« Sie tätschelte das Brot. »Das wird dann unser zweites Geheimnis, oc? Ein fairer Tausch?«
Einen Moment lang fürchtete sie, sich eine zu große Vertraulichkeit herausgenommen zu haben. Doch nach kurzem Zögern grinste Jacques.
»Ben«, sagte sie. Gut. »Wenn die Sonne hoch steht, komme ich wieder und kümmere mich darum. Dins d’abôrd.« Bald.
Als Alaïs die Küche verließ und wieder die Treppe hinaufging, hörte sie, wie Jacques alle anbrüllte, nicht länger Maulaffen feilzuhalten, sondern sich wieder an die Arbeit zu machen, ganz so, als sei nichts gewesen. Sie schmunzelte.
Alles war so, wie es sein sollte.
Alaïs zog die schwere Tür auf, die in den großen Hof führte, und trat hinaus in den neugeborenen Tag.
In der Mitte des ummauerten Hofes hoben sich die Blätter der mächtigen Ulme, unter der Vicomte Trencavel Recht sprach, schwarz gegen das Dunkelblau der schwindenden Nacht ab. Im Geäst wimmelte es von Lerchen und Zaunkönigen, die mit ihren hellen und klaren Stimmen die morgendliche Stille durchdrangen.
Raymond-Roger Trencavels Großvater hatte das Château Comtal vor über hundert Jahren erbaut, um von hier aus über seine sich immer weiter ausdehnenden Gebiete zu herrschen. Sein Territorium erstreckte sich von Albi im Norden und Narbonne im Süden bis nach Béziers im Osten und Carcassonne im Westen.
Das Château umschloss einen großen rechteckigen Hof und bezog auf der Westseite die Reste einer älteren Burg mit ein. Sie gehörte zur Verstärkung des Westteils der mächtigen Festungsmauern, die die gesamte Cité umringten und einen weiten Ausblick über den Fluss Aude und das nördliche Marschland dahinter ermöglichten.
Der donjon, wo die Consuln zusammenkamen und wichtige Dokumente unterzeichneten, erhob sich in der Südwestecke des Hofes und war gut bewacht. Im dämmrigen Licht sah Alaïs irgendetwas vor der Mauer liegen. Sie schaute genauer hin und erkannte, dass es ein schlafender Hund war, der sich zusammengerollt hatte. Ganz in der Nähe saßen einige Jungen wie Krähen auf der Umrandung eines Gänseverschlags und versuchten das Tier zu wecken, indem sie es mit Steinchen bewarfen. In der Stille hörte sie, wie die Fersen der Jungen dumpf gegen die Holzstreben schlugen.
Das Château Comtal hatte zwei Ein- und Ausgänge. Durch das breite überwölbte Westtor, das meist geschlossen war, gelangte man unmittelbar auf die grasbewachsenen Hänge, die zu den Mauern führten. Das Osttor, schmal und eng, war zwischen zwei hohen Wachtürmen eingezwängt und führte direkt in die Straßen der Ciutat, der Cité.
Man konnte sich nur über Holzleitern und eine Reihe von Klapptüren zwischen den oberen und unteren Stockwerken der Wachtürme hin und her bewegen. Eines ihrer Lieblingsspiele als Kind war es gewesen, dort mit den Jungen aus der Küche um die Wette rauf- und runterzuklettern, ohne dass die Wachen etwas merkten. Alaïs war schnell und gewann immer.
Sie zog den Mantel fester um sich und überquerte mit schnellen Schritten den Hof. Sobald die Abendglocke geläutet hatte, die Tore für die Nacht geschlossen worden waren und die Wachen Posten bezogen hatten, durfte niemand mehr ohne die Erlaubnis ihres Vaters hinaus. Bertrand Pelletier war zwar kein Consul, aber er hatte am Hof eine einzigartige und hochgeschätzte Stellung inne. Nur wenige wagten es, ihm den Gehorsam zu verweigern.
Es war ihm schon immer ein Dorn im Auge gewesen, dass sie sich gern in aller Frühe aus der Cité schlich, und zurzeit bestand er noch entschiedener darauf, dass sie nachts die sicheren Mauern des Châteaus nicht verließ. Alaïs vermutete, dass ihr Ehemann das genauso sah, obgleich Guilhem nie ein Wort gesagt hatte. Doch nur in der Stille und Anonymität der Morgendämmerung, frei von den Einschränkungen und Vorschriften des Hofes, hatte Alaïs wirklich das Gefühl, sie selbst zu sein. Niemandes Tochter, niemandes Schwester, niemandes Gattin. Sie hatte immer geglaubt, dass ihr Vater das tief in seinem Herzen verstand. Sosehr es sie auch schmerzte, ihm gegenüber ungehorsam zu sein, auf diese Augenblicke der Freiheit wollte sie nicht verzichten.
Meistens drückten die Männer der Nachtwache ein Auge zu, wenn Alaïs kam und ging. Zumindest bisher. Doch seit Kriegsgerüchte die Runde machten, waren sie vorsichtiger geworden. Nach außen hin nahm das Leben nach wie vor seinen gewohnten Gang, und auch die Berichte der Flüchtlinge, die hin und wieder in der Cité eintrafen, über Angriffe und Verfolgungen von Andersgläubigen, beinhalteten nichts Ungewöhnliches. Vor Überfällen von räuberischen Banden, die wie ein Sommergewitter aus heiterem Himmel zuschlugen, war niemand gefeit, der nicht im Schutze einer Stadt oder eines Dorfes mit Festungsmauern wohnte.
Guilhem schienen die Kriegsgerüchte nicht sonderlich zu beunruhigen, zumindest nicht, soweit Alaïs das sagen konnte. Er sprach nicht mit ihr über derlei Dinge. Ihre Schwester Oriane behauptete jedoch, eine französische Armee aus Kreuzfahrern und Kirchenmännern würde sich für den Angriff auf das Pays d’Oc rüsten. Außerdem hatte sie gesagt, der Papst und der französische König stünden hinter dem geplanten Feldzug. Alaïs wusste aus langjähriger Erfahrung, dass Oriane ihr mit solchen Geschichten oft nur Angst machen wollte. Andererseits schien ihre Schwester vieles früher als sonst jemand am Hofe zu wissen, und es war nicht zu bestreiten, dass die Zahl der Boten, die im Château ein und aus gingen, tagtäglich zunahm. Ebenso unbestreitbar war, dass die Falten im Gesicht ihres Vaters in letzter Zeit tiefer und dunkler und seine Wangen hohler geworden waren.
Die sirjans d’arms am Osttor waren noch wachsam, obwohl ihre Augen nach einer langen Nacht rot gerändert waren. Sie hatten ihre gedrungenen Silberhelme weit nach hinten geschoben, und ihre Kettenhemden sahen im fahlen Morgenlicht matt aus. Die Schilde hatten sie nachlässig über die Schulter gehängt, und ihre Schwerter steckten in der Scheide. Sie sahen eher schlafbereit als kampfbereit aus.
Als Alaïs sich ihnen näherte, war sie froh, Bérenger zu erkennen. Als er sie sah, grinste er und neigte den Kopf.
»Bonjorn, Dame Alaïs. Ihr seid heute früh auf den Beinen.«
Sie lächelte. »Ich konnte nicht mehr schlafen.«
»Fällt Eurem Ehemann nichts ein, wie er Euch nachts beschäftigen kann?«, warf der andere mit einem anzüglichen Zwinkern ein. Er hatte ein pockennarbiges Gesicht und abgekaute, blutige Fingernägel. Sein Atem roch ranzig nach Essen und Bier.
Alaïs achtete nicht auf ihn. »Wie geht es deiner Frau, Bérenger?«
»Sehr gut, Dame Alaïs. Schon fast wieder ganz die Alte.«
»Und dem Kleinen?«
»Wird von Tag zu Tag größer. Der frisst uns noch die Haare vom Kopf, wenn wir nicht aufpassen!«
»Offensichtlich ganz der Vater«, sagte sie und piekste ihn in den ausladenden Bauch.
»Das sagt meine Frau auch.«
»Bestellst du ihr bitte Grüße von mir, Bérenger?«
»Sie wird sich freuen, dass Ihr an sie denkt, Dame Alaïs.« Er zögerte kurz. »Und jetzt soll ich Euch wohl durchlassen?«
»Ich will nur in die Ciutat, vielleicht noch hinunter zum Fluss. Ich bin bald zurück.«
»Wir dürfen niemanden durchlassen«, knurrte sein Kamerad. »Befehl von Intendant Pelletier.«
»Dich hat keiner gefragt«, zischte Bérenger. »Darum geht es nicht, Dame Alaïs«, sagte er mit leiserer Stimme. »Aber Ihr wisst doch, wie die Dinge zurzeit stehen. Wenn Euch etwas zustößt und herauskommt, dass ich Euch durchgelassen habe, würde Euer Vater …«
Sie legte ihm eine Hand auf den Arm. »Ich weiß, ich weiß«, sagte sie sanft. »Aber es besteht kein Grund zur Sorge, wirklich. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Und überhaupt …« Alaïs schielte zu dem anderen Wachposten hinüber, der sich jetzt in der Nase bohrte und dann die Finger am Ärmel abwischte, »… am Fluss kann mir bestimmt nichts Schlimmeres passieren als das, was du hier alles durchmachst!«
Bérenger lachte. »Versprecht mir, dass Ihr Euch vorseht, è?«
Alaïs nickte und öffnete ihren Mantel ein Stück, um ihm das Jagdmesser an ihrem Gürtel zu zeigen. »Das werde ich. Versprochen.«
Sie musste durch zwei Tore hindurch. Bérenger entriegelte sie nacheinander, dann hob er den schweren Eichenbalken, der das äußere Tor sicherte, und zog es so weit auf, dass Alaïs hindurchschlüpfen konnte. Sie dankte ihm mit einem Lächeln, duckte sich unter seinem Arm hindurch und trat hinaus in die Welt.
Kapitel 2
Alaïs spürte, wie sich ihr das Herz weitete, als sie aus dem Schatten der Wachtürme trat. Sie war frei. Zumindest für eine Weile.
Ein beweglicher Holzsteg verband das Torhaus mit der flachen Steinbrücke, über die man vom Château Comtal in die Straßen von Carcassonne gelangte. Auf dem Gras in dem trockenen Graben unterhalb der Brücke schimmerte der Morgentau im rötlich blauen Licht. Noch immer war der Mond zu sehen, wenn auch zunehmend blasser, da es jetzt langsam Tag wurde.
Alaïs ging so schnell, dass ihr Mantel wirbelnde Muster im Staub hinterließ, und hoffte, dass die Wachen am anderen Ende der Brücke ihr keine Fragen stellten. Sie hatte Glück. Sie dösten auf ihrem Posten, ohne sie zu bemerken. Sie hastete über die freie Fläche und tauchte in das Geflecht von engen Gassen ein. Sie wollte zu einer kleinen Ausfallpforte am Tour du Moulin d’Avar, dem ältesten Teil der Stadtmauer. Die Pforte führte direkt in die Gemüsegärten und faratjals, die Weiden, die das Land um die Cité und den nördlichen Vorort Sant-Vicens beherrschten. Um diese Tageszeit war das der schnellste und unauffälligste Weg hinunter zum Fluss.
Alaïs raffte ihre Gewänder und suchte sich einen Weg durch den Unrat, den eine weitere ausschweifende Nacht in der taberna »Sant Joan dels Evangèlis« hinterlassen hatte. Überall lagen matschige Äpfel, angebissene Birnen, abgenagte Knochen und zerbrochene Bierkrüge. Ein Stück weiter die Straße hinunter kauerte ein schlafender Bettler in einem Torweg, ein Arm lag auf dem Rücken eines riesigen, zottigen alten Hundes. Drei Männer saßen an den Brunnen gelehnt, ihr Grunzen und Schnarchen übertönte sogar die Vögel.