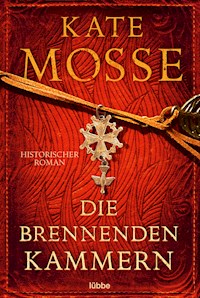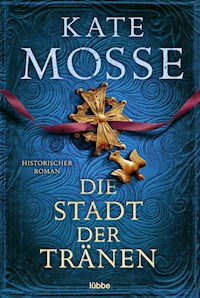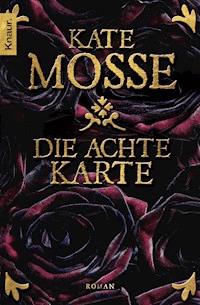
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als die junge Meredith auf der Suche nach ihren Wurzeln durch Paris streift, stößt sie auf ein seltenes und unvollständiges Set Tarotkarten aus vergangener Zeit. Sie ist sofort gefangen von den geheimnisvollen Ab-bildungen, denn eine davon trägt unverkennbar ihre eigenen Gesichtszüge. Was die junge Frau nicht weiß: Die Karten erzählen von einem schrecklichen Unglück in ihrer Familie – und es scheint, als habe Meredith die alten -Geister wieder geweckt ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 957
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Kate Mosse
Die achte Karte
Roman
Aus dem Englischen von Ulrike Wasel und Klaus Timmermann
Knaur e-books
Inhaltsübersicht
Für meine Mutter Barbara Mosse, zum Dank für das erste Klavier.
Und, wie immer, meinem geliebten Greg – für alles, was ist, war und noch sein wird.
Karte
Sépulture
∞
Si par une nuit lourde et sombre
Un bon chrétien, par charité,
Derrière quelque vieux décombre
Enterre votre corps vanté,
A l’heure où les chastes étoiles
Ferment leurs yeux appesantis,
L’araignée y fera ses toiles,
Et la vipère ses petits;
Vous entendrez toute l’année
Sur votre tête condamnée
Les cris lamentables des loups
Et des sorcières faméliques,
Les ébats des vieillards lubriques
Et les complots des noirs filous.
Charles Baudelaire, 1857
Grabstätte
∞
Wenn einst in einer dumpf und düstren Nacht ein guter Christ, aus Barmherzigkeit, hinter altem Gemäuer deinen hochgepriesenen Leib bestattet,
Zur Stunde, da die keuschen Sterne schläfrig die Augen schließen, wird dort die Spinne ihre Netze weben und die Natter ihre Jungen hecken;
Jahraus jahrein wirst du über deinem verdammten Haupte die kläglichen Schreie der Wölfe
Und hungerdürrer Hexen hören, das Schäkern geiler Greise und die Komplotte schwarzer Gauner.
Charles Baudelaire, 1857
Aus dem Französischen von Friedhelm Kemp
L’âme d’autrui est une forêt obscure où il faut marcher avec précaution.
Die Seele des anderen ist ein dunkler Wald, in dem man sich mit Vorsicht bewegen muss.
Brief, 1891
Claude Debussy
The true Tarot is symbolism; it speaks no other language and offers no other signs.
Wahres Tarot ist Symbolismus. Es spricht keine andere Sprache und birgt keine anderen Zeichen.
The Pictorial Key to the Tarot, 1910
Arthur Edward Waite
Präludium
März 1891
∞
Mittwoch, 25. März 1891
Diese Geschichte beginnt in einer Knochenstadt. In den Gassen der Toten. Auf den stillen Boulevards, Promenaden und Sackgassen des Cimetière de Montmartre in Paris, einem Ort, bevölkert von Grabmälern und steinernen Engeln und den zaudernden Geistern derjenigen, die schon vergessen wurden, noch ehe sie in ihren Gräbern erkalteten.
Diese Geschichte beginnt mit den Wächtern an den Toren, mit den Armen und Verzweifelten von Paris, die gekommen sind, um von der Trauer anderer zu profitieren. Mit den gaffenden Bettlern und scharfäugigen chiffonniers, mit den Kranzflechtern und Straßenhändlern, die billige Votivgaben feilbieten, mit den Mädchen, die Papierblumen binden, und den wartenden Kutschen mit schwarzem Verdeck und verschmierten Scheiben.
Die Geschichte beginnt mit der Inszenierung einer Beerdigung. Eine kleine Annonce im Figaro hatte Ort und Zeitpunkt bekanntgegeben, doch wenige sind gekommen. Ein zerstreutes Grüppchen, dunkle Schleier und Cutaways, blanke Stiefel und extravagante Schirme zum Schutz gegen den garstigen Märzregen.
Léonie steht mit ihrem Bruder und ihrer Mutter am offenen Grab, das aparte Gesicht hinter schwarzer Spitze verborgen. Von den Lippen des Priesters fallen Platitüden, Worte der Vergebung, die alle Herzen kaltlassen und alle Emotionen unberührt. Der hässliche Mann mit seiner ungestärkten weißen Halsbinde, den groben Schnallenschuhen und dem fettigen Teint weiß nichts von den Lügen und Täuschungsmanövern, die zu diesem Fleckchen Erde im 18. Arrondissement am nördlichen Rand von Paris geführt haben.
Léonies Augen sind trocken. Ebenso wie der Priester weiß sie nicht, was an diesem Nachmittag wirklich gespielt wird. Sie glaubt, sie nimmt an einer Beerdigung teil, dem Schlusspunkt eines zu früh geendeten Lebens. Sie ist gekommen, um der Geliebten ihres Bruders die letzte Ehre zu erweisen, einer Frau, der sie nie im Leben begegnet ist. Um ihrem Bruder in seiner Trauer zur Seite zu stehen.
Léonies Augen ruhen auf dem Sarg, der in die feuchte Erde gesenkt wird, wo Würmer und Spinnen hausen. Wenn sie Anatole jetzt unvermittelt einen raschen Seitenblick zuwerfen würde, dann würde sie den Gesichtsausdruck ihres geliebten Bruders bemerken und sich wundern. Denn nicht Schmerz schwimmt in seinen Augen, sondern eher Erleichterung.
Und da sie sich nicht umwendet, bemerkt sie auch nicht den Mann im grauen Zylinder und Gehrock, der sich zum Schutz vor dem Regen unter die Zypressen in der hintersten Ecke des Friedhofs gestellt hat. Er gibt eine beeindruckende Figur ab, die Sorte Mann, bei dessen Anblick une belle parisienne ihr Haar berühren und die Augen unter dem Schleier ein wenig heben würde. Seine breiten und starken Hände stecken in maßgeschneiderten Kalbslederhandschuhen und ruhen vollendet auf dem Silberknauf seines Gehstocks aus Mahagoni. Es sind Hände, die eine Taille umfassen, eine Geliebte näher ziehen, eine blasse Wange liebkosen könnten.
Er beobachtet die Szene mit einem Ausdruck großer Intensität im Gesicht. Seine Pupillen sind schwarze Nadelspitzen in hellen blauen Augen.
Ein dumpfer Aufprall von Erde auf dem Sargdeckel. Die letzten Worte des Priesters hallen durch die schwere Luft.
»In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.«
Er macht das Kreuzzeichen und geht davon.
Amen. So sei es.
Léonie lässt ihre Blume fallen, die sie heute Morgen im Parc Monceau frisch gepflückt hat, eine Rose zum Gedenken. Die Blüte kreiselt nach unten durch die kühle Luft, leuchtendes Weiß, das langsam aus ihren schwarz behandschuhten Fingern gleitet.
Lasst die Toten ruhen. Lasst die Toten schlafen.
Der Regen wird stärker. Jenseits der hohen schmiedeeisernen Tore des Friedhofs sind die Dächer, Kirchtürme und Kuppeln von Paris in silbrigen Nebel gehüllt. Er dämpft das Geräusch der klappernden Kutschen auf dem Boulevard de Clichy und das ferne Kreischen der Züge, die aus dem Gare Saint-Lazare rollen.
Die Trauergesellschaft wendet sich vom Grab ab. Léonie berührt den Arm ihres Bruders. Er tätschelt ihre Hand, senkt den Kopf. Während sie den Friedhof verlassen, hofft Léonie mehr als alles andere, dass es nun endgültig vorbei ist. Dass sie nach den letzten schlimmen Monaten voller Drangsal und Unglück nun einen Schlussstrich ziehen können.
Dass sie aus dem Schatten treten und wieder anfangen können zu leben.
Doch da, viele hundert Meilen südlich von Paris, regt sich etwas.
Eine Reaktion, eine Verbindung, eine Konsequenz. In den alten Buchenwäldern oberhalb des beliebten Kurorts Rennes-les-Bains hebt ein Windhauch die Blätter. Musik, gehört und doch nicht gehört.
Enfin.
Das Wort ist ein Hauch im Wind. Endlich.
Ausgelöst durch die Tat eines arglosen Mädchens auf einem Friedhof in Paris, bewegt sich etwas in der steinernen Grabstätte. Etwas erwacht, das auf den verschlungenen und überwucherten Wegen der Domaine de la Cade längst vergessen war. Ein zufälliger Beobachter würde es wohl nur für eine Sinnestäuschung im schwindenden Nachmittagslicht halten, doch für einen flüchtigen Moment scheinen die Gipsstatuen zu atmen, zu schwanken, zu seufzen.
Und die Porträts auf den Karten, die unter Erde und Stein begraben liegen, wo der Fluss versiegt, scheinen für einen Moment zu leben. Schemenhafte Gestalten, Eindrücke, Ahnungen, mehr noch nicht. Eine Andeutung, eine Illusion, ein Versprechen. Die Brechung des Lichts, die Bewegung der Luft unter der Biegung der Steintreppe. Die unentrinnbare Verbundenheit von Ort und Augenblick.
Denn in Wahrheit beginnt diese Geschichte nicht mit den Knochen auf einem Pariser Friedhof, sondern mit einem Kartenspiel.
Dem Bilderbuch des Teufels.
Erster Teil
Paris
September 1891
Kapitel 1
∞
Paris, Mittwoch, 16. September 1891
Léonie Vernier stand auf den Stufen zum Palais Garnier, hielt ihr Ridikül umklammert und wippte ungeduldig mit dem Fuß.
Wo bleibt er denn?
Die Dämmerung kleidete den Place de l’Opéra in ein seidiges blaues Licht.
Léonie runzelte die Stirn. Es war zum Verrücktwerden. Seit fast einer Stunde wartete sie nun schon auf ihren Bruder am vereinbarten Treffpunkt, unter dem gleichmütigen Blick der Statuen, die das Dach des Opernhauses zierten. Sie hatte zudringliche Blicke erduldet. Sie hatte das Kommen und Gehen der fiacres beobachtet, Privatkutschen mit geschlossenem Verdeck, öffentliche Droschken ohne Schutz vor den Elementen, vierrädrige Gespanne, Gigs, und alle hatten sie ihre Passagiere abgesetzt. Ein Meer von schwarzen Seidenzylindern und erlesenen Abendkleidern aus den Schauräumen von Maison Léoty und Charles Worth. Es war ein elegantes Premierenpublikum, eine Menge Kulturbeflissener, die sehen und gesehen werden wollten.
Aber kein Anatole.
Einmal meinte Léonie, ihn zu erblicken. Ein Mann mit der Haltung und Statur ihres Bruders, groß und breitschultrig, und mit dem gleichen bedächtigen Gang. Aus der Ferne bildete sie sich sogar ein, seine glänzenden braunen Augen und den dünnen schwarzen Schnurrbart zu sehen, und sie hob die Hand, um zu winken. Doch dann drehte sich der Mann vollständig um, und sie erkannte, dass er es nicht war.
Léonie richtete den Blick wieder auf die Avenue de l’Opéra. Sie verlief quer bis hinunter zum Palais du Louvre, ein Überbleibsel zerbröckelnder Monarchie, als ein ängstlicher französischer König einen sicheren und direkten Zugang zu seiner abendlichen Unterhaltung verlangte. Die Laternen strahlten in der Dämmerung, und durch die erleuchteten Fenster der Cafés und Bars wurden Rechtecke warmen Lichtes geworfen. Die Gaslampen spuckten und zischten.
Um sie herum war die Luft erfüllt von den Geräuschen einer Stadt in der Dämmerung, wenn der Tag der Nacht weicht. Entre chien et loup. Das Klirren von Geschirren und Rädern auf den belebten Straßen. Der Gesang ferner Vögel in den Bäumen des Boulevard des Capucines. Das heisere Schreien von Straßenhändlern und Pferdeknechten, die sanfteren Töne der Mädchen, die auf den Stufen zur Oper künstliche Blumen verkauften, die hellen Rufe der Jungen, die einem Herrn für einen Sou die Schuhe wichsten und wienerten.
Ein weiterer Omnibus rollte zwischen Léonie und der prächtigen Fassade des Palais Garnier auf seinem Weg zum Boulevard Haussmann vorbei, und der Schaffner pfiff auf dem Oberdeck vor sich hin, während er die Fahrkarten lochte. Ein alter Veteran mit einem Tonquin-Orden an der Brust torkelte nach rechts und links und sang ein trunkenes Soldatenlied. Léonie sah sogar einen Clown mit weißgeschminktem Gesicht unter dem schwarzen Dominofilzhut, das Kostüm mit Goldpailletten besetzt.
Wie kann er mich nur so warten lassen?
Die Glocken begannen für die Abendandacht zu läuten, und die getragenen Töne hallten über das Pflaster. Von Saint-Gervais oder einer anderen Kirche in der Nähe?
Sie zuckte halbherzig die Achseln. Ihre Augen blitzten vor Zorn und dann vor Belustigung.
Léonie konnte nicht länger warten. Wenn sie Monsieur Wagners Lohengrin hören wollte, dann musste sie ihr Herz in beide Hände nehmen und allein hineingehen.
Konnte sie das?
Sie hatte zwar keinen Begleiter, aber zum Glück eine eigene Eintrittskarte.
Aber traute sie sich das?
Sie überlegte. Es war die Pariser Premiere. Wieso sollte sie dieses Erlebnis versäumen, nur weil Anatole unpünktlich war?
Im Innern des Opernhauses glitzerten die prächtigen Kristallleuchter. Alles war Licht und Eleganz, eine Gelegenheit, die man nicht verpassen durfte.
Léonie traf ihre Entscheidung. Sie lief die Stufen hinauf, durch die Glastür und hinein in die Menge.
Das Klingelzeichen ertönte. Nur noch zwei Minuten, bis sich der Vorhang hob.
Mit fliegenden Röcken und blitzenden Seidenstrümpfen eilte Léonie über den Marmor im Grand Foyer, wobei sie gleichermaßen Beifall und Bewunderung erntete. Mit ihren siebzehn Jahren stand Léonie kurz davor, sich in eine große Schönheit zu verwandeln, nicht länger Kind, aber noch immer mit Anklängen an das Mädchen, das sie einmal gewesen war. Sie hatte das Glück, die derzeit beliebten Gesichtszüge und die nostalgischen Farben zu besitzen, die von Monsieur Moreau und seinen befreundeten Präraffaeliten so geschätzt wurden.
Aber ihr Aussehen täuschte. Léonie war eher willensstark als gefügig, eher kühn als bescheiden, eine junge Frau mit dem Feuer ihrer Zeit, keine sittsame mittelalterliche Maid. Ja, Anatole neckte sie sogar damit, dass sie zwar wie das Porträt von Rossettis La Damoiselle Élue aussehe, aber in Wahrheit deren Gegenbild war. Ihre Doppelgängerin, aber nicht sie. Von den vier Elementen war Léonie Feuer, nicht Wasser, Erde nicht Luft.
Jetzt waren ihre Alabasterwangen gerötet. Dicke kupferfarbene Haarlocken hatten sich aus den Kämmen gelöst und fielen über die nackten Schultern. Ihre betörenden grünen Augen, umrahmt von langen braunen Wimpern, blitzten vor Zorn und Verwegenheit.
Er hat mir versprochen, nicht zu spät zu kommen.
Während Léonie über den Marmorboden eilte, hielt sie mit der einen Hand ihre Abendtasche, wie einen Schild, die Röcke ihres grünen Seidensatinkleides mit der anderen, ohne die missbilligenden Blicke von älteren Damen und Witwen zu beachten. Die unechten Perlen und Silberpailletten am Saum ihres Kleides klickerten gegen die Marmorstufen der Treppe, als sie zwischen rosafarbenen Marmorsäulen, vergoldeten Statuen und Wandfriesen hindurch auf die geschwungene Grand Escalier zulief. Eingezwängt in ihr Korsett, atmete sie keuchend, und ihr Herz pochte wie ein zu schnell eingestelltes Metronom.
Dennoch verlangsamte Léonie ihren Schritt nicht. Weiter vorne sah sie, dass die Lakaien Anstalten machten, die Türen zum Grande Salle zu schließen. Mit einer letzten Kraftanstrengung erreichte sie den Eingang.
»Voilà«, sagte sie und hielt dem Saaldiener ihre Eintrittskarte hin. »Mon frère va arriver …«
Er trat beiseite und ließ sie hinein.
Nach den geräuschvollen und schallenden Marmorhallen des Grand Foyer war der Saal ungewöhnlich still. Leises Gemurmel, Begrüßungen, Erkundigungen nach Gesundheit und Familie, alles halb verschluckt von den dicken Teppichen und den Reihen roter Samtsessel.
Die üblichen Notenläufe der Holz- und Blechbläser, Tonleitern und Arpeggien und Auszüge aus der Oper, immer lauter, drangen aus dem Orchestergraben wie herbstliche Rauchfahnen.
Ich hab’s geschafft.
Léonie nahm Haltung an und strich ihr Kleid glatt. Es war eine Neuanschaffung, erst heute Nachmittag von La Samaritaine geliefert und noch ganz steif. Sie zog die langen grünen Handschuhe bis über die Ellbogen, so dass nur ein dünner Streifen nackter Haut sichtbar war, und ging dann durchs Parkett Richtung Bühne.
Ihre Plätze waren in der ersten Reihe, zwei der besten im ganzen Haus, was sie Anatoles Freund und ihrem Nachbarn zu verdanken hatten, dem Komponisten Achille Debussy. Auf dem Weg nach vorne passierte sie links und rechts Reihen von schwarzen Zylindern, gefiederten Damenhüten und wedelnden schmuckbesetzten Fächern. Rot und lila verfärbte cholerische Gesichter, dick gepuderte Witwen mit akkuratem Weißhaar. Sie erwiderte jeden einzelnen Blick mit einem herzlichen Lächeln und einer leichten Neigung des Kopfes.
Es liegt eine seltsame Anspannung in der Luft.
Léonies Blick wurde wachsamer. Je weiter sie in den Grande Salle hineinging, desto deutlicher wurde, dass irgendetwas nicht stimmte. Misstrauen spiegelte sich auf den Gesichtern, etwas brodelte dicht unter der Oberfläche, Unruhe lag in der Luft.
Sie spürte ein Prickeln im Nacken. Das Publikum war auf der Hut. Sie sah es in den verstohlenen Blicken und argwöhnischen Mienen.
Mach dich nicht lächerlich.
Léonie erinnerte sich schwach an einen Zeitungsartikel, den Anatole beim Abendessen vorgelesen hatte, über Proteste gegen die Aufführung von Werken eines preußischen Künstlers in Paris. Aber das hier war das Palais Garnier, keine düstere Gasse in Clichy oder Montmartre.
Was soll denn in der Oper schon passieren?
Léonie schob sich durch den Wald aus Knien und Abendkleidern in ihrer Reihe und setzte sich mit einem Gefühl der Erleichterung auf ihren Platz. Sie brauchte einen Moment, um sich zu sammeln, und schielte dann zu ihren Nachbarn hinüber. Links von ihr saß eine mit Schmuck behängte Dame neben ihrem deutlich älteren Mann, dessen wässrige Augen von buschigen weißen Brauen fast verdeckt wurden. Fleckige Hände lagen, eine über der anderen, auf dem Knauf eines Gehstocks mit Silberspitze und einem Band mit Inschrift um den Hals. Rechts von ihr bildete Anatoles leerer Platz wie ein Graben eine Barriere zu vier finsteren bärtigen Männern in mittlerem Alter, die missmutig dreinblickten, allesamt die Hände auf langweilige Gehstöcke aus Buchsbaum gestützt. Die Art, wie sie stumm dasaßen und mit einem Ausdruck großer Konzentration geradeaus blickten, hatte etwas Beunruhigendes.
Es schoss Léonie durch den Kopf, wie seltsam es doch war, dass sie alle Lederhandschuhe trugen, und dass ihnen unangenehm heiß sein musste. Dann wandte einer den Kopf und starrte sie an. Léonie errötete, richtete den Blick nach vorn und bewunderte lieber den herrlichen Trompe-l’œil-Vorhang, der in karmesinroten und goldenen Falten vom Proszeniumsbogen bis hinunter zum Holzboden der Bühne fiel.
Vielleicht hat er sich nicht verspätet. Und wenn ihm etwas zugestoßen ist?
Léonie schüttelte den Kopf über diesen neuen und unliebsamen Gedanken.
Sie zog ihren Fächer aus der Tasche und klappte ihn mit leichtem Schwung auf. So gern sie auch Entschuldigungen für ihren Bruder finden wollte, es lag wahrscheinlich eher an seiner mangelnden Zeiteinteilung.
Wie so oft in letzter Zeit.
Tatsächlich war Anatole seit der tristen Beerdigung auf dem Cimetière de Montmartre sogar noch unzuverlässiger geworden. Léonie runzelte die Stirn, als sich die Erinnerung wieder einmal in ihre Gedanken drängte. Der Tag verfolgte sie. Sie durchlebte ihn wieder und wieder.
Im März hatte sie gehofft, dass nun alles vorbei und vorüber wäre, aber sein Verhalten war nach wie vor unberechenbar. Oft verschwand er tagelang, kehrte mitten in der Nacht zurück, mied viele seiner Freunde und Bekannten und vergrub sich stattdessen in Arbeit.
Aber heute Abend hatte er versprochen, pünktlich zu sein.
Der chef d’orchestre trat ans Pult und vertrieb Léonies Gedanken. Applaus brandete durch den erwartungsvollen Saal wie eine Gewehrsalve, heftig und jäh und intensiv. Léonie klatschte mit Verve und Begeisterung, aufgrund ihrer Angespanntheit sogar noch stärker. Das Herrenquartett neben ihr rührte sich nicht, die Hände weiter reglos auf den billigen, hässlichen Gehstöcken. Sie warf ihnen einen Blick zu, fand sie unhöflich und ungehobelt und fragte sich, warum sie sich überhaupt herbemüht hatten, wo sie doch anscheinend entschlossen waren, sich nicht an der Musik zu erfreuen. Und sie wünschte, obwohl es sie ärgerte, sich eine solche Verunsicherung eingestehen zu müssen, sie würde nicht direkt neben ihnen sitzen.
Der chef d’orchestre verneigte sich tief und wandte sich dann der Bühne zu.
Der Applaus verklang. Stille senkte sich über den Grande Salle. Der Dirigent klopfte mit dem Taktstock auf das Holzpult. Die blauen Gasflämmchen in den Saallampen zischten und flackerten, erloschen dann. Die Atmosphäre lud sich verheißungsvoll auf. Aller Augen ruhten auf dem Dirigenten. Die Männer im Orchester setzten sich aufrechter und hoben ihre Bögen oder führten Instrumente an die Lippen.
Der Dirigent hob seinen Stock. Léonie hielt den Atem an, als die Eröffnungsakkorde von Monsieur Wagners Lohengrin die palastartigen Räume des Palais Garnier erfüllten.
Der Platz neben ihr blieb leer.
Kapitel 2
∞
Fast augenblicklich setzten Pfiffe und Zwischenrufe auf den oberen Rängen ein. Zuerst überhörte die Mehrheit des Publikums die Störung geflissentlich. Doch dann wurde sie aufdringlicher, denn auch auf dem unteren Rang und im Parkett wurden Stimmen laut.
Léonie konnte nicht genau verstehen, was die Protestler riefen.
Sie hielt den Blick entschlossen auf den Orchestergraben gerichtet, bemüht, jedes neuerliche Zischen oder Tuscheln zu ignorieren. Aber je länger die Ouvertüre dauerte, desto mehr breitete sich die Unruhe von oben nach unten aus, entlang der Sitzreihen, verstohlen und bösartig. Unfähig, noch länger den Mund zu halten, lehnte sich Léonie zu ihrer Nachbarin hinüber.
»Wer sind die Leute?«, flüsterte sie.
Die Dame war über die Unterbrechung ungehalten, antwortete aber dennoch.
»Sie nennen sich die abonnés«, erwiderte sie hinter ihrem Fächer. »Sie sind gegen die Aufführung von Werken nichtfranzösischer Komponisten. Sehen sich als musikalische Patrioten. Im Prinzip bringe ich ihnen eine gewisse Sympathie entgegen, aber das hier ist ungehörig.«
Léonie nickte dankend und setzte sich wieder gerade hin. Die sachliche Art der Frau beruhigte sie etwas, obwohl die Störmanöver an Heftigkeit deutlich zunahmen.
Die Schlusstakte der Ouvertüre hingen noch in der Luft, da ging der Protest erst richtig los. Als der Vorhang sich hob und ein Chor in Sicht kam, der deutsche Ritter des zehnten Jahrhunderts am Ufer eines alten Flusses in Antwerpen darstellte, brach im ersten Rang lautstarker Tumult aus. Eine Gruppe von mindestens acht oder neun Männern sprang auf und begann zu pfeifen, zu buhen und langsam zu klatschen. Eine Welle der Missbilligung lief durch die Reihen im Parkett und in den oberen Rängen und wurde von weiteren Protestausbrüchen beantwortet. Dann verfielen die Aufrührer in einen Sprechchor, doch Léonie verstand zunächst nicht, was sie riefen. Ein lärmendes Crescendo, und auf einmal unmissverständlich:
»Boche! Boche!«
Der Protest hatte die Ohren der Sänger erreicht. Léonie sah Blicke zwischen Chor und Hauptdarstellern hin und her huschen, Sorge und Ratlosigkeit überdeutlich in jedem Gesicht.
»Boche! Boche! Boche!«
Léonie wollte zwar nicht, dass die Vorstellung unterbrochen wurde, gestand sich aber gleichzeitig ein, wie aufregend das alles für sie war. Von solchen Ereignissen, wie sie es jetzt hautnah erlebte, erfuhr sie sonst nur aus Anatoles Figaro.
Da habe ich Anatole richtig was zu erzählen.
Aber der Charakter des Protestes veränderte sich.
Das Ensemble, blass und ängstlich unter der dicken Theaterschminke, sang unbeirrt weiter, so lange, bis das erste Wurfgeschoss auf die Bühne flog. Eine Flasche, die nur knapp den Basssänger in der Rolle des König Heinrich verfehlte.
Einen Moment lang schien es, als habe das Orchester aufgehört zu spielen, so tief und unheilschwanger war die Stille. Das Publikum hielt gleichsam kollektiv die Luft an, während die Flasche wie von Geisterhand verlangsamt kreiselte, das grellweiße Rampenlicht einfing und zu flirrenden grünen Strahlen brach. Dann schlug sie mit einem dumpfen Laut gegen die Kulissenleinwand, fiel herab und rollte zurück in den Graben.
Der reale Welt war blitzartig wieder da. Chaos brach aus, auf der Bühne und davor. Der Lärm wurde infernalisch. Dann flog ein zweites Wurfgeschoss über die Köpfe des fassungslosen Publikums hinweg und zerbarst auf der Bühne. Eine Frau in der ersten Reihe schrie auf und hielt sich Mund und Nase zu, als ein widerwärtiger Gestank nach Blut und verfaultem Gemüse und Gosse bis ins Parkett drang.
»Boche! Boche! Boche!«
Das Lächeln auf Léonies Gesicht erstarb, wich einem Ausdruck von Besorgnis. Sie hatte Schmetterlinge im Bauch. Das hier war kein Abenteuer mehr, sondern bedrohlich und furchterregend. Ihr wurde schlecht.
Plötzlich sprang das Quartett zu ihrer Rechten in einem Satz auf und begann, vollkommen gleichzeitig und zunächst ganz langsam zu klatschen, wobei sie Tierlaute von sich gaben, Schweine und Kühe und Ziegen nachahmten. Ihre Gesichter waren brutal und bösartig, als sie ihr antipreußisches Leitmotiv skandierten, das nun in jeder Ecke des Saales aufgegriffen wurde.
»In Gottes Namen, Mann, setzen Sie sich hin!«
Ein vollbärtiger und bebrillter Herr mit dem blässlichen Teint eines Menschen, der seine Zeit mit Tintenfass, Wachs und Dokumenten verbrachte, klopfte einem der Protestler mit seinem Programmheft auf den Rücken.
»Das ist hier weder der rechte Zeitpunkt noch der rechte Ort. Nehmen Sie Platz!«
»Ja wirklich«, pflichtete sein Begleiter bei. »Setzen Sie sich.«
Der Protestler wandte sich um und schlug dem Mann fest mit seinem Stock auf die Finger. Léonie schnappte nach Luft. Der Geschlagene, überrumpelt von der Schnelligkeit und Brutalität des Angriffs, heulte auf und ließ das Programmheft fallen. Als Blut aus der Wunde sickerte, sprang sein Begleiter vor. Er hatte gesehen, dass im Knauf des Stocks ein Metallstift steckte, und wollte dem Protestler die Waffe entreißen, doch grobe Hände stießen ihn zurück, und er stürzte.
Der Dirigent versuchte, das Orchester im Takt zu halten, aber die Musiker warfen verstörte Blicke um sich, und das Tempo wurde abgehackt und ungleichmäßig, sowohl zu schnell als auch zu langsam. Hinter der Bühne war eine Entscheidung getroffen worden. Schwarzgekleidete Bühnenarbeiter, die Ärmel bis zu den Ellbogen hochgekrempelt, kamen plötzlich aus den Seitenkulissen geschwärmt und drängten die Sänger aus der unmittelbaren Schusslinie.
Die Opernleitung gab Anweisung, den Vorhang fallen zu lassen. Die Gewichte schepperten und dröhnten gefährlich, als sie zu schnell nach oben schossen. Der schwere Stoff sackte abwärts, verfing sich dann an einem Kulissenteil und blieb hängen.
Das Gebrüll wurde heftiger.
Der Exodus begann zuerst in den Privatlogen. Die Bourgeoisie zog sich hastig in einem Wirbel von Federn und Gold und Seide zurück. Bei ihrem Anblick breitete sich der Wunsch nach Rückzug in die oberen Ränge aus, wo sich viele der nationalistischen Protestler befanden, dann in die unteren Ränge und ins Parkett. Auch die Reihen hinter Léonie leerten sich eine nach der anderen in die Gänge. Von überall im Grande Salle hörte sie, wie Sitze hochklappten. An den Ausgängen ertönte das Rasseln von Messingringen auf ihren Stangen, als die schweren Samtvorhänge jäh aufgerissen wurden.
Aber die Protestler hatten ihr Ziel, die Aufführung zu stoppen, noch immer nicht ganz erreicht. Weitere Wurfgeschosse landeten auf der Bühne. Flaschen, Steine und Ziegel, faules Obst. Das Orchester verließ den Graben, floh mit den kostbaren Noten, Bögen und Instrumentenkästen, drängte sich zwischen den hinderlichen Stühlen und Pulten hindurch, um unter der Bühne zu verschwinden.
Endlich erschien der Opernleiter durch einen Spalt im Vorhang auf der Bühne und bat um Ruhe. Er schwitzte und betupfte sich das Gesicht mit einem grauen Taschentuch.
»Mesdames, messieurs, s’il vous plaît. S’il vou plaît!«
Er war ein massiger Mann, doch weder seine Stimme noch sein Auftreten zeugten von Autorität. Léonie sah, wie hilflos seine Augen blickten, während er mit den Armen wedelte und versuchte, dem wachsenden Chaos irgendeine Art von Ordnung aufzuzwingen.
Es war zu wenig, zu spät.
Wieder flog ein Geschoss durch die Luft, aber diesmal war es keine Flasche oder irgendein käuflich erworbener Gegenstand, sondern ein Stück Holz, in dem Nägel steckten. Es traf den Opernleiter über dem Auge. Er taumelte zurück, presste die Hand aufs Gesicht. Blut quoll zwischen seinen Fingern hervor, und er kippte zur Seite, sackte wie eine Stoffpuppe auf den Bühnenboden.
Das brachte das Fass zum Überlaufen, und Léonie verlor endlich den Mut.
Ich muss hier raus.
Entsetzt, schon fast panisch, sah sie sich verzweifelt im Saal um, aber sie saß in der Falle, eingezwängt zwischen dem Mob hinter und neben ihr und der Gewalt vor ihr. Léonie umklammerte die Rückenlehne des Sitzes, weil sie meinte, entkommen zu können, wenn sie über die Reihen hinwegkletterte, doch als sie ein Bein hinüberschwingen wollte, merkte sie, dass sich der perlenbesetzte Saum ihres Kleides an den Metallbolzen unter ihrem Sitz verfangen hatte. Sie bückte sich und versuchte mit immer hektischeren Fingern, zu ziehen, sich loszureißen.
Jetzt gellte ein neuer Protestschrei durch den Saal.
»A bas! A bas!«
Sie sah hoch.
Was denn jetzt?Der Schrei wurde von allen Seiten aufgegriffen.
»A bas. A l’attaque!«
Wie Kreuzritter bei der Belagerung einer Burg stürmten die Aufrührer Stöcke und Knüppel schwenkend nach vorne. Hier und da blitzte eine Klinge auf. Ein Schauder des Entsetzens durchlief Léonie. Sie begriff, dass der Mob die Bühne stürmen wollte und sie ihm genau im Weg war.
Das bisschen, was von der Maske der Pariser Gesellschaft noch übrig geblieben war, bekam überall im Saal Risse, splitterte und zersprang. Hysterie erfasste alle, die noch festsaßen. Anwälte und Journalisten, Maler und Gelehrte, Bankiers und Beamte, Kurtisanen und Ehefrauen, alle stürzten jetzt verzweifelt zu den Türen, um der Gewalt zu entkommen.
Sauve qui peut. Rette sich wer kann.
Die Nationalisten erreichten die Bühne. Mit militärischer Präzision rückten sie aus jedem Bereich des Saales vor, schwangen sich über Sitze und Geländer, schwärmten durch den Orchestergraben und hinauf auf die Bühne. Léonie zerrte fester und fester an ihrem Kleid, bis der Stoff riss und sie befreit war.
»Boche! Alsace française! Lorraine française!«
Die Protestler waren jetzt dabei, die Kulissen einzureißen. Gemalte Bäume, Wasser, Felsen und Steine, die imaginären Soldaten des zehnten Jahrhunderts zerstört von einem sehr realen Mob des neunzehnten Jahrhunderts. Die Bühne war übersät mit zersplittertem Holz, Leinwandfetzen und Staub, als Lohengrins Welt in der Schlacht unterging.
Schließlich formierte sich Widerstand. Eine Schar junger Männer und Veteranen vergangener Feldzüge fand sich irgendwie im Parkett zusammen und verfolgte die Nationalisten auf die Bühne. Die Durchgangstür, die den Saal vom rückwärtigen Teil des Hauses trennte, wurde aufgebrochen. Sie stürmten in die Seitenkulissen und verbündeten sich dort mit den Bühnenarbeitern, die zwischen den Kulissen und dem Bühnenbilddepot zum Angriff auf die antipreußischen Nationalisten übergingen.
Léonie beobachtete das Ganze entsetzt, war aber auch gebannt von dem Schauspiel. Ein gutaussehender Mann, fast noch ein Junge, im geliehenen, zu weiten Abendanzug und mit einem langen gewichsten Schnurrbart, stürzte sich auf den Rädelsführer der Protestler. Er schlang seine Arme um die Kehle des Mannes und wollte ihn von den Beinen reißen, landete aber selbst auf dem Boden. Er schrie auf, als ein Stiefel mit Stahlkappe seinen Magen traf.
»Vive la France! A bas!«
Blutdurst griff um sich. Léonie sah Erregung, Raserei in den weit aufgerissenen Augen der Aufrührer, als die Gewalt eskalierte. Wangen waren gerötet, fiebrig.
»S’il vous plaît«, rief sie verzweifelt, blieb aber ungehört, und sie sah noch immer keinen rettenden Ausweg für sich.
Léonie wich zurück, als ein Bühnenarbeiter von der Bühne geworfen wurde. Sein Körper machte einen Salto über den leeren Orchestergraben und blieb an dem Messinggeländer hängen. Sein Arm und seine Schulter baumelten lose, verdreht und verkrüppelt. Seine Augen blieben offen.
Du musst weiter nach hinten. Los, schnell.
Aber jetzt schien die Welt in Blut zu ertrinken, in gesplitterten Knochen und klaffenden Wunden. Sie konnte nichts anderes mehr sehen als den fanatischen Hass in den Gesichtern der Männer um sie herum. Keine anderthalb Meter von der Stelle entfernt, wo sie wie erstarrt stand, kroch ein Mann auf Händen und Knien, seine Weste und Anzugjacke hingen offen. Er hinterließ eine Spur von blutigen Handabdrücken auf den Holzbrettern der Bühne.
Hinter ihm wurde eine Waffe gehoben.
Nein!
Léonie wollte ihm eine Warnung zurufen, doch der Schock raubte ihr die Stimme. Die Waffe stieß herab. Fand ihr Ziel. Der Mann rutschte weg, fiel schwer auf die Seite. Er schaute zu seinem Angreifer hoch, sah das Messer und riss die Hände hoch, zum Schutz vor der niederfahrenden Klinge. Metall traf auf Fleisch. Er schrie auf, als das Messer herausgezogen wurde und erneut zustieß, tief in seine Brust.
Der Körper des Mannes zuckte und wand sich wie eine der Puppen in dem Pavillon auf den Champs-Élysées, seine Arme und Beine schlugen, dann rührte er sich nicht mehr.
Léonie merkte erstaunt, dass sie weinte. Dann packte die Angst sie wilder denn je.
»S’il vous plaît«, rief sie, »lassen Sie mich durch.«
Sie versuchte, sich mit den Schultern durchzuzwängen, aber sie war zu klein, zu leicht. Eine Menschenmasse trennte sie vom Ausgang, und der Mittelgang war jetzt mit dunkelroten Kissen übersät. Unterhalb der Bühne war ein Funkenschauer von den Gaslampen auf die Notenblätter niedergegangen, die verlassen auf dem Boden lagen. Ein orangenes Fauchen, ein gelbes Zischen und dann ein jähes Aufflackern, als die hölzerne Unterseite der Bühne zu brennen begann.
»Au feu! Au feu!«
Schlagartig fegte ein anderes Panikgefühl durch den Saal. Die Erinnerung an das Inferno, das vor fünf Jahren die Opéra-Comique verwüstet und über achtzig Tote gefordert hatte, griff um sich.
»Lasst mich durch!«, schrie Léonie. »Ich flehe euch an.«
Niemand achtete auf sie. Auf dem Boden unter ihren Füßen lag jetzt ein Teppich aus vergessenen Programmheften und gefiederten Damenhüten, Lorgnetten und Operngläser zersplitterten unter Schuhsohlen wie vertrocknete Knochen in einem alten Grabmal.
Léonie konnte nichts sehen außer Ellbogen und unbedeckte Hinterköpfe, aber sie bewegte sich vorwärts, quälend langsam, Zentimeter um Zentimeter, so dass sie allmählich ein wenig Distanz zwischen sich und die schlimmsten Kämpfe brachte.
Dann stolperte neben ihr eine ältere Dame und fiel.
Sie werden sie tottrampeln.
Léonie streckte rasch die Hand aus und bekam den Ellbogen der Frau zu fassen. Unter dem gestärkten Stoff fühlte sie einen spindeldürren Arm.
»Ich wollte doch nur die Musik hören«, weinte die Frau. »Deutsch, französisch, mir ist das gleichgültig. Dass wir so etwas noch erleben müssen. Dass es wieder so weit kommt.«
Léonie stolperte vorwärts, trug das volle Gewicht der betagten Dame, während sie Richtung Ausgang taumelte. Die Last schien mit jedem Schritt schwerer zu werden. Die Frau verlor allmählich das Bewusstsein.
»Wir haben’s gleich geschafft«, rief Léonie. »Bitte, halten Sie durch, bitte«, damit die alte Frau bloß nicht zusammenbrach. »Wir sind fast an der Tür. Fast in Sicherheit.«
Endlich entdeckte sie die vertraute Livree eines Operndieners.
»Mais aidez-moi, bon Dieu«, rief sie. »Par ici. Vite!«
Der Saaldiener gehorchte sofort. Wortlos erleichterte er Léonie von ihrer Bürde, hob die alte Dame mit Schwung hoch und trug sie ins Grand Foyer.
Léonie knickten die Knie vor Erschöpfung ein, aber sie zwang sich weiter. Nur noch ein paar Schritte.
Plötzlich packte jemand sie am Handgelenk.
»Nein!«, schrie sie. »Nein!«
Sie würde sich nicht hier festhalten lassen, mit dem Feuer und dem Mob und den Barrikaden. Léonie schlug blind um sich, traf aber nur Luft.
»Fassen Sie mich nicht an!«, kreischte sie. »Loslassen!«
Kapitel 3
∞
Léonie, c’est moi. Léonie!«
Eine Männerstimme, vertraut und beruhigend. Und ein Duft nach Sandelholzpomade und türkischem Tabak.
Anatole? Hier?
Und jetzt umfassten starke Hände ihre Taille und hoben sie hoch über das Gedränge.
Léonie öffnete die Augen. »Anatole!«, schrie sie und schlang die Arme um seinen Hals. »Wo warst du denn? Wie konntest du?« Ihre Umarmung wurde zum Angriff, als sie mit wütenden Fäusten auf seine Brust eintrommelte. »Ich habe gewartet und gewartet, aber du bist nicht gekommen. Wie konntest du mich hier alleine …«
»Ich weiß«, erwiderte er rasch. »Und du hast alles Recht der Welt, mir Vorwürfe zu machen, aber nicht jetzt!« Ihr Zorn legte sich so schnell, wie er aufgebrandet war. Plötzlich erschöpft, ließ sie den Kopf auf die Brust ihres großen Bruders sinken.
»Ich habe gesehen …«
»Ich weiß, petite«, sagte er sanft und strich mit der Hand über ihr zerzaustes Haar, »aber die Soldaten sind schon draußen. Wir müssen hier weg, sonst geraten wir noch zwischen die Fronten.«
»So ein Hass in ihren Gesichtern, Anatole. Sie haben alles zerstört. Hast du das gesehen? Hast du das gesehen?«
Léonie spürte, wie Hysterie in ihr aufstieg, vom Magen in die Kehle, in den Mund sprudelte. »Mit bloßen Händen haben sie …«
»Das kannst du mir alles später erzählen«, sagte er schneidend, »aber jetzt müssen wir hier raus. Vas-y.«
Sofort kam Léonie wieder zur Besinnung. Sie holte tief Luft.
»Braves Mädchen«, sagte er, als er sah, wie die Klarheit in ihre Augen zurückkehrte. »Jetzt schnell!«
Anatole gelang es dank seiner Größe und Kraft, eine Schneise durch die Masse der Leiber zu bahnen, die aus dem Saal drängten.
Sie traten durch die Samtvorhänge ins Chaos. Hand in Hand liefen sie am zweiten Rang entlang zur Grand Escalier. Der mit Champagnerflaschen, umgekippten Eiskübeln und Programmheften übersäte Marmorboden war wie eine Eisbahn unter ihren Füßen. Sie schlitterten weiter, erreichten die Glastüren, ohne auch nur einmal richtig auszugleiten, und waren schließlich auf dem Place de l’Opéra.
Sogleich ertönte hinter ihnen das Geräusch von splitterndem Glas.
»Léonie, hier lang!«
Wenn sie die Szenen im Grande Salle schon für unerträglich gehalten hatte, so war es draußen auf den Straßen noch schlimmer. Die aufrührerischen Nationalisten, die abonnés, hatten auch die Treppe zum Palais Garnier besetzt. Mit Stöcken und Flaschen und Messern bewaffnet, standen sie in drei Reihen, warteten und warteten, sangen. Unten auf dem Place de l’Opéra knieten Soldaten in kurzen roten Jacken und Goldhelmen, ihre Gewehre auf die Protestler gerichtet, und hofften auf den Schießbefehl.
»Es sind so viele«, rief Léonie.
Anatole antwortete nicht und zog sie durch die Menge vor der barocken Fassade des Palais Garnier. Er kam an eine Ecke und bog scharf nach rechts auf die Rue Scribe, um aus der direkten Schusslinie rauszukommen. Sie hielten einander an der Hand, die Finger fest verschränkt, um nicht voneinander getrennt zu werden, als sie fast einen Häuserblock weit von Menschenmassen mitgerissen wurden, hin und her geworfen und gestoßen wie Treibgut auf einem schnell fließenden Fluss.
Aber eine Weile fühlte Léonie sich sicher. Anatole war bei ihr.
Dann das Geräusch eines einzelnen Gewehrschusses vom Fluss her. Einen Moment lang geriet die Menschenflut ins Stocken und setzte sich dann wieder geschlossen in Bewegung. Léonie spürte, wie sich ihre Schuhe von den Füßen lösten, und nahm plötzlich wahr, dass Männerschuhe an ihren Knöcheln entlangschrammten, auf den zerfetzten und über die Straße schleifenden Saum ihres Kleides traten. Eine Feuersalve krachte hinter ihr. Der einzige fixe Punkt war Anatoles Hand.
»Nicht loslassen«, schrie sie.
Hinter ihnen zerriss eine Explosion die Luft. Das Pflaster erbebte. Léonie drehte sich halb um, sah, wie vom Place de l’Opéra staubige, dreckige Rauchpilze grau in den Stadthimmel stiegen. Dann spürte sie eine zweite Detonation durchs Pflaster vibrieren. Die Luft um sie herum schien sich zunächst zu verdichten und dann in sich zusammenzufallen.
»Des canons! Ils tirent!«
»Non, non, c’est des pétards!«
Léonie schrie auf und packte Anatoles Hand noch fester. Sie stürzten weiter, immer weiter, ohne ein Gefühl für die Richtung, ohne Zeitgefühl, nur von einem animalischen Instinkt getrieben, der ihr sagte, erst dann stehen zu bleiben, wenn der Lärm und das Blut und der Staub weit hinter ihnen lagen.
Léonie wurden die Beine schwer, weil ihre Kräfte nachließen, aber sie rannte und rannte, bis sie nicht mehr konnte. Ganz allmählich verlief sich die Menschenmenge, und schließlich gelangten sie in eine ruhige Straße, weit weg von den Kämpfen, den Explosionen und Gewehrläufen. Léonie zitterten die Beine vor Erschöpfung, ihr Gesicht war gerötet und feucht von der Nachtluft.
Als sie stehen blieben, hob Léonie die Hand und stützte sich an einer Mauer ab. Ihr Herz pochte fieberhaft. Das Blut hämmerte ihr in den Ohren, wuchtig und laut.
Anatole lehnte sich mit dem Rücken gegen die Mauer. Léonie ließ sich gegen ihn sinken, ihre kupferroten Locken fielen ihr wie ein Strang Seide über den Rücken, und sie spürte, wie er beschützend den Arm um sie legte.
Sie sog die Nachtluft ein, versuchte, wieder zu Atem zu kommen, während sie die schmutzigen Handschuhe auszog, verdreckt von Ruß und den Pariser Straßen, und sie aufs Pflaster fallen ließ.
Anatole fuhr sich mit den Fingern durch das volle schwarze Haar, das ihm über die hohe Stirn und die markanten Wangenknochen gefallen war. Auch er war außer Atem, trotz der Stunden, die er in den Fechthallen verbrachte.
Merkwürdigerweise schien er zu lächeln.
Eine Weile sagte keiner von beiden ein Wort. Das einzige Geräusch war ihr keuchender Atem, der als weiße Wölkchen in den kühlen Septemberabend stieg. Endlich richtete Léonie sich auf.
»Wieso bist du zu spät gekommen?«, wollte sie von ihm wissen, als wären die Ereignisse der letzten Stunde nie geschehen.
Anatole starrte sie fassungslos an; dann begann er zu lachen, zuerst leise, dann lauter, und sein Gelächter füllte die Luft, während er zu sprechen versuchte.
»Du schimpfst mit mir, petite, selbst in so einem Moment?«
Léonie fixierte ihn mit einem strengen Blick, merkte aber bald, wie ihr selbst die Mundwinkel zuckten. Ein Kichern brach aus ihr heraus, dann noch einmal, bis ihre schlanke Gestalt vor Lachen bebte und ihr Tränen über die verschmierten, hübschen Wangen strömten.
Anatole zog sein Abendjackett aus und legte es ihr um die nackten Schultern. »Du bist wirklich ein ungewöhnliches Geschöpf«, sagte er. »Überaus ungewöhnlich!«
Léonie lächelte kläglich, als sie ihren mitgenommenen Zustand mit seiner Eleganz verglich. Sie sah an ihrem zerfetzten grünen Kleid hinab. Der Saum hing lose wie eine Schleppe hinter ihr, und die übriggebliebenen Glasperlen waren angeschlagen und baumelten nur noch an einem Faden.
Trotz ihrer kopflosen Flucht durch die Straßen von Paris sah Anatole aus wie aus dem Ei gepellt. Seine Hemdsärmel waren weiß und frisch, die Spitzen seines Kragens gestärkt und aufrecht. Kein einziger Fleck war auf seiner blauen Anzugweste zu sehen.
Er machte einen Schritt rückwärts und blickte hoch, um das Schild an der Mauer zu lesen.
»Rue Caumartin«, sagte er. »Ausgezeichnet. Abendessen? Du hast doch bestimmt Hunger, oder?«
»Hunger ist gar kein Ausdruck.«
»Ich kenne ein Café ganz in der Nähe. Die untere Etage ist bei den Künstlern vom Cabaret La Grande-Pinte und bei ihren Anhängern beliebt, aber im ersten Stock gibt es ganz anständige Séparées. Klingt das verlockend?«
»Ungemein.«
Er lächelte. »Also abgemacht. Und ausnahmsweise darfst du einmal lange aufbleiben, obwohl du längst ins Bett gehörst.« Er grinste. »Ich trau mich nicht, dich in diesem Zustand bei M’man abzuliefern. Das würde sie mir nie verzeihen.«
Kapitel 4
∞
Marguerite Vernier stieg in Begleitung von General Georges Du Pont an der Rue Cambon Ecke Rue Sainte-Honoré aus dem fiacre.
Während ihr Begleiter den Fahrpreis bezahlte, zog sie ihre Abendstola gegen die abendliche Kühle enger um sich und lächelte zufrieden. Es war das beste Restaurant der Stadt, und die berühmten Fenster waren wie immer mit feinster bretonischer Spitze verhängt. Dass Du Pont sie hierher ausführte, zeugte von seiner wachsenden Wertschätzung für sie.
Arm in Arm betraten sie das Voisin. Sie wurden von diskretem und sanftem Stimmengemurmel begrüßt. Marguerite spürte, wie Georges die Brust reckte und den Kopf ein wenig hob. Ihm war durchaus bewusst, so erkannte sie, dass jeder Mann im Raum ihn beneidete. Sie drückte seinen Arm, und die Geste wurde erwidert, eine Erinnerung daran, wie sie die letzten zwei Stunden verbracht hatten. Er richtete einen besitzergreifenden Blick auf sie. Marguerite bedachte ihn mit einem sanften Lächeln, öffnete dann leicht die Lippen und genoss es, wie er vom Kragen bis zu den Ohrspitzen rot anlief. Es war ihr Mund mit dem großzügigen Lächeln und den vollen Lippen, der ihre Schönheit außergewöhnlich machte. Er war verheißungsvoll und einladend zugleich.
Du Pont hob eine Hand an den Hals und zog an seinem steifen weißen Kragen, um die schwarze Krawatte zu lockern. Sein Abendjackett war würdevoll und dem Anlass angemessen und kaschierte darüber hinaus durch einen geschickten Schnitt, dass er mit seinen sechzig Jahren körperlich nicht mehr ganz so auf der Höhe war wie zu seinen Glanzzeiten in der Armee. Farbige Bänder in seinem Knopfloch symbolisierten die Orden, die er bei Sedan und Metz erhalten hatte. Statt einer Weste, die seinen vorstehenden Bauch betont hätte, trug er einen purpurroten Kummerbund. Mit seinen grauen Haaren und dem vollen und buschig gestutzten Schnurrbart war Georges jetzt Diplomat, förmlich und nüchtern, und er wollte, dass die Welt das zur Kenntnis nahm.
Extra für ihn hatte Marguerite ein sittsames lila Abendkleid aus Seidenmoiré mit Silber- und Perlenbesatz angezogen. Die Ärmel waren weit geschnitten und betonten so die schlanke Taille und die weiten Röcke. Es war am Hals hochgeschlossen, so dass nur ein kleines bisschen Haut zu sehen war, obwohl das Kleid an Marguerite dadurch nur umso aufreizender wirkte. Ihr dunkles Haar war kunstvoll zu einem Chignon gebunden, in dem nur ein paar lila Federn steckten, die Marguerites schlanken weißen Hals vorteilhaft hervorhoben. Braune, klare Augen ruhten in einem Gesicht mit makellosem Teint.
Jede gelangweilte ältere Dame und füllige Ehefrau im Restaurant starrte sie ablehnend und neidisch an, vor allem weil Marguerite Mitte vierzig war und nicht etwa in der Blüte der Jugend. Die Kombination von Schönheit und einer solchen Figur, gepaart mit dem Fehlen eines Ringes an ihrem Finger, kränkte den Gerechtigkeitssinn der Damen und ihr Gefühl für Anstand. War es denn richtig, dass eine derartige Liaison in einem Restaurant wie dem Voisin zur Schau gestellt wurde?
Der Besitzer, grauhaarig und so distinguiert wirkend wie seine Gäste, kam herbeigeeilt, um Georges zu begrüßen, trat aus dem Schatten der beiden Damen am Empfang, Skylla und Charybdis, ohne deren Segen keine Seele diesen kulinarischen Tempel betrat. General Du Pont war ein alter Stammgast, der den besten Champagner bestellte und großzügig Trinkgeld gab. Doch in letzter Zeit hatte er sich weniger häufig blicken lassen. Kein Wunder also, dass der Besitzer die Befürchtung hegte, er könnte seinen Kunden an das Café Paillard oder das Café Anglais verloren haben.
»Monsieur, es ist mir ein großes Vergnügen, Sie wieder bei uns begrüßen zu können. Wir hatten schon vermutet, Sie wären vielleicht auf einen Posten ins Ausland entsandt worden.«
Georges blickte betreten. So ein Puritaner, dachte Marguerite, obwohl sie das nicht unsympathisch fand. Er hatte bessere Manieren und war großzügiger und einfacher in seinen Bedürfnissen als viele der Männer, mit denen sie liiert gewesen war.
»Die Schuld liegt ganz allein bei mir«, sagte sie unter dunklen Wimpern. »Ich habe ihn für mich behalten.«
Der Besitzer lachte. Er schnippte mit den Fingern. Während die Garderobiere Marguerites Stola und Georges’ Gehstock nahm, tauschten die Männer Höflichkeiten aus, plauderten über das Wetter und die aktuelle Lage in Algerien. Es gab Gerüchte über eine antipreußische Demonstration.
Marguerite erlaubte ihren Gedanken abzuschweifen. Sie warf einen Blick auf den berühmten Obsttisch, auf dem die feinsten Früchte arrangiert waren. Die Saison für Erdbeeren war natürlich längst vorbei, und außerdem begab Georges sich gern frühzeitig zur Ruhe, daher war unwahrscheinlich, dass er bis zum Dessert würde bleiben wollen.
Marguerite unterdrückte gekonnt ein Seufzen, während die Männer ihr Gespräch beendeten. Obwohl um sie herum alle Tische besetzt waren, herrschte eine friedliche Atmosphäre stiller Behaglichkeit. Ihr Sohn würde das Restaurant abschätzig als langweilig und altmodisch bezeichnen, sie dagegen, die zu oft von außen in derlei Etablissements geblickt hatte, fand es entzückend und sah es als Beweis für die Sicherheit, die sie durch Du Ponts Gönnerschaft gefunden hatte.
Sobald die Unterhaltung vorüber war, hob der Besitzer die Hand. Der Oberkellner trat vor und führte sie durch den von Kerzenlicht erhellten Raum zu einem leicht erhöhten Tisch in einer Nische, der von anderen Gästen nicht eingesehen werden konnte und weit von den Schwingtüren zur Küche entfernt war. Marguerite bemerkte, dass der Mann schwitzte, seine Oberlippe glänzte unter dem gestutzten Schnurrbart, und sie fragte sich, was Georges eigentlich genau in der Botschaft machte, dass seine gute Meinung so überaus wichtig war.
»Monsieur, Madame, wünschen Sie einen Aperitif vorab?«, fragte der Weinkellner.
Georges sah zu Marguerite hinüber. »Champagner?«
»Das wäre wunderbar, ja.«
»Eine Flasche Cristal«, sagte er, wobei er sich auf seinem Stuhl zurücklehnte, als wollte er Marguerite das vulgäre Wissen ersparen, dass er die beste Marke des Hauses bestellt hatte.
Kaum war der Oberkellner gegangen, schob Marguerite ihre Füße unter dem Tisch vor, bis sie die Du Ponts berührten, und sah amüsiert, wie er zusammenfuhr und dann verlegen auf seinem Stuhl hin und her rutschte.
»Marguerite, bitte«, sagte er, obwohl sein Protest nicht überzeugend klang.
Sie zog einen Fuß aus dem Schuh und drückte ihn leicht gegen ihn. Durch den hauchdünnen Strumpf konnte sie den Saum seiner Hose spüren.
»Die haben hier den besten Rotweinkeller von ganz Paris«, sagte er mit rauher Stimme, als müsse er sich räuspern. »Burgunder, Bordeauxweine, alle entsprechend gelagert, zuerst die Spitzenweine der großen Weingüter und dann der Rest in der richtigen Reihenfolge bis hinunter zum bloßen Allerweltsgesöff.«
Marguerite vertrug keinen Rotwein und bekam furchtbare Kopfschmerzen davon, daher zog sie Champagner vor, doch sie hatte sich damit abgefunden, alles zu trinken, was Georges ihr vorsetzte.
»Sie wissen so viel, Georges.« Sie stockte, schaute sich dann um. »Und dass wir überhaupt einen Tisch bekommen haben. Es ist gut besucht für einen Mittwochabend.«
»Man muss nur wissen, an wen man sich wendet«, sagte er, obwohl sie ihm ansah, dass ihm ihre Schmeichelei guttat. »Haben Sie noch nie hier diniert?«
Marguerite schüttelte den Kopf. Der sorgfältige, detailbesessene, pedantische Georges sammelte Fakten und protzte gern mit seinem Wissen. Natürlich war ihr wie allen Parisern die Geschichte des Voisin bekannt, aber sie war bereit, Unkenntnis zu heucheln. Während der schmerzlichen Monate der Kommune hatte das Restaurant einige der gewalttätigsten Zusammenstöße zwischen den Kommunarden und den Regierungstruppen erlebt. Wo jetzt fiacres und Gigs auf Fahrgäste warteten, waren vor zwanzig Jahren die Barrikaden gewesen: eiserne Bettgestelle, umgekippte Holzkarren, Paletten und Munitionskisten. Sie und ihr Mann – ihr wunderbarer, heldenmütiger Leo – hatten auf diesen Barrikaden gestanden, für einen kurzen und herrlichen Moment als gleichwertige Partner gegen die herrschende Klasse vereint.
»Nach Louis-Napoleons schändlicher Niederlage in der Schlacht von Sedan«, schnaubte Georges, »rückten die Preußen gegen Paris vor.«
»Ja«, murmelte sie und fragte sich nicht zum ersten Mal, für wie jung er sie hielt, dass er meinte, ihr Geschichtsvorträge über Ereignisse halten zu müssen, die sie selbst miterlebt hatte.
»Je länger die Belagerung und der Beschuss andauerten, desto knapper wurden die Lebensmittel. Es war die einzige Möglichkeit, den Kommunarden eine Lehre zu erteilen. Die Folge war natürlich auch, dass viele der besseren Restaurants schließen mussten. Nicht genug zu essen, verstehst du? Spatzen, Katzen, Hunde, alles, was auf den Straßen von Paris kreuchte und fleuchte, galt als Freiwild. Um an Fleisch ranzukommen, wurden selbst die Tiere im Zoo geschlachtet.«
Marguerite lächelte ermutigend. »Ja, Georges.«
»Was glauben Sie, was an jenem Abend im Voisin auf der Speisekarte stand?«
»Ich möchte es mir gar nicht vorstellen«, sagte sie, genau das richtige Maß an Arglosigkeit in den großen Augen. »Ehrlich gesagt, ich traue mich kaum, es auszusprechen. Schlange, vielleicht?«
»Nein«, sagte er und lachte zufrieden auf. »Raten Sie noch einmal.«
»Ach, Georges, ich weiß es wirklich nicht. Krokodil?«
»Elefant«, sagte er triumphierend. »Ein Gericht aus Elefantenrüsseln. Was sagen Sie nun? Eigentlich prächtig. Fürwahr prächtig. Zeugt von einer bravourösen Haltung, finden Sie nicht?«
»O ja«, pflichtete Marguerite ihm bei und lachte ebenfalls, wenngleich ihre Erinnerung an das Frühjahr 1871 etwas anders aussah. Hunger, Wochen, in denen sie versuchte, zu kämpfen, ihren wilden, idealistischen, leidenschaftlichen Mann zu unterstützen und zugleich genug Nahrung für ihren geliebten Anatole zu finden. Grobes dunkles Brot, Kastanien und Beeren, nachts von den Sträuchern im Jardin des Tuileries gestohlen.
Als die Kommune fiel, floh Leo und wurde fast zwei Jahre lang von Freunden versteckt. Schließlich wurde auch er gefasst und entging nur knapp dem Erschießungskommando. Über eine Woche lang fragte Marguerite auf jeder Polizeiwache und in jedem Gerichtsgebäude in Paris nach, ehe sie herausfand, dass er bereits im Schnellverfahren abgeurteilt worden war. Sein Name stand auf einer Liste, die an der Wand eines städtischen Gebäudes hing: Deportation in die französische Pazifikkolonie Neukaledonien.
Die Amnestie der Kommunarden kam für ihn zu spät. Er starb auf der Galeere während der Überfahrt, ohne noch zu erfahren, dass er eine Tochter hatte.
»Marguerite?«, sagte Du Pont gereizt.
Marguerite merkte, dass sie zu lange geschwiegen hatte, und setzte eine andere Miene auf.
»Ich habe nur gerade gedacht, wie extraordinär das gewesen sein muss«, erwiderte sie rasch, »aber es sagt doch allerhand über die Fähigkeiten und den Einfallsreichtum des Kochs im Voisin aus, dass er ein solches Gericht zustande brachte. Wie wundervoll, hier zu sitzen, wo Geschichte gemacht wurde.« Sie hielt inne und fügte dann hinzu: »Mit Ihnen.«
Georges lächelte herablassend. »Am Ende setzt sich Charakterstärke nun mal durch«, sagte er. »Eine schlimme Situation lässt sich irgendwie immer zum eigenen Vorteil nutzen, aber die Erfahrung hat die heutige Generation ja noch nie gemacht.«
»Entschuldigen Sie, dass ich Sie beim Essen störe.«
Du Pont stand auf, wahrte trotz des Ärgers, der seine Augen verdunkelte, die Form. Marguerite wandte den Kopf und erblickte einen großen, aristokratisch wirkenden Herrn mit vollem dunklem Haar und hoher Stirn. Seine auffällig blauen Augen sahen mit scharfen, nadelspitzen Pupillen zu ihr herab.
»Monsieur?«, sagte Georges scharf.
Beim Anblick des Mannes huschte Marguerite eine Erinnerung durch den Kopf, obwohl sie sicher war, ihn nicht zu kennen. Er war ungefähr im selben Alter wie sie und trug die übliche Abendgarderobe, einen schwarzen Anzug, aber überaus gepflegt, der dem starken und beeindruckenden Körper darin schmeichelte. Breite Schultern, ein Mann, der es gewohnt war, sich durchzusetzen. Marguerite schaute kurz auf den Siegelring an seiner linken Hand, suchte nach Hinweisen auf seine Identität. Er hielt einen seidenen Zylinder in der Hand sowie weiße Abendhandschuhe und einen weißen Kaschmirschal, was darauf schließen ließ, dass er entweder gerade erst gekommen war oder im Begriff war, zu gehen.
Marguerite spürte, wie sie errötete, weil er sie förmlich mit den Augen auszog, spürte ihre Haut warm werden. Schweißperlen bildeten sich zwischen ihren Brüsten und unter der engen Schnürung des Korsetts.
»Verzeihen Sie«, sagte sie und warf Du Pont einen ängstlichen Blick zu, »aber kennen wir …«
»Mein Herr«, sagte er und nickte Du Pont entschuldigend zu. »Wenn Sie gestatten?«
Beschwichtigt nickte Du Pont knapp.
»Ich bin ein Bekannter Ihres Sohnes, Madame Vernier«, sagte er und zog eine Visitenkarte aus seiner Westentasche. »Victor Constant, Comte de Tourmaline.«
Marguerite nahm die Karte nach kurzem Zögern.
»Es ist überaus unhöflich, Sie zu stören, ich weiß, aber ich müsste Vernier dringend in einer wichtigen Angelegenheit sprechen. Ich war auf dem Lande, bin erst heute Abend in die Stadt gekommen und hatte gehofft, Ihren Sohn zu Hause anzutreffen. Aber leider …« Er zuckte die Achseln.
Marguerite hatte schon viele Männer gekannt. Sie wusste stets, wie sie mit einer Zufallsbekanntschaft am besten umging, wie sie reden, schmeicheln, ihren Charme spielen lassen konnte. Aber dieser Mann? Sie konnte ihn nicht einordnen.
Sie schaute auf die Visitenkarte in ihrer Hand. Anatole erzählte ihr nicht viel von seinen Geschäften, aber Marguerite war sicher, dass er einen so vornehmen Namen noch nie erwähnt hatte, weder als Freund noch als Kunden.
»Wissen Sie vielleicht, wo ich ihn finden kann, Madame Vernier?«
Marguerite verspürte einen Schauder des Begehrens, dann Furcht. Beides war lustvoll. Beides beunruhigte sie. Seine Augen verengten sich, als könnte er ihre Gedanken lesen, und er nickte leicht.
»Leider nein, Monsieur«, erwiderte sie mit bemüht fester Stimme. »Vielleicht können Sie Ihre Karte in seinem Büro abgeben …«
Constant neigte den Kopf. »In der Tat, das werde ich. Und das Büro befindet sich …«
»In der Rue Montorgueil. Die Hausnummer habe ich leider nicht im Kopf.«
Constant sah sie weiter unverwandt an. »Sehr gut«, sagte er schließlich. »Ich bitte nochmals um Entschuldigung für die Störung. Wenn Sie so freundlich wären, Madame Vernier, Ihrem Sohn auszurichten, dass ich nach ihm suche, wäre ich Ihnen sehr dankbar.«
Ohne Vorwarnung griff er nach unten, nahm ihre Hand, die auf ihrem Schoß ruhte, und hob sie an den Mund. Marguerite spürte seinen Atem und das Kitzeln seines Schnurrbarts durch den Handschuh hindurch und fühlte sich von ihrem Körper verraten, dessen Reaktion auf seine Berührung im krassen Gegensatz zu ihren Wünschen stand.
»A bientôt, Madame Vernier. Mon Général.«
Dann deutete er eine knappe Verbeugung an und ging. Der Kellner kam und füllte ihre Gläser auf. Du Pont fuhr aus der Haut.
»Was für ein unverschämter, impertinenter Halunke«, knurrte er und lehnte sich auf seinem Stuhl zurück. »Völlig taktlos. Für wen hält sich dieser Lump eigentlich, Sie so zu beleidigen?«
»Mich beleidigen? Inwiefern, Georges?«
»Der Bursche konnte doch seine Augen nicht von Ihnen lassen.«
»Wirklich, Georges, das habe ich gar nicht bemerkt. Er hat mich nicht interessiert«, sagte sie in dem Versuch, eine Szene zu vermeiden. »Bitte machen Sie sich wegen mir keine Gedanken.«
»Kennen Sie den Burschen?«, fragte Du Pont plötzlich argwöhnisch.
»Ich sagte doch, nein«, erwiderte sie ruhig.
»Der Bursche kannte meinen Namen«, wandte er ein.
»Vielleicht hat er Sie aus der Zeitung wiedererkannt, Georges«, sagte sie. »Sie wissen gar nicht, wie viele Menschen Sie kennen. Sie vergessen, was für eine bekannte Persönlichkeit Sie sind.«
Marguerite sah ihm an, dass die behutsame Schmeichelei sein Misstrauen beruhigte. Um die Sache zu beenden, fasste sie Constants edle Visitenkarte an einer Ecke und hielt sie an die Flamme der Kerze, die mitten auf dem Tisch stand. Das Papier brauchte einen Moment, bis es Feuer fing, und brannte dann hell und lichterloh.
»Was in Gottes Namen machen Sie denn?«
Marguerite hob ihre langen Wimpern, blickte dann wieder nach unten auf die Flamme, bis sie ein letztes Mal aufflackerte und erlosch. »So«, sagte sie und fegte die graue Asche von der Spitze ihres Handschuhs in den Aschenbecher. »Vorbei und vergessen. Und falls der Graf jemand ist, mit dem mein Sohn Geschäfte machen möchte, dann wäre der richtige Ort dafür zwischen zehn und fünf in seinem Büro.«
Georges nickte zustimmend. Erleichtert sah sie den Argwohn in seinen Augen dahinschmelzen.
»Wissen Sie wirklich nicht, wo Ihr Sohn heute Abend ist?«
»Natürlich weiß ich es«, sagte sie und lächelte, als würde sie ihn in einen Scherz einweihen, »aber Vorsicht hat noch niemandem geschadet. Ich kann geschwätzige Frauen nicht leiden.«
Er nickte erneut. Marguerite wollte, dass Georges sie für diskret und zuverlässig hielt.
»Völlig richtig, völlig richtig.«
»Genauer gesagt, Anatole ist mit Léonie in die Oper gegangen. Zur Premiere des neuesten Werks von Wagner.«
»Verdammte preußische Propaganda«, grollte Georges. »So was gehört verboten.«
»Und ich glaube, anschließend wollte er sie noch zum Abendessen ausführen.«
»Bestimmt in eines dieser fürchterlichen Lokale wie Le Café de la Place Blanche. Ein Tummelplatz für Künstler und was weiß ich noch alles.« Er trommelte mit den Fingern auf dem Tisch. »Wie heißt dieser andere Laden auf dem Boulevard Rochechouart noch gleich? Den sollten sie dichtmachen.«
»Le Chat Noir«, sagte Marguerite.
»Faulenzer, alle miteinander«, erklärte Georges, der sich für dieses neue Thema erwärmte. »Die klatschen Farbtupfer auf ein Stück Leinwand und nennen das Kunst: Was ist denn das für ein Beruf für einen Mann? Und dieser unverschämte Bursche, der in Ihrem Haus lebt, dieser Debussy? Kerle wie der gehören ausgepeitscht, alle miteinander.«
»Achille ist Komponist, mein Lieber«, schalt sie ihn sanft.
»Parasiten, alle miteinander. Immer griesgrämig. Hämmert Tag und Nacht auf dem Klavier herum, mich wundert, dass sein Vater ihm nicht mal eine ordentliche Tracht Prügel verpasst. Das würde ihn vielleicht zur Vernunft bringen.«
Marguerite unterdrückte ein Schmunzeln. Da Achille ein Altersgenosse von Anatole war, fand sie es ein wenig spät für derartige Erziehungsmaßnahmen. Und außerdem war Madame Debussy viel zu rasch mit Schlägen bei der Hand gewesen, als ihre Kinder noch klein waren, und es hatte offensichtlich nicht das Geringste bewirkt.
»Dieser Champagner ist wirklich ganz köstlich, Georges«, sagte sie, um das Thema zu wechseln. Sie beugte sich über den Tisch und nahm seine Finger, drehte dann seine Hand um und presste ihm ihre Fingernägel in die Handfläche. »Sie sind so fürsorglich«, sagte sie, beobachtete, wie sich der überraschte Schmerz in seinen Augen in Lust verwandelte. »Nun, Georges. Würden Sie bitte für mich bestellen? Wir sitzen schon so lange hier, und ich habe inzwischen richtig Appetit.«
Kapitel 5
∞
Léonie und Anatole wurden im ersten Stock der Bar Romain in ein Séparée mit Blick auf die Straße geführt.
Léonie gab Anatole sein Jackett zurück, dann ging sie in den angrenzenden Waschraum, wo sie sich Gesicht und Hände wusch und das Haar in Ordnung brachte. Ihr Kleid würde zwar von ihrem Dienstmädchen geflickt werden müssen, aber nachdem sie den Saum festgesteckt hatte, sah es fast wieder respektabel aus.
Sie musterte sich im Spiegel. Von der abendlichen Hast durch die Pariser Straßen glühte ihre Haut, und ihre smaragdgrünen Augen strahlten hell im Licht der Kerzen. Jetzt, wo die Gefahr vorüber war, malte Léonie sich das Geschehen im Geist bereits in leuchtenden, kühnen Farben aus, wie eine Geschichte. Schon hatte sie den Hass auf den Gesichtern der Männer vergessen, ihr eigenes Entsetzen.
Anatole bestellte zwei Gläser Madeira, gefolgt von Rotwein, der zu einem schlichten Mahl, bestehend aus Lammkoteletts und Sahnekartoffeln, serviert wurde.
»Danach gibt es Birnensoufflé, falls du noch Hunger hast«, sagte er und entließ den garçon.
Während sie aßen, schilderte Léonie ihm die Ereignisse bis zu dem Augenblick, als Anatole sie gefunden hatte.
»Diese abonnés sind ein seltsamer Haufen«, sagte Anatole. »Auf französischem Boden sollte nur französische Musik aufgeführt werden, das ist ihr Ziel. 1861 haben sie schon mit ihren Störaktionen die Absetzung von Tannhäuser erzwungen.« Er zuckte die Achseln. »Alle Welt glaubt, es geht ihnen überhaupt nicht um die Musik.«
»Worum denn dann?«
»Chauvinismus, schlicht und ergreifend.«
Anatole schob seinen Stuhl vom Tisch zurück, streckte seine langen, schlanken Beine aus und zog sein Zigarettenetui aus der Westentasche. »Paris wird Wagner wohl nicht mehr willkommen heißen. Jetzt nicht mehr.«