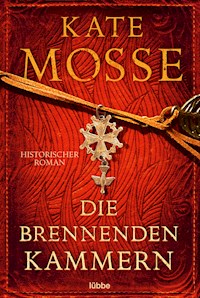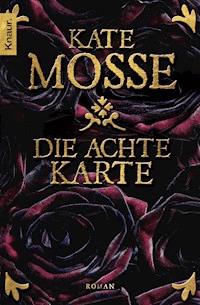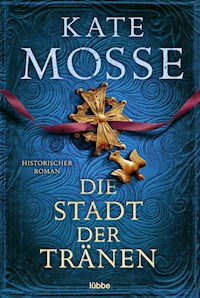
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lübbe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Juni 1572. Die Religionskriege machten aus Nachbarn Feinde und forderten zahllose Tote. Aber nun gibt es Hoffnung auf Frieden, denn die Hochzeit zwischen dem Hugenottenkönig Heinrich von Navarra und der Katholikin Margarete von Valois soll die Lager versöhnen. Im fernen Puivert erhalten Minou Reydon und ihre Familie die Einladung zum großen Fest nach Paris. Was Minou nicht weiß: Auch ihr Erzfeind Vidal wird anwesend sein. Und sie ahnt nicht, dass es nur kurz nach der Hochzeit, in der Nacht auf den Bartholomäustag, zu blutigen Kämpfen kommen wird, die Minous Familie brutal auseinanderreißen werden ...
Band 2 des farbenprächtigen Epos rund um das Schicksal der Hugenotten
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 680
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhalt
Über das Buch
Juni 1572. Die Religionskriege machten aus Nachbarn Feinde und forderten zahllose Tote. Aber nun gibt es Hoffnung auf Frieden, denn die Hochzeit zwischen dem Hugenottenkönig Heinrich von Navarra und der Katholikin Margarete von Valois soll die Lager versöhnen. Im fernen Puivert erhalten Minou Reydon und ihre Familie die Einladung zum großen Fest nach Paris. Was Minou nicht weiß: Auch ihr Erzfeind Vidal wird anwesend sein. Und sie ahnt nicht, dass es nur kurz nach der Hochzeit, in der Nacht auf den Bartholomäustag, zu blutigen Kämpfen kommen wird, die Minous Familie brutal auseinanderreißen werden …
Band 2 des farbenprächtigen Epos rund um das Schicksal der Hugenotten
Über die Autorin
Die britische Bestsellerautorin Kate Mosse lebt in Chichester (West Sussex) sowie in Carcassonne (Südfrankreich), wo auch ihr neuster Roman spielt. Ihre Bücher werden in 37 Sprachen übersetzt und erscheinen in 40 Ländern. Weltbekannt wurde sie mit dem internationalen Bestseller »Das verlorene Labyrinth«. Neben dem Schreiben ist sie in Rundfunk und Fernsehen aktiv und hat eine Gastprofessur and der University of Chichester inne. Außerdem ist sie die Gründerin des Women’s Prize for Fiction, dem wichtigsten Literaturpreis für Frauen im englischsprachigen Raum.
Übersetzung aus dem Englischenvon Dietmar Schmidt
Vollständige eBook-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Dieser Titel ist auch als Hörbuch erschienen
Titel der englischen Originalausgabe:
»The City of Tears«
Für die Originalausgabe:
Copyright © Mosse Associates Ltd 2020
Christopher Marlowe: Das Massaker von Paris/Die Historie des Doktor Faustus. Deutsch von Dietrich Schamp. Buchholz in der Nordheide 1999
Mit freundlicher Genehmigung durch Verlag Uwe Laugwitz.
John Milton: Das verlorene Paradies, Erster Gesang (1667), nach der Übers. von Adolf Böttger
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2021/2022 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Katharina Rottenbacher, Berlin
Umschlaggestaltung: Johannes Wiebel | punchdesign, München
Umschlagmotiv: © ivgroznii/shutterstock.com; RedDaxLuma/shutterstock.co; Lava 4 images/shutterstock.com; Magnia/shutterstock.com; Picsfive/shutterstock.com; © P Deliss / Godong/akg-images.de
© FALKENSTEINFOTO/Alamy Stock Photo
eBook-Produktion: Dörlemann Satz, Lemförde
ISBN 978-3-7517-0349-9
luebbe.de
lesejury.de
Wie immer für meine Liebsten
Greg & Martha & Felix
Und für Peter Clayton
20. Juni 1964 – 18. Juni 2018
Sehr vermisst
Doch Er, der über Wolken sitzt und herrscht,
Er höret die Gebete der Gerechten –
Und wird das Blut der Unschuldigen rächen,
Die je der Guise mit Heimtücke erschlug
Und vor der Zeit durch Mord ums Leben brachte.
Christopher Marlowe Das Massaker von Paris (1593)
Es ist der Geist sein eigner Raum, er kann
In sich selbst einen Himmel aus der Hölle,
Und aus dem Himmel eine Hölle schaffen.
John MiltonDas verlorene Paradies, Erster Gesang (1667)
Historische Anmerkung
Als Hugenottenkriege bezeichnet man eine Reihe von Bürgerkriegen in Frankreich, die nach jahrelang schwelenden Konflikten am 1. März 1562 begannen: Bei dem Blutbad von Wassy metzelten katholische Soldaten des Herzogs von Guise, François de Lorraine, unbewaffnete Hugenotten nieder. Erst nachdem mehrere Zehntausende Menschen getötet oder vertrieben worden waren, endeten die Kriege am 13. April 1598 mit der Unterzeichnung des Edikts von Nantes durch den ehemals protestantischen König Henri IV. Der bekannteste Vorfall der Hugenottenkriege ist die Bartholomäusnacht in Paris, ein Massenmord, der in den ersten Morgenstunden des 24. Augusts 1572 begann, doch sowohl vorher als auch nachher geschahen ähnliche Massaker in Städten und Dörfern in ganz Frankreich, unter anderem in Toulouse im Jahr 1562 (dem Zeitraum, von dem in Die brennenden Kammern berichtet wird). Auf die Pariser Bartholomäusnacht 1572 folgten Nachahmungstaten in zwölf Großstädten.
Die Ereignisse im Frühjahr und Sommer 1572, die zur Bartholomäusnacht und den Geschehnissen unmittelbar danach führten – der Tod Jeanne d’Albrets, die Hochzeit Marguerite de Valois’ mit Henri de Bourbon, zu diesem Zeitpunkt König von Navarra, die Ermordung Admiral de Colignys und die Verantwortung für die Anordnung des Massakers selbst –, sind heftig interpretiert, um nicht zu sagen fiktionalisiert worden, und zwar durch Generationen von Librettisten, Künstlern, Regisseuren, Bühnenautoren und Romanciers, an vorderster Stelle Christopher Marlowe, Prosper Mérimée und Jean Plaidy. Die vorherrschende Auslegung der historischen Ereignisse ist Alexandre Dumas’ Roman Königin Margot von 1845. In diesem Geiste habe auch ich mir ein gewisses Maß an künstlerischer Spekulation und Freiheit eingeräumt.
Henri IV., der erste Bourbonenkönig Frankreichs, konvertierte (zum zweiten Mal und endgültig) im Juli 1593 zum Katholizismus, um sein gespaltenes Königreich zu einigen und die ausgesprochen katholische Hauptstadt Frankreichs auf seine Seite zu ziehen. Angeblich sprach er dabei die Worte: »Paris vaut bien une messe – Paris ist eine Messe wert.« Im Februar 1594 wurde er in Chartres gekrönt, seine Exkommunikation ein Jahr später aufgehoben.
Bei seinem Inkrafttreten 1598 war das Edikt von Nantes womöglich weniger Ausdruck einer aufrichtigen Sehnsucht nach wahrer religiöser Toleranz als vielmehr der Erschöpfung und des militärischen Stillstands. Der Friede, den es einem Land schenkte, das sich über Fragen von Doktrin, Religion, Bürgerschaft und Souveränität zerfleischt und in den Ruin getrieben hatte, war eher zähneknirschender Natur.
Der Enkel Henris IV., Louis XIV., hob am 22. Oktober 1685 in Fontainebleau das Edikt von Nantes auf und bewirkte damit den Exodus der Hugenotten, die in Frankreich geblieben waren. Jedes Land, das die Flüchtigen aufnahm, wurde durch ihre Anwesenheit bereichert – in der Tat leitet sich der englische Begriff Refugee vom französischen Refugié ab, mit dem zuerst die Hugenotten bezeichnet wurden.
Der Achtzigjährige Krieg in den Niederlanden war nicht weniger kompliziert. Er begann 1568 als Aufstand der Siebzehn Provinzen – die heute die Niederlande, Belgien und Luxemburg bilden – gegen die Gewaltherrschaft des habsburgischen Spaniens. Unter der Führung des Fürsten von Oranien, Wilhelm des Schweigers, konnten die Invasionstruppen unter dem Herzog von Alba – der Philipp II. von Spanien unterstand – am Ende aus dem Norden und Westen des Landes vertrieben werden. Am 18. Februar 1578 wurde die Satisfactie unterzeichnet, die Amsterdam und Holland wiedervereinte, und am 29. Mai des gleichen Jahres wurde Amsterdam, die letzte katholische Großstadt in Holland, durch die Alteratie calvinistisch. Außergewöhnlich ist im Kontext der blutigen Geschichte dieser Zeit, dass dabei niemand getötet wurde. Ich habe mir in der Schilderung dieses Ereignisses ebenfalls viele Freiheiten erlaubt.
Holländer, Friesen, Zeeländer, Gelderländer und andere verstanden sich allmählich als Niederländer. Am 26. Juli 1581 unterzeichneten die Provinzen das Plakkaat van Verlatinghe, das als die Unabhängigkeitserklärung der Niederlande betrachtet wird, ein erster Schritt zur Selbstregierung. 1588 wurde die Republik der Sieben Vereinigten Provinzen gegründet, und 1609, ein Jahr vor der Ermordung Henris IV. in Paris, wurde die Republik der Vereinigten Niederlande anerkannt. Dennoch sollte es eine weitere Generation dauern, bis 1648 in Münster der Westfälische Friede unterzeichnet wurde, der nicht nur den Dreißigjährigen Krieg in Deutschland, sondern auch den Achtzigjährigen Krieg in den Niederlanden beendete und dort das sogenannte Goldene Zeitalter des 17. Jahrhunderts einleitete.
Sowohl die Entwicklung des französischen Protestantismus als auch die Anfänge der Niederländischen Republik sind Teil der Reformation in Europa, die am 31. Oktober 1517 begann, als Martin Luther in Wittenberg seine 95 Thesen an die Kirchentür nagelte. Henry VIII. von England setzte sie ab 1536 mit der Auflösung der Klöster fort, der missionarische Evangelist Jean Calvin schuf 1541 in Genf eine sichere Zuflucht für französische Flüchtlinge und Ende der 1560er Jahre in Amsterdam und Rotterdam entstanden weitere sichere Schutzorte für Protestanten. Im Mittelpunkt der Auseinandersetzungen standen das Recht, Gott in der eigenen Sprache zu verehren, die Ablehnung des Kults um Reliquien und Fürbitten, die Forderung, den Wortlaut der Bibel strenger auszulegen, der Wunsch nach schlichten Gottesdiensten auf Grundlage der Lebensregeln in der Heiligen Schrift, eine Verurteilung der Exzesse der katholischen Kirche, die viele als abstoßend empfanden, und ein Streit um die Natur der Hostie bei Kommunion und Abendmahl. Für die meisten Menschen jedoch waren solche Fragen der Doktrin sehr lebensfern.
Viele ausgezeichnete Geschichtsbücher über die Hugenotten schildern den außergewöhnlichen Einfluss dieser kleinen Gemeinschaft, eine Diaspora, die sie als kenntnisreiche Einwanderer nach Holland führte, nach Deutschland, England, Irland, in die Neue Welt, nach Kanada, Russland, Dänemark, Schweden, in die Schweiz und nach Südafrika. Der Ursprung der Bezeichnung Hugenotte ist unklar, allerdings gibt es Hinweise, dass es sich zu Anfang um ein Schimpfwort gehandelt haben könnte; zeitgenössische Anhänger sprachen von sich als Mitgliedern der l’Église Réformée, der Reformierten Kirche. Dem Fluss der Erzählung zuliebe verwende ich im vorliegenden Text jedoch die Bezeichnungen Protestant, Calvinist und Hugenotte nebeneinander.
Die Stadt der Tränen ist der zweite Band einer dreihundertjährigen Geschichte, die aus dem Frankreich des 16. ins Südafrika des 19. Jahrhunderts führt. Wenn nicht anders angegeben, sind die Figuren und ihre Familien erfunden, aber sie hätten in diesen Zeiten leben können: gewöhnliche Frauen und Männer, die vor dem Hintergrund von Glaubenskrieg und Vertreibung um ihre Liebe und ihr Überleben kämpfen.
Damals wie heute.
Kate Mosse
Carcassonne, Amsterdam und Chichester
Januar 2020
Hauptfiguren
IN PUIVERT
Marguerite (Minou) Reydon-Joubert, Châtelaine de Puivert, Herrin der Burg Puivert
Piet Reydon, ihr Gatte
Marta, ihre Tochter
Jean-Jacques, ihr Sohn
Salvadora Boussay, Minous Tante
Aimeric Joubert, ihr Bruder
Alis Joubert, ihre Schwester
Bernard Joubert, ihr Vater
IN PARIS UND CHARTRES
Vidal du Plessis (Kardinal Valentin), Beichtvater Henri de Lorraines, des Herzogs von Guise, und späterer Seigneur de Évreux
Louis (Volusien), sein illegitimer Sohn
Xavier, sein Verwalter und Diener
Pierre Cabanel, ein Hauptmann in der katholischen Miliz
Antoine le Maistre, ein hugenottischer Flüchtling aus Limoges
IN AMSTERDAM
Mariken Hassels, eine Begine
Willem van Raay, ein reicher Kornhändler und katholischer Ratsherr
Cornelia van Raay, seine Tochter
Die Vorsteherin des Begijnhof (Beginenhof)
Jacob Pauw, ein katholischer Kaufmann und Ratsherr
Jan Houtman, ein calvinistischer Kämpfer während der Alteratie
Joost Wouter, ein calvinistischer Söldner
Bernarda Reydon, Minous jüngste Tochter
HISTORISCHE PERSONEN
Caterina de’ Medici, Königin und Regentin von Frankreich, Mutter dreier Valoiskönige – François II., Charles IX. und Henri III. (1519–1589)
Marguerite de Valois, Königin von Navarra und Caterinas Tochter (1553–1615)
Henri de Bourbon, König Henri III. von Navarra und als Henri IV. erster Bourbonenkönig von Frankreich (1553–1610)
Admiral Gaspard de Coligny, militärischer Anführer der Hugenotten (1519–1572)
Henri de Lorraine, Herzog von Guise und Gründer der Heiligen Liga (1550–1588)
PROLOG
FRANSCHHOEK
28. Februar 1862
Die Frau liegt unter einem weißen Laken in einem weißen Zimmer und träumt von Farbe.
Hier rust. Hier ruht.
Sie ist nicht mehr auf dem Friedhof. Oder?
Die Frau ist zwischen Schlafen und Wachen gefangen, taucht aus einem Reich der Schatten hoch in eine Welt des grellen Lichtes. Sie hebt die Hand an den Kopf und spürt an ihrer Schläfe zwar die Platzwunde, findet dort aber kein Blut. Ihre Schulter schmerzt. Sie stellt sich vor, dass sie blau ist von Quetschungen, wo er sie gepackt hielt, wo seine Finger sich eingedrückt haben. Sie sieht, wie das in lohfarbenes Leder gebundene Tagebuch aus ihrer Hand auf die rote Erde des Kaps fiel. Es ist das Letzte, woran sie sich erinnert. Das und die Worte, die sie mit sich trägt.
Heute ist der Tag meines Todes.
Die Frau schlägt die Augen auf. Das Zimmer ist undeutlich und fremd, aber ein typischer Raum in einem kapholländischen Gehöft. Weiße Wände, schmucklos bis auf eine Stickarbeit mit Bibelversen. Ein Boden aus blankem Holz, eine Kommode und ein Nachttisch. Auf ihrer Reise von Kapstadt über Stellenbosch, Drakenstein und Paarl hat sie in vielen solchen Häusern übernachtet. Kapsiedlerhäuser, manche groß, manche klein, aber stets von einer Sehnsucht nach Amsterdam und dem Leben geprägt, das ihre Besitzer hinter sich gelassen haben.
Die Frau setzt sich auf und schwingt die Beine vom Bett. Ihr schwindelt, und sie hält kurz inne, bis die Übelkeit nachlässt. Durch die Strümpfe an ihren Füßen spürt sie den Holzboden. Ihre weiße Bluse und ihr Reitrock sind rot bestäubt, aber jemand hat ihr die Schuhe ausgezogen und ans Fußende des Bettes gestellt. Ihr Lederhut hängt an einem Haken an der Tür. Auf der Kommode steht ein Messingtablett mit einem Krug voll Kapwein – kirschrot und stark –, dazu ein Stück Weißbrot und Streifen aus getrocknetem Rindfleisch, von einem Tuch bedeckt.
Sie versteht nicht. Ist sie Gefangene oder Gast?
Auf unsicheren Füßen geht sie zur Tür und findet sie abgeschlossen vor. Von draußen hört sie das Gezwitscher eines Starenschwarms. Sie zieht die Schuhe an und geht zum Fenster. An der Innenseite des kleinen quadratischen Rahmens sind dünne Eisenstangen eingesetzt. Um sie einzusperren oder andere fernzuhalten?
Sie greift durch die Gitterstäbe und drückt die Scheibe auf. Bei Sonnenuntergang sieht der Himmel über dem Kap genauso aus wie über dem Languedoc, weiß mit einem rosa Schleier, wo die Sonne hinter die Berge gesunken ist. Die Frau kann die Kapelle am höchsten Punkt der Ortschaft sehen, ein weiteres kleines weißes Bauwerk im kapholländischen Stil mit Strohdach und spitzen Fenstern zu beiden Seiten des bogenförmigen Eingangs. Seit die neue Kirche vor einigen Jahren ihrer protestantischen Gemeinde die Türen öffnete, hat dieses Gebäude als Schule gedient. Der Anblick gibt ihr Hoffnung, denn wenigstens ist sie noch innerhalb der Stadtgrenzen. Wenn er sie ermorden wollte, hätte er sie doch gewiss in die Berge geschafft und es dort getan?
Fernab aller neugierigen Blicke.
Sie erkennt auch die Obsthaine, in denen Pflaumen, Birnen und Äpfel wachsen; in diesen Wochen hat sie gelernt, jede Art zu erkennen und zu wissen, welcher Farmer sie züchtet: die Familie Hugo und die Haumanns, die de Villiers und die Nachfahren der du Toits.
Sie hört die an- und abschwellenden Stimmen der Mädchen, die Seilchen springen. Eine Mischung aus Afrikaans und Englisch, kein Französisch, das Erbe jahrelanger Kämpfe um die Herrschaft über dieses geraubte Land. Das Kap ist erneut britische Kolonie, die Hauptstraße der Ortschaft wurde zu Ehren der englischen Königin in Victoria Street umbenannt. Von weiter weg ertönt der Gesang der Männer, die von den Feldern nach Hause kommen, in einer anderen Sprache, die sie nicht erkennt.
Ihre Erleichterung ist flüchtig. Rasch weicht sie der Bestürzung über den Verlust des Tagebuchs, der Karte, des kostbaren Testaments, das seit Hunderten von Jahren im Besitz ihrer Familie ist. Obwohl sie das Tagebuch nun verloren hat, kennt sie jedes Wort darin auswendig, jeden Knick auf der Karte, die Klauseln und Bestimmungen des Testaments. Während sie wartet und wartet und das Licht am Himmel verblasst, glaubt sie die Stimmen ihrer Vorfahren zu hören, die ihr über die Jahrhunderte hinweg zurufen.
Château de Puivert. Samstag, der dritte Tag des Monats Mai im Jahr des Herrn 1572.
Der Kummer über den Verlust der Dokumente schlägt in Angst um: Er hat sie nur deshalb noch nicht ermordet, weil er etwas von ihr will. Nun bedauert sie ihre Vorsicht. Erinnert sich, wie sie die Hand ausstreckte, um das Moos vom Grabstein zu kratzen. Ihr schaudert bei der Erinnerung an die kalte Mündung des Revolvers und die Gnadenlosigkeit in der Stimme des Mannes, der die Waffe hielt. Sein Schatten, der Geruch nach Schweiß und nach Stein, die weiße Strähne in seinem schwarzen Haarschopf.
Sie hatte ihr Messer gezückt, ihm aber nur in die Hand geschnitten. Das hat nicht gereicht.
Das Licht wird immer schwächer, die Luft regt sich nicht, das Summen und Surren der Insekten ist die einzige Bewegung. Die Kinder werden hineingerufen, und in jedem Haus erscheinen Nadelspitzen aus Licht, als Kerzen angezündet werden. Obwohl sie erschöpft ist, hält die Frau am Fenster Wache. Sie isst ein wenig Brot, trinkt einen Schluck vom milden Kapwein und gießt den Rest aus dem Fenster. Sie muss ihre Sinne beisammenhalten.
Die Kirchenglocke in dem einsamen weißen Turm schlägt die Stunde. Neun, zehn. Draußen ist die Dunkelheit hereingebrochen. Die Berge sind in den Schatten verschwunden. Auf der Victoria Street und dem Gitterwerk aus schmaleren Sträßchen und Gassen erlöschen die Kerzen eine nach der anderen. Franschhoek ist ein Städtchen, in dem man früh zu Bett geht und mit der Sonne aufsteht.
Erst nach elf Uhr, als sie schon mit dem Schlaf kämpft und ihr wieder der Schädel pocht, hört sie zum ersten Mal ein Geräusch im Haus. Augenblicklich steht sie gerade.
Schritte nähern sich der Tür, aber leise. Wer da kommt, geht langsam, als wolle er nicht gehört werden.
Sie hatte Stunden, um zu entscheiden, was sie tun will, doch nun übernehmen ihre Instinkte.
Sie schleicht hinter die Tür, den leeren Weinkrug in der Hand erhoben. Sie horcht auf das Scharren eines Schlüssels, der ins Schloss geschoben wird. Klackend fährt der Riegel zur Seite, und langsam öffnet sich die Tür nach innen. In der Dunkelheit kann sie kaum etwas erkennen, doch sie sieht eine weiße Haarsträhne und riecht das Leder seiner Jacke, und kaum ist er in Reichweite, schlägt sie ihm den Krug auf den Hinterkopf.
Sie verschätzt sich. Sie zielt zu hoch, und der Mann taumelt zwar, aber er bricht nicht zusammen. Sie stürzt zur offenen Tür, versucht an ihm vorbeizukommen, aber er ist schneller. Er packt sie beim Handgelenk, drängt sie zurück ins Zimmer und hält ihr den Mund zu.
»Seien Sie still, Sie Närrin! Sie sorgen noch dafür, dass wir beide sterben.«
Augenblicklich ist sie ruhig. Es ist eine andere Stimme, und im Mondschein, der durchs Fenster fällt, sieht sie seinen Handrücken. Keine Spur von dem Schnitt, den sie ihrem Angreifer mit dem Messer beigebracht hat. Und der Mann scheint ihr zu trauen, denn er gibt sie frei und tritt einen Schritt zurück.
»Monsieur, vergeben Sie mir«, sagt sie. »Ich hielt Sie für ihn.«
»Nichts passiert«, antwortet er, ebenfalls auf Französisch.
Im silbrigen Schatten kann sie nun sein Gesicht erkennen. Er ist größer als der Mann, der sie auf dem Friedhof angegriffen hat, und trägt seine schwarzen Haare kürzer, allerdings durchzieht sie die gleiche weiße Strähne.
»Sie sehen ihm sehr ähnlich.«
»Richtig.«
Sie wartet, dass er mehr verrät, aber er sagt nichts.
»Wieso bin ich hier?«, fragt sie.
Er hebt die Hand. »Wir müssen gehen. Uns bleibt nur wenig Zeit.«
Die Frau schüttelt den Kopf. »Nicht bevor Sie mir gesagt haben, wer Sie sind.«
»Wir …« Er zögert. »Ich habe beobachtet, was auf dem Friedhof geschehen ist. Ich musste bis jetzt warten. Er ist mein Bruder.«
Sie verschränkt die Arme. Sie weiß nicht, ob sie dem Mann trauen soll oder nicht. Sie wartet.
»Wir sind unterschiedlicher Meinung.«
Wieder erwartet sie, dass er es näher ausführt, aber er blickt zur Tür. Er hat es eilig wegzukommen.
»In wessen Haus sind wir?«, fragt sie.
»Es gehört unserer Mutter. Sie ist bettlägerig und weiß nicht, dass Sie hier sind. An alldem trägt sie keine Schuld.« Er berührt flüchtig ihre Hand. »Bitte, kommen Sie mit. Ich beantworte Ihnen alle Fragen, sobald wir Franschhoek verlassen haben.«
»Wo ist Ihr Bruder jetzt?«
»Er ist ausgegangen und trinkt, aber er kann jeden Moment zurückkehren. Wir müssen gehen. Am Ostrand der Stadt stehen Pferde bereit.«
Sie löst die Verschränkung ihrer Arme. »Und was, wenn ich Sie nicht begleite?«
Der Mann blickt sie offen an, und in seinen Augen sieht sie Entschlossenheit und auch Besorgnis.
»Er wird Sie töten.«
Die nüchterne Aussage überzeugt sie mehr, als beschwörende Worte oder emphatisches Zureden vermocht hätten. Lieber versucht sie ihr Glück mit dem Fremden, als dass sie hierbleibt und untätig abwartet, was das Morgengrauen bringt. Sie nimmt ihren Hut vom Türhaken.
»Sagen Sie mir, wie Sie heißen?«, flüstert sie, während sie ihm durch den dunklen Korridor zur Hintertür folgt.
Er legt den Finger auf die Lippen.
»Verraten Sie mir wenigstens, wohin wir gehen?«
Er zögert und antwortet. »Zur alten Steinbrücke an der Furt. Die anderen warten dort.«
»Ich verstehe nicht.«
»Jan Joubertsgat«, sagt er. »Wo Jan Joubert starb.« Er dreht sich zu ihr um. »Sind Sie etwa nicht deswegen hier?«
Die Frau hält den Atem an, fühlt sich mit einem Mal entblößt. »Sie wissen, wer ich bin?«
Ein Lächeln erscheint auf dem Gesicht des Mannes. »Aber sicher.« Er löst den Riegel und drückt die Tür auf. »Jeder weiß, wer Sie sind.«
ERSTER TEIL
AMSTERDAM UND PUIVERT
Mai und Juni 1572
KAPITEL 1
BEGIJNHOF AMSTERDAM
Donnerstag, 22. Mai 1572
Die alte Mariken kniete in der Kapelle des Begijnhofs vor dem Altar, wie sie es jeden Abend tat, seit sie den Brief erhalten hatte, und betete um göttliche Führung.
In schwungvoller Schrift auf feinem Papier geschrieben, mit Wachs versiegelt und einem adligen Wappen versehen – sie hatte die Pflicht zu antworten. Trotzdem war ein Tag nach dem anderen verstrichen, und beantwortet hatte sie das Schreiben noch immer nicht. Die Worte schienen sich durch ihr Kleid zu brennen, brandmarkten sie zischend mit Verleumdung. Dreißig Jahre zuvor hatte sie an einem Totenbett in einer Pension an der Kalverstraat ein Versprechen gegeben.
»Heer, leid mij«, flüsterte Mariken. »Herr, leite mich.«
Verfasser des Briefes war ein französischer Kardinal, ein mächtiger Mann. Sie konnte sich ihm nicht widersetzen. Das Ersuchen um Auskunft über den Jungen und seine Mutter erschien harmlos, war einfach und plausibel formuliert. Zur Besorgnis bestand kein Anlass. Dennoch spürte Mariken hinter den amtlich klingenden Worten Boshaftigkeit. Wenn sie Seiner Eminenz gab, was er verlangte, würde sie, so fürchtete sie, nicht nur den Eid brechen, den sie einer Sterbenden geleistet hatte, sondern auch das Todesurteil für den Jungen unterzeichnen. Das Wissen, das sie besaß, war mächtig und gefährlich.
Flüchtig lächelte Mariken über ihre Torheit. Wenn der Junge noch lebte, wäre er ein gestandener Mann von etwa fünfunddreißig Jahren. In ihrer Erinnerung war er jedoch für immer das Kind, das über dem kalten Leichnam seiner Mutter schluchzte und ein Bündel umklammerte, das ihm gegeben worden war.
Mariken hatte das Bündel ihrer Freundin, Schwester Agatha, zur sicheren Verwahrung anvertraut, in der festen Absicht, es abzuholen und dem Knaben zurückzugeben, wenn die Zeit reif war. Aber als die Jahre dahinzogen, hatte sie es vergessen. Was darin war, hatte sie nie erfahren, doch sie hegte einen Verdacht, was es enthalten mochte. Die Chronik einer Geschichte, wie sie nicht selten vorkam: Einzelheiten eines Verlöbnisses, ein Versprechen, erst gegeben, dann gebrochen, und noch eine Frau, die in Schande leben musste.
»Domine, exaudi orationem meum. – Herr, erhöre mein Gebet.«
Marikens Worte hallten im leeren Raum wider, zu laut. Ihr Herz machte einen Satz, und sie wandte sich vom Altar ab, fürchtete, man könnte sie zu dieser Abendstunde allein in der Kapelle ertappen. Aber niemand hob den Riegel, niemand trat ins Kirchenschiff.
Sie hob den Blick zum Kreuz und überlegte, ob sonst noch jemand sich Marta Reydons und ihres Sohnes erinnerte. Sie bezweifelte es. Die meisten ihrer Gefährtinnen aus jener Zeit waren tot. Obwohl so viele Jahre verstrichen waren, betete Mariken noch immer für ihre Seele: Marta war im Tod genauso übel mitgespielt worden wie im Leben.
Erste Bekanntschaft mit ihr hatte Mariken in den Gassen gemacht, die die alte Pfarrkirche Sint Nicolaas umgaben. Dort tummelten sich die Frauen, die sich an die Seeleute verkauften, wenn sie von Bord der Schiffe kamen. Mariken und Schwester Agatha, eine Nonne aus einem Konvent in der Nähe, hatten für die armen Dinger getan, was sie konnten.
Mariken schüttelte den Kopf. So lange war es her. Ihre Erinnerungen hatten an Farbe eingebüßt. Sie schloss die Hand um den Brief, den sie unter ihrer langen schlichten Kutte verborgen hatte. Länger konnte sie es nicht hinauszögern. Für sie nahm es kein gutes Ende, versagte sie dem Kardinal die Einzelheiten, die er verlangte – nein, bestätigte sie nicht das, was er offenbar schon wusste. Denn wenn die Beginen auch nur fromme Frauen waren und keine Nonnen, legten sie dennoch einen Eid des Gehorsams und der Dienstbarkeit ab. Und in diesen gesetzlosen Zeiten benötigte ihre Gemeinschaft Schutz. Amsterdam hatte sich zwar noch nicht den protestantischen Rebellen angeschlossen, aber Mariken fürchtete, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis die Stadt fiel. Vor den Toren scharten sich die Calvinisten zusammen. Viele ihrer katholischen Schwestern und Brüder waren schon aus ihren Konventen, Klöstern und Stillen Gärten vertrieben worden und geflohen. Die Vorsteherin des Begijnhofs würde von ihr erwarten, dass sie ihre Pflicht der heiligen Mutter Kirche gegenüber erfüllte.
Gleichwohl.
Als Mariken den Brief erhielt, hatte sie sich zunächst am Hafen erkundigt. In den Schenken am Zeedijk und am Nieuwendijk erhielt man Auskünfte, wenn man den Preis entrichtete. Danach hatte sie sich an einen einflussreichen Bekannten auf der Warmoesstraat gewandt. Der wohlhabende Kornhändler Willem van Raay war fromm und diskret, ein Hüter von Geheimnissen. Mariken hatte einige Jahre zuvor seine Tochter gesund gepflegt, und daher vertraute sie ihm genügend, um ihn zu fragen, ob er vielleicht von einem Pieter Reydon gehört habe oder ob darüber geredet werde, wieso jemand so Erlauchtes wie ein französischer Kardinal seinen Blick auf Amsterdam richtete. Willem van Raay hatte einen Brief an Reydon entgegengenommen, den er übergeben sollte, falls er ihn fand, und versprochen, der Angelegenheit nachzugehen.
Doch zwei Wochen waren verstrichen, und noch immer hatte sie nichts gehört.
Mariken hatte eingesehen, dass ihr nichts weiter übrigblieb, als Willem van Raay persönlich aufzusuchen. Noch eine Bürde, die auf ihrem Gewissen lastete: Beginen war es verboten, tagsüber ohne Erlaubnis auszugehen, und da sie niemandem die Gründe für ihren Wunsch, die Gemeinschaft zu verlassen, anvertrauen durfte, müsste sie lügen. Indem sie sich in der Nacht davonschlich, umging sie wenigstens die zweite Übertretung, versicherte sie sich.
Den Schlüssel zum Außentor hatte sie bereits früher entwendet, auch wenn sie sich noch nicht entschlossen hatte, ihn zu benutzen: Nicht zuletzt missfiel Mariken der Gedanke, ohne Begleitung zu solch später Stunde auf den dunklen Straßen unterwegs zu sein. Doch Gott würde gewiss über sie wachen. Sobald sie mit Ratsherr van Raay gesprochen hatte, wüsste sie genug, um eine passende Antwort an den Kardinal zu verfassen, und ihr Gewissen wäre rein. Die Last wäre ihr von den Schultern genommen.
Mariken bekreuzigte sich und erhob sich langsam. Sie spürte den kalten Abdruck der Fliesen auf ihren Knien. Jeder einzelne Knochen in ihrem Leib schien unter der Qual des Lebens zu schmerzen.
Sie rückte die Falie über den grauen Haaren zurecht und ging hinaus in die Nacht. Auf dem Hof war es dunkel, auch wenn in einem oder zwei Häusern um die Wiese noch Kerzen brannten. Zwischen den Dornbüschen murmelte der Bach sein Nachtlied. Mariken blickte hoch zum Fenster der Vorsteherin und betete, sie möge nicht wach sein und entdecken, dass der Schlüssel fehlte. Zu ihrer Erleichterung war das Fenster dunkel.
Ängstlich und besorgt, wie sie war, machte Mariken eine ungeschickte Bewegung und ließ den Schlüssel fallen. In all den Jahren, die sie der Gemeinschaft angehörte, hatte sie niemals auf solche Weise die Regeln gebrochen. Ihr altes Herz hämmerte, als es ihr endlich gelang, das Tor aufzuschließen. Sie trat auf die Begijnensloot hinaus und erreichte die schmalen Straßen auf der anderen Seite der Brücke. Mariken war so angespannt, dass sie nicht bemerkte, wie sich hinter ihr etwas im Dunkeln bewegte. Während sie mit gesenktem Kopf die Kalverstraat überquerte, spürte sie den Luftzug nicht. Als der Hieb sie traf und nach vorn in die Amstel schleuderte, blieb ihr keine Zeit zum Nachdenken.
Wie viele Amsterdamer, die ihr Leben von Kanälen umringt verbrachten, konnte Mariken nicht schwimmen. Als der erste Schluck Wasser in ihre Lunge drang, dachte sie nur, wie froh sie war, dass sie nun nicht mehr das Vertrauen brechen musste, das man in sie gesetzt hatte. Ihr Blick fiel auf einen Mann, der auf dem Kai stand und zusah, wie sie ertrank. Als ihre schwere graue Kutte sie rasch in die Tiefe zog, betete Mariken, dass der kleine Pieter und seine Mutter in Gottes Gnade wieder vereint würden, wenn die Zeit kam.
Und dass der Kardinal niemals die Wahrheit erfahren würde.
KAPITEL 2
Zwei Wochen später
CHÂTEAU DE PUIVERT LANGUEDOC
Freitag, 6. Juni
Kaum ein Wind ging.
Minou legte die langen, hellen Finger an die Schläfen und drückte. Ihr Kopf pochte unverdrossen weiter. Das nahende Unwetter spürte sie als Prickeln ihrer Haut und als Schweißfilm an ihrer Kehle.
Ihre Familie versammelte sich, um ihre Entscheidung zu hören. Länger konnte sie es nicht hinauszögern, und dennoch war sie unschlüssig. Minou sah sich auf der Musikantengalerie um. Der vertraute Ort beruhigte ihr Gemüt, aber als sie sich wieder dem Fenster zuwandte und die schwarzen Gewitterwolken sah, die sich über dem Tal ballten, stieg ihr das Unbehagen in die Brust.
Was sollte sie nur tun?
Minou lockerte den hohen Kragen. Zwischen Fingern und Daumen fühlte sich der Brokat steif an. Solche Unentschiedenheit sah ihr gar nicht ähnlich. Vielleicht lag es an der Anwesenheit der Familie, die dunkle Erinnerungen an das letzte Mal weckte, als sie alle zusammen in Puivert gewesen waren.
»Les phantômes d’été«, murmelte sie – die Gespenster des Sommers.
Blut, Sehnen und Bein. Der Stoß des Schwertes, das Schwingen des Seils, das Brüllen des Feuers, als die Flammen den Wald im Norden ergriffen. Zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang hatten sie viele verloren.
Zehn Jahre lag jene Nacht zurück. Neues Grün gedieh an der Stelle der schwarzen, verkohlten Baumstämme, weiches Licht sprenkelte die neuen Wege zwischen den Bäumen. Im Frühjahr hatte ein Teppich aus rosaroten und gelben Waldblumen geblüht. Doch auch wenn das Land die Narben der Tragödie nicht mehr trug, bei Minou war es anders. Stets begleitete sie der Schrecken über das, was sie tief in sich beobachtet hatte, wie ein Glassplitter, der sich im Fleisch verschob. Nie hatte sie vergessen, wie nahe der Tod ihr und den Ihren gekommen war. Wie sein Atem ihr die Wange versengte.
Deshalb hatte sie ihre ganze Familie zu einem Gedenkgottesdienst eingeladen, der in der Kapelle stattfinden sollte, um den Jahrestag zu begehen und die Vergangenheit ein für alle Mal zur Ruhe zu betten. Hinterher war Minou allein in den Wald gegangen und hatte Blumen auf das überwucherte Grab der letzten Châtelaine von Puivert gelegt. Andere Gaben hatte sie dort gesehen, Gedichte und Fetzen bunter Bänder für die alte Burgherrin. Ein Gebet auf Latein. Denn obwohl die Burg nun eine hugenottische Enklave war, hingen viele im umgebenden Land weiterhin dem alten katholischen Glauben an. Die gut besuchte Église Saint-Marcel im Dorf Puivert unterhalb der Burg bewies es.
Als wollte sie ihre Gedanken bekräftigen, läutete die Glocke dieser Kirche in diesem Moment zur vollen Stunde. Minou nahm ihr Tagebuch in die Hand. Sie folgte der Gewohnheit, am Nachmittag zu schreiben, und trug Pergament und Tinte hoch zum offenen Aussichtspunkt auf dem Dach des Donjons, des Wohnturms. Auf diese Weise verband sie das Mädchen von früher mit der Frau, zu der sie geworden war. Obwohl die Pflicht rief, gestattete sie sich noch einige Momente des Alleinseins. Schreiben half ihr, Sinn in der Welt zu erkennen, ein Bekenntnis zu dem Leben, wie sie es führte. Wenn alles andere nicht half, beruhigte das Schreiben ihre widerstreitenden Gedanken.
Minou verließ den Raum und stieg die schmale Steintreppe zum Dach hoch, deren Stufen durch die Füße von Generationen ausgetreten waren. Am engen Absatz unter dem Dach des Donjons nahm sie ihren alten grünen Reisemantel von seinem Haken neben der Tür, hob die Verriegelung und wollte gerade aufs Dach hinaustreten, als unten eine helle Stimme erklang.
»Maman!«
Mit dem Gefühl, ertappt worden zu sein, drehte sie sich rasch um.
»Je suis ici, petite.« – Hier bin ich, Kleine.
Minou hörte Schritte, und im Stockwerk unter ihr erschien das forschende Gesicht ihrer siebenjährigen Tochter. Marta ruhte niemals, weder geistig noch körperlich. Immer hatte sie es eilig, immer war sie voll Ungeduld. Wie gewöhnlich hielt sie ihre Leinenhaube, bestickt mit ihren Initialen, zerdrückt in der Hand.
»Maman, wo bist du?«
Minou nahm die Finger von der Verriegelung. »Hier oben.«
»Ah.« Marta spähte ins Halbdunkel und nickte. »Jetzt sehe ich dich. Papa sagt, es ist Zeit. Vier Uhr ist vorbei. Alle warten in der Kemenate.«
»Richte Papa aus, dass ich gleich dort sein werde.«
Hörbar holte Marta Luft, um etwas einzuwenden, aber ausnahmsweise sah sie davon ab.
»Oui, Maman.«
»Wo wir dabei sind, Marta, könntest du Papa auch bitten …«
Doch nur das Echo der eigenen Stimme antwortete Minou. Ihre quecksilbrige Tochter war schon verschwunden.
WALD VON PUIVERT
Der Mörder kauerte im Gestrüpp, Finger und Daumen schussbereit um die Radschlosspistole gelegt. Sein Blick war auf den höchsten Punkt der Burg gerichtet.
Er war bereit, war es seit dem ersten Licht. Er hatte gebeichtet und um Erlösung gebetet. Er hatte seine Gabe auf das Grab der vorherigen Châtelaine im Wald gelegt, einer frommen und gottesfürchtigen katholischen Edelfrau, die von hugenottischem Ungeziefer ermordet worden war. Seine Seele war rein. Er hatte gebeichtet.
Er war bereit zu töten.
Heute würde er Puivert vom Krebs der Ketzerei befreien, und dafür würde man ihn segnen. Er würde das Land säubern. Zehn Jahre lang hatte die protestantische Erbschleicherin das Château de Puivert mit Kriegsflüchtlingen gefüllt. Sie hatte Ketzern eine Zuflucht geboten, die ins Feuer der Hölle getrieben werden sollten, und den wahren Katholiken, die auf die Burg gehörten, das Essen weggenommen.
Genug war genug. Heute würde er seinen Eid erfüllen. Bald würden die Glocken der Burg wieder zur heiligen Messe rufen.
»Eine Ketzerin sollst du nicht leben lassen.«
Hatte der Priester in Carcassonne nicht genau diese Worte von der Kanzel gepredigt? Hatte er ihn nicht mit seinen stechenden Augen angeblickt, ihn aus der ganzen Gemeinde auserwählt, Gottes Befehl zu erfüllen? Hatte er ihn nicht gesegnet und ihm die Mittel verschafft?
Die rechte Hand des Mörders krampfte sich fester um die Pistole, während er die linke in die schwere Tasche schob, die neben dem Rosenkranz an seinem Gürtel hing. Auch wenn die größte Belohnung für seine christlichste Tat ihm erst im Leben nach dem Tod winkte, war es nur gerecht, dass er auf Erden einen Vorschuss erhielt.
Der Mann kreiste die Schultern und lockerte die Finger. Geduldig zu sein gehörte zu seinen Fähigkeiten. Er war ein Wilderer, er verstand es, seine Beute zu verfolgen und zur Strecke zu bringen. Der blutige Sack zu seinen Füßen zeugte von seinem Geschick. Ein Hase und ein ganzer Rattenbau. Die Küchengärten in der Hochburg zogen alle möglichen Nagetiere an. Es wäre eine Sünde gewesen, seine Anwesenheit dort nicht zu nutzen.
Der Mörder veränderte seine Stellung, als er merkte, wie die angespannten Muskeln in seinem rechten Oberschenkel zuckten. Durch das Dach aus Grün blickte er nach oben. Dunkle Wolken verhüllten die Sonne, und er hörte, wie die einzelne Glocke im Dorf zur Stunde schlug. Die Hugenottenhure pflegte zu dieser Nachmittagszeit auf dem Donjon Luft zu schnappen, warum also zeigte sie sich ausgerechnet heute nicht?
Er lauschte aufmerksam auf das leiseste Geräusch, hoffte auf das Knarren der hölzernen Tür. Er hörte nichts bis auf das ferne Donnergrollen in den Bergen und das Rascheln kleiner Tiere an den Hängen der Strauchheide hinter dem Wald.
Es war Gottes Wille, dass die Ketzerin starb. Wenn nicht heute, dann morgen. Frankreich würde nie wieder groß werden, ehe der letzte Protestant aus seinen Grenzen vertrieben war. Sie waren der Feind im Innern. Mann, Frau, Kind – es war gleichgültig. Tot, eingekerkert, vertrieben – es war gleichgültig. Wichtig war nur, die Wunde auszubrennen.
Der Mörder lehnte sich zurück und wartete auf sein Opfer. Zu seinen Füßen tränkte das Blut seiner Beute den Jutesack und färbte das grüne Gras rot.
KAPITEL 3
SAINT-ANTONIN QUERCY
In der ausgebrannten Ruine des Augustinerklosters stand ein Knabe schweigend im Schatten der geschwärzten Kirchenmauern, in denen so viele Katholiken gestorben waren. In seinen Träumen hörte er ihre Schreie noch immer. Vor sich sah er das blutüberströmte Gesicht der Frau, die ihm mit gebrochener Stimme befahl, zu fliehen und sich zu retten.
Bei jedem Wort, das der Priester zum Kardinal sprach, der auf den geborstenen Stufen vor ihnen stand, bohrte er dem Jungen die dünnen Finger fest in die schmalen Schultern, drückte und stach. Der Knabe verstand nicht, weshalb ihm befohlen worden war, seine wenigen Habseligkeiten zu packen, oder zu welchem Zweck er in die Kirchenruine gebracht worden war; aber wusste er, dass etwas Wichtiges bevorstand.
»Ich hätte nicht so kühn sein dürfen, Euch Eure Zeit zu rauben, Eure Eminenz«, stotterte der Priester. »Ich bitte Euch um Verzeihung.«
Speicheltröpfchen trafen den Jungen im Nacken. Die Spritzer liefen zwischen seiner Mütze und seinem Kragen hinunter. Er rührte sich nicht. Wenn er dem Stock auf dem bloßen Rücken und dem Kuss des Feuers an den nackten Beinen standhalten konnte, hielt er auch dies hier aus.
»Ich hätte mich nicht aufgedrängt, hätte ich es nicht als meine Pflicht empfunden, Euch in Kenntnis zu setzen …«
»Solch frommes Pflichtgefühl ist in unseren dunklen Zeiten lobenswert«, sagte der Kardinal.
Zum ersten Mal hatte der Besucher gesprochen, und der Junge musste sich beherrschen, um den Blick gesenkt zu halten und dem Fremden nicht ins Gesicht zu sehen. Eine Stimme voll Würde, voll Autorität und Macht.
»Selbstverständlich können sich Eminenz auf meine Diskretion verlassen …«
»Selbstverständlich.«
»… aber das große Glück Eurer Gegenwart in unserer gebeutelten Stadt ist die Antwort auf unsere Gebete. Ein Zeichen Gottes. Dass jemand Eurer Stellung …«
»Wer sonst weiß von dieser Angelegenheit?«
»Niemand«, versicherte der Priester hastig. Seine Finger zuckten so heftig, dass der Junge sofort dachte: Er lügt.
»Soso«, sagte der Besucher trocken.
»Wir haben gelernt, den Mund zu halten. In diesem Teil Frankreichs, in dieser gottlosen Stadt sind wir Ausgestoßene. Geächtete. Ein falsches Wort, und die Hugenottenhunde stehen vor unserer Tür. Wir sind so nahe bei Montauban. So viele Katholiken wurden geopfert.«
Die Stimme des Besuchers wurde nicht weicher. »Solange Ihr an Gottes Geboten festhaltet, wird der Herr die Rechtschaffenen beschützen.«
»Ja, natürlich, Eminenz.« Der Knabe spürte, wie der Priester innehielt, wie er einatmete. »Zugleich würde Eure Großzügigkeit unserer versteckten Gemeinde zugutekommen.«
»Ah, nun kommt es zur Sprache«, murmelte der Kardinal.
»Eminenz müssen verstehen, nur so können wir weiterhin den Gläubigen, die in Angst leben, das Wort Gottes verkünden.«
Wieder spritzte Speichel in den Nacken des Jungen. Diesmal konnte er sich nicht beherrschen und erschauerte.
»Oh, täuscht Euch nicht«, erwiderte der Kardinal kalt. »Ich verstehe gut.«
Einen Moment lang herrschte Schweigen. Der Junge zwang sich, den Blick weiter auf den Boden gerichtet zu halten: ein Quadrat aus trockener Erde, verstreute weiße Kiesel, niedergetrampelte Grashalme. Der Besucher bewegte sich, und der Junge erhaschte einen Blick auf den roten Saum seines Gewands aus feinem Tuch und die dunklen bestickten Schuhe, auf deren Spitzen kein einziges Staubkorn zu sehen war.
»Ihr braucht nicht zu befürchten, dass es weitere Appelle an Eure Wohltätigkeit geben könnte«, fügte der Priester in dem Versuch hinzu, seinen Vorteil auszubauen.
Der Besucher atmete aus. »Davor fürchte ich mich nicht.«
»Nein, Eminenz?«
»Ihr seid ein wahrhaft gläubiger Mann, richtig? Ein Mann, der zu seinem Wort steht.«
»Ich bin in Saint-Antonin als höchst fromm bekannt.«
Der Junge merkte der Stimme des Priesters die Eitelkeit an und wunderte sich darüber. Merkte er denn nicht, dass ihm nicht geschmeichelt, sondern dass er verspottet wurde? Er war ein heimtückischer, erfinderischer Mann und zugleich ein Narr. Im nächsten Augenblick stach ihm die Hand des Priesters von hinten ins Kreuz.
»Der Junge ist stark und gesund. Von edler Abstammung.«
»Welchen Beweis habt Ihr dafür?«
»Diesen.« Der Junge spürte, wie ihm die Mütze vom Kopf gezogen wurde. »Und die Beichte seiner Mutter.«
Nun spürte er den Blick des Besuchers mit ganzer Macht auf sich.
»Sieh mich an, Junge. Du brauchst keine Angst zu haben.«
Er hob den Kopf und sah dem Fremden zum ersten Mal ins Gesicht. Groß, mit bleicher Haut und dunklen Brauen, verbarg er das rote Gewand eines Kardinals fast vollständig unter einem schwarzen Kapuzenmantel. Der Junge hatte ihn noch nie zuvor gesehen.
Und trotzdem: Da war etwas.
»Ich habe keine Angst, Eminenz«, log er.
»Wie alt bist du?«
»Er hat neun Sommer gesehen«, antwortete der Priester.
»Lasst ihn für sich selbst sprechen. Er hat schließlich eine Zunge im Mund.«
Zum Erstaunen des Jungen zog der Besucher einen seiner ledernen Handschuhe aus und berührte ihn an der weißen Strähne in seinen Haaren, der Hauptursache, weshalb man ihn so schlecht behandelte. Ein Teufelsmal nannten sie es, ein Pestzeichen. Zahllose Geistliche hatten versucht, es ihm zu nehmen, indem sie ihm die Haare ausrupften. Stets waren sie weißer als zuvor nachgewachsen. Der Besucher rieb Daumen und Zeigefinger aneinander, zog den Handschuh wieder über und nickte.
»Keine Kreide, Eminenz. Niemand beabsichtigt hier eine Täuschung.«
Der Besucher ließ sich nicht anmerken, dass er zugehört hatte, er griff nur in sein Gewand und holte einen kleinen Jutebeutel heraus. Der Priester riss habgierig die Augen auf.
»Über diese Angelegenheit wird kein weiteres Wort verloren.«
»Selbstverständlich, Eure Eminenz. Die Mutter des Jungen ist bei seiner Geburt gestorben. Er ist mit der Liebe und Zuneigung unserer heiligen Mutter Kirche aufgewachsen. Wir lassen ihn nur mit großem Bedauern gehen.«
Der Besucher ging nicht auf die Worte ein.
»Willst du mit mir kommen, Junge? Willst du mir dienen?«
Der Junge dachte an den schwammigen weißen Leib des Priesters und das schrumplige Glied, das ihm zwischen den dürren Beinen hing, an das stille Weinen der anderen Jungen, die nicht begriffen, dass sie, wenn sie Schwäche zeigten, nur zu größerer Grausamkeit ermutigten.
»Jawohl, Herr.«
Ein schwaches Lächeln zuckte über das Gesicht des Besuchers. »Nun gut. Wenn du mir dienen möchtest, sollte ich deinen Namen kennen.«
»Volusien ist der Name, den meine Mutter mir gegeben hat.«
»Aber er wird Louis genannt«, unterbrach der Priester. »Sein Vormund hielt das bei einem Kind seiner unerfreulichen Situation für angebracht.«
Der Besucher kniff die Augen zusammen. »Unerfreulich?«
Der Junge sah, wie der Priester wütend errötete, und wunderte sich darüber, doch nun streckte der Besucher den Beutel vor. Der Priester griff mit gieriger Hand danach, aber im letzten Augenblick – zu rasch, als dass Louis sicher sagen konnte, ob es mit Absicht oder aus Unachtsamkeit geschah – ließ der Besucher den Beutel zu Boden fallen. Die Münzen klirrten hell, als er auf die Erde prallte und sie herausgeschleudert wurden.
»Komm, Junge.«
Er zögerte, gefangen zwischen Aufregung und Angst. »Ich soll Euch nun begleiten, Herr?«
»Das sollst du.« Der Kardinal drehte sich um und ging.
Louis stand gebannt vor seinem Peiniger, der auf den Knien sein Blutgeld aufsammelte, und begriff, dass er nichts empfand. Welches Mitleid oder Erbarmen Louis einmal besessen haben mochte, es war im Waisenhaus aus ihm herausgeprügelt worden. Er empfand nicht einmal Abscheu.
Er rannte los, um den Kardinal einzuholen. Sollte er Reitknecht oder Page werden? Geträumt hatte er zwar davon, aber nie erwartet, dass solche Wünsche in Erfüllung gingen. Seine Mutter hatte er nie gekannt – er wusste nur, dass die Umstände seiner Geburt von Schande überschattet waren, die Fürsorge seiner Vormünder stets von Widerwillen geprägt.
Als sie um die Ecke der niedergebrannten Kirche bogen, traten zwei Männer aus den Schatten. Ihre Gesichter waren hinter vorgebundenen Tüchern verborgen, und in den Händen hielten sie blanke Klingen. Louis hob sofort die Fäuste, bereit, seinen neuen Herrn zu verteidigen, doch der Kardinal legte ihm nur schwer die Hand auf den Kopf, als segnete er ihn.
Sein neuer Herr nickte.
Die Männer gingen an ihnen vorbei und verschwanden um die Ecke. Nur Augenblicke später hörte Louis einen Laut, der halb wie ein Quietschen, halb wie ein Grunzen klang. Danach herrschte Stille. Der Besucher blieb kurz stehen, als wollte er sich vergewissern, dann ging er weiter zu einer Kutsche mit zwei Pferden.
»Komm, Junge.«
»Zu Befehl.«
Louis hatte zwar noch nie Saint-Antonin verlassen und keinerlei Schulbildung erhalten, aber er hatte einen scharfen Verstand. Er beobachtete, und er hörte zu. Deshalb erkannte er in diesem außergewöhnlichen Moment an diesem außergewöhnlichen Tag auf der Kutsche das Distelwappen und die Farben des Herzogs von Guise.
Seine Gedanken überschlugen sich, und er grübelte, ob das Elend, das er kannte, bald durch etwas Schlimmeres ersetzt wurde. Er hatte keine andere Wahl, als mitzugehen. Trotz allem fand er, als er in die Kutsche stieg, den Mut, eine weitere Frage zu stellen.
»Wie soll ich Euch anreden? Ich möchte Euch nicht durch meine Unwissenheit kränken.«
Der Kardinal lächelte kalt. »Wir werden sehen, Volusien, bekannt als Louis. Wir werden sehen.«
KAPITEL 4
CHÂTEAU DE PUIVERT LANGUEDOC
Minou hörte das erste Donnergrollen, als sie die schmale Treppe im Donjon hinuntereilte. Sie konnte kaum glauben, wie die Zeit dahingeflogen war. Sie hatte nur wenige Minuten schreiben wollen, doch nun war nahezu eine ganze Stunde vergangen.
Die Nachmittagsschatten waren länger geworden, und die drückende frühe Hitze des Tages war einer stillen Kühle gewichen. Die Luft knisterte unter dem Eindruck von Bedrohung und Gefahr. Minou schüttelte ungeduldig den Kopf. Am Himmel stand keine Prophezeiung. Ein Sommergewitter in den Pyrenäen war zu dieser Jahreszeit alles andere als ungewöhnlich. Die Dorfbewohner neigten zwar dazu, jedes einzelne davon als Vorbote einer Katastrophe oder eines Richtspruchs zu betrachten, doch sie glaubte, dass es die Natur war und nicht Gottes Plan, die über die Gestalt der Welt bestimmte.
Minou blieb am unteren Ende der Treppe stehen und sah auf das Wappen, das über dem Haupteingang des Wohnturms in den Stein gemeißelt war, umgeben von den Buchstaben B und P für Bruyère und Puivert. Seit zehn Jahren war sie Marguerite de Bruyère, Châtelaine der Burg von Puivert, deren Ländereien und deren Bewohner. Die Familie Bruyère hatte den quadratischen Turm im dreizehnten Jahrhundert erbaut, und als sie ihr unerwartetes Erbe erhielt, hatte Minou den Namen als ihr Geburtsrecht angenommen. Obwohl sie mittlerweile das grüne Tal im Vorgebirge der mächtigen Pyrenäen liebte – und stolz war, eine Zuflucht für alle Anhänger des Reformierten Glaubens geschaffen zu haben, die sich der Verfolgung entziehen wollten –, der Titel bedeutete ihr nichts. Sie betrachtete sich als Verwalterin von Puivert, nichts weiter.
Ihr Ehename Reydon war ein Geschenk ihres Gatten Piet, eine Gabe seines französischen Vaters, den er nie kennengelernt hatte. Seine Zuneigung galt seiner holländischen Mutter, die vor dreißig Jahren gestorben war. Ihre Tochter Marta war nach ihr benannt.
In Wahrheit fühlte sie sich noch immer als Minou Joubert, und das würde auch immer so bleiben. Dieser Name zeichnete das genauste Bild von der Frau, die sie war.
Im Wald jenseits der Burgmauern fuhr der Mörder aus dem Schlaf hoch, die Pistole noch immer in der Hand. Donnergrollen ertönte.
Hatte er sein Opfer verpasst?
Er warf einen Blick hoch zum Donjon. Dort war niemand zu sehen. Nichts von dem grünen Mantel. Die Tür zum Dach war nach wie vor geschlossen. Er rieb sich das Gesicht mit schmutziger Hand und erstarrte, als er noch ein Geräusch hörte. Diesmal kam es aus dem Unterholz hinter ihm. Er legte die Pistole hin und näherte die Hand langsam dem Jagdmesser, das er an der Hüfte trug.
Er kniff die Augen zusammen. Der Hase spürte die Gefahr, hob die Ohren und machte kehrt. Zu langsam und zu spät. Das Messer flog durch die Luft und traf das Tier in den weichen, weißen Bauch. Der Mörder sammelte die Beute ein und zog die Waffe heraus. Gedärme quollen aus dem zertrennten Fell.
Er ergriff das Tier beim Nacken und steckte es, eine Blutspur am Boden hinterlassend, in seinen Sack. Ob die Protestantenhure sich heute Nachmittag nun zeigte oder nicht, alles in allem hatte er ein gutes Tagwerk verrichtet.
Der Mörder wischte das Messer am Ärmel seiner Jacke ab und trank einen Schluck Bier. Nachdem er geprüft hatte, dass sein Kästchen mit dem Schießpulver und den Kugeln noch trocken war, setzte er sich wieder, um zu warten.
Der Nachmittag war noch nicht vorüber. Mehrere Stunden gutes Licht erwarteten ihn. Es war fast der längste Tag im Jahr.
Minou sammelte sich und blickte über den Burghof zum Hauptgebäude, in dem ihre Familie wohnte, als sich die Tür öffnete und ihr Mann herauskam.
»Minou! Endlich! Es ist beinahe fünf Uhr.«
Sie eilte zu ihm und streckte die Hände aus. »Es tut mir leid.«
Piet runzelte die Stirn. »Wir haben alle in der Kemenate auf dich gewartet.«
»Ich weiß.« Sie küsste ihn auf die Wange. »Ich habe geschrieben und die Zeit vergessen. Vergibst du mir?«
Seine Miene wurde nachsichtig. »Als wüsste ich nach all den Jahren nicht, was geschieht, wenn dich die Worte gefangen nehmen!«
»Mir tut es wirklich leid.«
Langsam gingen sie nebeneinanderher zum Haupthaus. Minou bemerkte ein Spinnennetz aus Fältchen um die Augen ihres Mannes. Er ließ die Schultern hängen, und sie fragte sich, was ihn bedrückte. Die Musik von Piets Herz kannte sie so gut wie die ihres eigenen. In den letzten Wochen – oder nein, schon länger – hatte sie gespürt, wie Distanz zwischen ihnen entstanden war. Er hatte mehrere ungeplante Reisen nach Carcassonne unternommen, und in letzter Zeit behielt er seine geheimsten Gedanken für sich.
»Wie geht es dir, mein Geliebter?«, fragte sie leichthin.
»Alles ist gut«, antwortete er, aber im Kopf war er woanders, das konnte jeder sehen.
Nach der Schlacht von Jarnac vor drei Jahren – ein Gefecht, bei dem Piets Kampfarm verletzt worden war – war ihr Gatte gezwungen gewesen, das Schwert abzulegen und andere Wege zu suchen, seiner Sache zu dienen. Er hatte ein Netz von Kurieren ins Leben gerufen, die vertrauliche Nachrichten überbrachten, flüchtigen Brüdern und Schwestern sicheres Geleit aus katholischen Städten in hugenottische Enklaven verschafft und erhebliche Mittel eingeworben, um die rebellierenden calvinistischen Kräfte in den Niederländischen Provinzen zu unterstützen.
Die Berichte über den protestantischen Aufstand dort hatte Piet mit großer Aufmerksamkeit verfolgt. Als die Nachricht vom Erfolg der Wassergeusen gegen die spanischen Kräfte im Norden Puivert erreichte, hatte Minou ihm angemerkt, wie sehr es ihn schmerzte, nicht an der Seite der »Bettler zur See« auf dem Schlachtfeld stehen zu können, besonders jetzt, da Amsterdam zwischen altem und neuem Glauben schwankte.
Sie sah ihn an. Minou hatte angenommen, er habe sich mit seiner Lage abgefunden, doch vielleicht irrte sie sich. Deshalb war ihre Entscheidung, was Paris anbetraf, so wichtig. Paris böte Piet nicht nur die Gelegenheit, viele alte Kameraden wiederzusehen, sondern auch erneut im Zentrum des Geschehens zu stehen. So Gott es wollte, gab das Abenteuer ihrem Mann etwas von dem wieder, was er verloren hatte.
»Hast du dich entschieden, Minou?«, fragte er, als sie die Schwelle des Hauses erreichten.
»Das habe ich«, log sie.
Donner ertönte über den fernen Gipfeln.
»Bist du dir sicher? Wir können noch warten, falls …«
Minou drückte seinen Arm. Die Hoffnung in seiner Stimme berührte sie. »Du wartest schon zu lange, Geliebter. Der Jahrestag ist gekommen und vergangen, alles hat sich hier versammelt.« Wieder hörten sie trockenes Donnergrollen und den Ruf eines Kuckucks. »Da. Es gibt keinen besseren Herold, der die Ankunft des Sommers verkündet. Bevor die Nacht einbricht, wird es regnen.«
Sie hörte, wie er tief Luft holte. »Minou, bevor wir hineingehen, muss ich dir etwas sagen … etwas, das ich dir schon eine ganze Weile beichten wollte.«
Minous Herz schlug schneller. »Du kannst mir alles sagen, das weißt du doch.«
»Vor einigen Wochen erfuhr ich …«
»Maman!«, rief ihre Tochter in diesem Moment und streckte sich gefährlich weit aus dem Erker über dem Burghof. »Beeil dich! Wir sind alle schon das Warten leid!«
»Marta!« Minou scheuchte sie mit der Hand zurück. »Das ist gefährlich, sich so weit aus dem Fenster zu lehnen. Geh wieder hinein.«
»Dann komm schnell.«
»Wir sind gleich bei euch.«
Minou wandte sich Piet wieder zu. »Wirklich, Marta ist zu waghalsig. Richtig furchtlos.« Sie legte ihm die Hand auf die Wange, spürte die Stoppeln seines gestutzten roten Barts, in den sich nun Grau mischte, rau unter ihren Fingern. »Was wolltest du mir sagen, mon cœur?«
Piet lächelte. »Ach, egal. Das kann warten. Wir wurden gerufen.«
Minou lachte. »Mademoiselle Marta kann sich noch einen Augenblick lang gedulden.«
»Nicht für alle Veilchen von Toulouse würde ich ihre Geduld länger auf die Probe stellen. Wir sollten hineingehen.«
Wenn Minou zurückblickte in den Monaten und endlosen Jahren, die folgen sollten, betrachtete sie dieses erste leise Missverständnis als den Wendepunkt, diesen einen Herzschlag der Zeit, von dem an – hätte nur Marta nicht gerufen – eine andere Geschichte erzählt worden wäre.
Doch wie hätte sich Minou an jenem Junitag, als sie mit Piet im Hof der Hochburg des Château von Puivert stand, auch vorstellen sollen, dass all die Not und der Schmerz, den sie in der Vergangenheit erlitten hatte, neben dem Verlust und der Verzweiflung, die sie noch erwarteten, zu nichts verblassen würden.
KAPITEL 5
Die Kemenate, der Hauptwohnraum der Familie, erstreckte sich auf ganzer Länge im ersten Stock des Haupthauses der Burg. Der große behagliche Saal profitierte vom besten Nachmittagslicht und gehörte zu den ersten Veränderungen, die sie vorgenommen hatte, nachdem die Burg in ihren Besitz übergegangen war. Minou hatte etliche Trennwände einreißen und die Treppen und Korridore neu anordnen lassen, damit keine Erinnerungen an den alten Wohnraum zurückblieben – und die schrecklichen Taten, die darin stattgefunden hatten.
Durch drei hohe Fenster mit Doppelflügeln, jedes von Brokatvorhängen umgeben, blickte man über den Hof der Burg nach Süden. Über der Tür hing an einer Messingstange ein schwerer Vorhang. Im Sommer wurde er mit einem dicken Seil zur Seite gebunden, im Winter, wenn aus den Bergen der eisige Wind pfiff, blieb er geschlossen. Links und rechts vom Kalksteinkamin standen hölzerne Sitzbänke im rechten Winkel zueinander, davor mehrere gepolsterte Fußhocker und Stühle mit hohen Lehnen. Das andere Ende des Raumes nahm ein großer Esstisch aus Nussbaum mit zwei langen Bänken ein. An den Wänden standen eine Anrichte und zur Aufbewahrung von Tafelgeschirr und Tischwäsche eine Truhe.
Die Wandbehänge waren es, die dem Raum seinen besonderen Charakter verliehen. Vom Boden bis zur Decke bedeckten zwei Gobelins die Wände, die Minou bei einem hugenottischen Weber in Carcassonne in Auftrag gegeben hatte: Einer stellte Puivert dar, der andere war eine künstlerische Anmutung des Begijnhofs, der frommen Gemeinschaft in Amsterdam, die sich zwischen Singel und Kalverstraat zwängte. Ein dritter, viel kleinerer Gobelin zeigte ein Familienporträt und war im vergangenen Winter fertiggestellt worden.
Als Minou mit Piet auf der Schwelle stehenblieb, genoss sie einen Moment lang den Anblick ihrer Lieben, die sich unbeobachtet wähnten: ihr Vater, Bernard Joubert, dessen alte Augen nun getrübt und blicklos waren, während seine Weisheit wie eh und je hell und klar strahlte, und ihre siebzehnjährige Schwester Alis mit dem dunklen Teint des Midi, die ihre wilden schwarzen Locken zähmte, indem sie sie zu einem langen Zopf flocht. Ihr derber, stämmiger Körperbau verriet mehr Kraft als Anmut. Ihr Bruder Aimeric war ebenfalls stämmig und stark, und obwohl er dreiundzwanzig Jahre alt war, glich er Alis so sehr, dass man sie für Zwillinge halten konnte. Er stand im Gespräch mit ihrer Tante Salvadora, deren Doppelkinn unter der schwarzen Witwenhaube wabbelte. Marta und der zwei Jahre alte Jean-Jacques hörten gespannt zu, wie ihr Großvater eine Geschichte von Rittern und dem Hof in Carcassonne aus alter Zeit erzählte, die Minou aus ihrer eigenen Kindheit kannte.
Während ihre Tochter vom Äußeren her Minou nachkam – nicht zuletzt hatte sie die ungleichen Augen, eins blau, das andere braun –, ähnelte ihr Sohn Piet und dessen Mutter: Mit seinen rostroten Haaren, grünen Augen und der sommersprossigen Haut kam er kaum nach seinen französischen Vorfahren.
Das Knarren eines lockeren Bodenbretts verriet ihre Anwesenheit.
»Enfin!«, rief Marta und sprang vom Fenstersitz. »Wir warten schon ewig auf euch.«
»Du musst lernen, geduldiger zu sein, petite«, entgegnete Minou liebevoll.
»Tante Salvadora sagt, dass im Louvre, im Königspalast, die meisten edlen Damen Röcke tragen, die so weit sind.« Marta breitete die Arme aus. »Zu groß, um durch eine Tür zu passen, man muss sich seitlich durchquetschen. Stimmt das wirklich? Denn wie sollen …«
»Das habe ich überhaupt nicht gesagt«, wandte Salvadora ein. »Ich wollte erklären, inwiefern die Mode bei Hof die Eleganz und Größe der Krone widerspiegeln sollte. Unser edler König – und seine Schwester und seine Brüder – stellen das Beste an Frankreich dar, und deshalb müssen sie auf den Eindruck achten, den sie vermitteln. Auf ihren Porträts ebenso wie in ihrem täglichen Leben.«
Minou sah, wie Aimeric und Alis einen Blick wechselten. Sie hatten für den Valoishof nichts übrig. Mit Tante Salvadora verhielt es sich anders. Trotz ihrer Zuneigung für ihre Nichten und ihren Neffen – die durchaus erwidert wurde – hielt sie an dem alten Glauben fest, in dem sie erzogen worden war. Trotz der Gerüchte über König Charles IX., seine Wutanfälle und seine angeschlagene Gesundheit – ganz zu schweigen von der allgemein bekannten Tatsache, dass bei Hofe in Wirklichkeit die Königinmutter Caterina de’ Medici herrschte –, wollte sie kein schlechtes Wort über die königliche Familie hören. Ihre Bewunderung blieb unerschütterlich.
»Die Damen und Herren am Pariser Hof tragen zu offiziellen Anlässen elegante Garderobe, aber im Alltag kleiden sie sich genauso wie wir mit weniger Pracht.« Minou wies auf das kunstvolle Familienporträt an der Wand. »Papa trägt nie sein blaues Wams mit den silbernen Schlitzen, es sei denn zu besonderen Anlässen, nicht wahr?«
Marta, die sich mit ihren sieben Jahren für weise hielt, sagte nachdenklich: »Und ich nicht meine juwelenbesetze Haube. Die ist nur für besondere Tage.«
»Genau.« Minou strich ihrer Tochter über die Wange. »Und im Louvre ist es genauso.«
Das Kind nickte. »Es ist klug, wenn sogar Königinnen und Prinzessinnen Alltagskleider haben, denn wie sollten sie sonst spielen können?«
Alle lachten, sogar Salvadora, und Minou empfand eine Welle der Dankbarkeit für die Liebe und Gemeinschaft, die sie teilten. Sie sah wieder zum Gobelin. Piet und sie saßen in Goldfäden gekleidet, mit Silber, Perlen und Juwelen geschmückt. Auf Kissen vor ihnen saß Marta mit ihrer weißgebleichten Haube neben dem zweijährigen Jean-Jacques in Samthose und mit hölzerner Rassel. Die Farben strahlten, die Stickerei war voller Leben und Bewegung. Obwohl der Gobelin nicht größer war als das Tuch einer Dame, hatte Minou ihn am liebsten. Von allen Wandbehängen verriet er am meisten, wer sie waren.
Sollten sie all das für Paris riskieren?
Minou straffte sich, als der Gedanke ihr in den Sinn kam. Gewiss, die Reise wäre lang. Gewiss, das beständige Muster ihres Lebens, das sie sich mit Mühe erkämpft hatten, würde gestört. Aber welche Entbehrungen sie auch auf sich nehmen müssten, Paris mit eigenen Augen zu sehen würde es doch gewiss aufwiegen? Vor den mächtigen Türmen der Kathedrale Notre-Dame zu stehen und zuzusehen, wie Geschichte geschrieben wurde, war eine Ehre, die man sich nicht entgehen lassen sollte.
Minou spürte deutlich, dass Piet sie nicht aus den Augen ließ. Kein Mann hätte sich stärker bemühen können, eine Botschaft der Toleranz zu verbreiten oder zu versuchen, eine gemeinsame Grundlage für Menschen unterschiedlichen Glaubens zu schaffen. Ihr Gatte glaubte nicht nur fest daran, dass ein dauerhafter Friede möglich war, sondern auch, dass die Mehrheit der Männer und Frauen in Frankreich – ob Katholiken oder Hugenotten – diesen Frieden wirklich wollten. Zum Beweis führte er die eigene Familie an. Während Bernard wie Salvadora beim alten Glauben blieben, hatten Minou und Piet ihre Kinder nach den Vorstellungen der Reformierten Kirche erzogen. Wenn es ihrer Familie gelang, nach mehr als einem Jahrzehnt Bürgerkrieg die gegenseitigen Unterschiede zu achten, warum nicht auch die anderen?
»Minou«, sagte Piet leichthin, »sprichst du?«
Er lächelte, und selbst nach zehn Jahren Ehe sang ihr Herz. Die Unsicherheit fiel von ihr ab. Welche Zweifel sie auch hegte, sie schuldete es ihrem Mann, in Paris an seiner Seite zu sein.
KAPITEL 6
»Ich danke euch für eure Geduld.« Minou sah alle nacheinander an. »Und ich bitte um eure Nachsicht für mein schlechtes Zeitgefühl.«
Beim Klang ihrer Stimme verstummten alle. Bernard drehte sich in seinem Sessel. Tante Salvadora klappte ihren Fächer zusammen und legte ihn auf ihren Schoß. Alis ließ das Auf- und Abgehen und stellte sich neben Aimeric. Selbst der kleine Jean-Jacques spürte die Feierlichkeit des Augenblicks und hörte auf, mit den pummeligen Füßchen zu treten, als Marta neben das Kindermädchen auf die Bank sprang und ihrem Bruder zuflüsterte, leise zu sein.
»Ich bin auch dankbar, dass niemand …« – Minou sah ihre Tochter an – »fast