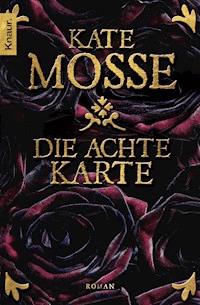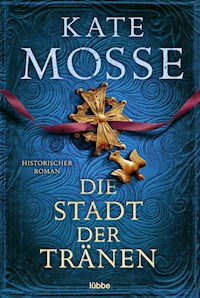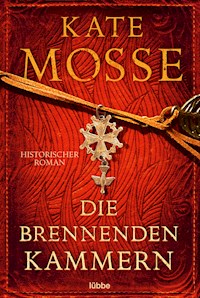
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lübbe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Carcassonne, 1562: Minou Joubert wächst als Tochter eines katholischen Buchhändlers auf. Eines Tages erhält sie einen versiegelten Brief mit den Worten: "Sie weiß, dass Ihr lebt." Noch bevor sie herausfinden kann, was hinter der mysteriösen Botschaft steckt, wird die Begegnung mit dem jungen Piet Reydon ihr Leben für immer verändern. Denn der Hugenotte hat eine gefährliche Mission, und er zählt auf Minous Hilfe, um aus der Stadt zu fliehen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 727
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Inhalt
Über das Buch
Carcassonne, 1526: Minou Joubert wächst als Tochter eines katholischen Buchhändlers auf. Eines Tages erhält sie einen versiegelten Brief mit den Worten: »Sie weiß, dass Ihr lebt.« Noch bevor sie herausfinden kann, was hinter der mysteriösen Botschaft steckt, wird die Begegnung mit dem jungen Piet Reydon ihr Leben für immer verändern. Denn der Hugenotte hat eine gefährliche Mission, und er zählt auf Minous Hilfe, um aus der Stadt zu fliehen.
Über die Autorin
Die britische Bestsellerautorin Kate Mosse lebt in Chichester (West Sussex) sowie in Carcassonne (Südfrankreich), wo auch ihr neuster Roman spielt. Ihre Bücher werden in 37 Sprachen übersetzt und erscheinen in 40 Ländern. Weltbekannt wurde sie mit dem internationalen Bestseller „Das verlorene Labyrinth“. Neben dem Schreiben ist sie in Rundfunk und Fernsehen aktiv und hat eine Gastprofessur and der University of Chichester inne. Außerdem ist sie die Gründerin des Women’s Prize for Fiction, dem wichtigsten Literaturpreis für Frauen im englischsprachigen Raum.
HISTORISCHER ROMAN
Übersetzung aus dem Englischenvon Dietmar Schmidt
Vollständige eBook-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Dieser Titel ist auch als Hörbuch erschienen
Titel der englischen Originalausgabe:
»The Burning Chambers«
Für die Originalausgabe:
Copyright © Mosse Associates Ltd 2018
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2020 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Katharina Rottenbacher, Berlin
Umschlaggestaltung: Johannes Wiebel / punchdesign, München
Einband- / Umschlagmotiv: RedDaxLuma/shutterstock.com; tofutyklein/shutterstock.com; Lava 4 images/shutterstock.com; osobystist/shutterstock.com; Vannaweb/shutterstock.com
eBook-Produktion: Dörlemann Satz, Lemförde
ISBN 978-3-7325-8636-3
www.luebbe.de
www.lesejury.de
Wie immer für meine Liebsten
Greg & Martha & Felix
Und auch für meine wunderbare Schwiegermutter
Granny Rosie
Die einzige Hoffnung, sonst Verzweiflung,
liegt in der Wahl zwischen Scheiterhaufen und Scheiterhaufen –
erlöst zu werden vom Feuer durchs Feuer.
T. S. Eliot, Little Gidding, Vier Quartette (1942)
Anmerkung zu den Hugenottenkriegen
Als Hugenottenkriege bezeichnet man eine Reihe von Bürgerkriegen in Frankreich, die nach jahrelang schwelenden Konflikten am 1. März 1562 begannen. Bei dem Blutbad von Wassy metzelten katholische Soldaten des Herzogs von Guise, François de Lorraine, unbewaffnete Hugenotten nieder. Die Hugenottenkriege endeten erst, nachdem mehrere Millionen Menschen getötet oder vertrieben worden waren, mit der Unterzeichnung des Edikts von Nantes durch Heinrich von Navarra, den protestantischen König Heinrich IV., am 13. April 1598. Der bekannteste Vorfall der Hugenottenkriege ist die Bartholomäusnacht in Paris, ein Massaker, das sich vom 23. auf den 24. August 1572 ereignete. Doch ähnliche Zwischenfälle geschahen in Städten und Dörfern in ganz Frankreich, darunter auch in Toulouse, wo zwischen dem 13. und 16. Mai 1562 über viertausend Menschen getötet wurden.
Bei seinem Inkrafttreten war das Edikt von Nantes weniger aufrichtiges Zeichen einer Sehnsucht nach religiöser Toleranz als vielmehr Ausdruck der Erschöpfung und des militärischen Stillstands. Es stiftete widerwilligen Frieden in einem Land, das sich über Fragen von Doktrin, Religion und Souveränität zerfleischt und in den Ruin getrieben hatte. Der Enkel Heinrichs IV., Ludwig XIV., hob in Fontainebleau am 22. Oktober 1685 das Edikt von Nantes auf und bewirkte damit den Auszug derjenigen Hugenotten, die in Frankreich geblieben waren.
Die Hugenotten umfassten nie mehr als ein Zehntel der französischen Bevölkerung, und dennoch übten sie einen bedeutenden Einfluss aus. Die Geschichte des französischen Protestantismus ist Teil der Geschichte der Reformation in Europa, die am 31. Oktober 1517 begann, als Martin Luther in Wittenberg seine 95 Thesen an die Kirchentür nagelte. Heinrich VIII. von England setzte sie ab 1536 mit der Auflösung der Klöster fort, der missionarische Evangelist Jean Calvin schuf 1541 in Genf eine sichere Zuflucht für französische Flüchtlinge und Ende der 1560er Jahre in Amsterdam und Rotterdam weitere sichere Schutzorte für Protestanten. In Frankreich standen im Mittelpunkt der Auseinandersetzungen das Recht, Gott in der eigenen Sprache zu verehren, die Ablehnung des Kults um Reliquien und Fürbitten, die Forderung, den Wortlaut der Bibel strenger auszulegen, der Wunsch nach schlichten Gottesdiensten auf Grundlage der Lebensregeln in der Heiligen Schrift, eine Verurteilung der Exzesse der katholischen Kirche, die viele als abstoßend empfanden, und ein Streit um die Natur der Hostie – heilige Wandlung gegen die sakramentale Einheit von Leib und Blut Jesu Christi mit Brot und Wein. Für die meisten Menschen jedoch waren solche Fragen der Doktrin sehr lebensfern.
Viele ausgezeichnete Geschichtsbücher über die Hugenotten schildern den außergewöhnlichen Einfluss dieser kleinen Gemeinschaft und ihre Diaspora, die sie als gebildete Flüchtlinge nach Holland führte, nach Deutschland, England, Kanada und Südafrika.
Die brennenden Kammern ist der Auftakt einer Romanreihe vor dem Hintergrund einer dreihundertjährigen Geschichte, die sich vom Frankreich des 16. bis ins Südafrika des 19. Jahrhunderts spannt. Wenn nicht anders angegeben, sind die Figuren und ihre Familien erfunden, aber sie hätten in diesen Zeiten leben können: gewöhnliche Frauen und Männer, die vor dem Hintergrund von Glaubenskrieg und Vertreibung um ihre Liebe und ihr Überleben kämpfen.
Manche Dinge ändern sich nie.
Hauptfiguren
IN CARCASSONNE – LA CITÉ
Marguerite (Minou) Joubert
Bernard Joubert, ihr Vater
Aimeric, ihr Bruder
Alis, ihre Schwester
Rixende, ihre Dienerin
Bérenger, ein Soldat der königlichen Garnison
Marie Galy, ein Mädchen aus der Nachbarschaft
IN CARCASSONNE – DIE BASTIDE
Cécile Noubel (vorher Cordier), Pensionswirtin
Monsieur Sanchez, ein Converso und Nachbar
Charles Sanchez, sein ältester Sohn
Oliver Crompton, ein hugenottischer Offizier
Philippe Devereux, sein Cousin
Alphonse Bonnet, ein Tagelöhner
Michel Cazès, ein hugenottischer Soldat
IN TOULOUSE
Piet Reydon, ein Hugenotte
Vidal (Monsignore Valentin), ein Edelmann und Priester
Madame Boussay, Minous Tante
Monsieur Boussay, Minous Onkel
Madame Montfort, seine verwitwete Schwester und Haushälterin
Martineau, Verwalter des Boussay’schen Hauses
Jacques Bonal, Meuchelmörder und Diener Vidals
Jasper McCone, ein englischer Handwerker und Protestant
Félix Prouvaire, ein hugenottischer Student
IN PUIVERT
Blanche de Bruyère, Châtelaine von Puivert
Achille Lizier, Dorfklatschmaul
Guilhem Lizier, sein Großneffe und Soldat im Château de Puivert
Paul Cordier, Dorfapotheker und angeheirateter Cousin Cécile Noubels
Anne Gabignaud, die Dorfhebamme
Marguerite de Bruyère, verstorbene Châtelaine von Puivert
HISTORISCHE PERSONEN
Pierre Delpech, katholischer Waffenhändler in Toulouse
Pierre Hunault, Edelmann und hugenottischer Kommandeur in Toulouse
Capitaine Saux, hugenottischer Offizier in Toulouse
Jean Barrelles, Pastor des hugenottischen Tempels von Toulouse
Jean de Mansencal, Präsident des Parlaments von Toulouse
François de Lorraine, Herzog von Guise, Anführer der katholischen Seite
Henri, sein ältester Sohn und Erbe
Charles, sein Bruder und Kardinal von Lothringen
Prolog
FRANSCHHOEK
28. Februar 1862
Die Frau steht allein unter einem stechend klaren Himmel. Grüne Zypressen und hohe Gräser grenzen den Friedhof ein. Die grauen Grabsteine hat die erbarmungslose Sonne am Kap gebleicht, bis sie die Farbe von Knochen annahmen.
Hier Rust. Hier ruht.
Sie ist groß und hat die auffälligen Augen, die die Frauen in ihrer Familie schon seit Generationen haben, ohne dass sie davon weiß. Sie beugt sich vor, um die Namen und Daten auf den Grabsteinen zu lesen, die von Flechten und Moosen verdeckt werden. Zwischen ihrem hohen weißen Kragen und der staubbedeckten Krempe ihres Lederhuts ist die Haut ihres Halses schon brennend rot. Für ihren europäischen Teint ist die Sonne zu stark, und sie ist tagelang durch die Savanne geritten, die hier Veld heißt.
Sie zieht die Handschuhe aus und faltet sie ineinander. Sie hat zu viele verlegt, um sorglos zu sein, und wie sollte sie hier ein neues Paar kaufen? In der gastfreundlichen Grenzstadt gibt es zwar zwei Krämerläden, aber sie hat nur wenig, was sie eintauschen könnte, und ihre Erbschaft ist verbraucht, ausgegeben auf der langen Reise von Toulouse nach Amsterdam und von dort ans Kap der Guten Hoffnung. Jeden einzelnen Franc hat sie für Vorräte und Empfehlungsschreiben aufgewendet, für Leihpferde und einen vertrauenswürdigen Führer, der sie durch das fremde Land leiten soll.
Sie lässt die Handschuhe vor ihre Füße auf den Boden fallen. Ein Wölkchen aus kupferrotem Kapstaub stiebt auf und legt sich wieder. Ein schwarzer Käfer, mit hartem Rücken und Entschlossenheit gepanzert, huscht in ein Versteck.
Die Frau atmet durch. Endlich ist sie angekommen.
Gefolgt ist sie der Spur vom Ufer der Aude, der Garonne und der Amstel über die wilden Meere an die Stelle, wo der Atlantik auf den Indischen Ozean trifft, ans Cap de Bonne-Espérance.
Manchmal hat die Spur hell geleuchtet. Die Geschichte zweier Familien und eines Geheimnisses, von Generation zu Generation weitergegeben. Ihre Mutter und ihre Großmutter, dann weiter zurück zu ihrer Urgroßmutter und deren Mutter. Ihre Namen sind vergessen, sind in denen der Ehemänner, Brüder und Geliebten aufgegangen, ihr Geist aber lebt in ihr. Das weiß sie. Ihre Suche endet hier endlich. In Franschhoek.
Ci gît. Hier ruht.
Die Frau nimmt den ledernen Reithut ab und fächelt sich mit der breiten Krempe glühende Luft zu. Erleichterung bringt es nicht. Es ist heiß wie in einem Ofen, und ihr flachsblondes Haar ist dunkel vor Schweiß. Auf ihr Aussehen legt sie wenig Wert. Sie hat die Stürme überlebt, die Angriffe auf ihren guten Ruf und auf ihre Person, den Diebstahl ihres Eigentums und den Verlust alter Freundschaften, von denen sie glaubte, sie würden ewig halten. Alles, um hierherzukommen.
Auf diesen ungepflegten Friedhof in dieser Grenzstadt.
Sie löst die Schnalle ihrer Satteltasche und greift hinein. Mit den Fingern streicht sie über die kleine alte Bibel – ein Talisman, den sie als Glücksbringer bei sich trägt –, aber was sie herausnimmt, ist das Tagebuch: in weiches lohfarbenes Leder gebunden, wird es von einer dünnen Schnur zusammengehalten, die zweimal herumgeschlungen ist. Darin liegen Briefe und handgezeichnete Karten, ein Testament. Das Tagebuch ist die Chronik der Suche ihrer Familie, die Anatomie einer Fehde. Wenn sie recht hat, stellt dieses Notizbuch aus dem 16. Jahrhundert das Mittel dar, mit dem sie Anspruch erheben kann auf das, was von Rechts wegen ihr gehört. Nach mehr als dreihundert Jahren werden Besitz und guter Name der Familie Joubert endlich wiederhergestellt. Der Gerechtigkeit wird Genüge getan.
Falls sie recht hat.
Dennoch, sie kann sich nicht überwinden, den Namen auf dem Grabstein zu lesen. Im Wunsch, diesen letzten Moment der Hoffnung ein wenig auszudehnen, schlägt sie stattdessen das Tagebuch auf. Die krakelige Schrift in gebräunter Tinte, die altertümliche Sprache packt sie über die Jahrhunderte hinweg. Jede einzelne Silbe kennt sie wie einen Katechismus aus der Sonntagsschule. Der allererste Eintrag.
Heute ist der Tag meines Todes.
Sie hört den Flügelschlag eines Rotschwingenstars und den Schrei eines Hagedaschs im Busch am Friedhofsrand. Wie unmöglich es erscheint, dass solche Laute ihr noch vor einem Monat vollkommen exotisch vorkamen und jetzt alltäglich sind. Ihre Fingerknöchel sind weiß, so fest hat sie die Fäuste geschlossen. Was, wenn sie nach alldem falschliegt? Was, wenn es hier nicht beginnt, sondern endet?
Gott der Herr sei mein Zeuge, während ich hier, von eigener Hand, dies niederlege, meinen Letzten Willen, mein Testament.
Die Frau betet nicht. Weil sie es nicht vermag. Die vielen Ungerechtigkeiten, die ihren Vorfahren im Namen der Religion angetan wurden, beweisen, dass es keinen Gott gibt. Denn welcher Gott würde zulassen, dass in seinem Namen so viele in Qual und Furcht und Schrecken sterben?
Dennoch sieht sie hoch, als könnte sie einen Blick auf die himmlischen Gefilde erhaschen. Der Februarhimmel über dem Kap der Guten Hoffnung ist vom gleichen tiefen Blau wie über dem Languedoc. Die gleichen schroffen Winde wirbeln den Staub im Hinterland des Cap de Bonne-Espérance wie in der Garrigue du Midi. Eine Art von Hitze, ein Atem, der die rote Erde aufwirbelt und einen Schleier über die Augen legt. Er pfeift durch die grauen und grünen Bergpässe des Landesinnern, über Pfade, die Tiere und Menschen geschaffen haben. Hier in diesem Buschland, das sie einmal Elefantenwinkel nannten, bevor die Franzosen kamen.
Jetzt ist es windstill. Die Luft ist heiß. Wenig rührt sich unter der Hitze der Mittagssonne. Hunde und Farmarbeiter haben sich in den schützenden Schatten zurückgezogen. Schwarze Geländer grenzen die Grabstätten ab – die Familie de Villiers, die Familie le Roux, die Familie Jordan –, auf denen allesamt Anhänger der reformierten Kirche liegen, die aus Frankreich flohen, um hier Zuflucht zu finden. Im Jahr des Heils 1688.
Auch ihre Vorfahren?
In der Ferne, hinter den steinernen Engeln und den Grabsteinen, begrenzen die Berge den Blick, und eine Erinnerung an die Pyrenäen trifft die Frau mit einem Mal: ein scharfes, verzweifeltes Verlangen nach der Heimat, das sich ihr wie ein eisernes Band um die Rippen legt. Die Berge sind im Winter weiß, im Frühling und im Frühsommer grün. Im Herbst verwandeln sich die grauen Felsen in Kupfer, dann beginnt der Zyklus erneut. Was würde sie geben, um sie noch einmal zu sehen.
Sie seufzt, denn sie ist hier. Sie ist weit fort von ihrem Zuhause.
Zwischen den abgegriffenen Seiten des ledernen Tagebuchs zieht sie die Karte hervor. Sie kennt jeden Strich, jeden Knick und jeden Tintenfleck, und doch betrachtet sie alles ganz genau. Liest erneut die Namen der Farmen jener ersten hugenottischen Siedler, die sich nach Jahren des Exils und des Umherirrens hier niederließen.
Am Ende kauert die Frau nieder und streckt die Hand aus, um die Buchstaben nachzuziehen, die in den Grabstein geschlagen sind. Sie ist so versunken, dass sie – die gelernt hat, wachsam zu sein – die Schritte hinter sich nicht hört. Sie bemerkt nicht den Schatten, der die Sonne verdeckt. Sie beachtet nicht den Geruch nach Schweiß, nach Stein, nach Leder und nach einer langen Reise über das Veld, bis sie die Mündung einer Waffe in ihrem Nacken spürt.
»Stehen Sie auf.«
Sie will sich umwenden, sein Gesicht sehen, aber der kalte Stahl drückt ihr auf die Haut. Langsam erhebt sie sich.
»Geben Sie mir das Tagebuch«, sagt er. »Wenn Sie das tun, geschieht Ihnen nichts.«
Sie weiß, dass er lügt, denn dieser Mann hat sie zu lange gejagt, und es steht zu viel auf dem Spiel. Seit dreihundert Jahren versucht seine Familie, ihre Familie zu vernichten. Wie könnte er sie laufenlassen?
»Geben Sie es her. Langsam.«
Die Kälte in der Stimme ihres Feindes ist beängstigender, als Wut es wäre, und instinktiv fasst sie das Tagebuch und die kostbaren Papiere, die es enthält, fester. Nach allem, was sie erduldet hat, wird sie es ihm nicht leicht machen. Doch jetzt gräbt er seine spitzen Finger durch den weißen Baumwollstoff der Bluse in ihre Schulter. Hart und grimmig bohren sie sich in den Muskel. Sie muss ihren Griff lösen. Das Tagebuch fällt in den Schmutz und klappt auf, das Testament und die Urkunden liegen im Staub des Friedhofs.
»Sind Sie mir von Kapstadt gefolgt?«
Sie erhält keine Antwort.
Sie hat keine Schusswaffe, aber sie besitzt ein Messer. Als er sich bückt, um die Papiere aufzuheben, zieht sie die Klinge aus dem Stiefel und sticht nach seinem Arm. Wenn sie ihn kampfunfähig machen kann, und sei es nur für einen Augenblick, kann sie vielleicht die Papiere wieder an sich bringen und davonlaufen. Doch er rechnet mit einem Angriff dieser Art und verlagert sein Gewicht zur Seite. Ihre Klinge streift nur seine Hand.
Kurz bevor er sie seitlich am Kopf trifft, ist sie sich seines herabschießenden Armes gewahr. Sie erhascht einen Blick auf schwarzes Haar, von einer weißen Strähne geteilt. Der Schmerz überwältigt sie, als ihr Fleisch unter dem Revolver aufplatzt. Sie spürt das Blut an ihrer Schläfe, seine Wärme, und sie stürzt.
In den letzten Sekunden, in denen sie bei Bewusstsein ist, trauert sie darum, dass ihre Geschichte so enden soll, in der vergessenen Ecke eines Friedhofs am anderen Ende der Welt. Die Geschichte um ein gestohlenes Tagebuch und eine Erbschaft. Eine Geschichte, die vor dreihundert Jahren begann, kurz vor Ausbruch der Bürgerkriege, die Frankreich in die Knie zwangen.
Heute ist der Tag meines Todes.
ERSTER TEIL
CARCASSONNE
Winter 1562
KAPITEL 1
INQUISITIONSGEFÄNGNIS ZU TOULOUSE
Samstag, 24. Januar
»Bist du ein Verräter?«
»Nein, Monsieur.« Der Gefangene war sich nicht sicher, ob er es laut aussprach oder nur in seinem zerrütteten Geist antwortete.
Abgebrochene Zähne, verrenkte Knochen, der Geschmack von getrocknetem Blut in seinem Mund. Wie lange war er bereits hier? Stunden? Tage?
Schon immer?
Der Inquisitor wedelte mit der Hand. Der Gefangene hörte das Schleifen, mit dem eine Klinge geschärft wurde, sah die Eisen und Zangen auf dem Holztisch neben der Feuerstelle. Der Balg wurde betätigt, die Kohlen glühten auf. Er empfand einen seltsamen Augenblick der Erholung, als die Furcht vor der nächsten Folter kurz den Schmerz des rohen Fleisches auf seinem gepeitschten Rücken verdrängte. Die Furcht vor dem Bevorstehenden ertränkte, wenn auch nur für einen Moment, seine Scham, zu schwach zu sein, um zu ertragen, was ihm angetan wurde. Er war Soldat. Auf dem Schlachtfeld hatte er gut und tapfer gekämpft. Wie konnte es sein, dass er nun unter dieser Tortur zusammenbrach?
»Du bist ein Verräter.« Die Stimme des Inquisitors klang dumpf und ausdruckslos. »Du bist dem König untreu, du bist Frankreich untreu. Wir haben die Aussagen vieler, die es beweisen. Sie beschuldigen dich!« Er klopfte auf einen Stoß Papiere, die auf seinem Tisch lagen. »Protestanten – Männer wie du – gewähren unseren Feinden Beistand. Das ist Verrat.«
»Nein!«, wisperte der Gefangene, als fühlte er schon, wie der Atem des Schinderknechts ihm den Nacken wärmte. Sein rechtes Auge war zugeschwollen, aber er spürte, dass sein Verfolger näher kam. »Nein, ich …«
Er stockte, denn was konnte er zu seiner Verteidigung anführen? Hier, im Inquisitionsgefängnis zu Toulouse, war er der Feind.
Hugenotten waren der Feind.
»Ich bin der Krone treu ergeben. Mein protestantischer Glaube bedeutet nicht …«
»Dein Glaube brandmarkt dich als Ketzer. Du hast dich von dem einen wahren Gott abgewandt.«
»Dem ist nicht so. Bitte! Das ist alles ein Irrtum.«
Er hörte, wie er flehte, und empfand Scham. Und er wusste, wenn der Schmerz wieder einsetzte, würde er sagen, was immer sie hören wollten. Wahrheit oder Lüge, er hatte nicht mehr die Kraft, Widerstand zu leisten.
Ein Moment der Zartheit setzte ein, so kam es ihm in seiner Verzweiflung vor. Ein sanftes Heben der Hand, wie von einem Ritter, der seine Dame umwarb. Einen flüchtigen Augenblick lang erinnerte sich der Mann an die wunderbaren Dinge, die es auf der Welt gab. Liebe und Musik, der süße Duft der Blumen im Frühling. Frauen, Kinder, Männer, die Arm in Arm durch die eleganten Straßen von Toulouse flanierten, wo Menschen streiten und uneins sein konnten, es aber nie an Respekt und Würde vermissen ließen. Weinkelche wurden bis zum Überlaufen gefüllt, und es gab reichlich zu essen: Feigen, geräucherten Bergschinken und Honig. In dieser Welt, in der er einst gelebt hatte, schien die Sonne, und das endlose Blau des Midi, des Südens Frankreichs, spannte sich einem Baldachin gleich über die Stadt.
»Honig«, murmelte er.
Hier, in dieser Hölle unter der Erde, gab es keine Zeit mehr. In den Oubliettes, wie man sie nannte, konnte ein Mensch verschwinden und wurde nie wieder gesehen. Als die Folter begann, war der Schock umso schlimmer, weil sie so unangekündigt einsetzte. Ein Zwicken, dann Druck, dann die eisernen Zähne der Zange, die seine Haut durchdrangen, seine Muskeln und seine Knochen.
Als die Schmerzen ihn umfingen, glaubte er aus der Nachbarkammer die Stimme eines Mitgefangenen zu hören. Ein gebildeter Mann, ein Gelehrter; mehrere Tage lang hatte man sie in der gleichen Zelle festgehalten. Er kannte ihn als einen Ehrenmann, einen Buchhändler, der seine drei Kinder liebte und mit milder Trauer von seiner verstorbenen Frau sprach.
Er vernahm das Murmeln eines anderen Inquisitors hinter der tropfenden Zellenwand: Sein Freund wurde ebenfalls verhört. Dann erkannte er das Pfeifen, mit dem die Chatte de griffe durch die Luft zischte, den dumpfen Schlag, als die Krallen auf den Leib trafen, und es entsetzte ihn zu hören, wie sein Mitgefangener schrie. Er war ein starker Mann, der bislang still gelitten hatte.
Der Gefangene hörte das Öffnen und Schließen einer Tür und wusste, dass noch jemand die Zelle betreten hatte. Seine Zelle, oder die nebenan? Ein Murmeln, Papierrascheln. Einen wunderbaren Augenblick lang glaubte er, seine Tortur sei zu Ende. Dann räusperte sich der Inquisitor, und die Befragung begann erneut.
»Was weißt du über das Grabtuch von Antiochia?«
»Ich weiß nichts über Reliquien, egal welche.« Das war die Wahrheit, doch der Gefangene wusste, dass sein Wort nichts galt.
»Die heilige Reliquie wurde vor fünf Jahren aus der Église Saint-Taur gestohlen. Von mehreren Seiten wird behauptet, dass du einer der Verantwortlichen seist.«
»Wie könnte ich das?«, rief der Gefangene in jähem Trotz. »Ich war noch nie in Toulouse, bis … bis jetzt.«
Der Inquisitor bedrängte ihn weiter. »Wenn du uns sagst, wo das Grabtuch versteckt gehalten wird, endet unser Gespräch sofort. Die heilige Mutter Kirche wird dir in ihrer Gnade die Arme öffnen und dich wieder in ihrem Schoß willkommen heißen.«
»Monsieur, ich gebe Euch mein Wort, dass ich …«
Er roch seine versengte Haut, bevor er sie spürte. Wie schnell wird ein Mann zum Tier, zu Fleisch.
»Überdenke deine Antwort sehr gut. Ich werde dich erneut befragen.«
Der Schmerz, schlimmer als alles zuvor Erduldete, gewährte ihm nun eine vorübergehende Erleichterung. Er zog ihn in die Dunkelheit, an einen Ort, wo er stark genug war, um ihren Fragen zu widerstehen, und wo es ihn retten konnte, wenn er die Wahrheit sprach.
KAPITEL 2
LA CITÉ
Samstag, 28. Februar
»In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti.«
Mit einem leisen Geräusch fiel die Erde auf den Sarg. Braune Erde glitt durch weiße Finger. Dann eine andere Hand, über das offene Grab gestreckt, wieder eine, Krumen und Steinchen prasselten wie Regen auf das Holz. Das leise Schluchzen eines kleinen Kindes, in den schwarzen Umhang des Vaters gehüllt.
»Allmächtiger Vater, in deine Hand befehlen wir den Geist von Florence Joubert, geliebte Ehefrau und Mutter und Dienerin Christi. Möge sie im Licht deiner ewigen Gnade in Frieden ruhen. Amen.«
Das Licht änderte sich. Nicht mehr feuchte, graue Luft lag über dem Friedhof, sondern eine tintige Schwärze. Statt Schlamm sah sie rotes Blut. Warm und frisch fühlte es sich an, glitschig auf dem Handteller. Sammelte sich in den Fältchen ihrer Finger. Sie sah auf ihre blutigen Hände hinunter.
»Nein!«, schrie Minou und warf sich herum, sodass sie aufwachte.
Im ersten Moment sah sie nichts. Dann wurde die Kammer ringsum wieder scharf, und sie begriff, dass sie abermals auf ihrem Stuhl eingeschlafen war. Kein Wunder, dass sie so schlecht geträumt hatte. Minou drehte ihre Hände. Sie waren sauber. Keine Erde unter den Fingernägeln, kein Blut auf der Haut.
Ein Albtraum, weiter nichts. Eine Erinnerung an den schrecklichen Tag vor fünf Jahren, als sie ihre geliebte Mutter zur letzten Ruhe gebettet hatten. Die Erinnerung wich etwas anderem. Finstere Bilder, erschaffen aus leerer Luft.
Minou blickte auf das Buch, das offen auf ihrem Schoß lag – eine Meditation der englischen Märtyrerin Anne Askew. Ob es zu ihren unruhigen Träumen beigetragen hatte?
Sie reckte sich, damit die Nacht aus ihren Knochen wich, und glättete ihr zerknittertes Unterkleid. Die Kerze war niedergebrannt, und das Wachs hatte auf dem dunklen Holz eine Lache gebildet. Welche Stunde mochte es sein? Sie wandte sich dem Fenster zu. Lichtfinger traten durch die Risse in den Läden und warfen ein schraffiertes Muster auf die abgewetzten Bodendielen. Von draußen hörte sie die üblichen frühmorgendlichen Geräusche der Cité, die zur Dämmerung erwachte, und von den Bastionen das Klappern und Trappeln der Wächter auf den steilen Treppen des Tour de la Marquière.
Sie wusste, dass sie sich noch länger ausruhen sollte. Der Samstag war der geschäftigste Tag in der Buchhandlung ihres Vaters, sogar zur Fastenzeit. Jetzt, da die Verantwortung für das Geschäft auf ihren Schultern lag, hatte sie in den bevorstehenden Stunden nur wenig Zeit für sich. Doch ihre Gedanken drehten Kreise wie die Stare, die im Herbst auf- und absteigend um die Türme des Château Comtal zogen.
Minou legte sich die Hand auf die Brust und spürte den kräftigen Schlag ihres Herzens. Ihr Traum, der so lebhaft gewesen war, hatte sie verdrießlich gestimmt. Es bestand kein Grund zur Annahme, dass ihre Buchhandlung erneut durchsucht wurde. Ihr Vater hatte nichts Falsches getan, er war ein guter Katholik. Dennoch konnte sie den Gedanken nicht abschütteln, dass über Nacht etwas geschehen sein könnte.
Auf der anderen Seite der Kammer lag ihre siebenjährige Schwester noch im tiefen Schlaf, die Locken eine schwarze Wolke über dem Kissen. Minou berührte Alis an der Stirn und stellte erleichtert fest, dass sie kühl war. Sie war auch erleichtert, dass das Ausziehbett, in dem ihr dreizehnjähriger Bruder manchmal die Nacht verbrachte, wenn er nicht schlafen konnte, leer war. In letzter Zeit hatte sich Aimeric allzu oft in ihre Kammer geschlichen und Angst vor dem Dunkeln vorgeschützt. Das sei das Zeichen eines schlechten Gewissens, sagte der Priester. Würde er über ihre Albträume das Gleiche behaupten?
Minou spritzte sich ein wenig kaltes Wasser ins Gesicht und wusch sich unter den Armen. Sie zog sich den Rock über, schloss das Kleid, nahm vorsichtig, um Alis nicht aufzuwecken, das geliehene Buch und verließ auf Zehenspitzen das Zimmer unter dem Dach. Die Treppe hinunter, vorbei an der Kammertür ihres Vaters und dem winzigen Abstellraum, in dem Aimeric schlief, dann weiter abwärts bis ins Erdgeschoss.
Die Tür, die den Durchgang vom großen Wohnraum trennte, war geschlossen, saß aber schlecht im Rahmen, und Minou hörte das Klappern der Pfannen und das Knarren der Kette über der Feuerstelle, als die Dienerin den Kessel an den Haken hängte, um Wasser zu erhitzen.
Sie öffnete leise die Tür und griff hinein, hoffte, die Schlüssel vom Regal nehmen zu können, ohne dass Rixende es bemerkte. Die Dienerin war warmherzig, aber sie schwatzte gern, und an diesem Morgen wünschte Minou nicht aufgehalten zu werden.
»Nanu, Mademoiselle«, sagte Rixende fröhlich. »Ich hätte nicht gedacht, dass Ihr so früh aufsteht. Alle anderen liegen noch in den Federn. Kann ich Euch Frühstück bringen?«
Minou hielt die Schlüssel hoch. »Ich muss mich sputen. Wenn mein Vater erwacht, sagst du ihm bitte, dass ich schon früh in die Bastide gegangen bin, um den Laden herzurichten? Um uns den Markttag zunutze zu machen. Er braucht sich nicht zu beeilen, sollte er beabsichtigen …«
»Nein, was für eine wunderbare Nachricht, dass der Herr …«
Rixende hielt inne, als sie Minous Gesicht sah.
Obwohl allgemein bekannt war, dass ihr Vater seit Wochen das Haus nicht verlassen hatte, sprachen sie nicht davon. Bernard Joubert war von seiner Winterreise als veränderter Mensch nach Carcassonne zurückgekehrt. Aus jemandem, der gern lächelte und für jeden ein freundliches Wort hatte, einem guten Nachbarn und treuem Feind, war ein Schatten seiner selbst geworden. Grau und zurückgezogen, mit gedämpftem Gemüt, ein Mensch, der nicht mehr von Ideen und Träumen sprach. Minou schmerzte es, ihn so niedergeschlagen zu sehen, und sie versuchte oft, ihn aus seiner schwarzen Melancholie hervorzulocken. Doch wann immer sie ihn fragte, was ihn bedrücke, verwandelten sich die Augen ihres Vaters in Glas. Er murmelte etwas von der Bitterkeit der Jahreszeit und vom Wind, den Schmerzen und Gebrechen des Alters, dann verfiel er wieder in Schweigen.
Rixende errötete. »Pardon, Mademoiselle. Ich werde dem Herrn Eure Worte ausrichten. Aber seid Ihr sicher, dass Ihr nichts zu trinken braucht? Es ist kalt da draußen. Und zu essen? Es gibt ein Stück Pan de blat, und vom Pudding von gestern ist auch noch ein Rest …«
»Guten Tag«, sagte Minou bestimmt. »Wir sehen uns am Montag wieder.«
Der Boden fühlte sich kalt an unter ihren Strümpfen, und sie konnte ihren Atem sehen, weiß in der eisigen Luft. Sie schlüpfte in ihre Lederschuhe, nahm ihre Kapuze und ihren dicken Wollumhang vom Ständer und steckte die Schlüssel und das Buch in die Tasche, die sie sich um die Taille band. Mit den Handschuhen in den Fingern schob sie den schweren Metallriegel zurück und trat hinaus auf die stille Straße.
Ein beherztes Mädchen an einem kalten Februarmorgen.
KAPITEL 3
Die ersten Sonnenstrahlen wärmten schon die Luft und ließen Nebelspiralen über die Kopfsteine tanzen. Die Place du Grand Puits wirkte friedlich im rosaroten Morgenlicht. Minou atmete ein, spürte die Kälte in der Lunge und setzte sich zum Tor in Bewegung, durch das man die Cité betrat oder verließ.
Zuerst sah sie niemanden. Die Dirnen, die nachts auf der Gasse ihrem Gewerbe nachgingen, hatte das Tageslicht vertrieben. Die Karten- und Würfelspieler, die die Taverne Saint-Jean unsicher machten, lagen längst im Bett. Minou hob den Rocksaum, damit die übelsten Überreste der Exzesse vom Vorabend ihn nicht beschmutzten: zerbrochene Bierkrüge, ein Bettler, der schlafend an der Wand lehnte, den Arm auf einem Hund voller Flohbisse. Der Bischof hatte gebeten, dass während der Fastenzeit alle Schänken und Tavernen in der Cité geschlossen blieben. Aber der Seneschall hatte, eingedenk der leeren Truhen des Königs, das Ersuchen abgelehnt. Es war allgemein bekannt – laut Rixende, der kein Klatsch und Tratsch entging –, dass die gegenwärtigen Bewohner des Bischofspalasts und des Château Comtal nichts füreinander übrig hatten.
Die Giebelhäuser in der schmalen Straße, die zur Porte Narbonnaise hinunterführte, schienen sich aneinander zu stützen wie Betrunkene. Ihre Ziegeldächer waren einander so nahe, dass sie sich fast berührten. Minou bewegte sich gegen die Masse der Wagen und Menschen, die zum Tor hineinströmten, und kam nur langsam voran.
Vor hundert Jahren hätte es genauso ausgesehen, dachte Minou, oder vor zweihundert, bis zurück zur Zeit der Troubadoure. In der Cité nahm das Leben immer den gleichen Gang, Tag für Tag.
Nichts änderte sich.
Zwei Soldaten kontrollierten den Verkehr an der Porte Narbonnaise. Manche Menschen winkten sie durch, ohne ihnen einen zweiten Blick zu gönnen, andere jedoch hielten sie an und durchwühlten ihre Habseligkeiten, dann wechselten Münzen den Besitzer. Ihre Helme und die Klingen ihrer Hellebarden glänzten in der matten Sonne. Das königliche Wappen auf ihren blauen Waffenröcken hob sich hell von den stumpfen Fastenfarben ab.
Als Minou näher kam, erkannte sie Bérenger, einen der vielen, die Grund hatten, ihrem Vater dankbar zu sein. Die meisten einheimischen Soldaten konnten – im Gegensatz zu denen, die aus Lyon oder Paris zur Garnison abgestellt wurden – das königliche Französisch nicht lesen. Wenn sie sich unbeobachtet glaubten, zogen viele es sogar vor, Okzitanisch zu sprechen, die alte Sprache der Region. Dennoch erhielten sie Papiere und schriftliche Befehle auf Französisch und wurden bestraft, wenn sie es versäumten, ihre Pflichten buchstabengetreu zu erfüllen. Die meisten hielten das für nur einen weiteren Kniff des Seneschalls, um an Geld zu kommen. Minous Vater half jedem, der ihn darum bat, indem er erklärte, was die offiziellen Schriften besagten.
Zumindest hatte er das früher getan.
Minou blieb stehen. Es bewirkte nichts Gutes, endlos darüber zu rätseln, was ihren geliebten Vater befallen hatte. Oder sich immer wieder sein ausgezehrtes, gehetztes Gesicht vor Augen zu rufen.
»Guten Morgen, Bérenger«, sagte sie. »Ihr habt ja allerhand zu tun heute.«
Sein ehrliches, altes Gesicht verzog sich zu einem Lächeln. »Das kann man sagen, Madomaisèla Joubert! Eine hübsche Meute, auch wenn ich mir das an einem so bitterkalten Tag nicht erklären kann. Schon vor dem ersten Licht wartete eine große Schar von ihnen.«
»Vielleicht hat der Seneschall sich jetzt in der Fastenzeit an seine Pflicht zur Wohltätigkeit erinnert und gewährt den Armen Almosen. Was haltet Ihr davon? Wäre es möglich?«
»Das wäre ein denkwürdiger Tag.« Bérenger prustete. »Für seine guten Taten wird unser edler Herr und Meister nicht gerühmt!«
Minou senkte die Stimme. »Ach, welches Glück es wäre, wenn ein gottesfürchtiger und frommer Grundherr uns regieren würde!«
Er lachte erneut bellend, bis er merkte, dass sein Kamerad ihn missbilligend anblickte.
»Sei’s drum, was hilft’s«, sagte er in formellerem Ton. »Was bringt Euch zu dieser Stunde hierher, und das ohne Begleitung?«
»Ich komme auf Geheiß meines Vaters«, log Minou. »Er hat mir befohlen, für ihn den Laden zu öffnen. Weil Markttag ist, hofft er, dass viele Kunden in die Bastide kommen. Alle, so Gott will, mit vollen Taschen und einem Geschmack an Gelehrsamkeit.«
»Lesen?« Bérenger verzog das Gesicht. »Nicht mein Fall, aber das soll jeder halten, wie er will. Doch wäre es nicht besser, wenn Euer Bruder diese Arbeit übernähme? Mir erscheint es seltsam, dass Monsieur Joubert einer Jungfrau so etwas abverlangt, wo er doch mit einem Sohn gesegnet ist.«
Minou hielt den Mund, auch weil sie ihm seine Bemerkung nicht verübelte. Bérenger war ein Mann des Midi, nach alten Vorstellungen und Traditionen erzogen. Recht hatte er insofern, als Aimeric mit dreizehn in der Lage sein sollte, einige Aufgaben des Vaters zu übernehmen. Nur war es so, dass ihr Bruder weder die Neigung noch die Befähigung zum Geschäft zeigte. Ihn interessierte es mehr, Sperlinge mit seiner Schleuder zu schießen oder mit anderen Jungen auf Bäume zu klettern, als seine Tage in der Enge einer Buchhandlung zuzubringen.
»Aimeric wird heute Morgen zu Hause gebraucht«, sagte sie lächelnd, »deshalb muss ich herhalten. Es ist eine Ehre, meinem Vater nach Kräften zu helfen.«
»Aber sicher, natürlich ist es das.« Er räusperte sich. »Und wie ist Sénher Jouberts Befinden? Ich habe ihn eine Weile nicht mehr gesehen. Nicht einmal in der heiligen Messe. Geht es ihm etwa nicht gut?«
Seit dem Ausbruch der Pest brachte jede Frage nach der Gesundheit eines Menschen einen dunkleren Unterton mit sich. Fast keine Familie war verschont geblieben. Bérenger hatte seine Frau und beide Kinder an den gleichen Ausbruch verloren, der Minou die Mutter geraubt hatte. Fünf Jahre war sie nun tot, doch Minou vermisste sie jeden Tag und träumte, wie in der vergangenen Nacht, oft von ihr.
Dennoch, am Tonfall von Bérengers Frage und der Art, wie er ihrem Blick auswich, erkannte Minou schweren Herzens, dass die Gerüchte um die Zurückgezogenheit ihres Vaters sich weiter verbreitet hatten als befürchtet.
»Er ist im Januar sehr erschöpft von seinen Reisen nach Hause gekommen«, sagte sie mit einem Funken Trotz, »aber davon abgesehen erfreut er sich ausgezeichneter Gesundheit. Ihm macht die Buchhandlung viel Arbeit, und er ist sehr beschäftigt.«
Bérenger nickte. »Nun, das freut mich zu hören, ich habe schon befürchtet …« Er verstummte und errötete vor Verlegenheit. »Das ist unwichtig. Wenn Ihr Sénher Joubert meine besten Wünsche ausrichten würdet.«
Minou lächelte. »Darüber wird er sich sehr freuen.«
Bérenger streckte den Arm aus und hinderte eine große Frau mit einem Gesicht wie ein Schinken und einem kreischenden Säugling daran, sich vor sie zu drängen. »Dann geht nur. Aber achtet auf Euch, Madomaisèla, wenn Ihr die Bastide ganz allein durchquert, è? Dort gibt es Schurken aller Art, die Euch genauso leichthin ein Messer in die Rippen stechen, wie sie ausspucken.«
Minou lächelte. »Ich danke Euch, freundlicher Bérenger. Das werde ich.«
Das Gras im Graben unter der Zugbrücke glänzte vom frühmorgendlichen Tau, der hell auf den grünen Halmen schimmerte. Normalerweise hob der Anblick der Welt außerhalb von La Cité immer Minous Laune: der endlose weiße Himmel, der blau wurde, wenn der Tag voranschritt, die grau-grünen Felsspitzen auf der Montagne Noire am Horizont. Aber an diesem Morgen machte ihre unruhige Nacht sie zusammen mit Bérengers Warnungen sorgenschwer.
Minou rief sich zur Ordnung. Sie war kein kleines Mädchen, das sich vor dem eigenen Schatten fürchtete. Außerdem befand sie sich in Rufweite der Wächter. Wenn jemand sie wirklich bedrohen sollte, drangen ihre Hilferufe zur Cité, und Bérenger wäre unverzüglich an ihrer Seite.
Ein gewöhnlicher Tag. Nichts zu fürchten.
Dennoch war sie erleichtert, als sie den Rand von Trivalle erreichte, einer armen, aber anständigen Vorstadt, in der vor allem jene wohnten, die in den Webereien arbeiteten. Wolle und Tücher, die in die Levante verkauft wurden, brachten Wohlstand nach Carcassonne, und respektable Familien hatten ihre Häuser am linken Ufer errichtet.
»Kommt ein Mägdlein vorbei …«
Minou fuhr zusammen, als sich eine Hand um ihr Fußgelenk schloss. »Monsieur!«
Sie sah hinunter. Zu fürchten war dort nur wenig. Die Finger eines Betrunkenen, zu schwach, um sie zu halten. Sie riss sich los und ging rasch weiter. Ein junger Mann, einundzwanzig vielleicht, saß am Wegesrand und lehnte sich an eine Häuserwand. Sein kurzer Umhang deutete auf einen Mann von Stand hin, auch wenn sein senfgelbes Wams verrutscht war und die Hose dunkle Flecken hatte. Bier oder Schlimmeres.
Er sah durch die umgeknickte blaue Feder an seinem Hut zu ihr hoch.
»Mademoiselle, wie wäre es mit einem Kuss? Ein Küsschen für Philippe. Das kostet Euch nichts. Keinen Sol, keinen Denier … Was auch gut ist, denn ich habe nichts.«
Der Bursche wendete mit übertriebenen Gesten seinen Geldbeutel nach außen. Gegen ihren Willen musste Minou lächeln.
»Sagt, kenne ich Euch, meine Dame? Ich halte das für unmöglich, denn ich müsste mich erinnern, hätte ich je solch ein schönes Gesicht gesehen. Eure blauen Augen … Oder braun, sie sind beides.«
»Ihr kennt mich nicht, Monsieur.«
»Das ist schade«, murmelte er. »Furchtbar schade. Denn wenn ich Euch kennte …«
Minou wusste, dass sie ihn nicht ermutigen sollte – und sie hörte im Kopf die klare Stimme ihrer Mutter, die sie ermahnte weiterzugehen –, aber er war jung, und er klang so reumütig.
»Ihr solltet zu Bett gehen«, sagte sie.
»Philippe«, nuschelte er.
»Es ist früher Morgen. Ihr werdet Euch erkälten, wenn Ihr hier draußen auf der Straße sitzt.«
»Eine Maid, die so klug ist wie schön. Ach, wäre ich doch ein Wörterschmied. Ein Gedicht könnte ich schreiben. Weise Worte. Schön und weise …«
»Guten Tag.« Minou ging weiter.
»Süße Dame«, rief er ihr nach, »Ihr sollt überschüttet werden von Segen. Möge Euer …«
Ein Erkerfenster wurde aufgerissen, und eine Frau lehnte sich hinaus. »Das reicht!«, kreischte sie. »Seit es vier schlug, musste ich Euer Gefasel und Euer Rezitieren erdulden. Keinen Augenblick lang habt Ihr Ruhe gegeben. So, ich hoffe, das stopft Euch das Maul!«
Minou sah zu, wie sie einen Eimer über das Fensterbrett hob, schmutzig graues Wasser schoss an der Mauer hinunter auf den Kopf des Burschen. Er sprang schreiend auf und schüttelte Arme und Beine wie im Veitstanz. Er sah so trostlos und zugleich komisch aus, dass Minou sich vergaß und laut auflachte.
»Ich hole mir den Tod!«, rief er und warf seinen triefenden Hut auf den Boden. »Wenn ich krank werde und sterbe, habt Ihr meinen Tod – meinen Tod – auf dem Gewissen. Dann wird es Euch leidtun. Wenn Ihr wüsstet, wer ich bin. Ich bin ein Gast des Bischofs, ich bin …«
»Wenn Ihr hinscheidet, werde ich jubeln!«, keifte die Frau. »Studenten! Faules Gesindel, jeder Einzelne von euch! Leistet mal nur einen Tag lang ehrliche Arbeit. Dann habt Ihr keine Zeit zum Erfrieren.«
Sie knallte das Fenster zu, die Frauen auf der Straße applaudierten, die Männer grummelten.
»Ihr solltet nicht erlauben, dass sie in diesem Ton mit Euch spricht«, sagte ein pockennarbiger Kerl. »Die hat kein Recht, so zu jemandem von Eurer Stellung zu reden. Das steht ihr nicht zu.«
»Ihr solltet sie dem Seneschall melden«, rief ein anderer. »Sich so an Eurer Person zu vergreifen, das ist ja ein tätlicher Angriff.«
Die älteste der Frauen lachte. »Ha! Weil sie einen Eimer Wasser über ihn ausgekippt hat? Er hat Glück, dass es kein Pisspott war!«
Belustigt ging Minou weiter. Die Streiterei hinter ihr wurde leiser. Sie erreichte den Mietstall, wo ihr Vater ihre alte Stute Canigou unterstellte, dann näherte sie sich der Steinbrücke, die über den Fluss führte. Die Aude stand hoch, doch es ging kein Wind, und die Flügel des Moulin du Roi und der Salzmühlen standen still. Am anderen Flussufer erhob sich die Bastide und wirkte ernst im Frühlicht. An den Ufern breiteten die Wäscherinnen bereits die ersten Bahnen gebleichten Stoffes zum Trocknen unter der Sonne aus. Minou hielt inne und nahm einen Sol aus ihrem Geldbeutel, dann ging sie die hundert Schritt über die Brücke.
Die Münze reichte sie dem Torwächter als Zoll. Er prüfte sie zwischen den Zähnen und stellte fest, dass sie echt war. Dann überschritt das Mädchen, das als Minou Joubert bekannt war, die Grenze, die das alte Carcassonne vom neuen trennte.
Ich werde nicht zulassen, dass mir mein Erbe genommen wird.
Die Jahre, die ich unter seinem widerwärtigen, schwitzenden Leib lag. Jedes Mal die Prellungen und Entwürdigungen, wenn mein Monatsfluss kam. Seine gierigen Finger auf meinen Brüsten zu dulden, zwischen meinen Beinen. Seine Hände, die mir die Haare an den Wurzeln verdrehten, bis das Blut rosa aus der Kopfhaut quoll. Sein saurer Atem. Solche Demütigung von den Händen eines Schweins für nichts? Wegen eines Testaments, das vor neunzehn Jahren aufgesetzt wurde, so sagt er. Sein Geständnis auf dem Totenbett, eine Verirrung seines verfallenden Verstands? Oder liegt Wahrheit in dem, was er sagt?
Wenn es ein Testament gibt, wo mag es sein? Die Stimmen schweigen.
Im Buch der Prediger steht, dass ein Jegliches seine Zeit habe und jedes Vorhaben unter dem Himmel seine Stunde.
Am heutigen Tag, die linke Hand auf der heiligen katholischen Schrift, während die rechte freien Willens die Feder hält, lege ich dies nieder. Dies ist mein aufrichtiger Schwur, der nicht mehr gebrochen werden kann. Ich schwöre beim allmächtigen Gott, niemals zuzulassen, dass die Brut einer hugenottischen Hure bekommt, was rechtmäßig mir gehört.
Vorher töte ich sie alle.
KAPITEL 4
LA CITÉ
»Vergib mir, Vater, denn ich habe gesündigt. Seit meiner letzten Beichte sind …« – Piet griff eine Zahl aus der Luft – »zwölf Monate vergangen.«
Von der anderen Seite des Beichtstuhls in der Kathedrale Saint-Nazaire hörte er ein Husten. Er brachte das Gesicht dichter an das Gitter, das ihn vom Priester trennte, und mit einem Mal roch Piet das unverwechselbare Haaröl seines alten Freundes. Er hielt den Atem an. Merkwürdig, wie ein Geruch einem nach so langer Zeit noch immer das Herz zu zerreißen vermochte.
Er hatte Vidal vor zehn Jahren kennengelernt, als sie beide am Collège de Foix in Toulouse studierten. Piet, Sohn eines französischen Kaufmanns und einer Holländerin, der keine andere Wahl geblieben war, als sich als Hure zu verkaufen, damit sie und ihr Sohn etwas zu essen hatten, war ein verdienstvoller, wenn auch benachteiligter Student gewesen. Mit rascher Auffassungsgabe und einigen Empfehlungsschreiben ausgestattet, hatte er die Gelegenheit ergriffen, sich in kanonischem Recht, Zivilrecht und Theologie zu bilden.
Vidal entstammte der Seitenlinie einer adligen, aber jüngst in Ungnade gefallenen Toulouser Familie. Sein Vater war wegen Hochverrats hingerichtet, seine Ländereien beschlagnahmt worden. Nur seinem Onkel, einem bedeutenden und reichen Verbündeten des Hauses Guise, verdankte er seine Aufnahme in das Collège.
Beide waren sie Außenseiter gewesen und hatten durch ihre intellektuelle Neugier und ihren Fleiß aus ihren Kommilitonen hervorgestochen, von denen die meisten sehr wenig Interesse an der Wissenschaft zeigten. Rasch wurden sie Freunde und verbrachten viel Zeit miteinander. Sie tranken, lachten, diskutierten bis spät in die Nacht und lernten den anderen besser kennen als sich selbst, sowohl seine Schwächen als auch seine Vorzüge. Sie beendeten gegenseitig ihre Sätze und wussten, was der andere dachte, bevor der Gedanke in Worte gefasst war.
Sie standen einander so nahe wie Brüder.
Als ihre Studien abgeschlossen waren, überraschte es Piet nicht, dass Vidal die Priesterweihen empfing. Wie konnte er besser den Besitz seiner Familie zurückerlangen, als indem er Teil des Klerus wurde, der ihr die angestammten Rechte entzogen hatte? Vidal stieg rasch auf: vom Kaplan in der Pfarrkirche Saint-Antonin-Noble-Val in eine Stellung als Beichtvater eines adligen Hauses in der Haute Vallée, dann Rückkehr als Domherr an die Kathedrale Saint-Étienne. Man sprach von ihm bereits als dem zukünftigen Bischof von Toulouse.
Piet hatte einen anderen Weg gewählt.
»Und was hat dich so lange von Gottes Gnade ferngehalten, mein Sohn?«, fragte Vidal.
Piet legte sich das Taschentuch vor den Mund und beugte sich zum Trenngitter.
»Vater, ich habe verbotene Bücher gelesen und vieles darin gefunden, dem ich zustimmen muss. Ich habe Abhandlungen verfasst, in denen ich die Autorität der Heiligen Schrift und der Kirchenväter in Frage stelle, ich habe Meineid geschworen, ich habe den Namen des Herrn missbraucht. Ich bin der Sünde des Stolzes schuldig. Ich habe mit Frauen gelegen. Ich … habe falsches Zeugnis abgelegt.«
Dieses letzte Bekenntnis zumindest entsprach der Wahrheit.
Piet hörte, wie scharf Luft geholt wurde. War Vidal über die Litanei seiner Sünden entsetzt, oder hatte er seine Stimme erkannt?
»Bereust du von Herzen, Gott den Herrn gekränkt zu haben?«, fragte Vidal bedächtig. »Fürchtest du, das Himmelreich zu verlieren, und graut dir vor den Qualen der Hölle?«
Gegen seinen Willen fühlte sich Piet dem vertrauten Ritual verbunden und getröstet von dem Wissen, wie viele Menschen an der Stelle, wo er jetzt kniete, schon mit gesenktem Kopf um Vergebung ihrer Sünden gebeten hatten. Einen Augenblick lang fühlte er sich ihnen allen verbunden, die durch das Bekenntnis erneuert wieder in die Welt hinausgetreten waren.
Alles Lügen, natürlich. Alles unwahr. Dennoch verlieh genau dies der alten Religion solche Macht über Herzen und Köpfe der Menschen. Piet war überrascht, als er merkte, dass er selbst jetzt und nach allem, was er im Namen Gottes gesehen und erduldet hatte, noch immer nicht gefeit war gegen die süßen Versprechungen des Aberglaubens.
»Mein Sohn?«, fragte Vidal wieder. »Warum hast du dich von Gottes Gnade ausgeschlossen?«
Der Augenblick war gekommen. Am Himmel gab es keine Burgen, und es bestand kein Anlass für andere Männer, für ihn in einer antiken, lange toten Sprache zu sprechen. Sein Schicksal hielt er selbst in der Hand. Piet musste sich jetzt offenbaren. Sie hatten einander nahegestanden wie Brüder, ihre Geburtstage lagen nur einen Tag auseinander, im dritten Monat des gleichen Jahres. Doch der heftige Streit zwischen ihnen war seit fünf Jahren nicht beigelegt, und seitdem hatte sich die Welt zum Schlechteren verändert.
Wenn Piet sich offenbarte und Vidal die Schergen rief, konnte er nicht mit Erbarmen rechnen. Er hatte Männer gekannt, die für weniger auf die Streckbank kamen. Doch wenn sein Freund der gleiche prinzipientreue Mensch war wie in seiner Jugend, war es noch immer möglich, zwischen ihnen alles wieder zurechtzurücken.
Piet stählte sich, und zum ersten Mal, seitdem er die Kathedrale betreten hatte, sprach er mit seiner eigenen Stimme, mit dem Akzent, der von seiner Kindheit in den Gassen Amsterdams kündete und von der Färbung des Midi überlagert wurde.
»Ich habe es versäumt, meinen Verpflichtungen nachzukommen. Gegenüber meinen Lehrern und meinen Wohltätern. Gegenüber meinen Freunden …«
»Was sagst du da?«
»Gegenüber meinen Freunden.« Er schluckte. »Gegenüber denen, die mir teuer sind.«
»Piet, bist du das? Ist es möglich?«
»Es tut gut, deine Stimme zu hören, Vidal«, antwortete er so bewegt, dass sich ihm die Kehle zuschnürte.
Er hörte noch ein Einatmen. »Das ist nicht mehr mein Name.«
»Früher war er das.«
»Das ist lange her.«
»Fünf Jahre. Gar nicht so lange.«
Schweigen legte sich auf sie. Piet bemerkte eine leichte Bewegung auf der anderen Seite des Gitters. Er wagte kaum zu atmen.
Er setzte an: »Mein Freund …«
»Du hast keinerlei Recht, mich Freund zu nennen, nach dem, was du gesagt und getan hast. Ich kann nicht …«
Vidals Stimme versagte. Der Abgrund zwischen ihnen war unermesslich. Piet hörte etwas Vertrautes, das Trommeln von Fingern an der Holzwand des Beichtstuhls. Als sie jung gewesen waren, hatte Vidal, wann immer er eine besonders komplizierte Frage oder Regel der Doktrin überdachte, das Gleiche getan. Er hatte auf einen Tisch getrommelt, auf eine Bank, auf den Boden neben der Ulme mitten im Hof des Collège de Foix. Vidal behauptete, es helfe ihm, klar zu denken. Ihre Tutoren und Kommilitonen hatte das ablenkende Klopfen oft in den Wahnsinn getrieben.
Piet wartete, aber Vidal sagte nichts. Am Ende blieb ihm keine Wahl, als den Katechismus zu rezitieren, weil Vidal als Beichtvater ihm dann antworten musste.
»Für diese und alle anderen Sünden meines vergangenen Lebens bitte ich Gott um Vergebung«, sagte Piet. »Erteilt Ihr mir Absolution, Vater?«
»Wie kannst du es wagen! Es ist ein schweres Vergehen, das heilige Sakrament der Beichte zu verhöhnen.«
»Das war nicht meine Absicht.«
»Und doch bist du hier und sprichst Worte, die, wie du selbst zugegeben hast, für dich keinerlei Wert haben. Es sei denn, du wärest zur Besinnung gekommen und in den Schoß der wahren Kirche zurückgekehrt.«
»Verzeih mir.« Piet lehnte den Kopf an das hölzerne Gitter. »Ich wollte dich nicht beleidigen.« Er schwieg kurz. »Du bist schwer zu finden, Vidal. Ich habe mehrmals geschrieben. Als ich vergangenen Winter in Toulouse war, hoffte ich dich zu sehen.« Er schwieg wieder. »Hast du meine Briefe erhalten?«
Vidal beantwortete die Frage nicht. »Fragen sollte man doch eher, wieso du überhaupt nach mir suchst. Was willst du von mir, Piet?«
»Nichts.« Piet seufzte. »Aber … ich möchte dir wenigstens eine Erklärung geben.«
»Eine Entschuldigung?«
»Eine Erklärung«, wiederholte Piet. »Das Missverständnis zwischen uns …«
»Ein Missverständnis! So nennst du es? Hast du dir damit in den vergangenen Jahren dein Gewissen beruhigt?«
Piet legte die Hand an das Trenngitter. »Du bist noch immer zornig?«
»Überrascht dich das? Wie einen Bruder habe ich dich geliebt, habe dir mein Vertrauen geschenkt, und wie hast du es mir vergolten? Durch den Diebstahl …«
»Nein! So war es nicht!«, rief Piet. »Ich weiß, dass du glaubst, ich hätte unsere Freundschaft verraten, und ja, der Anschein spricht gegen mich. Aber bei meiner Ehre, ich bin kein Dieb. Ich habe oft versucht, dich zu finden, weil ich hoffte, den Graben zwischen uns schließen zu können.«
Vidal seufzte. Piet hoffte unvermittelt, dass seine Worte den Panzer seines Freundes durchdrungen hatten.
»Woher wusstest du, dass ich in Carcassonne bin?«, fragte Vidal schließlich.
»Ein Diener in Saint-Étienne. Ich habe nicht wenig dafür bezahlt. Doch andererseits bezahlte ich ihn auch dafür, dass er meine Briefe an dich weitergibt, und das hat er offenbar unterlassen.«
Piet griff in die Ledertasche, die ihm über der Schulter hing. Er war wegen etwas anderem in Carcassonne. Dass er Vidal heute Morgen wiedersehen sollte, nachdem er schon alle Hoffnung aufgegeben hatte, ihn je wieder zu Gesicht zu bekommen, erschien ihm noch immer als seltsame Fügung. Eine Fügung, was sonst konnte es sein? Die Personen, die wussten, dass Piet in Carcassonne war, konnte man an den Fingern einer Hand abzählen. Die Einzelheiten seiner Reise hatte er für sich behalten. Keine Menschenseele wusste, wo er sich einquartiert hatte.
»Alles, worum ich bitte«, sagte er ruhig, »ist eine Stunde deiner Zeit – eine halbe Stunde, wenn das alles ist, was du erübrigen willst. Der Bruch zwischen uns liegt mir schwer auf der Seele.«
Piet verstummte. Er kannte seinen Freund. Wenn er Vidal drängte, erreichte er das genaue Gegenteil dessen, was er anstrebte. Er hörte das beständige Pochen seines eigenen Herzens, während er wartete. Zwischen ihnen schwebten alle Worte, ob ausgesprochen oder ungesagt seit dem heftigen Streit, der ihre Freundschaft beendet hatte.
»Hast du das Grabtuch gestohlen?«, fragte Vidal.
In seiner Stimme war keinerlei Wärme, und dennoch empfand Piet einen Funken Hoffnung. Denn wenn Vidal die Frage überhaupt stellte, musste es bedeuten, dass er zweifelte, ob sich Piet der Tat schuldig gemacht hatte, die ihm zur Last gelegt wurde.
»Das habe ich nicht«, sagte er ruhig.
»Aber du wusstest, dass der Diebstahl verübt werden würde?«
»Vidal, triff dich woanders mit mir, und ich will versuchen, dir alle Fragen zu beantworten. Ich gebe dir mein Wort.«
»Dein Wort! Das eines Mannes, der bereits zugegeben hat, Meineide geschworen zu haben. Dein Wort bedeutet nichts! Ich frage dich erneut: Selbst wenn es nicht deine Hand war, die es nahm, wusstest du, dass man solch ein Verbrechen zu begehen plante? Ja oder nein?«
»So einfach ist das nicht«, sagte Piet.
»So einfach ist es. Entweder bist du ein Dieb – im Gedanken, wenn nicht durch die Tat –, oder dein Gewissen ist rein.«
»Nichts ist einfach in dieser Welt, Vidal. Du als Priester solltest das am besten wissen. Bitte, mein Freund.« Er schwieg kurz und wiederholte es. »Alsjeblieft, mijn vriend.«
Piet spürte, wie Vidal hinter dem Gitter zurückzuckte, und er wusste, dass seine Worte ins Schwarze getroffen hatten. Als sie Studenten gewesen waren, hatte er Vidal ein paar Brocken seiner Muttersprache beigebracht.
»Das war nicht angebracht.«
»Lass mich meinen Fall darlegen«, sagte Piet. »Wenn ich dich noch nicht überzeugt habe, besser von mir zu denken, dann werde ich, bei meiner Ehre …«
»Was? Dich den Behörden stellen?«
Piet seufzte. »Dich nicht länger behelligen.«
Er ging im Kopf rasch die Stunden des Tages durch. Seine Verabredung war mittags, aber danach gehörte seine Zeit ihm. Er hatte beabsichtigt, unverzüglich nach Toulouse zurückzukehren, aber wenn Vidal bereit war, sich mit ihm zu treffen, war das ein ausreichender Grund, seine Abreise auf den kommenden Morgen zu verschieben.
»Wenn du es für unklug hältst, hier in der Cité zu reden, dann komm in die Bastide, Vidal. Ich übernachte in einer Pension auf der Rue du Marché. Die Eigentümerin, Madame Noubel, ist Witwe und sehr verschwiegen. Wir würden nicht gestört werden. Bis auf die Stunde um Mittag bin ich den ganzen Tag und den Abend dort.«
Vidal lachte. »Das glaube ich kaum. Die Bastide ist aufgeschlossener gegenüber Männern deiner Überzeugung, um es so zu nennen, als meiner. Mein Gewand verrät mich. Ich wage mich nicht auf diese Straßen.«
»In diesem Fall«, drängte Piet, »komme ich zu dir. In dein Haus oder wo sonst es dir passt. Wähle Ort und Zeit, und ich werde dort sein.«
Vidal trommelte wieder mit den Fingern auf der abgenutzten hölzernen Trennwand. Piet betete, dass sein alter Freund die Neugierde nicht eingebüßt haben möge. Eine gefährliche Eigenschaft für einen Priester, hatten ihre Lehrer am Collège de Foix gewarnt, wo Ergebung und Gehorsam so wichtig waren.
»Ich werde wie ein Dunst im Nebel sein«, versicherte Piet ihm. »Niemand wird mich sehen.«
KAPITEL 5
Das Trommeln wurde lauter, hartnäckiger. Und genau so abrupt, wie er damit begonnen hatte, stellte Vidal es ein.
»Also gut«, sagte er.
»Dank je wel«, hauchte Piet erleichtert. »Wo soll ich dich aufsuchen?«
»Ich wohne auf der Rue Notre-Dame, im ältesten Teil der Cité«, antwortete Vidal. Nun, da er eine Entscheidung getroffen hatte, klang er energischer. »Ein hübsches Steingebäude, drei Stockwerke hoch, du kannst es nicht verfehlen. Hinter dem Haus ist ein Garten. Ich sorge dafür, dass das Tor unverschlossen ist. Komm nach der Komplet. Nach dem Nachtgebet werden nur noch wenige Leute auf der Straße sein, aber achte dennoch darauf, dass du nicht gesehen wirst. Gib dir größte Mühe! Niemand darf uns miteinander in Verbindung bringen.«
»Ich danke dir«, sagte Piet noch einmal.
»Danke mir nicht«, erwiderte Vidal scharf. »Ich verspreche nicht mehr, als dass ich dir zuhören werde.«
Unvermittelt hallte ein Geräusch durch das Kirchenschiff. Ein Knarren, dann ein Scharren der schweren Nordtür über den Bodenplatten.
Kam noch ein Bußfertiger zur Beichte?
Piet verfluchte sich, unbedacht gehandelt zu haben, aber der Anblick Vidals, der allein in die Kathedrale ging, war ihm als zu großer Glücksfall erschienen, um ihn ungenutzt zu lassen. Der ältere Teil seiner Seele, der mit Wundern und Reliquien aufgewachsen war, hätte vielleicht behauptet, es sei ein Zeichen. Sein moderner Verstand verwarf solche überholten Vorstellungen. Der Mensch war es, der die Welt in Gang hielt, nicht Gott.
Piet hörte Schritte und legte die Hand auf den Griff seines langen, schmalen Dolchs. Wie viele Türen hatte die Kathedrale? Ohne Zweifel mehrere, und er hatte sie sich nicht angesehen, bevor er das Gotteshaus betrat. Er lauschte angestrengt. Zwei Paar Füße und nicht nur eines? Leise, als sollten sie nicht gehört werden.
»Piet?«
»Wir sind nicht allein«, flüsterte er.
Er zückte die Waffe, hob mit der Spitze des Poignards den Vorhang und spähte hinaus ins Kirchenschiff. Zuerst konnte er nichts erkennen, doch dann entdeckte er im schwachen Morgenlicht, das durch die Fenster hinter dem Altar fiel, zwei Männer, die mit blanken Klingen näher kamen.
»Ist es üblich, dass Soldaten der Garnison eine heilige Stätte bewaffnet betreten?«, flüsterte er. »Oder ohne Erlaubnis des Bischofs?«
In Toulouse waren Auseinandersetzungen zwischen Hugenotten und Katholiken etwas Alltägliches und brachten zusätzliche Soldaten auf die Straße – sowohl private Söldner als auch neuangeworbene Stadtwächter. Er hätte nicht gedacht, dass sich die Spannungen in diesem Ausmaß schon bis Carcassonne ausgebreitet hatten.
»Gehören sie der Garnison an?«, fragte Vidal drängend. »Erkennst du das königliche Wappen?«
Piet spähte ins Halbdunkel. »Ich kann kaum etwas erkennen.«
»Der Waffenrock des Seneschalls ist blau.«
»Diese Männer tragen Grün.« Er senkte die Stimme noch mehr. »Vidal, wenn sie dich ansprechen sollten, leugne, dass ich bei dir war. Du hast niemanden gesehen. Niemand ist heute Morgen zur Beichte erschienen. Kein Soldat riskiert sein Seelenheil, indem er einem Priester im Stand der Gnade auch nur ein Haar krümmt.«
Die Selbstgewissheit blieb ihm in der Kehle stecken. Sie lebten in Zeiten des Bluts und des Chaos. Auf seiner Reise nach Süden ins Languedoc hatte Piet genug gesehen, um zu wissen, dass auch eine Kirche keine sichere Zuflucht mehr darstellte – falls sie das je gewesen war. Er spähte wieder aus dem Beichtstuhl.
Die Soldaten durchquerten das Kreuzschiff und durchsuchten die Nebenkapelle hinter dem Altarraum. Es konnte nicht lange dauern, bis sie ihre Aufmerksamkeit auf diese Seite der Kathedrale lenkten. Er durfte hier nicht entdeckt werden.
»Ich bin durch die Nordtür hereingekommen«, flüsterte er eilig. »Welche anderen Ausgänge gibt es?«
»In der Westwand ist eine Tür zum Palast des Bischofs, eine andere unter dem Rosettenfenster, nur befürchte ich, sie sind zu dieser Stunde beide verschlossen.« Vidal hielt kurz inne. »In der Südostecke der Kathedrale sind noch zwei Türen. Eine führt zum Grab Bischof Radulphes und ist eine Sackgasse. Durch die andere gelangst du in die Sakristei. Sie ist für alle bis auf den Bischof und seine Akolythen verboten. Von dort kommst du direkt in die Kreuzgänge.«
»Ist die Tür der Sakristei denn nicht auch abgeschlossen?«
»Sie bleibt unverschlossen, damit die Kanoniker Tag und Nacht hineinkönnen. Sobald du in den Kreuzgängen bist, lass das Refektorium und das Siechenhaus zu deiner Rechten, und du findest ein Tor, durch das du auf die Place Saint-Nazaire gelangst.«
Die Glocken schlugen die Stunde. Ihr rauer Klang füllte die leeren Reihen und verlieh Piet die Deckung, die er brauchte. »Bis heute Abend«, flüsterte er.
»Ich bete für dich«, antwortete Vidal. »Dominus vobiscum.«
Piet duckte sich unter dem schweren roten Vorhang durch und rannte zur ersten gewaltigen Steinsäule. Kurz hielt er inne und eilte weiter zur nächsten. Während die Soldaten auf der anderen Seite vorrückten, stahl er sich gegen den Uhrzeigersinn bis zur Tür der Sakristei. Er drückte die Klinke. Trotz Vidals Zusicherung war sie abgeschlossen.
Lautlos fluchte Piet. Er sah sich um, bis er entdeckte, dass der Schlüssel an einem Haken hing, der in die Steinwand geschraubt war. Er nahm ihn und schob ihn ins Schloss. Er passte schlecht, und zuerst konnte er den Schlüssel nicht drehen. Erst als der letzte Glockenschlag verhallte, gab das Schloss mit einem schweren Ratschen nach.
Zu laut. Die Soldaten fuhren herum. Der Größere von beiden hatte eine auffällige Narbe auf der linken Wange und senkte das Visier seines Helms.
»Halt! Stehen bleiben!«
Doch Piet war schon durch die Tür. Er knallte sie hinter sich zu und verkeilte eine Bank unter dem Griff. Die Blockade würde nicht lange halten, aber seine Verfolger zumindest kurze Zeit aufhalten.
Im Zickzack eilte er durch die Gärten, übersprang die niedrigen Buchsbaumhecken. Er rannte an den Kapitelhäusern vorbei, entdeckte das Tor am anderen Ende des Kreuzgangs und hielt darauf zu. Ein junger Priester trat ihm in den Weg, zu dicht, um den Zusammenstoß noch zu vermeiden. Piet prallte in vollem Lauf gegen ihn und warf ihn zu Boden. Entschuldigend hob er den Arm, aber stehen bleiben durfte er nicht. Seine Muskeln brannten, seine Kehle war trocken, aber er rannte weiter und erreichte das Tor. Sofort riss er es auf und entfloh ins Gassengewirr der Cité.
KAPITEL 6
DIE BASTIDE
Die Glocken schlugen acht, als Minou unter der Porte des Cordeliers hindurchging und die Bastide betrat. Zu ihren frühesten Erinnerungen gehörte, wie sie auf dem Knie ihrer Mutter saß und Geschichten lauschte, wie die beiden Carcassonnes entstanden waren: die Römersiedlung Carcasso auf dem Hügel, der Ansturm der Westgoten im fünften Jahrhundert und, siebenhundertfünfzig Jahre später, die sarazenische Eroberung und die Legende von Dame Carcas. Später folgten der Aufstieg und tragische Fall des Geschlechts Trencavel und das Gemetzel an den Katharern, die der junge Vicomte vergeblich zu schützen versucht hatte.
»Wenn wir die Fehler der Vergangenheit nicht kennen«, sagte ihre Mutter gern, »wie sollen wir da lernen, sie nicht zu wiederholen? Die Geschichte ist unser Lehrmeister.«