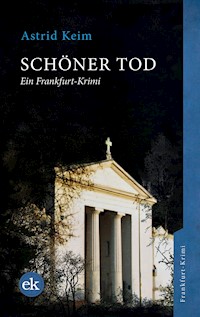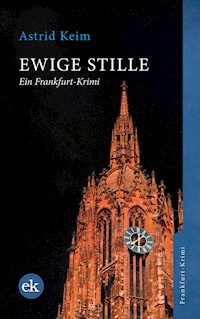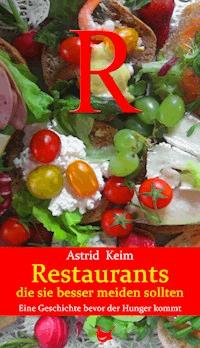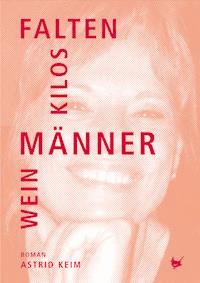Astrid Keim
Das verschwundene Gold
Der Frankfurter Fettmilch-Aufstand 1612–1616
Historischer Roman
Inhaltsverzeichnis
Das verschwundene Gold
Vorwort
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
Geschichtliche Anmerkungen
Persönliche Anmerkungen
Danksagung
Impressum
Orientierungsmarken
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Zwei Jahre lang herrschte Bürgerkrieg in Frankfurt. Nicht nur die Ärmsten erhoben sich, auch Meister und Gesellen der Zünfte sowie Angehörige des Bürgertums. Der Stadtrat, dominiert von Adligen und Patriziern, regierte mit eiserner Hand. Jedes Jahr wurden die Steuern erhöht, die Münzen verloren an Wert und die Lebensmittel verknappten sich. Große Teile der Bevölkerung verarmten, während der Rat Feste feierte und die Steuergelder für seine Lebenshaltung mit vollen Händen ausgab. Im Jahre 1612 entlud sich der schon lange aufgestaute Zorn unter Führung von Vincenz Fettmilch, Zunftmeister der Zuckerbäcker.
Ich habe den Versuch unternommen, diese aufregende Zeit nachzuempfinden, und mich dabei eng an die historischen Ereignisse und Orte gehalten. Mit wenigen Ausnahmen sind Namen, Ämter und Aufgaben der handelnden Personen historisch belegt. Eine dieser Ausnahmen ist der älteste Sohn Fettmilchs – ich nenne ihn Martin. Zwar weiß man, dass Vincenz und Katharina zehn Kinder hatten – acht Mädchen, einen jüngeren sowie einen älteren Sohn –, von denen drei früh verstarben. Über ihre Namen oder Schicksale ist jedoch nichts bekannt.
Schwierig war die Wahl der Sprache, denn hier unterhalten sich Angehörige aller Bevölkerungsschichten. Friedrich Stoltze fand in seinem Drama über den Fettmilchaufstand eine praktische Lösung: Die einfachen Menschen sprechen frankfurterisch, die Gebildeten hochdeutsch. Obwohl ziemlich gut im hiesigen Dialekt bewandert, kam für mich diese Variante jedoch nicht in Frage, schon im Hinblick auf Leser außerhalb des Rhein-Main-Gebietes. Da es mir wenig sinnvoll erschien, altertümliche Ausdrücke oder eine historisierende Sprechweise zu verwenden, entschied ich mich durchgehend für das Hochdeutsche.
1.
Auf der Brücke nach Sachsenhausen gibt es kein Fortkommen mehr. Von beiden Seiten drängeln sich zahlreiche Schaulustige. Auf der östlichen Seite haben Fischer ihre Nachen an zahlungskräftige Kunden vermietet, die das Geschehen hautnah mitverfolgen wollen. Es ist das Jahr 1612. Der frühe Morgen verspricht einen heißen Tag, ungewöhnlich für Ende April. Kein Lüftchen regt sich. Schweißgeruch überlagert die mannigfaltigen Ausdünstungen der zusammengepferchten Leiber. Martin Fettmilch hat sich mit seinem Freund Hans Gerngroß rechtzeitig auf den Weg gemacht, um einen guten Platz in der Nähe des Brückenturms zu ergattern, wo die zum Tode Verurteilten in Gesellschaft eines Geistlichen ihre letzten Stunden verbringen.
Die beiden Burschen könnten unterschiedlicher nicht sein. Martin ist groß und kräftig, mit blonden Haaren und hellen Augen, die fast ins Grünliche spielen. Während die breite, hohe Stirn und das ausgeprägte Kinn von Willensstärke sprechen, mildert der volle, geschwungene Mund diesen Eindruck. Unter der sanften jugendlichen Glätte dieses Gesichts, ahnt man bereits die kantigen Züge des erwachsenen Mannes.
Hans ist weniger hoch gewachsenen, aber von verblüffend gutem Aussehen. Himmelblaue Augen stehen in Kontrast zum dunkelbraunen Haar, das in Wellen über die Schultern fällt. Seine Erscheinung ist von geschmeidiger Schlankheit, und wären da nicht die kräftigen, von harter Arbeit zeugenden Hände, könnte man ihn für einen empfindsamen Poeten halten. Der einzige Schönheitsfehler sind seine schadhaften Zähne. Um die zu verbergen, hat er sich seit einiger Zeit angewöhnt, nicht herauszulachen, sondern mit geschlossenem Mund zu lächeln.
Die Freunde sind ohne Erlaubnis ihrer Väter hier, denn an diesem Tag soll ein Exempel statuiert werden, das diese nicht gutheißen. Ein Diener hatte beim letzten Festessen der adligen Gesellschaft Limpurg eine silberne Weinkanne mitgehen lassen. Es wurde kurzer Prozess gemacht und die Todesstrafe durch Ertrinken verhängt. Manche lachten über das feinsinnige Urteil. Andere konnten das nicht. Der Mann war bitterarm und wusste nicht, wie er das Überleben von Mutter und Schwester sichern sollte. Er sah den Überfluss, die hemmungslose Prasserei und griff zu, in der Hoffnung, es würde schon nicht auffallen.
Die Väter der beiden jungen Männer hatten ein gewisses Verständnis gezeigt, auch wenn sie die Tat selbst nicht billigten, denn die Abgabenlast wird mit jedem Jahr schlimmer. Die Frankfurter Bürger verelenden, während der Rat in Saus und Braus lebt. Früher konnte man von der Stadt für fünf Prozent Zinsen Geld leihen, aber seit einiger Zeit wird dies verweigert. Man muss sich von den Juden das nötige Geld beschaffen, zu einem wesentlich höheren Zinssatz. Wozu die Steuern verwendet werden, weiß keiner, es wird aber gemunkelt, dass büttenweise Gulden in die Judengasse geschafft und dort zu einem Zins von fünf Prozent angelegt werden. Obwohl der Magistrat also über Geld verfügt, profitieren die kleinen Leute nicht davon, im Gegenteil, die Abgaben werden so rigoros eingetrieben, dass nicht wenige im Schuldturm sitzen und ihre Familien vom Ruin bedroht sind.
Trotz alledem wollen die Freunde das Spektakel auf keinen Fall verpassen, wollen vor allem nicht behandelt werden wie kleine Kinder, denen vorgeschrieben wird, was sie zu tun oder zu lassen haben. Unter dem Vorwand, Besorgungen zu machen, haben sie sich davongestohlen. Bei vielköpfigen Familien gibt es immer etwas zu erledigen, und so schöpfte niemand Verdacht.
Das Schauspiel hat fliegende Händler angelockt, die Zuckerstangen und Salzgebäck feilbieten. Zauberer führen ihre Tricks auf, ein Hütchenspieler mit einem Frettchen an der Leine als Blickfang zieht den Leuten Geld aus der Tasche. Zwei Jongleure bringen das Publikum mit ihren Bällen und Ringen zum Staunen. Man plaudert miteinander und ist guter Dinge.
Als sich das Tor des mächtigen Turms öffnet, geht ein Raunen durch die Menge. Ein elendes Häuflein Mensch, das sich kaum auf den Beinen halten kann, gefesselt und mit einem Strick um den Hals blinzelt ins grelle Sonnenlicht. Sogleich bahnen Bewaffnete eine Schneise und räumen den Platz der Hinrichtungsstätte. Als der Weg frei ist, treten zwei Henkersknechte hinzu und schleifen ihn zur Mitte der Brücke. Robuste Männer sind es, mit speckigen Lederkollern, bauschigen, geschlitzten Kniehosen und Stülpstiefeln, deren erbarmungslosen Gesichtern man ansieht, dass sie dieses Handwerk nicht zum ersten Mal verrichten.
Hans zeigt zur Brückenmitte. Dort, wo das Wasser am tiefsten und die Strömung am stärksten ist, befindet sich ein Kreuz mit einem vergoldeten Hahn darauf. »Das hat mir mein Vater erklärt«, sagt er. »Das Kreuz steht für die Gnade, der Hahn für die Buße. So weiß jeder arme Sünder, dass es auch Hoffnung gibt, und kann seinem Ende gefasst entgegensehen.«
Martin hat Zweifel an dieser Aussage. »Gefasst? Das kann ich mir nicht vorstellen. Sieh dir den armen Teufel doch an. Der macht sich ja vor Angst in die Hose.«
Auch die Umstehenden haben es bemerkt, Gelächter und schadenfrohe Bemerkungen machen die Runde, aber auch eine andere Stimme erhebt sich. »Hohn und Spott, sonst habt ihr nichts übrig? Die Todesstrafe für ein wenig Silber, aus der Not genommen, um hungrige Mäuler zu stopfen, genommen von der Tafel eines Patriziers, dessen Truhen davon überquellen, ist das Gerechtigkeit?«
»Nein, das ist keine Gerechtigkeit«, ruft ein Tagelöhner mit gekrümmtem Rücken in löchriger Kleidung, »und deshalb bin ich gekommen, aus Mitleid, aus Anteilnahme, um mit Gebeten das Scheiden dieses armen Menschen zu begleiten.«
Zustimmende Rufe sind zu hören, sogar ein zögerliches Klatschen.
An diesen Aspekt hatten die beiden Freunde noch gar nicht gedacht. Aber doch, so kann man es auch sehen. Hans spricht es aus und grinst. »Eine gute Idee. Sollte uns jemand auf die Schliche kommen, können wir einfach sagen, wir wären aus Anteilnahme hier gewesen.«
Martin kraust die Stirn und wirft dem Gefährten einen schrägen Blick unter gesenkten Lidern zu. Die Worte der beiden Männer haben ihn nachdenklich gemacht. War das wirklich Gerechtigkeit? Die ganze Angelegenheit kommt ihm nicht mehr geheuer vor. Warum die Todesstrafe, warum nicht das übliche Abhacken der Hand? Er hätte auf den Vater hören und nicht hingehen sollen. Da seinen Freund jedoch keine Gewissensbisse zu plagen scheinen, behält er diese Gedanken für sich. Als Schwächling will er schließlich nicht gelten.
Er hält den Atem an, als die Schergen den halb ohnmächtigen, wimmernden Todeskandidaten grob packen und ihn mit gefesselten Händen und Füßen bäuchlings auf eine Planke legen. Der Pastor tritt hinzu, bittet Gott um Gnade für den armen Sünder und spricht ihm Mut zu. Nun waltet der wartende Henker in schwarzer Robe seines Amtes, befestigt die um den Hals liegende Schlinge an den Fußfesseln und schiebt das Brett über die Brüstung.
Martin wird flau im Magen. Ein Aufseufzen geht durch die Menge, dann beginnen einige zu klatschen. Der Jubel allerdings fällt verhaltener aus als sonst, wenn dem Gesetz Genüge getan wird. Ein Schatten hat sich über die Zuschauer gelegt. Von der Volksfeststimmung ist kaum noch etwas geblieben, die Menge beginnt, sich zu zerstreuen. Auch die beiden Freunde machen sich auf den Heimweg. Keiner spricht ein Wort, und Hans ist das Grinsen vergangen. Erst in der Nähe des Doms bricht er das Schweigen. »Ob er wohl schnell gestorben ist?«
»Hoffentlich. Wenn ihn die Strömung sofort auf den Grund gezogen hat, ist es bestimmt schnell gegangen. Wahrscheinlich wird er vom Wasser weggetragen. Vielleicht findet man ihn bei Höchst. Dort landen ja viele an. Dann braucht sich hier niemand um ihn zu kümmern.«
Hans nickt. »Das wäre dem Rat am liebsten. Wird er schnell ans Ufer getrieben, muss man ihn auf dem Schandfriedhof am Gutleuthof begraben. Das kostet Geld.«
2.
Auf dem Liebfrauenberg trennen sich ihre Wege. Martin strebt der Töngesgasse zu, Hans geht in Richtung Neue Kräme. Im Haus zum Hasen, in dem die Familie Fettmilch wohnt, herrscht eine bedrückte Stimmung. Katharina, die Mutter, ansonsten niemals untätig, sitzt mit den Händen im Schoß am Küchenfenster, und starrt in den Garten, zwei der Kinder kauern ihr zu Füßen, eines hat den Kopf in den Schoß gelegt. Nur die Kleinen sind munter wie immer.
Martin spürt die Veränderung sofort. »Was ist los?«, wendet er sich an die Mutter.
Die deutet mit dem Kinn auf seine älteste Schwester Elisabeth. »Sie mag erzählen, mir ist nicht danach zumute. Mein Gefühl sagt mir, dass etwas Ungutes im Gang ist.« Elisabeth berichtet, dass drei Zunftmeister den Vater abgeholt hätten, Conrad Schopp, Conrad Gerngroß und der hitzköpfige Rotbart aus Sachsenhausen, Georg Ebel.
Martin nickt. Er kennt sie. Enge Freunde des Vaters. »Weißt du, warum?«
»Sie haben gesagt, dass sie etwas gegen die Ungerechtigkeit tun müssen, dass es so nicht weitergehen kann, dass es viele gibt, die auch so denken. Sie wollen sich heimlich im Nebenraum vom Christophel versammeln. Und sie haben gesagt, dass Vater dabei sein muss, weil er über alle Dinge Bescheid weiß, weil er lesen und schreiben kann, weil er Latein spricht und weil er gut reden kann.«
»Hast du mitbekommen, was sie vorhaben?«
»Ich glaube, sie wollen sich an König Mathias wenden, wenn er in ein paar Tagen hierher kommt, für seine Krönung zum Kaiser. Dann soll ihm ein Brief mit Forderungen der Bürger an den Rat übergeben werden. Diese Schrift wollen sie wohl aufsetzen.«
Martin horcht auf. Forderungen an den Rat. Kein Bittgesuch, sondern Forderungen. So ist das also, das meinte der Vater, wenn er immer wieder davon sprach, dass vieles im Argen läge, dass man handeln müsse, dass von allein die Missstände nicht aufhören würden. Er hatte diese Reden nicht allzu ernst genommen, aber nun begreift er, dass etwas im Gang ist.
Er wendet sich zur Mutter. »Und deshalb macht Ihr Euch Sorgen?«
Katharina nickt. »Ich habe Angst, dass sich Vincenz auf etwas Gefährliches einlässt. Widerstand gegen die Obrigkeit wird hoch bestraft.«
»Aber man will doch nur ein Schreiben übergeben, das ist kein Widerstand.«
»Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Forderungen offene Ohren finden. Ich kenne deinen Vater. Wenn er sich etwas in den Kopf gesetzt hat, gibt er nicht auf. Was glaubst du, was passiert, wenn der Rat ablehnt?«
Jetzt wird Martin klar, was die Mutter beunruhigt. Natürlich, eine Ablehnung wird man nicht so einfach hinnehmen. Es wird Widerstand geben. Und scheinbar sind sich die Zunftmeister auch schon einig. Warum nur hatte der Vater ihm nichts davon erzählt? Seit zehn Jahren arbeitet er jetzt schon in der Backstube, die das ganze Erdgeschoss des Hauses einnimmt und trägt zum Unterhalt der Familie bei. Bald legt er die Gesellenprüfung ab. Ist das nichts? Hält er ihn für zu jung oder seines Vertrauens nicht wert? Zornig ballt er die Fäuste. Mit siebzehneinhalb ist man erwachsen, ein Mann, kein Kind mehr. Er wird eine Erklärung fordern. Fordern und nicht bitten.
»Ich bin froh, dass du zurück bist, mein Sohn«, unterbricht Katharina seine Gedanken. Sie ist aufgestanden und streicht energisch die Schürze glatt. »Diese Versammlung bedeutet nichts Gutes. Wenn sie geheim sein muss, ist sie gefährlich. In der Bürgerschaft gärt es. Mit mir spricht er nicht über seine Gedanken, aber ich muss wissen, was vor sich geht. Lauf zum Christophel, mein Sohn, und versuche herauszubekommen, was geplant wird.«
Martin kommt dieser Bitte nur zu gerne nach, denn Lene, eine Nichte des kinderlosen Ehepaars Straub, das die Gaststätte Zum Großen Christophel betreibt, geht ihnen in der Schankstube zur Hand. Auf sie hat er ein Auge geworfen und das Interesse ist wohl nicht einseitig, wenn er ihr Lächeln richtig deutet. Die schlanke Gestalt, das feine Oval des Gesichts mit den betonten Wangenknochen und leicht schräg stehenden grauen Augen, gesäumt von dichten, dunklen Wimpern erscheint ihm vollkommen und jedes Mal, wenn er an sie denkt, fängt sein Herz an zu pochen.
Zu dieser Zeit ist sie bestimmt da. Hin und wieder trifft er sie auch zufällig beim Gottesdienst in der Nikolaikirche. Einmal gelang es ihm, verstohlen ihre Hand zu drücken. Sie zog sie gleich wieder zurück, doch unter den gesenkten Lidern fing er einen Blick auf, der ihn hoffen ließ, dass die kühne Annäherung nicht unwillkommen gewesen war.
Um einen guten Eindruck bei Lene zu machen, schlüpft er noch schnell in seine Kammer, kämmt das Haar und zieht ein frisches Hemd an, bevor er sich auf den Weg macht.
3.
Schräge Streifen der späten Abendsonne fallen durch die Butzenscheiben der Fensterreihe zur Straße hin, genügen jedoch nicht, um den Raum zu erhellen. Auf den gescheuerten, stabilen Holztischen brennen Talgkerzen. Noch ist die Gästeschar überschaubar, das wird sich aber bald ändern, denn der Christophel ist beliebt bei den Handwerkern. Ein Fuhrwerk mit Weinfässern steht vor dem Kellerfenster. Muskelbepackte Schröter rollen Fässer über eine schräge Planke auf die Straße, stecken Hähne in die Spundlöcher und befestigen Schläuche daran. Nun kann der Wein in die Tiefe laufen und die Fässer dort unten füllen. Durch eine Falltür im Boden des Gastraums ist der Hausherr, Theobald Straub, bereits hinuntergestiegen, um alles zu überwachen. Zu seiner Freude trifft Martin Lene allein an, denn ihre Tante kümmert sich um die Versammlung der Zunftmeister im Nebenraum. Auf dieses Glück hatte er nicht zu hoffen gewagt. Jetzt gilt es, die Gunst des Augenblickes zu nutzen, denn lange wird es nicht dauern, bis einer der Wirtsleute zurückkommt.
»Lene.« Er tritt auf das Mädchen zu. »Wie schön, dich zu sehen.« Unter seiner Jacke hat Martin ein Lebkuchen versteckt, den er nun hervorholt und ihr entgegenstreckt. »Für dich. Ich habe ihn selbst gebacken.«
Sie nimmt das Gebäck entgegen, riecht daran und bedankt sich mit geröteten Wangen. »Das ist etwas ganz Besonderes. So was bekomme ich nicht jeden Tag. Warte einen Moment, ich muss dein Geschenk in meine Kammer bringen. Ich darf eigentlich nichts annehmen und die Tante sieht es auch nicht gern, wenn ich mit Jungen rede.«
Martin weicht zurück. Auch sie denkt also, er wäre noch ein Kind. Lene hat seine Betroffenheit bemerkt und lächelt ihm zu. »Schau«, sie deutet auf die zwei besetzten Tische, »mit wem ich sonst zu tun habe. Gegen sie bist du noch ein Junge.«
In der Ecke sitzen vier Männer beim Würfeln, am Tisch vor dem hinteren Fenster lassen sich drei weitere lautstark darüber aus, dass man den Rat davonjagen müsse, der für das ganze Elend verantwortlich sei. Alle haben die Mitte des Lebens bereits überschritten, ihre gefurchten Gesichter, die schütteren Haare und schwieligen Hände erzählen von vielen Jahren harter Arbeit. Martin nickt, sie lächeln sich an. Eilig verlässt Lene den Schankraum. Den Lebkuchen verbirgt sie unter ihrer Schürze.
Durch die geschlossene Tür dringen erregte Stimmen. Es scheint hoch herzugehen, nicht alle sind wohl gleicher Meinung. Er tritt näher heran. Polternd stürzt ein Stuhl um. Ob es wohl der Vater war? Sein Bass übertönt alle. Martin versteht Wortfetzen. »Nicht klein beigeben … handeln … der Rat muss …«
Schnell weicht er zurück, als sich die Tür zur Stube öffnet.
»Junge, das ist aber eine Überraschung. Was führt dich hierher?« Frau Straub streckt ihm freundlich ihre Hand entgegen.
Junge, schon wieder Junge! Ist ihr entgangen, wie groß er ist, welche Position er bereits hat? Liegt es daran, dass Frau Straub und seine Mutter gut befreundet sind? Martin kennt sie, solange er denken kann. Er hatte immer Respekt vor ihr. Kann es sein, dass er für sie auch jetzt noch der kleine Bub ist? Nun, das muss sich ändern. Er sehnt sich nach einer Gelegenheit, das Gegenteil zu beweisen.
Mit seiner tiefsten Stimme beantwortet er die Frage. »Mutter schickt mich. Wir machen uns Sorgen um Vater. Er soll bei der geheimen Versammlung hier dabei sein. Stimmt das?«
Frau Straub ist anzusehen, wie sie mit sich kämpft, etwas preiszugeben. Sie zupft an der Haube, öffnet den Mund, aber ihre Lippen schließen sich wieder. Nach kurzem Räuspern beginnt sie zu sprechen. »Du musst dir keine Gedanken machen, dein Vater ist mit Ehrenmännern zusammen. Gemeinsam wollen sie nach Lösungen suchen.«
»Lösungen für welche Probleme?«
Wieder zögert Frau Straub, mustert Martin nachdenklich. Groß ist er geworden, mit Flaum auf den Wangen und einer Stimme, die einmal der seines Vaters gleichen wird. Nein, hier steht kein Kind mehr vor ihr, sondern ein junger Mann, der nach Antworten sucht. Wie viel soll sie ihm erzählen?
Martin bemerkt ihre Unentschlossenheit. Will sie ihm etwas verschweigen? Das darf er nicht zulassen.
»Ich muss die Wahrheit wissen, wenn Vater Gefahr droht …«
»Gut, ich will ehrlich zu dir sein. Es ist möglich, dass ihm Gefahr droht, aber Gefahr droht uns allen. Schau dich um. Die Zahl der einfachen Leute, die nicht mehr das nötige Auskommen haben, um ihre Familien zu ernähren, steigt ständig. Seit 1609 hat sich der Preis für Weizen und Korn fast verdoppelt. In nur drei Jahren! Die Zunft der Bäcker trifft es besonders hart. Du weißt sicher, dass die Bauern nicht mehr in die Stadt dürfen, dass der Rat den Handel an sich gerissen hat. Er kauft das gesamte Getreide bei Überfluss billig ein, lagert es, verkauft es teuer bei Knappheit und schlägt auch noch hohe Steuern darauf.«
Martin entgeht der neue Ton nicht. Endlich, sie nimmt ihn ernst, zieht ihn ins Vertrauen. Er kommt nicht umhin, sich zu freuen, obwohl sie eigentlich nichts Neues erzählt, denn zu Hause wurde darüber gesprochen, aber er machte sich keine Gedanken darüber. Selbst dann nicht, als der Vater in die Judengasse ging. Er musste das Haus mit zweihundert Gulden beleihen, um den Dachstuhl reparieren zu können. Zweihundert Gulden zu zwölf Prozent! Martin war dabei, als er davon berichtete und erinnert sich noch gut daran, dass die Mutter in Tränen ausbrach. »Nie hätte ich gedacht«, schluchzte sie, »dass es so weit kommen könnte. Als wir vor neunzehn Jahren heirateten, bekamst du das Bürgerrecht und konntest in der Backstube arbeiten, sogar Meister werden. Es ging uns gut, auch nachdem die Kinder auf der Welt waren. Als Vater starb, hinterließ er das Haus schuldenfrei mit einem hübschen Batzen Geld im Sparstrumpf. Und was ist jetzt?«
Als sie das betretene Gesicht ihres Mannes sah, ging sie zu ihm, legte den Kopf an seine Brust. »Du hast keine Schuld daran, das weiß ich. Es ist ein Unglück, und ich bete zu Gott, dass er seine Hand über uns hält.«
Vincenz strich mit der Hand über ihre Wange. »Ja, es ist ein Unglück, aber nur auf Gott zu vertrauen – das wird nicht reichen.«
Es ist nicht zu leugnen, er hatte alles gewusst, aber nicht wahrgenommen, hatte so getan, als ginge ihn alles nichts an. Ganz andere Sachen waren wichtig. Wer getraut sich, nach Sachsenhausen zu schwimmen, wer rennt am schnellsten durch den Hirschgraben, welcher von den Kameraden hat die schönste Schwester? Kindereien, nichts als Kindereien. Ihm wird heiß, kleine Schweißperlen stehen auf der Stirn. Er schaut Frau Straub an, als sähe er sie zum ersten Mal.
Die bemerkt seinen Blick. »Du starrst mich an, als hätte dich der Blitz getroffen. Was ist los?«
»Ja, ein Blitz, so kann man wohl sagen. Redet weiter, ich muss alles wissen.«
»Das Blatt hat sich gewendet«, fährt sie fort, unsicher darüber, was Martin meinte, aber berührt von seiner Ernsthaftigkeit, »ja, es hat sich vieles geändert. An allem muss geknausert werden. An den Kerzen, am Fleisch, an der Kleidung. Früher kam auch bei den kleinen Leuten sonntags ein Braten auf den Tisch, das geschieht – wenn überhaupt – heute nur noch an hohen Festtagen. Die Metzger auf der Schirn wissen ein Lied davon zu singen. Sie haben viele Kunden verloren und müssen sich nach der Decke strecken. Außerdem war die Vertreibung der wohlhabenden Calvinisten aus Flandern und der Hugenotten aus Frankreich ein riesiger Fehler.«
Martin unterbricht. Ein kleines Lächeln gleitet über sein Gesicht. Endlich eine Gelegenheit zu zeigen, dass er nicht gänzlich ahnungslos ist. »Das hat mir der Vater gesagt. Sie ließen sich mit ihren großen Färber-, Seiden- und Schneiderwerkstätten in Hanau nieder.«
»Das erst später. Weil man ihnen verboten hatte, ihre Gottesdienste in der Stadt zu feiern, gingen sie nach Offenbach, das den Isenburgern gehört, und nach Bockenheim, das unter der Herrschaft Hanaus steht. Ganz nach Hanau überzusiedeln, war deshalb nur logisch – zu unserem Nachteil.«
»Wieso Nachteil?«
»Es liegt doch auf der Hand. Mit ihren großen Webstühlen und billigen Arbeitskräften machen sie Massenware. Dort kaufen jetzt die Händler ein. Statt Wettbewerb auszuschalten, ist das Gegenteil passiert, alles ging noch weiter bergab. Unsere Tuchmacher stellen keine Stoffe mehr her, und die Schneider keine Gewänder. Die da draußen sind zu billig. Viele Gesellen und Tagelöhner, sogar Meister sind nun ohne Brot und Arbeit.«
Martin ist rot geworden, nickt. »Bei uns bekommt keiner neue Kleider. Wenn etwas fehlt, holt es die Mutter aus der Judengasse.«
»Ja, da quellen die Lager von Pfändern über, die niemand mehr einlöst. Alles gibt es da um ein Weniges, Bücher, Schmuck, Bilder, Schuhe, Gürtel, Hüte, Pelze. Sogar neue Sachen werden für alt verkauft, wegen der Vorschriften. Die Handwerker gehen leer aus. So manche sind bei Wasser und Brot im Leinwandhaus eingesperrt, weil sie ihre Rechnungen nicht mehr zahlen können.«
»Im Haus der Geduld«, grinst Martin.
»Spotte nicht darüber. Es ist grausam dort. Aber wir hatten von den Juden gesprochen. Ich fürchte, mit ihnen wird es einen bösen Lauf nehmen. Die Stimmung hat sich gegen sie gekehrt. An allem gibt man ihnen jetzt die Schuld, dabei bleibt ihnen doch gar nichts anderes übrig, als vom Geldverleih und Verkauf der Pfänder zu leben. Alles andere ist ihnen ja verboten. Dafür stehen sie unter dem Schutz des Kaisers. Wenn sich das einmal ändert, gnade ihnen Gott!«
Martin antwortet nicht, er scheint in Gedanken versunken. Hat es ihm die Sprache verschlagen? Frau Straub beschließt, ihm Zeit zu geben, geht zur Falltür und erkundigt sich, wie es mit der Weinlieferung steht. Dumpf schallt die Stimme des Gatten herauf, ein paar Minuten dauere es noch. Hinter der geschlossenen Tür ist es ruhiger geworden. Der Zwist scheint verebbt. Sie geht zur Spülrinne und macht sich daran, die Kannen zu reinigen, schaut aus den Augenwinkeln zu Martin.
Der steht da wie erstarrt, schreckliche Gedanken gehen ihm durch den Kopf. Was würde aus seinem Freund Jakob? Droht ihm Gefahr? Über zehn Jahre ist es wohl schon her, dass er ihn kennenlernte. Jakob hatte sich aus der Judengasse geschlichen, um die Stadt zu erkunden und verirrte sich prompt in den engen Gassen. Der Vater nahm das weinende Kind zunächst mit nach Hause, übergab es seiner Frau und schickte einen Boten in die Judengasse, denn der gelbe Kreis auf der Jacke verriet seine Herkunft. Die beiden Knirpse verbrachten heitere Stunden miteinander, bis die Eltern eintrafen und ihren Sohn unter großen Dankesbezeugungen und strengen Ermahnungen mit nach Hause nahmen.
Den Jungen gelang es, den Kontakt aufrecht zu erhalten, und so treffen sie sich noch immer gelegentlich, ohne Wissen der Familien, die den Umgang sicher nicht gern gesehen hätten. Martin beißt die Zähne zusammen, strafft die Schultern und fasst einen Entschluss. Es ist an der Zeit, sich mit den Dingen zu beschäftigen, von denen er gerade hörte. So wie sein Vater, so wie dessen Gefährten. Und so wie Frau Straub, die ihm gerade die Visiten las, auch wenn sie es vielleicht nicht so meinte. Er wendet sich ihr zu.
»Verzeiht, ich war in Gedanken, ich muss mit meinem Vater sprechen.« Frau Straub dreht sich mit einer Kanne in der Hand um. »Nicht jetzt. Warte, bis er zu Hause ist. Wenn du vernünftige Fragen stellst, wirst du Antworten bekommen. Vielleicht.«
»Warum vielleicht?«
»Weil es vielleicht besser ist, wenn du nicht alles weißt. Die Versammlung ist wichtig, um die Zustände zu ändern. Wege müssen gesucht und Entscheidungen getroffen werden. Die meisten Bürger sind der gleichen Meinung, auch mein Ehegemahl und ich. Aber es gibt Spitzel. Sobald der Rat etwas von Plänen erfährt, die sich gegen ihn richten, kann es gefährlich werden. Geh jetzt, kümmere dich um deine Mutter. Richte ihr von mir einen Gruß aus und dass ich sie morgen besuche.«
4.
Zögernd macht sich Martin auf den kurzen Heimweg. Sein Schritt ist langsam, die Miene angespannt. Er schaut kaum auf den Weg, zu vieles muss er verarbeiten. Erst die Hinrichtung, die zum Mahnmal geworden ist, dann die geheime Versammlung, jetzt das Gespräch mit Frau Straub. Schlag auf Schlag wurden ihm die Augen geöffnet. Nichts ist mehr so wie gestern noch. Was bis jetzt so wichtig war, hat seine Bedeutsamkeit verloren. Auch Lene? Nein, Lene nicht. Das ist etwas anderes. Aber sie wird ab heute keinen Jungen mehr in ihm sehen, sondern einen Mann, der sich seiner Verantwortung bewusst ist.
Martin ist so mit seinen Gedanken beschäftigt, dass er die Bewaffneten erst bemerkt, als sie schon fast an ihm vorbei sind. Es sind Büttel des Rats mit dem Adler der Stadt auf dem ledernen Wams und derben Stiefeln, deren genagelte Sohlen jeden Schritt betonen. Am Gürtel sind Knüppel befestigt, um die Schultern des Anführers hängt eine Muskete.
Sehr eilig haben sie es offenbar nicht. Ihre Gesichter sind mürrisch, einer spuckt auf den Boden. Diese Kontrolle nach Dienstschluss hätte gerade noch gefehlt, fängt Martin auf, eine Zumutung, als wären sie nicht schon seit dem frühen Morgen auf den Beinen. Ihm stockt der Atem. Sie gehen in die Richtung, aus der er kommt. Sie wollen zum Christophel!
Er nimmt einen schmalen Durchgang und hetzt durch die Hinterhöfe zurück. Völlig außer Atem stürzt er in die Gaststube. »Schnell, schnell. Sie sind auf dem Weg!«
»Nun mal langsam.« Frau Straub legt ihm beruhigend den Arm auf die Schulter. »Wer ist auf dem Weg?«
»Wir dürfen keine Zeit verlieren, wenn mich nicht alles täuscht, soll das Haus durchsucht werden. Büttel sind unterwegs. Es kann nicht mehr lange dauern, bis sie hier sind. Die Versammlung muss fliehen!«
Jetzt ist Frau Straub alarmiert, ruft Lene zu, sie solle ihrem Mann im Keller Bescheid sagen, und dann sofort auf ihr Zimmer verschwinden. Sie eilt in den Nebenraum und kehrt wenig später mit den Männern im Gefolge zurück. Martin und sein Vater tauschen einen Blick. Vincenz nickt. »Das hast du gut gemacht. Geh jetzt.« Und mit Nachdruck: »Sofort! Nimm den Hinterausgang, man darf dich hier nicht sehen.«
»Steigt hinunter.« Die Wirtin deutet auf das Loch im Boden. »Dort unten ist eine versteckte Tür, die zum Braubach führt. Theobald wird sie euch zeigen. Schlüpft hindurch und folgt dem Lauf. Wir werden die Tür verschließen und Fässer davorstellen.« Und mit einem Blick auf die Gäste: »Kein Wort, hört ihr?«
»Da kann ich für alle sprechen.« Ein knorriger, hagerer Mensch mit grimmigem Gesichtsausdruck ist aufgestanden. »Von uns erfährt niemand etwas. Zum Teufel«, er schlägt mit der Hand auf den Tisch, dass das Talglicht flackert, »es wird doch höchste Zeit, etwas zu unternehmen. Wir sind auf eurer Seite.«
Die Falltür ist geschlossen, die Becher im Nebenraum weggeräumt. Es herrscht tiefster Friede, als die Wachtmannschaft eintrifft. Keine Sekunde zu früh. Die füllige Wirtin hatte gerade noch Zeit, ihre Haube zu richten und sich die Schweißperlen von der Stirn zu tupfen. Ihr beleibter Gatte wischt die Hände an der langen, speckig glänzenden Lederschürze ab und begrüßt die Männer jovial mit biederster Miene. »Welch Überraschung, welch besondere Gäste. Was möchtet ihr trinken? Die Runde geht auf mich.«
Die vier Männer tauschen Blicke. Das Angebot ist verlockend. Pflicht oder Vergnügen? Erst die Pflicht, entscheidet der Anführer und stellt sich breitbeinig in Positur. Allzu groß ist er nicht, aber stämmig und muskulös. »Im Namen der Stadt«, fordert er barsch, »gebt die Aufrührer heraus, wir wissen, dass sie hier sind.«
»Aber, meine Herren.« Straub hebt beschwichtigend die Hände. »Welche Aufrührer? Seht ihr hier jemand? Hier sind keine und waren auch keine. Solchem Gesindel bleibt mein Haus verschlossen. Das können meine Gäste bezeugen.«
Von denen hat sich bis jetzt keiner gerührt, aber jetzt kommt lautstarke Unterstützung.
»Das werden wir ja sehen.« Er schiebt den Wirt zur Seite und öffnet die Tür zum Nebenraum. In seinem Gesicht widerstreiten Enttäuschung und Erleichterung, als er ihn leer vorfindet. Die Erleichterung siegt. Zwar handelt er im Auftrag des Magistrats, große Loyalität empfindet er ihm gegenüber jedoch nicht. Dafür ist der Lohn zu karg, von dem nach Steuern kaum das Notwendigste zum Leben bleibt, und die hochmütige Behandlung ärgert ihn schon lange. Kommandos werden hingeworfen, Erklärungen nicht gegeben. Wenn jemand nachfragt, bezichtigt man ihn der Befehlsverweigerung, droht mit Strafe. Jetzt sind sogar Söldner in der Stadt, warum, weiß keiner. Sie nehmen sich heraus, was sie wollen, stolzieren umher wie die Pfauen, zahlen keinen Deut Abgaben und führen sich auf, als seien sie die Herren. Nein, er kennt keinen, der gut auf die Obrigkeit zu sprechen ist, auch nicht unter den Kameraden. Gäbe es Belohnungen für das Ergreifen von Verbrechern, sähe die Sache vielleicht anders aus, dann würde man vielleicht das Haus durchsuchen. Aber unter diesen Umständen … Er spuckt auf den Boden, was ihm sofort einen missbilligenden Blick der Wirtsfrau einbringt, lässt sich auf die Sitzbank fallen und bedeutet seinen Männern, es ihm gleich zu tun. Der Auftrag ist erledigt. Jetzt können sie doch noch den Feierabend genießen. Da kommt die Einladung zu einem Schoppen grade recht.
5.
Die Krönung von Mathias zum Kaiser des Heiligen Römischen Reiches steht bevor. Heute treffen die Reichskleinodien ein. Nürnberg schickte die Heilige Lanze, die Reichskrone, das Reichsschwert, den Krönungsmantel, den Reichsapfel und das Zepter. Aus Aachen holte man das Schwert Karls des Großen und das Reichsevangeliar, aus Palermo trafen die Adlerdalmatika, Strümpfe, Schuhe und Mäntel ein. Keines dieser Stücke darf in dem Zeremoniell fehlen, denn nur ihre Vollständigkeit sichert die Legitimation des Krönungsaktes.
Menschenmassen begleiten den Einzug. Auch Martin und Elisabeth wollten sich dieses Schauspiel anschauen und konnten den Vater überreden, mit ihnen zum Rossmarkt zu gehen. Dort muss der ganze Tross vorbei, von dort aus hat man die beste Sicht.
Elisabeth ist überwältigt vom Reichtum und Glanz, der sich hier offenbart, tritt aufgeregt von einem Bein aufs andere, hüpft zuweilen hoch, um mehr zu erspähen, wenn jemand die Sicht versperrt. Auch Martin lässt sich mit staunenden Augen von der Pracht gefangen nehmen, während der Vater keine Miene verzieht.
Trompeter und Husaren reiten dem rot-goldenen Kronwagen voraus, den vier adlige Kavaliere auf prächtigen Schimmeln begleiten. Es folgen mehrere sechsspännige Staatskarossen und Bagagewagen. Den Schluss bilden Bewaffnete zu Fuß und auf Pferden.
»War das nicht prächtig?«, wendet sich Elisabeth strahlend an den Vater, als sie sich auf den Heimweg machen und hält inne, als sie in sein Gesicht blickt. Falten auf der Stirn und herunter gezogene Mundwinkel sprechen von Missbilligung.
»Ja, das war wirklich prächtig. Hier wurden keine Kosten gescheut. Aber hast du schon einmal nachgedacht, wer das alles bezahlt?«
»Doch wohl der Kaiser.«
»Nein, dem Gesetz nach müssen die Gäste von der Stadt versorgt werden.«
»Aber das sind ja Hunderte. Hat denn die Stadt so viel Geld?«
»Jetzt sind es Hunderte, aber in den nächsten Tagen kommen die Kurfürsten mit ihrem Gefolge und dann der Kaiser mit seinen Leuten. Dann werden es Tausende sein. Du fragst nach dem Geld, ja, das Geld nimmt die Stadt von uns. Von uns kleinen Leuten werden Sonderabgaben für Schutz und Verköstigung dieses Heuschreckenschwarms erpresst.«
»Aber das ist doch ungerecht, dagegen muss man etwas tun!«
Martin hat das Gespräch verfolgt, bleibt stehen, legt eine Faust auf die Brust und bekräftigt mit flammendem Gesicht »Ja, das muss man! Ich will ab jetzt für die Gerechtigkeit kämpfen.«