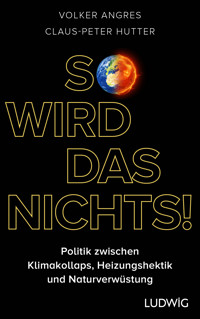11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 15,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ludwig Buchverlag
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Die dramatischen Folgen des heimischen Artensterbens
Es wird still und einsam um uns herum, der Mensch vernichtet seine eigenen Lebensgrundlagen: Die Insektenbestände brechen um über 80 Prozent ein, Tausende Quadratkilometer Ackerrandstreifen und andere Lebensräume wurden in den letzten Jahren vernichtet, Meerestiere sind plastikverseucht – die Vielfalt des Lebens ist massiv bedroht. Claus-Peter Hutter, Präsident von NatureLife-International und Leiter der Akademie für Natur- und Umweltschutz des Landes Baden-Württemberg, und Volker Angres, Leiter der ZDF-Umweltredaktion, zeigen die Gründe für das Artensterben auf, nennen Verursacher und Verantwortliche - insbesondere die industrialisierte Landwirtschaft mit ihrem maßlosen Einsatz von Pestiziden und den endlosen Monokulturen. Und sie machen mehr als deutlich, was endlich getan werden muss. Wie genau das aussehen kann und welche Beispiele es für die Rettung der biologischen Vielfalt gibt, sät ein Körnchen Hoffnung angesichts einer apokalyptischen Entwicklung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 426
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Das Buch:
Tier- und Pflanzenarten sterben aus, neue Arten entwickeln sich. Das ist der Millionen Jahre alte Lauf der Evolution, ein völlig normaler Vorgang. Bis der Mensch dazwischenfunkte. Die Felder voll mit Agrarchemie, denn sonst würden die Böden nichts mehr hergeben. Das Zubetonieren von Flächen für Einkaufszentren oder das Bepflastern der Vorgärten mit Steinen: Keine Chance mehr für Wildblumen und Gehölze. Dabei sind auch Deutschland, Österreich und die Schweiz Vertragspartner der UN-Konvention zum Erhalt der biologischen Vielfalt, Deutschland hat sogar eine eigene Biodiversitätsstrategie verabschiedet. Offenbar ohne durchschlagenden Erfolg:
In der Europäischen Union ist bei 42 Prozent der Tier- und Pflanzenarten im vergangenen Jahrzehnt die Populationsgröße zurückgegangen. Diese alarmierende Entwicklung gefährdet nicht nur die Biodiversität, sondern auch Wirtschaft, Ernährungssicherheit und Lebensqualität von uns allen. Und trotzdem geht es munter weiter so. Ganz legal.
Claus-Peter Hutter und Volker Angres zeigen diesen Skandal auf, machen deutlich, wie weit das Verstummen der Natur schon fortgeschritten ist. Sie beschreiben die Ursachen und zeigen schonungslos, wie sehr die Politik versagt hat. Doch bei aller Besorgnis sehen sie auch Grund zur Hoffnung: Viele kleine Initiativen beweisen nämlich, dass wir alle mithelfen können, das Artensterben zu stoppen.
VOLKER ANGRES · CLAUS-PETER HUTTER
DAS
VERSTUMMEN
DER NATUR
Das unheimliche Verschwinden der Insekten, Vögel, Pflanzen – und wie wir es noch aufhalten können
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
All jenen Menschen gewidmet, die mit großem persönlichem Einsatz und erheblichen Widerständen und oft auch Repressalien zum Trotz für den Erhalt unserer Natur kämpfen.
Originalausgabe 9/2018
Copyright © 2018 by Ludwig Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Ulrike Strerath-Bolz
Umschlaggestaltung: Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich,
unter Verwendung eines Fotos von © Getty Images / Moment / Roc Canals Photography
Satz und E-Book Produktion: Satzwerk Huber, Germering
ISBN: 978-3-641-23194-1V002
www.Ludwig-Verlag.de
Inhalt
Prolog – Teil eins
Tschüs, Schöpfung!
Prolog – Teil zwei
Trägheit tötet: Handeln ist überfällig
Basisfakten
Natur und Kultur Hand in Hand – von der Entwicklung der Artenvielfalt
Wunder Evolution – warum wir Artenvielfalt brauchen
Vernichtungsfaktoren
Bauern, Boden, Bienen – wie ein uraltes System aus den Fugen gerät
Vom Menschsein, menschlichen Dasein und Humanität – ein Gespräch mit Prof. Dr. Wolfgang Haber
Herausforderung Klimawandel
Wissenserosion gefährdet Leben und Demokratie
Das stille Sterben – wie wir vernichten, was wir lieben
Tod in der Tonne und andere Tierfallen
Dummheit vernichtet Dasein
Wenn Wohlstand biologische Vielfalt bedroht
Auerhahn und Feuersalamander haben keine Ersatzlebensräume – Egoismus und Rücksichtslosigkeit gefährden letzte Naturoasen
Gehetzt und vertrieben
Blindes Bauen bedroht Stadtnatur
Typologie der Lebensräume
Durch Wald, Feld und Flur – zur Typologie unserer Lebensräume
Wälder – die grünen Lungen unserer Heimat
Moore – Naturarchiv und CO2-Speicher
Wiesen – blumenbunte Teppiche der Kulturlandschaft
Bäche und Flüsse – Lebensadern der Landschaft
Seen – die blauen Augen der Flur
Leben im Abseits – bedrohte Überlebenskünstler
Rettungsversuche
Retter, Rückschläge, Resignationen – und kleine Hoffnungsschimmer
Wissen wie’s geht – Die Wiesenmacher
Wissen wie’s geht – Bringt der Handel den Wandel?
Vom Werden und langsamen Wirken des europäischen Naturschutzrechts. Gedanken zu Natura 2000
Eine nationale Strategie zur biologischen Vielfalt
Wer rettet die Retter? Das Gegenteil von gut ist gut gemeint.
Die Agrarwende ist überfällig
Das große Versagen der Politik
Der Worte gibt es viele …
Ausblick
Perspektiven – Europa als Chance für unser Naturerbe?
Eine neue EU-Agrarpolitik ist überfällig
Vom exotischen Thema zum Mainstream? – Was sich ändern muss, damit der Naturschutz besser vorankommt
Blick über die Grenzen
Versuch einer globalen Betrachtung
Epilog – Teil eins
Warum wir Katastrophen brauchen
Epilog – Teil zwei
Wie viel Natur sind wir uns selbst wert?
Anhang
Wer macht was? Nützliche Adressen
Anmerkungen
Literatur
Die Autoren
Dank
NatureLife-International Stiftung für Umwelt, Bildung und Nachhaltigkeit
Register
PROLOG – TEIL EINS
Tschüs, Schöpfung!
Der sechste Tag
Und Gott sprach: Wir wollen Menschen machen nach unserm Bild uns ähnlich; die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh auf der ganzen Erde, auch über alles, was auf Erden kriecht!
Und Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn; männlich und weiblich schuf er sie.
Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan und herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, was auf Erden kriecht!1
Gut dreitausend Jahre nach diesem überlieferten, mehrfach neu übersetzten Text lässt sich getrost feststellen: Das haben wir ganz prima hinbekommen. Wir haben uns die Erde untertan gemacht – zwar noch nicht überall und vollkommen, aber mit recht gutem Erfolg –, wir zerstören Wälder und Wiesen, verschmutzen Flüsse und Meere und vernichten Vögel und Fische in rauen Mengen. Wir bedrohen und gefährden mit allerhand chemischen Wirkstoffen schlicht alles Lebendige auf Erden. Menschliche Wesen nicht ausgenommen. Das ist, wenn man so will, auf eine zynische Weise wenigstens konsequent.
»Artensterben« ist das Schlagwort dazu. Meldungen, Berichte und wissenschaftliche Aufsätze gibt es reichlich, der Begriff hat längst auch den Weg in die Medien gefunden und bewegt so nicht mehr nur Naturschützer, sondern eine breite Öffentlichkeit. Tippt man etwa bei Google »Artensterben« ein, erscheinen 494000 Fundstellen in nur 0,4 Sekunden. Beispielsweise weiß Spiegel Online zu berichten, dass jährlich bis zu 58000 Tierarten sterben.
Natürlich ist diese Zahl eine grobe Schätzung, schon deshalb, weil niemand exakt weiß, wie viele Tier- und Pflanzenarten es insgesamt auf der Erde gibt. »Wir sind erstaunlich ignorant bezogen auf die Frage, wie viele Arten heute tatsächlich auf der Erde leben, und noch ignoranter sind wir gegenüber der Frage, wie viele Arten wir verlieren können, bis die Ökosysteme versagen, die die Menschheit am Leben erhalten«, stellt Robert M. May vom Fachgebiet Zoologie an der Universität von Oxford (Großbritannien) fest.2 Die Forscher geben zunächst mal einen Überblick: Die wissenschaftliche Literatur kennt für die Gesamtzahl der irdischen Arten Größenordnungen mit erstaunlichen Unterschieden, nämlich zwischen 3 Millionen und 100 Millionen. Sofort wird klar, dass es bisher keine verlässliche Datenbasis dazu gibt. Der Biologe Prof. Camilo Mora und sein Team haben sich an der Universität von Hawaii dieser Fragestellung angenommen und mithilfe eines recht einfachen statistischen Verfahrens eine von der Fachwelt hoch angesehene neue Methode der Artenschätzung entwickelt. Das Ergebnis: Es gibt auf dem Globus rund 8,7 Millionen Arten (+/-1,3 Millionen statistischer Fehler), die meisten Arten finden sich an Land, rund 2,2 Millionen (+/-0,2 Millionen statistischer Fehler) im Wasser. Camilo Mora bestätigt in seiner Arbeit noch eine andere Zahl: Rund 15000 Arten werden pro Jahr neu entdeckt.3
Eine ganze Menge Zahlenwirrwarr also für den Anfang eines Buches über das Artensterben. Aber wissen Sie was? Eigentlich ist es egal, wie viele Arten wir genau haben und kennen, wie viele verschwinden und wie viele neu entdeckt werden. Entscheidend ist etwas anderes: Wir müssen uns endlich unser Nichtwissen über die Leistungsfähigkeit der Natur und der damit einhergehenden ständigen genetischen Weiterentwicklung, der Evolution, eingestehen.
Wie ist das zu verstehen? Ein Beispiel: In den Siebzigerjahren des 20. Jahrhunderts fand der chinesische Agrarforscher Yuan Longping eine wilde Reissorte. Er kreuzte sie in eine bekannte Linie ein und erhielt einen sogenannten Hybridreis, der den Bauern 30 Prozent mehr Ertrag bescherte. Das also ist die Schlüsselbotschaft: Je mehr Arten verschwinden, bevor wir sie entdeckt haben, desto größer ist die Gefahr, nützliche oder gar überlebenswichtige Eigenschaften z. B. von Pflanzen nie zu entdecken.
Es ist in diesem Zusammenhang auch nicht beruhigend, wenn in der Literatur und in den Medien darauf hingewiesen wird, dass Artensterben ja etwas ganz Normales sei; schon immer habe es große Aussterbe-Szenarien gegeben. Das ist zunächst einmal korrekt. Der Paläontologe Norman McLeod beschreibt die wesentlichen erdgeschichtlichen Mechanismen für das Aussterben der Arten:4 Globale Abkühlung mit Eiszeiten als Folge, Änderung des Meeresspiegels etwa durch tektonische Veränderung der Meeresböden, Sauerstoffmangel in den Meeren, Veränderungen der Ozean-Atmosphären-Zirkulation, Veränderung der Sonneneinstrahlung etwa durch Vulkanausbrüche, Einschläge großer Meteoriten mit erheblichen Folgen wie globaler Dunkelheit und gewaltigen thermischen Blitzen mit Buschfeuern im Umkreis von Tausenden Kilometern um die Einschlagstelle. Diese Ereignisse besitzen ein unglaubliches Potenzial, eine geradezu kosmische Zerstörungskraft. Infolgedessen sind jeweils erhebliche Veränderungen der Biosphäre und der Ökosysteme zu erwarten bzw. auch schon eingetreten.
Das aktuell diskutierte Artensterben ist weit von kosmischen Ausmaßen entfernt. McLeod schätzt, dass es bei ungebrochenen Trends noch rund hundert bis fünfhundert Jahre dauern wird, bis man paläontologisch von einem neuen Aussterbeszenario sprechen kann, einem Szenario also, das sich mit anderen großen Aussterbe-Wellen der vergangenen zig Millionen bzw. Milliarden Jahre vergleichen lässt.
Und doch haben wir Anlass zu großer Sorge. Denn das aktuelle Artensterben kommt anders daher, hat andere Ursachen und verläuft ganz anders als die Ereignisse der frühen Erdgeschichte. Ein Grund dafür ist der Hauptakteur: Der Mensch, der sich die Erde untertan machen will.
Allein von 1945 bis 1962 wurden in den Laboratorien der großen Konzerne rund zweihundert neue agrarchemische Ausgangsstoffe hergestellt. Es handelt sich um Spritz- und Sprühmittel, Pulver und Aerosole, die sich besonders fein als Nebel verteilen. Sie werden unter Tausenden unterschiedlichen Handelsnamen verkauft, werden gern als Pflanzenschutzmittel bezeichnet und bewirken doch nur eins: Sie töten. Damit sogenannte Schädlinge, also Insekten, Nagetiere, aber auch Unkräuter auf bequeme Art und Weise entfernt werden können. Festgestellt und aufgeschrieben hat das als eine der Ersten die amerikanische Biologin und Schriftstellerin Rachel Carson. Ihr Buch Silent Spring, in Deutschland unter dem Titel Der stumme Frühling erschienen, sorgte im Erscheinungsjahr 1962 für einen Schock. Die Macht der neuen Chemikalien ist groß. Rachel Carson schreibt: »Sie töten jedes Insekt, die guten wie die schlechten, sie lassen den Gesang der Vögel verstummen und lähmen die munteren Sprünge der Fische in den Flüssen. Sie überziehen die Blätter mit einem tödlichen Belag und halten sich lange im Erdreich – all dies, obwohl das Ziel, das sie treffen sollen, vielleicht nur in ein wenig Unkraut oder ein paar Insekten besteht. Kann jemand wirklich glauben, es wäre möglich, die Oberfläche der Erde einem solchen Sperrfeuer von Giften auszusetzen, ohne sie für alles Leben unbrauchbar zu machen?«5
Das Buch wurde zum Bestseller und zur »Bibel« nicht nur der amerikanischen Umweltbewegung. Und es wurde zum Problem für all die Konzerne, die mit Agrarchemikalien ihr Geld verdienen. Viel Geld. Bis heute ist das so. Allerdings haben sich die Wirkstoffe verändert, sind weiterentwickelt worden, müssen bestimmte Umweltauflagen erfüllen. Dennoch: Pestizide, hergestellt aus immer neuen chemisch-synthetischen Stoffen und Stoffkombinationen, sind ein zentrales Problem beim neuen Artensterben.
Darauf ist unendlich oft hingewiesen worden, vor allem von den Umweltverbänden. Regelmäßig berichten WWF, BUND, NABU, EuroNatur, Robin Wood und Greenpeace über die Umweltverseuchung mit Agrarchemikalien und fordern seit Jahrzehnten ein Umsteuern in der europäischen Agrarpolitik. Bisher ohne nennenswerten Erfolg. Einig sind sie sich mit mächtigen Leuten: In seinem bereits 1993 erschienenen Buch Earth in the Balance greift US-Senator Al Gore6 die von Rachel Carson geschilderte Problematik auf und fügt weitere Beispiele an: So hat ein in Indonesien versprühtes Insektizid nicht nur die Schädlinge umgebracht, sondern auch eine spezielle Wespenart, die wiederum Schadinsekten in den reetgedeckten Dächern in Schach hielt. Die Folge: Nach und nach stürzten die Dächer ein. Das Insektizid war auch tödlich für Katzen, sie verendeten reihenweise. Darauf befiel eine Rattenplage die Dörfer – und mehr noch: Die Ratten übertrugen die Erreger der Beulenpest.
Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan und herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, was auf Erden kriecht!
Das Herrschen über alles Lebendige: Mit Pestiziden scheint die Menschheit weit über das Ziel hinauszuschießen. Statt die Schöpfung intelligent zu nutzen, bringen wir lieber Lebewesen um, die uns angeblich irgendwie in die Quere kommen. Warum das so ist und dass es durchaus Alternativen gibt, darüber wird auf den folgenden Seiten mehr zu erfahren sein.
Das neue Artensterben: Schon früh gab es dazu international anerkannte Befunde, und auch die internationale Politik ist keinesfalls blind: Schon auf der UN-Konferenz für Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro, wurde im Juni 1992 neben der Klimarahmenkonvention und der Konvention zur Bekämpfung der Wüsten auch die Konvention zum Erhalt der biologischen Vielfalt7 als völkerrechtlich bindender Vertrag verabschiedet. Deutschland ist seit dem Inkrafttreten der Konvention am 29. Dezember 1993 Vertragspartei, genau wie aktuell einhundertfünfundneunzig weitere Länder. Einhundertachtundsechzig davon haben die Konvention ratifiziert, das heißt: politisch anerkannt mit der Verpflichtung zur Umsetzung.
Offenbar bisher ohne durchschlagenden Erfolg: Die biologische Vielfalt geht in allen Regionen der Welt zurück, wie im März 2018 der Weltbiodiversitätsrat meldete.8 In der Europäischen Union weisen 27 Prozent der bewerteten Arten und 66 Prozent der Lebensraumtypen einen »ungünstigen Erhaltungszustand« auf. Bei 42 Prozent der bekannten terrestrischen Tier- und Pflanzenarten ist seit Beginn des Jahrtausends die Populationsgröße messbar zurückgegangen. Hauptursache für den Rückgang der Biodiversität in Europa ist laut Weltbiodiversitätsrat die zunehmende Intensität der konventionellen Land- und Forstwirtschaft. Darunter fallen nicht nur der Einsatz von Agrarchemikalien, sondern auch der Flächenverbrauch, die Bewirtschaftung mit Monokulturen und die damit verbundene Vernichtung von Lebensräumen sowie die Zerstörung aquatischer Lebensräume etwa entlang von Bachläufen.
Diese alarmierende Entwicklung gefährdet nicht nur die Umwelt, sondern auch Wirtschaft, Ernährungssicherheit und Lebensqualität der Menschen. Und trotzdem geht es munter so weiter. Ganz legal. Weil es vor allem die Interessenvertreter der Landwirte so wollen und es genau so der deutschen und europäischen Landwirtschaftspolitik ins Pflichtenheft schreiben. Sie machen sich die Erde untertan. Nimmt man das wörtlich, müsste Gott eigentlich hochzufrieden sein. Müsste. Ist er aber nicht. Wenn er noch mal zu uns sprechen würde, könnte das Zitat so lauten:
Und Gott sprach:
Ich habe einen Fehler gemacht. Der Homo sapiens ist mir zu dumm geraten.
Volker Angres
PROLOG – TEIL ZWEI
Trägheit tötet: Handeln ist überfällig
Die Symptome sind überall sichtbar, die Ursachen der von unserer Gesellschaft verursachten Epidemie Artensterben längst ergründet und definiert. Wir wissen also genug, um handeln zu können. Doch immer wieder wird so getan, als müsste man noch Ursachen erforschen. Denn mit Untersuchungen, Forschungsberichten und dabei festgestellten Erfordernissen für Folgeuntersuchungen lässt sich gut ablenken. Nichts gegen Forschung; die forschende Neugier hat uns Menschen weit gebracht. Aber so berechtigt Grundlagenforschung über das große Geheimnis des Lebens selbst und die faszinierende Vielfalt der Organismen und ihr Zusammenspiel untereinander und mit den verschiedenen Lebensräumen auch ist: Wir benehmen uns wie ein Arzt, der bei einer Patientin mit grippalem Infekt erst noch untersucht, ob der große Zeh am linken Fuß vielleicht eine Fehlstellung aufweist. Oder drastischer: Wie ein Notarzt, der bei einem Unfallopfer mit zerquetschtem Bein, das zu verbluten droht, noch untersucht, ob es nicht etwa zu viel wiegt und sich ungesund ernährt.
Ja, das klingt grotesk. Aber so verhalten wir uns. Wir forschen über den Rückgang von Arten, obwohl wir genug wissen, um die Lebensräume schützen zu können. Um es klar zu sagen: Wir brauchen Forschung, und wir brauchen Dokumentation. Aber statt herauszufinden, ob in irgendeinem Waldstück der Heimat oder der Tropen vielleicht noch eine weitere bislang noch unentdeckte Käferart herumkrabbelt, muss Energie, müssen Finanzmittel, Arbeitskraft und Management in den Schutz größerer Lebensräume gesteckt werden. Sind die erst einmal vor Profitgier und Gedankenlosigkeit gerettet, lässt sich immer noch bequem untersuchen, welche Arten sich dort angesiedelt haben. Da wir nicht nur in Deutschland und in anderen europäischen Ländern, sondern in vielen anderen Teilen der Welt kurz vor dem ökologischen Bankrott stehen, ist das Zeitfenster zum Handeln denkbar klein. Nicht dass die Welt unterginge, wenn einige Tier- und Pflanzenarten vom Planeten verschwinden, aber eines ist sicher: Sie wird viel ärmer werden – und für uns Menschen viel ungemütlicher. Ungemütlicher, als wir uns das mit unserer Haltung »es wird schon weitergehen« überhaupt vorstellen können.
Naturschützer schlagen schon seit Ende der Siebzigerjahre Alarm, dass sich die Tier- und Pflanzenwelt immer mehr verabschiedet. Nicht selten haben sie – zum Teil auch wegen ihres dogmatischen Auftretens – viele Mitbürgerinnen und Mitbürger und erst recht Ignoranten, die sich in ihrem Profitstreben gestört sahen, genervt. Aber inzwischen bemerken immer mehr Menschen, dass in der Natur etwas nicht stimmt. Besitzer oder Mieter eines Hausgartens etwa, weil sie immer weniger Schmetterlinge in ihrer Umgebung flattern sehen. Vogelfreunde, die mit Erschrecken feststellen, dass nur noch halb so viele Vögel wie in früheren Zeiten ans Futterhäuschen kommen. Für die Natur engagierte Mitbürger, die bei großflächigen Aktionen wie »Stunde der Gartenvögel« oder dem »Geo-Tag der Artenvielfalt« feststellen, dass manche Arten immer seltener werden und bei anderen die Individuenzahl abnimmt. Und dies nicht nur an einzelnen Orten, sondern überall. Es sind auch die letzten Spezialisten unter den Botanikern und Zoologen – sie sind ja nicht minder bedroht als ihre Studienobjekte –, die längst in umfassenden Studien belegt haben, wie Dutzende von Wildbienenarten, die nur unter wissenschaftlichem Namen einigen wenigen bekannt sind, oder das nahezu komplette ursprüngliche Artenspektrum der Feldkräuter verschwunden sind. Waren Fragen des Schutzes von Tier- und Pflanzenarten in den Regierungszentralen eher Randthemen, so ist der Verlust der biologischen Vielfalt spätestens mit der sogenannten Krefeld-Studie in den Schaltzentralen der Macht angekommen.9 Sie konnte zeigen, dass in manchen Gebieten die Biomasse der Insekten um mehr als 75 Prozent zurückgegangen ist. In kaum einer Rede des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann fehlt der besorgte Hinweis, dass bei längeren Autofahrten am Kühlergrill so gut wie keine Insekten mehr kleben – ein Hinweis auf das dramatische Artensterben. Die Arten sterben teilweise unbemerkt und lautlos.
Wer jetzt vorschnell ausgemacht haben will, dass natürlich ganz allein die Landwirtschaft an den Pranger gehört, der irrt. Die Zusammenhänge sind deutlich komplexer. Auch wir Verbraucher spielen eine Rolle. Sind wir es doch, die nach scheinbar günstigen Preisen schielen. Unser Einkaufsverhalten erzwingt letztlich eine auf Massenerzeugung ausgerichtete Agrarindustrie. Und wir bezahlen diese Entwicklung mit leer gefegten Feldfluren und dem Verstummen der Natur. Und: Die Natur verschwindet nicht nur auf den großen Agrarflächen, sondern auch vielhunderttausendfach im Kleinen. Haus- und Gartenbesitzer schütten Steine in den Vorgarten, vernichten Wildpflanzen und »pflegen« hinterm Haus den überdüngten sattgrünen Einheitsrasen. Gleichzeitig hängen sie – naturliebend, wie sie sind – Insektenhotels und Vogelnistkästen auf, doch Wildbienen, Schmetterlinge und andere Insekten brauchen Nahrung. Sie brauchen Nektar und Pollen, und einige Vogelarten wiederum brauchen Insekten zum Fressen. Nur Grün macht weder Insekten noch Vögel satt.
So werden Tag für Tag, Stück für Stück Lebensräume vernichtet. Hinzu kommt die Versiegelung in den Dörfern und Städten und beim Straßenbau mit Beton und Asphalt. Ein wirksames politisches oder gesellschaftliches Konzept, um mit diesem schleichenden Tod umzugehen, gibt es bisher nicht.
Weil sich immer mehr Menschen Sorgen um das Verstummen der Natur machen, sind wir diesem Phänomen nachgegangen. Wir haben uns umgeschaut in den zu Agrarsteppen umgewandelten Feldfluren, in Wäldern, entlang von Flüssen und rund um die Seen. Wir haben die Entwicklung der Städte und Dörfer unter die Lupe genommen, und wir haben mit vielen Menschen gesprochen. Mit Wissenschaftlern und Leuten aus der Wirtschaft, mit Bauern und Biologen, mit Naturschützern und Naherholungsmanagern. Wir sprachen mit Fischern und Forstleuten, mit Städteplanern und Statistikern, Bürgermeistern und Bauherren, Landschaftsplanern und Landwirten. Und wir haben über den Zustand der Natur selbst und zusammen mit anderen viel nachgedacht. Deshalb ergründen wir nicht nur das Verstummen der Natur durch das Aufzeigen von Fehlentwicklungen, sondern wir zeigen nach jedem Kapitel Handlungsoptionen auf. Gewiss nicht vollständig; aber immerhin so umfassend, dass niemand mehr sagen kann, er könne nichts tun.
Fangen wir damit an, die Zeit ist knapp. Jeder Tag, an dem nichts geschieht, um dem Verstummen der Natur Einhalt zu gebieten, ist ein verlorener Tag.
Claus-Peter Hutter
BASISFAKTEN
»Die Natur ist die Sprache der Liebe, die Liebe spricht zur Kindheit durch die Natur.«
Bettina von Arnim (1785–1851)
Natur und Kultur Hand in Hand – von der Entwicklung der Artenvielfalt
Monotone Mais- oder Weizenfelder, so weit das Auge reicht. Innerhalb weniger Jahrzehnte wurden jahrhunderte-, ja jahrtausendealte Kulturlandschaften massiv verändert. So massiv, dass angestammte Pflanzenarten wie Ackerrittersporn, Kornblume und Kamille vielerorts verschwunden sind und einstige Feldtiere wie Feldlerche, Feldhase, Feldhamster und Rebhuhn – früher Allerweltstiere – keine Lebensräume mehr finden. Wo noch vor fünfzig Jahren ausgedehnte Wiesen mit den alten Kopfweiden am Wassergraben die Landschaften prägten, wurden in den Niederungsgebieten große Flächen umgebrochen. Überall in Deutschland, Österreich und der Schweiz wurden großflächig Baumreihen, Hecken und Einzelbäume entfernt; mancherorts kann die Feldflur – so wie im Münsterland bei Billerbeck – nur noch als Agrarsteppe bezeichnet werden. Wo einst Abermillionen von weißen und rosa Obstblüten das Frühjahr einläuteten und die Obstwiesen in Tierparadiese verwandelten, dehnen sich heute uniforme Reihenhaussiedlungen, Wohnblocks und gesichtslose Gewerbegebiete in die Landschaft hinaus. Eine verfehlte Agrarpolitik auf europäischer wie nationaler Ebene hat aus dem einstigen artenreichen Mosaik von Natur und Kultur eine Einheitsagrarlandschaft gemacht. Eine Agrarlandschaft, die in den vergangenen zwanzig Jahren immer lebensfeindlicher geworden ist. Vom dänischen Frederikshavn bis zum sizilianischen Palermo radiert die Agrarpolitik innerhalb und außerhalb der Europäischen Union die regionale Vielfalt zunehmend aus und hinterlässt öde Einheitslandschaften. Die nischenreiche Kulturlandschaft mit ihrem vielseitigen Mosaik kleingliedriger Ackerflächen, Grenzfurchen, Wegrainen, Lesesteinhaufen oder den die Felder begrenzenden Baumgruppen fällt zusehends einer Ackermonotonie zum Opfer. Die reiche Lebensfülle der historisch gewachsenen Flur musste in vielen Gegenden einer störanfälligen Reißbrettlandschaft weichen. Beim Spaziergang durch die Fluren sehen wir immer öfter riesige Ackerschläge mit extrem abgewaschenen Kuppen. Nicht zu übersehen sind auch die Wiesengräben, die im abgetragenen Mutterboden ertrinken. Und wo sind die munteren Feldhasen und die verborgen lebenden Feldhamster geblieben? Einst häufige Pflanzen des Feldes wie Kornblume oder Kornrade sind durch sogenannte Kunstdünger, Gülle, Pestizide, Bodenverdichtung sowie die intensive Saatgutreinigung so verdrängt, dass sie nur noch ausnahmsweise zu sehen sind. Und auch die Lebensgrundlagen für viele Insekten sind verloren gegangen. Falter wie der kleine Perlmuttfalter suchen vergeblich nach Ackerstiefmütterchen zur Eiablage. Die kräftig mit Spritzmittel behandelten Äcker bieten fast keiner Schmetterlingsart mehr die Chance zur Ansiedelung. Felder ohne Natur?
Ein Blick zurück – ein kurzer Streifzug durch die Ackerbaugeschichte – macht es möglich, die fatale Entwicklung besser zu durchschauen.
Vom Arbeiten mit der Natur zum Wirtschaften gegen die Natur
Es waren unter anderem die Forschungen des Chemikers Justus von Liebig (1803–1873), die den verhängnisvollen Raubbau an der Natur ermöglicht haben. Liebig entdeckte, dass sich Pflanzen vorwiegend von anorganischen Stoffen ernähren. Demnach können die Verluste an mineralischen Nährstoffen, die im Boden durch den Pflanzenanbau entstehen, durch künstliche Düngung wieder ersetzt werden.
Ebenfalls im 19. Jahrhundert entwickelte sich die chemische Industrie. 1861 entstanden in Deutschland die ersten Kalifabriken. 1913 wurde zum ersten Mal Stickstoffdünger aus Luftstickstoff hergestellt. Um 1930 entwickelten Forscher die ersten synthetischen Pflanzenschutzmittel, sodass seit den Vierzigerjahren zusehends auch chemische Mittel im Landbau eingesetzt wurden. Eine weitere Triebfeder für den heutigen Landschaftswandel stellen die maschinellen Möglichkeiten der Landwirtschaft dar. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts ersetzten Maschinen nach und nach die Zugpferde und Ochsen sowie die menschliche Muskelkraft. 1921 entwickelte dann der Konstrukteur Fritz Huber in Deutschland den sogenannten Bulldog. Wie genau er auf den Typennamen kam, ist nicht bekannt. Klar ist jedoch, was die Erbauer zu dieser merkwürdigen Taufe veranlasste: Von vorne sah der damalige Traktor einer Bulldogge sehr ähnlich. Insgesamt 219253 Exemplare des »Allzweck-Bauern-Bulldog« liefen bis zum Jahr 1960 vom Mannheimer Fließband, dann folgte eine neue Generation von Traktoren. Zuvor hatten bereits mit Dieselmotoren angetriebene Dreschmaschinen den Bauern die kräftezehrende Arbeit mit den hölzernen Dreschflegeln abgenommen. Dampfmaschinen auf Rädern zogen mit den Dreschmaschinen von Hof zu Hof und trennten die Körnerfrüchte vom Rest der Getreidepflanzen. Seit etwa 1870 gehörten die klatschenden Geräusche der Riemen, mit denen die sogenannten Lokomobile die Dreschmaschinen antrieben, zum Alltag auf den Höfen Mitteleuropas. Schon 1885 hatte die Landmaschinenfabrik Heinrich Lanz in Mannheim die tausendste Dampfdreschgarnitur ausgeliefert.
Die Anfänge des Ackers
Die genannten technischen Erfolge wirkten sich jedoch erst seit den Fünfzigerjahren des letzten Jahrhunderts verheerend auf unsere Landschaften und die dort angestammte Tier- und Pflanzenarten aus. Auch engagierte Naturschützer sind weit davon entfernt, sich Zustände wie im 19. Jahrhundert oder zu Beginn des 20. Jahrhunderts zu wünschen; Zeiten, in denen die Menschen oft genug Hunger zu leiden hatten. Doch irgendwann fiel der sorgsame Umgang mit der Natur der Erleichterung der Arbeitsbedingungen endgültig zum Opfer. Und weil über viele Jahre hinweg bis heute Masse statt Klasse und immer größere Betriebe statt angepasster Bauernhöfe subventioniert wurden, ist der alte Gleichklang von Natur und Kultur einer ökologisch bankrotten Landschaft gewichen.
Wir wissen heute genug über ökologische Kreisläufe und Risiken, um klar zu sehen, dass der Zeitpunkt für eine intelligente, »echte« nachhaltige Landwirtschaft längst gekommen ist. Es ist schon auffallend, dass dieser lebensfeindliche Wandel nur den Zeitraum einer Generation benötigte, während es bis dahin mehr als fünftausend Jahre lang gelungen war, die Feldarbeit im Einklang mit der Natur zu betreiben.
Die Wiege des Ackerbaus liegt im Orient
Ob Jungsteinzeit oder die viel spätere Epoche der Kelten: die Ackerbaupioniere auf dem europäischen Kontinent waren nicht die Ersten, die eine solche sesshafte und die Landschaft gestaltende Lebensweise führten. Als in weiten Teilen Europas zwischen dem 9. und 6. vorchristlichen Jahrtausend die Menschen noch als Jäger und Sammler durch die Wälder streiften, kannten die Bewohner der berühmten »alten« Kulturen der Flussoasen Ägyptens, Mesopotamiens, Syriens, Palästinas und Kleinasiens schon den Getreideanbau. Das Gebiet des »grünen Halbmonds« ist höchstwahrscheinlich das Ursprungsgebiet der meisten europäischen und heute weltweit verbreiteten Kulturpflanzen. Auch die Wildformen von zwei sehr alten Weizensorten – Einkorn und Emmer – stammen aus diesem Raum. Zudem haben Forschungsarbeiten ergeben, dass viele Arten der Ackerbegleitflora, die in früheren jungsteinzeitlichen Siedlungen gefunden wurden, ihre Heimat im Vorderen Orient sowie im östlichen Mittelmeerraum haben. Von dort aus gelangten sie mit der Ackerbaukultur über Südosteuropa nach Mittel- und Westeuropa.
Anfang des 5. Jahrtausends vor Christus gelangte der Ackerbau über den Balkan nach Mitteleuropa und etablierte sich hier um etwa 4500 vor Christus. Aber auch in Nordafrika, selbst im Inneren der Sahara bestanden solche Kulturen. Wenn während der Jungsteinzeit die Bevölkerung explosionsartig anwuchs, so ist das auf den Ackerbau mit der im Vergleich zur Jagd sicheren Nahrungsbeschaffung zurückzuführen.
Die Menschen entwickelten Handwerkszeug für die Feldarbeit – zunächst einen einfachen Grabstock, wie er heute noch teilweise von einigen Völkern in Afrika, Indonesien, Südamerika oder Australien angewandt wird, und dann den Pflug. Die ersten Pflüge besaßen nur einen Haken oder Dorn an einem langen Stiel. Damit konnten die Bauern kleine Furchen für die Einsaat schaffen.
Die frühesten schriftlichen Hinweise über die Ernährung und den Ackerbau der Germanen liefern die Römer. Der Schriftsteller Livius schrieb um die Wende zur heutigen Zeitrechnung erstmals über Ackerland, das der germanische Stamm der Kimbern zusammen mit Wohnplätzen von den Römern verlangte, womit er die Auseinandersetzungen zwischen den Römern und Germanen einleitete. Julius Cäsar war über die einfache Form der germanischen Feldbestellung verwundert, weil er aus einem Land kam, das eine damals schon weit fortgeschrittene Ackerbaukultur kannte. Besonders ausgereift war die Bodenbewässerung der römischen Besitzungen. Aus den auf diese Weise in heutigen Nahen Osten und in Nordafrika bewässerten Olivenhainen und Datteloasen erhielten vor allem die wohlhabenderen Römer die Früchte für ihre erlesenen Gastmähler.
Wenn Julius Cäsar nach Ägypten zog, dann nicht nur wegen Kleopatra. Er war auch an den Feldprodukten des Nillandes interessiert. Wie die Unterwasserarchäologie heute nachweisen kann, führten die Römer auf Mittelmeerschiffen Datteln und Getreide aus Ägypten und auch aus anderen Regionen rund ums Mittelmeer ein. Aus dem Werk von Lucius Iunius Moderatus Columella († 70 n. Chr.)10 ist bekannt, dass die Zufuhr von Getreide aus den fernen römischen Provinzen auch deshalb nötig war, weil der einst fruchtbare Boden Italiens ausgelaugt war. Wie viel Getreide die Römer einführten, ist nicht mehr genau zu ermitteln. Aber die Historiker stimmen darin überein, dass das Kernland des Römischen Reiches seinen heute noch an den Resten prächtiger Gebäude ablesbaren Lebensstandard nur aufrechterhalten konnte, weil Getreide von der Iberischen Halbinsel, aus Syrien, Ägypten und anderen Gebieten Nordafrikas eingeführt wurde.
Um die Zeitenwende hatten die Germanen im Vergleich zu den Römern einen gewissen Rückstand, mussten sie doch erst die von den Kelten gelichteten Wälder weiter roden, um Felder bestellen zu können. Dabei förderten sie unabsichtlich die Verbreitung von Wildtieren: Die großen germanischen Waldrodungen im 8. Jahrhundert ermöglichten den aus den asiatischen Steppen stammenden Tieren wie Hase oder Rebhuhn die Zuwanderung nach Mitteleuropa. Dasselbe gilt für viele Pflanzenarten, die aus den Steppen des Ostens und aus dem Mittelmeerraum auf die gerodeten Freiflächen, auf entstehende Wiesen, Weiden und Äcker, gelangten. Durch die Verbreitung des Ackerbaus verwandelten die jungsteinzeitlichen Kelten und Germanen die Ur-Naturlandschaft allmählich in eine Kulturlandschaft. Aus natürlichen Ökosystemen entwickelten sich menschlich stark beeinflusste, aber intakte Agrarökosysteme.
Wie Kultur die Natur förderte
Im Laufe der Zeit entwickelten die Bauern ein ausgeklügeltes System für die Bewirtschaftung ihrer Äcker, um diese mit den damals gegebenen Mitteln so lange wie möglich sowohl für das weidende Vieh nutzen zu können als auch Ackerbau betreiben zu können: die Dreifelder- oder Brachefeldwirtschaft. Die Menschen des Mittelalters ließen die Äcker auf einem jeweils wechselnden Teil der Gemarkung, der sogenannten Zelg, brachliegen, auch wenn die einzelnen Grundstücke verschiedenen Besitzern gehörten. Dieser Teil wurde durch Zäune, Mauern, Dornenhölzer, Erdwälle oder Hecken eingegrenzt. Der allen Bauern auferlegte sogenannte Flurzwang ist erstmals in einer Urkunde des Klosters St. Gallen aus dem Jahr 763 erwähnt. Die hauptsächliche Wirtschaftsform des Mittelalters bestand in einer Abfolge von Brache, Winter- und Sommerfrucht. Nach der Brache pflügte der Bauer die Fläche und säte vor dem Winter das Getreide ein. Im Anschluss an die Ernte im folgenden Jahr nutzte man die Stoppelfläche als Viehweide. Im darauffolgenden Frühjahr wurde Getreide eingesät, und im Herbst nutzte man die Fläche wiederum als Viehweide. Im anschließenden Jahr folgte erneut die Brache, womit der nächste Umlauf begann. Die Dreifelderwirtschaft verlangte dabei von dem einzelnen Bauern, dass er sich den im Dorfrat gefassten Beschlüssen fügte und das gleiche Getreide wie die anderen anbaute.
Die Dreifelderwirtschaft konnte sich bis in die Neuzeit hinein erhalten, weil sie Ackerbau und Viehzucht zum Vorteil beider verknüpfte. Auf der Brachweide sorgte das Vieh für eine Düngung des Bodens, andererseits fand es hier besonders eiweißreiche Nahrung. Vor allem aber bewirkte die Brache eine Erholung des Bodens, da ihn die Bodenlebewesen im Verein mit den Futterpflanzen mit Luftstickstoff anreicherten. Diese Form der Bewirtschaftung trug sogar zur Vielfalt der Natur bei, denn sie ließ entsprechende ökologische Nischen. So konnten auf der Brache die Ackerkräuter immer wieder wachsen und aussamen. Zudem transportierte das Weidevieh gemeinsam mit den umherwandernden Schafen und Ziegen an den Hufen, im Fell und über den Kot die Samen und Früchte in andere Gebiete. Diesen Umständen ist es vermutlich zu verdanken, dass sich die Ackerwildkräuter auf den damals noch sehr verstreut liegenden Äckern so rasch in nahezu allen Teilen Europas ausbreiteten.
Die Verhältnisse änderten sich im 18. und 19. Jahrhundert, als die Brache aufgegeben und durch den Anbau von Klee und Luzerne verdrängt wurde. Ende des 18. Jahrhunderts kam bei diesem neuen Fruchtwechsel als »Brachefrucht« noch die Kartoffel und zu Beginn des 19. Jahrhunderts die Futterrübe, später die Zuckerrübe hinzu. Damit erhielten die Haustiere ein neues Futter und konnten nun auch in den Ställen ernährt werden. Andererseits entstand durch die fehlende Ruhephase und Beweidung der Zwang, die Flächen intensiv zu düngen. Die alte Kreislaufwirtschaft bekam damit schon spürbar Schlagseite; allerdings dauerte in verschiedenen Regionen Europas – etwa in Teilen Spaniens – der Brachefeldbau bis Mitte der Achtzigerjahre des 20. Jahrhunderts fort und existiert zum Teil in Abwandlung noch heute.
Die pure Naturidylle hat es nie gegeben
Freilich, auch wenn es sich so liest: Die pure Naturidylle hat es nie gegeben. Schaut man sich in den Freilandmuseen um, die meist Situationen präsentieren, wie sie bis zur Wende vom 19. auf das 20. Jahrhundert bestanden haben, so sieht man oft kleinste Schweineställe, in denen die Tiere meist einzeln und im Dunkeln gehalten wurden. Solche Formen der Tierhaltung existierten bis in die Sechzigerjahre des letzten Jahrhunderts hinein und waren bestimmt nicht wünschenswert. Auch die aus heutiger Sicht geradezu unbeschreibliche Artenvielfalt auf den Feldfluren wurde nur dort zugelassen, wo Tiere nicht als Konkurrenz des Menschen oder als Jagdbeute galten. Mit Gewehren, Fallen, Schlagstöcken und Leimruten stellten die Menschen vielen Tierarten nach. Nester von Adlern und Falken wurden ausgenommen, die Altvögel abgeschossen und ausgestopft. Alle möglichen Vogelarten wurden gefangen und verspeist. So gibt es etliche Rezepte, wie man Wacholderdrosseln als sogenannte Krammetsvögel zubereitet. Während aber weitverbreitete Arten wie die Wacholderdrossel oder Stare – deren Jungvögel man früher aus den Nistkästen holte, die Kästen wurden überhaupt erst zu diesem Zweck aufgehängt – wegen der reichen Bestände im Großen und Ganzen die Eingriffe der Menschen wieder ausgleichen konnten, ging es solchen Lebewesen, die auf bestimmte, punktuelle Lebensräume angewiesen waren, schon früh an den Kragen. So scheint der Waldrapp – ein eigentümlich aussehender Ibisvogel – der in Felsgeländen in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Frankreich beheimatet war, so gut geschmeckt zu haben, dass die Vogelart wegen der menschlichen Nachstellungen schon im 17. Jahrhundert in Europa ausgestorben war.11
Machen wir uns nichts vor: Die Geschichte der Menschheit ist in erster Linie eine Geschichte des Kampfes gegen die Natur. Säbelzahntiger und Höhlenbär wurden ebenso wie das Mammut von altsteinzeitlichen Jägern ausgerottet. Und wo immer der Mensch auftauchte, verschwand schon bald wegen dessen Nachstellungen die Megafauna. Sechshundert Jahre nach der vor zehn- bis zwölftausend Jahren erfolgten menschlichen Besiedlung Südamerikas waren Riesenfaultier und Riesengürteltier ausgerottet. Zuvor mussten im nordamerikanischen Raum Wollhaarmammut und andere Arten daran glauben. Bis zu sieben Meter lange Echsen, kleinwagengroße Schildkröten und wohl bis zu zwei Tonnen schwere Wombats und 500 Kilogramm schwere, drei Meter hohe Laufvögel waren in Australien nach Ankunft der Menschen vor fünfzig- bis sechzigtausend Jahren bald restlos ausgerottet. Für Neuseeland gilt dasselbe: Nach Ankunft der Menschen waren die Riesenstrauße »Moa« und andere Großtiere bald vernichtet. Seefahrer plünderten nicht nur auf Galapagos, sondern auch auf anderen Inseln die Bestände der Riesenschildkröten und stapelten diese oft über Monate hinweg im dunklen Rumpf der Schiffe als lebende Vorräte. Von einst fünfzehn Unterarten der Galapagos-Riesenschildkröte sind fünf Unterarten komplett ausgerottet.
Wo der Mensch nicht selbst den Tieren nachstellte, waren es seine »Mitbringsel« wie Hauskatzen, Wiesel und die unbeabsichtigt eingeschleppten Ratten, die bis heute den seltenen Nationalvogel Neuseelands – den Kiwi – gefährden. Ebenfalls durch die Nachstellungen hungriger Seeleute – was sollten sie auch anderes tun? – war auch der bis zu 85 Zentimeter große Riesenalk, der früher Inseln im Nordatlantik besiedelte, nahezu ausgestorben. Unglaublich, aber traurigerweise wahr: Was Seeleute nicht fertigbrachten, das schafften Ornithologen und Sammler von Vogelbälgen, die für ihre Sammlungen der selten gewordenen Vögel auf ein Präparat nicht verzichten wollten. 1844 wurden im letzten Rückzugsgebiet der Riesenalke, auf der Felseninsel Eldey, die letzten beiden Exemplare der flugunfähigen Vogelart getötet und ihre Bälge an einen dänischen Sammler verkauft.
Jagdleidenschaft, Ignoranz und Fehleinschätzungen führten auch in Mitteleuropa zur Ausrottung von Lebewesen. So soll der letzte bayerische Auerochse schon 1470 im Neuburger Wald unweit von Passau geschossen worden sein. Der letzte Braunbär wurde 1835 bei Ruhpolding erlegt und einer der letzten frei lebenden Wölfe Süddeutschlands bei Cleebronn unweit von Heilbronn im Jahr 1847. Direkte Verfolgung machten auch Bartgeier, Gänsegeier, Wanderfalke, Uhu, Wildkatze und manch attraktiver Großschmetterlingsart – die von Sammlern gefangen, getötet und aufgespießt wurden – den Garaus. Aus heutiger Sicht fast undenkbar: Noch bis in die Fünfzigerjahre haben »Vogelfreunde« die Nester von Rotrückenwürgern (Neuntöter) geplündert, um Singvögel wie Stieglitz und Rotschwanz zu »schützen«. Weshalb? Nun, Neuntöter jagen nicht nur Insekten und kleine Mäuse, sondern schon auch einmal junge Vögel.
Die schlimmsten Auswirkungen auf die heimische Tier- und Pflanzenwelt hatten jedoch die massiven Umweltverschmutzungen in der Wiederaufbauphase nach dem Zweiten Weltkrieg. Noch in den Sechziger- und anfangs der Siebzigerjahre gehörten Schaumberge an den Schleusen vieler Flussstrecken in Deutschland zum gewohnten Bild. An den Bächen, die mal rot, mal blau oder gelb waren, konnte man sehen, welche Farbe die Gerbereien am Oberlauf gerade verwendeten. Fischsterben war an der Tagesordnung, und der Bestand der Graureiher sowie vieler anderer Wasser- und Watvögel war 1970 auf dem absoluten Tiefpunkt angekommen. Diese Umweltbelastungen und der Bau von Kernkraftwerken führten dann ab Ende der Siebzigerjahre zur Entstehung der Umweltbewegung. Aus klassischen Wander-, Heimat- und Naturschutzverbänden wurden Umweltorganisationen; aus regionalen Vereinigungen formierten sich schlagkräftige Verbände wie der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), der Naturschutzbund Deutschland (damals Deutscher Bund für Vogelschutz) und andere (siehe Anhang des Buches). Die Gründung der Partei Die Grünen im Jahr 1980 und deren späterer Zusammenschluss mit dem Bündnis 90, das aus der Bürgerrechtsbewegung der ehemaligen DDR entstanden war, war die politisch manifestierte Reaktion auf die massiven Umweltzerstörungen.
Diese gipfelten 1986 in einem Chemieunglück der Firma Sandoz (heute Novartis) bei Basel in der Schweiz. Unmengen von Pflanzenschutzmitteln wurden mit dem Löschwasser in den Rhein gespült und lösten eines der größten Fischsterben aus, bei dem unter anderem die Population der Aale auf einer Strecke von 400 Kilometern vernichtet wurde. Dieses Unglück am 1. November 1986 und zuvor schon die Nuklearkatastrophe von Tschernobyl (26. April 1986) führten letztlich zur Gründung des Bundesumweltministeriums und der Länderumweltministerien. Davor waren Aufgaben des Umwelt- und Naturschutzes auf verschiedene Ressorts verteilt und sollten nun gebündelt werden. Seitdem haben die staatlichen Instanzen ebenso wie die Verbände – oft genug auf deren Druck – durchaus einiges erreicht. Kläranlagen wurden gebaut, Schutzgebiete ausgewiesen und Bestimmungen zum Schutz bedrohter Arten erlassen. Zuvor ausgestorbene Arten sind zurückgekehrt, so etwa Biber und Uhu durch gezielte Wiederansiedlungsmaßnahmen und spätere Zuwanderungen. Die Bestände des Weißstorchs und des Kranichs haben sich erholt, nach langjährigen Überwachungen der Brutfelsen sind auch die Populationen des Wanderfalken wieder stabil, und seit den Neunzigerjahren haben sich die Wildkatze und stellenweise der Luchs manche ihrer alten Lebensräume zurückerobert.
Doch allen Schutzmaßnahmen zum Trotz werden manche Arten weiterhin illegal verfolgt. So werden immer wieder Luchse im Bayerischen Wald getötet. Wie es den zunächst von Osten her über Brandenburg und später auch aus anderen Richtungen zugewanderten Wölfen ergehen wird, ist eine heiß diskutierte Frage. Bringen es Gesellschaften in hoch entwickelten Ländern wie Deutschland, Österreich und der Schweiz fertig, auch solchen Tieren ein Lebensrecht zu gewähren, wie man es von den Menschen in armen Regionen ganz selbstverständlich fordert? Mit welchem Argument sollen etwa Menschen in Afrika, Südamerika oder Asien motiviert werden, Löwen, Tiger, Jaguar oder Elefanten zu schützen, wenn unsere wohlstandsgesättigte Gesellschaft nicht bereit ist, auch Wildtiere ohne Kuschelfaktor zu dulden?
Trotz aller Erfolge: die Natur ist auf dem Rückzug
All die Erfolgsgeschichten um Symbolarten wie den Steinadler, der in den Alpentälern wieder zu Hause ist, oder die Graureiher, die jetzt wieder überall zu beobachten sind, dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Natur auf dem Rückzug ist wie noch nie zuvor. Innerhalb von nur fünfzig Jahren haben wir mehr Arten ausgerottet oder an den Rand ihrer Existenzmöglichkeit gedrängt als unsere Vorfahren in fünftausend Jahren. Neben vielen anderen Faktoren ist es letztlich der Wandel von der bäuerlichen Landwirtschaft zur agrarindustriellen Bearbeitung der Ackerflächen mit immer größeren Maschinen und einem mittlerweile jahrzehntelangen Bombardement unterschiedlichster Chemikalien, welches zum Artensterben führt. Die Intensivlandwirtschaft unterscheidet sich vom traditionellen Ackerbau durch intensive Bodenbearbeitung, Stoppelumbruch nach der Ernte, Frühsaat von Sommergetreide in schneller Bearbeitungsfolge, Spätsaat von Wintergetreide sowie die Aussaat in Reihen und eine hochtechnisierte Saatgutreinigung. Hinzu kommt die massive Mineraldüngung aller Kulturen bei gleichzeitiger Entwicklung leistungsfähiger Getreidesorten mit einer raschen Stickstoffverwertung. Vom biologischen Landbau abgesehen, werden mechanische Pflegemaßnahmen auf breiter Front durch chemische Unkrautbekämpfungsmaßnahmen, Kontakt- und Wuchsstoffmitteln, Boden- und Breitbandherbiziden ersetzt. Eine Vielfalt, wie wir sie noch dort antreffen, wo nicht zuletzt für den Fremdenverkehr verschiedene Haustierarten und -rassen gehalten und auch historische Kulturen gepflegt werden, ist in der Breite heute nicht mehr gegeben.
Und so kommen viele Ursachen für den Verlust von Pflanzen- und Tierarten zusammen. Die Abschaffung von Großvieh (Rinder und Pferde) führt zum Verschwinden der Rauchschwalben aus den Ställen. Außerdem sind die Aufgabe der Viehhaltung und die damit einhergehende Beseitigung offener Dunglagerstätten und Jaucheabflüsse (vor allem wegen der Umweltauflagen) sowie der Rückgang von frei laufendem Federvieh wie Hühner, Enten und Gänse nicht ohne Auswirkungen für Insekten, Spinnentiere, Asseln und andere Klein- und Kleinsttiere und Vögel, die im Bereich solcher Areale lebten. Hinzu kommt der Rückgang hofnaher Abstellflächen mit Holzstapeln, die Beseitigung alter Obstbäume einhergehend mit der Pflasterung oder Asphaltierung von Zufahrten und Hofflächen. Überall verschwinden auch alte, vielfältige Bauerngärten, die noch nicht überzüchtete Pflanzen beherbergten: Pflanzen, an denen Hummeln und andere Bienen, Schwebfliegen (die für die Läusebekämpfung wichtig sind) und Schmetterlinge Nektar sammeln konnten.
Die Rauchschwalbe – Symbol für den Exodus der Natur auf dem Land
Seit alter Zeit gelten Schwalben auf dem Land als Glücksbringer. Ihre Ankunft ist ein untrügliches Zeichen für das Ende eines langen Winters und den einsetzenden Frühling. Dagegen kündigt ihr Abflug im September den nahenden Herbst an: »An Maria Geburt fliegen die Schwalben furt!« – und das ist der 8. September. Die Aufenthaltszeit der Schwalben ist gleichbedeutend mit der Dauer der Wachstumsphase in der Vegetation. Insbesondere die Rauchschwalben, deren schüsselförmige Lehmnester früher in allen Kuhställen zu finden waren, zählten zum Inventar jedes Gehöfts. Ihr zwitschernder Gesang gehört wohl zu den bekanntesten Vogelstimmen.
Rauchschwalben haben zwei Bruten mit vier bis fünf Jungen. Die erste schlüpft Ende Mai bis Anfang Juni während der sogenannten Schafskälte – für Insektenfresser eine harte Zeit. Allerdings bieten Rinderställe wegen ihres hohen Dunganfalls und den dazugehörenden Dunghaufen ideale Entwicklungsbedingungen für Fliegen und stellen somit eine überaus reichliche Futterquelle dar. Je größer früher Rinderbestand und Dunghaufen auf einem Bauernhof waren, umso mehr Rauchschwalben gab es im Stall. Damit galt eine hohe Rauchschwalbendichte auf einem Gehöft als Zeichen bäuerlichen Wohlstandes – daher der Ruf der Schwalben als Glücksbringer.
Inzwischen hat sich die Rinderhaltung deutlich verändert. Die wenigen im Dorf verbliebenen landwirtschaftlichen Betriebe haben den Rinderbestand aufgegeben oder aufgestockt. Damit einher geht der Umbau von der Festmistwirtschaft zur Güllewirtschaft. In vielen Dörfern gibt es daher den traditionellen Misthaufen nicht mehr! Damit entfällt ein wesentliches Element aus der Nahrungsversorgung für Schwalben, und ihr Rückgang ist dramatisch. Auch matschige Pfützen auf ausgefahrenen Feldwegen und schlecht gepflegten Hofstellen sind im Zeitalter von Asphalt und Beton zur Seltenheit geworden, sodass auch Nistmaterial für den Bau der Lehmnester knapp wird. Die Zahlen über den Rückgang der Rauchschwalben sind alarmierend. Aber auch dies ist ein Zeichen für den Strukturwandel auf dem Land: Wo Bauern knapp werden, sind auch Schwalben und andere ursprüngliche »Kulturfolger« ein knappes Gut. Es wäre wohl naiv, unter diesen Rahmenbedingungen ein »Dunghaufenprogramm« zu fordern. Allerdings wären der Kulturlandschaft einige Probleme erspart geblieben, wenn anstelle von Schwemmentmistung und Güllewirtschaft eine Festmistwirtschaft entwickelt worden wäre.
Rote Listen – Warnung ohne Wirkung?
Man kann ja nur schützen, was man kennt und wenn man weiß, wo was wie lebt. Unsere Kenntnisse über die Verbreitung von Arten sind aber noch relativ jung. Abgesehen von attraktiveren Blütenpflanzen – wie Orchideen und Enziane – und Vogelarten begann die systematische Kartierung, Dokumentation und Bewertung ebenso wie die Erfassung von Biotopen recht spät, nämlich erst in den Siebziger- und Achtzigerjahren. Zum Teil konnte auf regionale Bestandserhebungen von Spezialisten und Liebhabern zurückgegriffen werden, sodass erste Vergleiche und Analysen möglich wurden. All diese Ergebnisse, die laufend ergänzt und fortgeschrieben werden und zu denen zahlreiche ehrenamtliche Helfer im Naturschutz beitragen, sind Grundlage der »Rote Listen gefährdeter Biotop-, Tier- und Pflanzenarten sowie der Pflanzengesellschaften«. Dies sind nach der Definition des Bundesamtes für Naturschutz12 »…Verzeichnisse ausgestorbener, verschollener und gefährdeter Tier-, Pflanzen- und Pilzarten, Pflanzengesellschaften sowie Biotoptypen und Biotopkomplexe«. Die Roten Listen sollen der Information der Öffentlichkeit über die Gefährdungssituation der Arten und Biotope dienen, aber auch als ständig verfügbare Gutachten Argumentationshilfe für raum- und umweltrelevante Planungen darstellen. Insbesondere zeigen Rote Listen den Handlungsbedarf im Naturschutz auf.
Dieser Handlungsbedarf ist heute größer denn je, das zeigen die Roten Listen selbst. Diese Verzeichnisse der vom Aussterben bedrohten oder gefährdeten Tier- und Pflanzenarten werden länger und länger, während die zu schützenden Lebewesen still und leise (und oft unbemerkt) aus der Landschaft verschwinden. So sind von den 863 bewerteten Lebensraumtypen, die sich in Deutschland unterscheiden lassen, nahezu zwei Drittel (65,1 Prozent) nach Angaben des Bundesamtes für Naturschutz von unterschiedlich hohem Verlustrisiko gekennzeichnet. Es kommt einem ökologischen Staatsbankrott gleich, wenn nahezu die Hälfte der heimischen Tierarten ausgestorben, verschollen, vom Aussterben bedroht oder nach unterschiedlichen Kategorien stark gefährdet sind. Die Datengrundlage ist erschöpfend. Es wurden von den heimischen rund 45000 Tierarten mehr als 16000 Arten – das sind 35 Prozent – hinsichtlich ihrer Gefährdung bewertet. Nicht anders bei den Pflanzen, von denen fast die Hälfte der 28000 in Deutschland beheimateten Arten im Hinblick auf die Gefährdung untersucht und bewertet worden sind. Von den untersuchten Arten stehen schon rund 40 Prozent auf der Roten Liste; 4 Prozent sind bereits ausgestorben. Ursachen sind die Zerstörung von Lebensräumen durch Anlage von Siedlungen, Industrie- und Gewerbegebieten, Verkehrswege und andere Baumaßnahmen. Aber schon an zweiter Stelle – so das Bundesamt für Naturschutz – »… rangierte landwirtschaftliche Nutzung. Nutzungsaufgabe und -intensivierung sind die Hauptursachen, deren Wirkung anhält, besonders auf bisher extensiv bewirtschaftetem Grün- und Ackerland«.
Nimmt man die Roten Listen als Bilanz unseres Umgangs mit der Natur und unserer eigenen Lebensgrundlagen, so ist der ökologische Staatsbankrott schlicht und einfach Realität. Und damit steht das Wunder der Evolution auf dem Spiel, nichts weniger als die Überlebensgarantie der Menschheit.
Fazit: Bald bevölkern mehr Tier- und Pflanzenarten die Roten Listen als die freie Natur.
Wunder Evolution – warum wir Artenvielfalt brauchen
Manchmal geht einem das Gemecker der Naturschützer ganz schön auf die Nerven. Schon wieder Kampf um irgendeinen Tümpel, ein paar Hecken am Wegesrand, ein Waldstück oder einen Uferabschnitt am Fluss. Na klar, schön grün soll alles sein, man will ja die Natur genießen, mit dem Hund spazieren gehen, seiner »Outdoor«-Sportart nachgehen oder in einem sauberen Fluss schwimmen. Gibt es ein neues Naturschutzgebiet, ist womöglich Schluss mit Mountainbiking und Nordic Walking. Plötzlich passen Ranger auf jeden Grashalm auf und verwarnen ungebetene menschliche Eindringlinge. Mitunter fällt es schwer, das nötige Verständnis dafür aufzubringen.
Nun, es geht nicht darum, via Naturschutz möglichst viele Menschen zu ärgern. Es geht darum, der Natur das zu ermöglichen, was sozusagen ihr Kerngeschäft ist. Nämlich eine dauerhafte, optimale Anpassung an die sich ständig und auch immer schneller verändernden Umweltbedingungen zu gewährleisten. Diesen »Job« kann die Natur nur dann erledigen, wenn wir zulassen, dass es eine größtmögliche Artenvielfalt gibt. Nur dann kann das Wunder der Evolution seinen unersetzlichen Lauf nehmen. Es lohnt, sich ein paar Minuten damit zu befassen. Denn wer die Leistungen der Evolution zu würdigen weiß, der wird auch die Notwendigkeit unserer Artenvielfalt (und ihres Schutzes) verstehen.
Der Begriff Evolution wirdim Lexikon meist als »Entwicklung« oder »Veränderungen im Lauf der Zeit« definiert. Im biologischen Zusammenhang bezieht sich die Evolution lediglich auf eine ganz bestimmte Veränderung: die genetische Veränderung in einer Gruppe von Individuen.13 Wir haben schon erwähnt, dass niemand weiß, wie viele Tier- und Pflanzenarten es auf der Erde gibt. Gemeinhin werden Zahlen zwischen drei und 100 Millionen Arten genannt. Natürlich ist es unmöglich, bei einer derartigen Spannbreite überhaupt das Verschwinden der Arten zu quantifizieren. Erst die jüngsten Arbeiten von Prof. Camilo Mora14 und seinem Team an der Universität von Hawaii haben neue Methoden der Schätzung entwickelt (siehe Prolog - TEIL EINS). Trotzdem: Es bleiben Schätzzahlen, nur ein Bruchteil der Arten sind bekannt, also die allermeisten noch gar nicht entdeckt. Andere sterben aus, bevor sie überhaupt gefunden worden sind.
Ein ständiges Auf und Ab der Arten ist etwas völlig Normales. Es gehört zum Gesamtsystem Erde und ist für den Blauen Planeten geradezu typisch, vielleicht sogar ein kosmisches Alleinstellungsmerkmal. Viele wissenschaftliche Abhandlungen belegen, dass es beispielsweise im Erdzeitalter des Kambriums eine explosionsartige Evolution im Tierreich gab – also vor über 500 Millionen Jahren. Plötzlich fand eine reichhaltige Entfaltung von Schwämmen, Ringelwürmern, Krebsen, Trilobiten sowie Stachelhäutern statt. Das belegen Fossilien, also Überreste von Tieren, die in verschiedenen geologischen Ablagerungen gefunden wurden. Paläontologen, Molekularbiologen sowie Entwicklungsgenetiker können heute die Millionen Jahre alten Lebensspuren früherer Organismen anhand hochauflösender Röntgenscans entschlüsseln. Und immer wieder machen spektakuläre Funde von sich reden. Ein Beispiel aus jüngster Vergangenheit ist der Fossilienfund eines sibirischen Einhorns im Jahr 2016 in Kasachstan. Nach Abschluss der Untersuchungen konnten die Paläontologen von der staatlichen Universität Tomsk attestieren, dass ihr Fund aus dem Zeitraum zwischen 28985 und 27490 vor Christus stammen muss.15 Dank Hightech also lassen sich die Evolution und die damit verbundenen Veränderungen der Artenvielfalt entschlüsseln.
Das war vor zweihundert Jahren natürlich noch nicht möglich. Bis zum Ende des 18. Jahrhunderts hatten die Menschen die Vorstellung, dass Gott die Erde etwa viertausend Jahre vor Christi Geburt erschaffen habe und seither keine Tier- und Pflanzenart verschwunden oder dazugekommen sei. Schönheit, Vielfalt und Anpassung an die Umwelt galten als Zeugnis der Schöpfungsmacht. Daraus leitete sich folgerichtig die Schöpfungslehre ab. Es galt die weitverbreitete Meinung, dass für die Erhaltung der Art zwei zur Fortpflanzung gelangende männliche und weibliche Individuen genügen würden. Dieser Gedanke lag auch dem Arche-Noah-Prinzip zugrunde. Dass sich die Lebewesen ständig wandeln und damit ständig neue Arten entstehen, die später auch wieder verschwinden, war mit der Schöpfungslehre nicht vereinbar.
Welche Ursachen für die Evolution und damit für die Veränderung von Tier- und Pflanzenarten verantwortlich sind, versuchte erstmals Jean-Baptiste de Lamarck (1744–1829) Anfang des 19. Jahrhunderts zu ergründen. Der französische Biologe stellte die Theorie auf, dass sich Tiere und Pflanzen durch Gebrauch oder Nichtgebrauch ihrer Organe oder anderer Körperteile an die Bedürfnisse anpassen und dass sich eine solche erworbene Anpassung auf die Nachkommen vererbt. Ein Beispiel der Lamarck-Theorie: Der lange Giraffenhals sei dadurch entstanden, dass ihre Vorfahren als Laubfresser den Hals immer höher nach den Baumzweigen strecken mussten. So sei der Hals immer länger geworden, und damit sei im Laufe der Generationen das Tier in seiner heutigen Form entstanden. Umgekehrt sollte der Nichtgebrauch eines Organs zur Verkümmerung führen; ein Beispiel bei Lamarck waren die beinlosen Schlangen. Die Umbildung eines Organs als Anpassung an die jeweiligen Erfordernisse – daraus leitete der Biologe Lamarck eine Kausalkette ab. An deren Anfang stehen die verschiedenen Gegebenheiten der natürlichen Umwelt. Davon ausgehend stellt sich heraus, welche Körperfunktion und damit welches Organ oder welche Extremität nicht gebraucht werden und somit langsam verkümmern. Diese neu erworbene Eigenschaft wird dann vererbt, was schließlich als Vervollkommnung des Tieres angesehen wird. Verändert sich die Umweltsituation und damit das Bedürfnis, setzt sich die Veränderung und damit die Evolution fort.16
Mitte des 19. Jahrhunderts revolutionierte der britische Forscher Charles Darwin (1809–1882) mit seiner Evolutionstheorie die Naturwissenschaften. Begeistert von Naturkunde und Geografie, begab er sich 1831 auf eine fünfjährige Schiffsreise und umsegelte die Welt. Während dieser Zeit registrierte er die Vielfalt der Tier- und Pflanzenarten und sammelte viele davon ein, um sie später zu sezieren und zu zeichnen. Charles Darwin brachte aber auch Fossilienfunde mit und versuchte sie zu entschlüsseln. Seine erste Feststellung: Die Arten der Jetztzeit unterscheiden sich ganz wesentlich von denen der Vergangenheit. Daraus ergab sich der Schluss: Die Arten konnten nicht unveränderlich sein. »Es ist, als gestehe man einen Mord«, so fasst er seine Erkenntnisse in seinem Brief an einen befreundeten Wissenschaftler in Worte.
Seine Antithese zu den bisher bestehenden Ansichten fasste der Naturwissenschaftler in seinem 1859 erschienenen Buch On the Origin of Species by Means of Natural Selection (Von der Entstehung der Arten mit Hilfe der natürlichen Zuchtwahl) zusammen. In diesem Werk nahm er auch eine einleuchtende Ursachenbeschreibung für die Evolution der Organismen vor. Die Darwin’sche Abstammungslehre stieß erwartungsgemäß auf Kritik, nicht zuletzt beim Klerus. Mediziner, Zoologen und Philosophen jedoch, darunter Ernst Haeckel und August Weismann, verhalfen der Lehre zum Durchbruch. Heute gilt Darwins Evolutionstheorie als eine der wichtigsten wissenschaftlichen Theorien, auf die sich Populationsgenetiker sowie Molekularbiologen weltweit berufen.17
Aus der Fülle der paläontologischen Betrachtungen, der Erkenntnisse der vergleichenden Anatomie und der Erforschung der Tiergeografie hat Charles Darwin abgeleitet, dass die Artenbildung auf Selektion basiert. Er führt zur Begründung seiner Evolutionstheorie mehrere Thesen an:
Die Natur hat sich nicht auf einen Schlag entwickelt, sondern ganz allmählich. Dies wird durch die Belege untermauert, die Charles Darwin während seiner Schiffsreise gesammelt und nach seiner Rückkehr nach England ausgewertet hat.Alle Arten auf der Erde haben sich aus verschiedenen Urformen entwickelt.Um die Wahrscheinlichkeit des Überlebens zu erhöhen, erzeugen Lebewesen viel mehr Nachkommen, als zur Erhaltung der Art notwendig sind. Da die Ressourcen in jedem Lebensraum begrenzt sind, können nicht alle Organismen überleben.