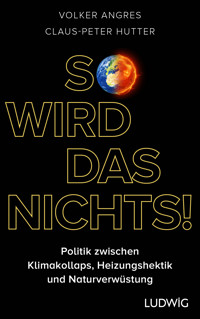
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ludwig Buchverlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Angenommen, Sie haben eine Milliarde für den Klimaschutz, was würden Sie mit dem Geld machen?
Klar: Da ausgeben, wo es am meisten Klimaschutz dafür gibt. Doch in der aktuellen Politik geschieht das häufig nicht. Im Gegenteil: Das Geld fließt in Maßnahmen, die Umwelt und Klima schaden. Bürokratie, Subventionen, versteckte Kosten und falsche Ökobilanzen verhindern wirksame Maßnahmen. Währenddessen erleben wir Hitze, Dürre, Waldbrände und Fluten. Doch statt schnell Überlebensstrategien für Mensch und Natur umzusetzen, leisten wir uns teure Öko-Romantik. So eingelullt, werden Fehlentwicklungen von unserer Gesellschaft und auch von den Medien gar nicht mehr wahrgenommen. Ob Green Deal der EU, E-Mobilität oder vermeintlich umweltschonende Landwirtschaft: Was uns vorgegaukelt wird, sind vielfach Öko-Fakes, politische Konzepte, die nichts gegen den Klimawandel ausrichten und viel zu wenig für die Umwelt tun.
Volker Angres und Claus-Peter Hutter hinterfragen die missionarische Entwicklung der Ökoblase kritisch und beleuchten kenntnis- und faktenreich die wichtigsten Politikfelder. Sie stellen Akteure vor, die schon seit Langem wissen, wie es besser geht, und zeigen anhand von Beispielen, wie wirklich nachhaltige Lösungen aussehen. Das Einzige, was sie für all das brauchen, ist gesunder Menschenverstand.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 444
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über dieses Buch:
Was würden Sie machen, wenn Sie eine Milliarde Euro für den Klimaschutz hätten? Klar: Da ausgeben, wo es am meisten Klimaschutz dafür gibt. Doch in der aktuellen Politik geschieht das häufig nicht. Im Gegenteil: Bürokratie, Subventionen, versteckte Kosten und falsche Ökobilanzen verhindern wirksame Maßnahmen. Währenddessen erleben wir Hitze, Dürre, Waldbrände und Fluten. Doch statt schnell Überlebensstrategien für Mensch und Natur umzusetzen, leisten wir uns teure Ökoromantik: Was uns vorgegaukelt wird, sind vielfach Ökofakes – politische Konzepte, die nichts gegen den Klimawandel ausrichten und viel zu wenig für die Umwelt tun.
Volker Angres und Claus-Peter Hutter hinterfragen die Entwicklung der Ökoblase kritisch und beleuchten kenntnis- und faktenreich die wichtigsten Politikfelder. Sie stellen Akteure vor, die schon seit Langem wissen, wie es besser geht, und zeigen anhand von Beispielen, wie wirklich nachhaltige Lösungen aussehen. Das einzige, was Sie für all das brauchen, ist: gesunder Menschenverstand.
Über die Autoren:
Volker Angres ist Autor, Moderator und Coach. Nach seiner Ausbildung zum Bankkaufmann studierte er Publizistik, Politik und Pädagogik mit Abschluss Magister Artium (M.A.) in Mainz. Er war von 1990 bis 2022 Leiter der ZDF-Umweltredaktion und ab 2014 stellvertretender Leiter der Hauptredaktion Wirtschaft, Recht, Soziales, Service und Umwelt. Er verantwortete u. a. die Umwelt-Dokureihe planet e. und arbeitete als Autor für das heute-journal sowie die heute-Nachrichten. Für seine Arbeit wurde Angres mehrfach ausgezeichnet. Er war Mitglied im Nationalkomitee der UN-Dekade »Bildung für Nachhaltige Entwicklung« und gehörte bis März 2024 dem Verwaltungsrat der Stiftung Warentest an. Seit 2022 ist er u. a. Botschafter des Natourale-Filmfestivals in Wiesbaden.
Claus-Peter Hutter ist Präsident der Stiftung NatureLife-International, Autor, Mitautor und Herausgeber zahlreicher Bücher und Publikationen rund um das Thema Natur sowie zu Umwelt und Verbraucherthemen. Der Diplom-Verwaltungswirt (FH) setzt sich unter anderem als Ehrensenator der Universität Hohenheim und Lehrbeauftragter der Universität Stuttgart sowie als freier Berater für einen unverkrampften Umweltdialog ein. Auch als langjähriger Leiter der Umweltakademie Baden-Württemberg entwickelte er wegweisende Projekte. Für sein Engagement wurde er unter anderem mit einer Ehrendoktorwürde und dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Hutter initiierte die ersten Umwelt-Städtepartnerschaften in Europa und half in Südostasien, unter anderem 1,2 Millionen Bäume zu pflanzen.
VOLKER ANGRES
CLAUS-PETER HUTTER
SO WIRD DAS NICHTS!
Politik zwischen Klimakollaps, Heizungshektik und Naturverwüstung
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Die Familie Craft mit Lara, Lennart und Finn ist für dieses Buch frei erfunden. Jede Ähnlichkeit mit lebenden Personen ist nicht beabsichtigt und wäre rein zufällig. Ebenso ist die Waschmaschinenmarke ›MarkantDoppelPlus‹ frei erfunden. Sollte eine entsprechende Marke existieren, wäre auch das eine rein zufällige Duplizität.
All jenen gewidmet, die sich als Helden der Landschaft oder des Bürokratiedschungels unbeirrt für Naturbewahrung, Umweltvorsorge und Klimaschutz einsetzen. All jenen Menschen, denen der gesunde Menschenverstand noch nicht abhandengekommen ist, die sich nicht von Ökofloskeln blenden lassen und im Gegensatz zu vielen machen statt schwätzen …
Originalausgabe 2024
Copyright © 2024 by Ludwig Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Anne-Kathrin Janetzky
Umschlaggestaltung: wilhelm typo grafisch
Satz: satz-bau Leingärtner, Nabburg
ISBN 978-3-641-31711-9V001
www.Ludwig-Verlag.de
Inhalt
Ein Pamphlet
Begegnung mit der wirklich »letzten Generation«
Zwischen Ökophrasen und Kompetenzillusion
Über grüne Fantasien und graue Wirklichkeit
Das Projekt »Energiewende«
Bauern, Bio, Bürger im freien Fall – Landwirtschaft am Scheideweg
Vom Milliardengrab verfehlter Agrarpolitik
Bevor den Städten die Luft ausgeht
Warum wir wieder kontinuierliche Stadt- und Siedlungsplanung brauchen
Historische Momente
Was die Menschheit missachtet hat
Wird der Wald noch alt?
Bäume statt Bürokratie
Wissenserosion bedroht Zukunftsfähigkeit
Wenn Bildungspolitik versagt
Mobil ins Abseits?!
Verkehrspolitik zwischen Aberglauben und Realitätsverweigerung
Epilog: Laras Lösung
Dank
Über die Autoren
Anmerkungen
Register
Die Eine-Milliarde-Euro-Frage: 17 Antworten, 17 Ideen
Svenja Schulze
Prof. Dr. Ottmar Edenhofer
Arved Fuchs
Dipl.-Ing. agr. Dr. Alois Kapfer
Sonja Aldinger
Dr. Monika Griefahn
Prof. Dr. Peter Hennicke
Prof. Dr. Lamia Messari-Becker
Prof. Dr. Mojib Latif
Rüdiger Beck
Martin Janner
Dagmar Fritz-Kramer
Dr. Christoph Schenck
Dr. Markus Reinbold
Günther H. Oettinger
Prof. Dr. Julia Fritz-Steuber
Sven Plöger
»Der Mensch ist nicht das Produkt seiner Umwelt – die Umwelt ist das Produkt des Menschen.«
Benjamin Disraeli, Schriftsteller und britischer Premierminister, 1804–1881
EIN PAMPHLET
Stadtbewohner stöhnen unter der Gluthitze. Ein paar Kilometer weiter: Ganze Ortschaften werden überschwemmt, saufen ab. Totalverlust von Wohneigentum, Verletzte, gar Tote. Wärmepumpen als Klimaretter!? E-Auto-Subventionen statt Mobilitätskonzepte. Auf den Feldern stirbt die Artenvielfalt, nebenan auch der Naherholungswald. Aber massenhaft stehen Tauben und Saatkrähen unter Schutz. Sanierungsstau bei der Bahn. Keine deutsche Autobahn ohne Baustelle. Marode Brücken überall. Öffentliche Gebäude, vor allem Schulen, bröseln dahin. Dazu passend: das Bildungssystem im freien Fall. Mehr als nur peinlich für Deutschland: die PISA-Studie. Gleichzeitig: Die Sozialausgaben gehen durch die Decke – sie sind längst der mit Abstand größte Posten im Bundeshaushalt. Ein Fass ohne Boden. Keine Anreize zur Bildung, zur Weiterbildung und zu eigenverantwortlicher Vorsorge. Dafür Bürgergeldsegen, und die letzten selbstständigen Bäcker, Metzger und andere Handwerker finden keine Mitarbeiter mehr. Bürokratiezuwachs statt -abbau. Immer höhere Steuerlasten anstatt der regelmäßig beschworenen Steuersenkungsvorhaben. Drei-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich, damit die Klimaaktivisten Zeit zum Protestieren, Festkleben oder Beschmieren haben. Streiks bei den Lokführern und Piloten bringen Milliardenverluste für die Wirtschaft. Währenddessen: Die Natur verliert ihr fein justiertes Gleichgewicht. Und über allem schwebt das »New-Work-Age«, Homeoffice statt Büro. Engagement im Beruf war gestern, jetzt gilt nur noch eins: Work-Life-Balance für alle!
… und die Menschen flüstern: So wird das nichts.
Lara und die Lesung
Es war spät geworden. Die Lesung hatte deutlich länger gedauert als angekündigt. Also machte sich Lara Craft erst um kurz nach 21 Uhr auf den Heimweg. Als Bankkauffrau war ihr das äußerst unangenehm, war sie doch Pünktlichkeit und Correctness professionell gewohnt. Ihr Mann Lennart und ihr 16-jähriger Sohn Finn würden wahrscheinlich schon Pizza bestellt haben. Eigentlich wollte Lara heute Abend ein leckeres Menü zaubern. Zur Feier des Tages. Denn es war äußerst selten, dass Lennart als leitender Ingenieur bei der Bundesflugbereitschaft mal ein paar Abende daheim verbrachte. Immerhin war der Stadtbus pünktlich. Nach 20 Minuten Fahrt war Lara zu Hause. Sie schloss die Wohnungstür auf und versuchte es mit einem versöhnlichen »Hallo, ist jemand zu Hause?«. Lennart und Finn kamen die Treppe herunter. »Das hat aber echt lange gedauert. Was war denn so toll bei der Lesung?« Lara warf einen Seitenblick in die Küche: Zwei leere Pizzakartons und einer, der noch unangetastet aussah. Offenbar hatten die beiden eine Pizza für sie mitbestellt – in weiser Voraussicht. »Es war sensationell«, legte Lara los, während sie sich den Mantel auszog, »da hättet ihr dabei sein sollen.« »Warum denn das?«, fragte Finn, »und um welches Buch ging es überhaupt?« »Also, das Buch hat heute Premiere und heißt: ›So wird das nichts. Politik zwischen Klimakollaps, Heizungshektik und Naturverwüstung‹. Beide Autoren waren anwesend. Erst lasen sie ein paar Seiten aus dem Buch vor, dann konnten Fragen gestellt werden und dann brach die Diskussion los.« »Wie, Diskussion? Einfach so? Seit wann diskutieren denn bei uns die Leute einfach so?« »Weil sich alle aufregen. Über das, was im Buch steht. Habt ihr gewusst, dass der Klimawandel und die Folgen, die wir jetzt erleben, schon seit Jahrzehnten bekannt sind? Exakt seit 1957. Das ist doch unglaublich, da kriege ich doch echt die Krise, so viel verlorene Zeit für Gegenmaßnahmen! Und hier, … wartet mal, Wasserstoff …« Lara blätterte im frisch erstandenen Druckwerk und fand fast auf Anhieb die Seite. »Also, alle reden ja über Wasserstoff als tollen Energieträger. Auch Stahlwerke sollen auf Wasserstoff umgestellt werden, um das Verbrennen von Koks zu vermeiden. Um CO2 einzusparen.« »Ja und …?«, drängelte Lennart, der jetzt neugierig wurde. Schließlich ging es hier um ein technisches Thema. »Um allein das Bremer Stahlwerk auf Wasserstoff umzustellen, was ja nur Sinn macht, wenn der klimaneutral über Elektrolyse per Ökostrom erzeugt wird, dann braucht man dafür in Bremen 160 Windkraftanlagen. Nur für das eine Stahlwerk!« Triumphierend schaute Lara ihre beiden Männer an. Sie war sich sicher, dass keiner von beiden die geringste Ahnung hatte, wie eine Wasserstoffwirtschaft aussehen würde. »Das ist der Hammer«, meldete sich Finn als Erster, »das habe ich noch nie gehört.« »Das sagt ja auch keiner da in Berlin«, murmelte Lennart. »Und hier noch so ein Ding.« Lara blätterte weiter. »Agrarpolitik: Die meisten Fördermittel für die Landwirtschaft kassieren Agrargroßbetriebe mit riiiiiesigen Ställen und unendlichen Flächen!« Lara zeichnete mit beiden Armen die Umrisse eines gigantischen Kuhstalls in die Luft. »Und dann viel zu oft höchst fragwürdige Tierhaltung. Das wollt ihr gar nicht im Detail hören! Alles Konzerne, die mit Acker und Feld nicht mehr viel zu tun haben. Die Kleinen, die noch naturnah arbeiten, gehen dabei kaputt.« Diesmal war es Lennart, der nur noch »Ich glaub’s nicht, ist ja irre« herausbrachte. Lara war jetzt in ihrem Element. »Hier etwas für dich, Finn, du interessierst dich ja für Architektur und Städtebau. Da hat doch eine Baufirma für eine lächerliche Aufstockung in einem Berliner Stadtviertel zwei Jahre gebraucht.« »Was ist daran jetzt der Aufreger?«, fragte Finn leicht mürrisch dazwischen. »Zwei Jahre – nur für die Genehmigung!«, sagte Lara und blätterte weiter. »Hier, im Bildungskapitel. Es gibt kaum noch Schülerinnen und Schüler, die fünf heimische Vogelarten benennen, geschweige denn unterscheiden können. Die Autoren sagen, die Wissenserosion schreitet dramatisch voran, Biologieunterricht in den Schulen würde heftig zurückgefahren.« Finn musste an seine Schule denken, tatsächlich wurden im letzten Schuljahr die Bio-Stunden von zwei auf eine Wochenstunde gekürzt. Und fünf Vogelarten …? Nun ja, die würde auch er nur mit größter Mühe zusammenkriegen. Vielleicht war doch was dran an dem Buch. »Jedenfalls fallen die beiden Autoren nicht auf das Ökogeplapper rein«, stellte Lara fest, »sie schauen hinter die Kulissen.« Langsames, Zustimmung verheißendes Nicken seitens Lennart und Finn. »Aber …«, fuhr Lara zögernd fort, »etwas im Buch hat mich total irritiert.« »So? Was denn?« Lennart und Finn wurden hellhörig. »… Äh, ich kann es nicht wirklich erklären, es ist irgendwie echt komisch. Wir, ich meine, unsere Familie, also du, Finn, Lennart und ich, wir kommen in dem Buch vor. Wir sind darin die Familie Craft.«
Begegnung mit der wirklich »letzten Generation«
von Claus-Peter Hutter
Mit jedem Treffen, jedem Telefonat und jeder Videokonferenz steigerte sich unser Zorn. Der Zorn darüber, dass Milliarden für angeblichen Klimaschutz ausgegeben werden, dass Millionen in »Deko-Programmen« zur angeblichen Rettung der biologischen Vielfalt vergeudet und immer neue Bürokratiemonster auf unsere Gesellschaft losgelassen werden. Wenn etwa Weingärtner für die Verbreiterung eines Weges eine Trockenmauer in mühsamster Handarbeit versetzen müssen und dann amtlich verlangt wird, die dort lebenden Eidechsen erst zu erfassen, dann zu fangen und sofort danach – das ist die Krönung des Vorgangs – nur wenige Meter entfernt wieder auszusetzen! Wo bleibt der gesunde Menschenverstand, wenn auf einer Wiesenfläche an einem Schwarzwaldhang ein Holunderstrauch wächst, aber die vier Quadratmeter Fläche vom landwirtschaftlichen Landschaftspflege-Zuschuss herausgerechnet werden, um die Förderung zu kürzen? Wie kann es sein, dass eben noch der Holunderbusch herausgerechnet wird, es aber zugleich Programme zur Förderung landschaftlicher Vielfalt gibt und genau solche Holunderbüsche, Hecken oder andere Gehölze auf Staatskosten zur Biotopvernetzung gepflanzt werden? Längst weiß die rechte Hand nicht mehr, was die linke tut. Um es klar zu sagen: Die Sachbearbeiter in den Behörden wollen es natürlich richtig machen, sie sind jedoch gefangen im Paragrafendschungel: »Du glaubst es mir nicht, aber wenn ich richtig vernünftig Naturschutz machen will, müsste ich laufend Naturschutzvorschriften verletzen«, sagte mir eine junge, stark engagierte Biologin eines Landratsamtes, die nicht genannt werden will, weil sie Repressalien fürchtet.
Viele, die hoffnungsvoll gestartet sind, haben sich nach etlichen Jahren der Amtszermürbung in die innere Emigration begeben, gehen zu Natur- und Umweltschutzverbänden, welche die Leute – vielfach staatlich bezuschusst und gefördert – besser bezahlen als deren Counterparts in den Ämtern. Aber auch die Verbände – zum Teil auf staatliche Förderung angewiesen, um ihre eigene, angewachsene Bürokratie zu finanzieren – sind in gewisser Weise zu Öko-Staatssklaven geworden.
Auf der Strecke bleiben die Macher, die wirklich letzte Generation. Wenn dem in der Gesellschaft durch die Politik – insbesondere die Bildungs- und Forschungspolitik – nicht schleunigst entgegengewirkt wird, werden wir eine kollektive Wissenserosion erleben, die Wohlstand, Sicherheit und erträgliche Zukunft bedroht. Wir haben geniale Naturschutzgesetze – eigentlich. Aber sie sind überholt, da sich die Gesellschaft geändert hat. So wie sie vollstreckt werden, wird das nichts mit der Bewahrung der Schöpfung!
Mit diesem Buch wollen wir deshalb denjenigen Mitmenschen eine Stimme geben, denen Ökoromantik wie Ökodogmatismus gleichermaßen auf die Nerven fallen wie uns. Menschen, die sich daran orientieren, was bei Projekten und Maßnahmen wirklich für Mensch und Natur herauskommt. Menschen, denen viel zu viel geredet, aber viel zu wenig gehandelt wird. Menschen, die das ständige Parteigeplänkel satthaben und nicht mehr mit ansehen wollen, wie Finanzmittel in »Glaubensprojekten« vergeudet werden.
Sie alle haben uns Mut gemacht, dieses Buch zu schreiben. Klimaschutz taugt einfach nicht zum Klassenkampf.
Zwischen Ökophrasen und Kompetenzillusion
von Volker Angres
Seit einiger Zeit begegnen uns ständig schnell dahergesagte und unkritisch übernommene Ökophrasen und -schlagwörter, etwa »Nachhaltigkeit«. Kaum jemand weiß, dass die Bedeutung dieses Begriffs auf das Jahr 1713 zurückgeht. Damals ging es nicht etwa um den Schutz der Umwelt, sondern um rein wirtschaftliche Interessen, um Profit (vgl. Kap. »Historische Momente«).
Weiterhin der Begriff »Klimaschutz«, die neue Religion des 21. Jahrhunderts. Der eine oder andere unterliegt einer Art Kompetenzillusion, wenn er meint, das Klima lasse sich national schützen, als würde man einen Wall um Deutschland herum entlang der Landesgrenzen hochziehen. Es handelt sich aber um ein globales Problem. Also muss man dort in Klimaschutzmaßnahmen investieren, wo es für das Investment auch den meisten Klimaschutz gibt. Es geht dabei um Größenordnungen, welche die Habeck’sche Heizungspolitik Anfang 2023 ins Reich der klimapolitischen Absurditäten verweist.
Noch ein Schlagwort: »Tempolimit«. Es ist in jedem Fall entspannter, etwa in Frankreich mit maximal 130 km/h über die Autobahnen zu brummen (die übrigens dank der Maut in einem hervorragenden Zustand sind). Aber zu behaupten, ein Tempolimit hätte eine Auswirkung auf die Senkung der globalen Durchschnittstemperatur, ist schlicht eine »grüne« Fantasie, gepaart mit Populismus. Ein Tempolimit vermindert die Unfallhäufigkeit, macht das Fahren also sicherer und ist allein deswegen sinnvoll.
Apropos Fahren: Elektroautos sind eine Art Klimarettungs-Turbo geworden: Man kaufe sich ein E-Auto und das 1,5 Grad-Limit aus dem Pariser Klimaabkommen von 2015 wird locker eingehalten. Zumindest kann ein solch aberwitziger Eindruck entstehen, hört man den einschlägigen Ressorts der Ampelregierung und einigen Umweltverbänden zu. In Wahrheit – Stand 2024 – verschärfen E-Autos die Klimaproblematik, und zwar massiv (vgl. Kap. Mobil ins Abseits).
Lara Craft hat sich völlig zu Recht bei der Buchpräsentation aufgeregt, als sie auch noch erfuhr, dass wir im Umgang mit dem Klimawandel mehr als 50 Jahre verloren haben. Erkenntnisse zum Thema gab es reichlich, politische Versprechen auch. Wirkungsvolle Maßnahmen so gut wie keine. Leider müssen wir hier feststellen: Das gilt auch für die Artenvielfalt, für den Ressourcenverbrauch und für soziale Gerechtigkeit.
Was ist eigentlich los mit unseren Politikern, mit den Regierungen, aber auch mit den Medien? Wenigstens aus meiner Perspektive – zehn Jahre Wirtschaftsfernsehen in der ARD, fast 32 Jahre Leitung der Umweltredaktion im ZDF – kann man schon erkennen, dass in jüngster Zeit auch öffentlich-rechtliche Sender eher dem Mainstream zuneigen, nach »Klicks« im Internet lechzen und deshalb nahezu willenlos die jeweiligen Zielgruppen bedienen. Für unsere Gesellschaft bedeutsame und komplexe Sachverhalte aufzuarbeiten und dem Gebühren zahlenden Publikum zu erklären, ist halt anstrengender und erfordert starkes publizistisches Selbstbewusstsein.
Jedenfalls ist es Zeit, die Dinge, die unseren Planeten und damit uns alle ausmachen, im Ganzen zu betrachten. Nur so lässt sich ein Verständnis für unsere aktuelle Situation erreichen. Darauf aufbauend sollte es dann gelingen: mal echt verstehen, welche politischen Entscheidungen wirklich hilfreich sind und welche man getrost unter alltäglichem Politgeplapper verbuchen und vergessen kann.
Eine kleine Einordnung: Was will das Buch, was kann es nicht?
Politik zwischen Klimakollaps, Heizungshektik und Naturverwüstung: So lautet der Untertitel dieses Werkes. Wenn wir geahnt hätten, worauf wir uns da eingelassen haben! Denn jede Woche, wenn nicht jeden Tag, gibt es neue Aspekte zu diesen Themensegmenten, mal hochinteressant und zielführend, mal mit einer Halbwertszeit von nur wenigen Stunden. Also kann das Buch nicht auf allerneueste Entwicklungen reagieren. Die grundlegenden Fakten aber und die sich daraus ergebenden politischen Mechanismen sind unverändert. Das ist unser Ziel: Wir möchten dazu beitragen, hinter die Dinge schauen zu können, zu verstehen, um was es eigentlich geht. Ganz klar: Viele Themen konnten und wollten wir nicht anschneiden – auch wenn uns deren Problematik bewusst ist. Meeresmüll etwa, überhaupt die Plastikverseuchung der Umwelt, Östrogene im Abwasser und in den Böden, Zusatzstoffe in Lebensmitteln, die diesen Namen eigentlich nicht mehr verdienen. Die Liste könnte noch ein gutes Stück fortgesetzt werden. Also haben wir uns auf die Themen konzentriert, die spätestens seit dem Heizungsgesetz die Debatten dominieren. Das Buch erklärt faktische Zusammenhänge und bietet – wenn Sie so wollen – kompakte Resümees. Entstanden sind sie nach ungezählten Gesprächen und Diskussionen, mitgenommen aus Workshops, Seminaren, Kongressen und Exkursionen. Eingeflossen sind zudem Erfahrungen und Ergebnisse der eigenen Arbeit und eigener Projekte im In- und Ausland. Das Prägendste aber waren stets die Begegnungen mit Menschen, die mehr von den Dingen verstehen als wir Autoren. Es sind »Macher« aus allen gesellschaftlichen Bereichen, von Bildung und Forschung über Land- und Forstwirtschaft hin zu Experten der Energieversorgung sowie der Siedlungs- und Mobilitätsplanung und des Landschaftsmanagements.
Eingebaut haben wir die Eine-Milliarde-Euro-Frage, gerichtet an sehr unterschiedliche Persönlichkeiten: »Sie haben eine Milliarde für den Klimaschutz. Was würden Sie mit dem Geld anfangen?« Siebzehnmal gefragt, siebzehnmal höchst verschiedene Antworten …
Einen Punkt möchten wir gleich zu Beginn besonders herausstellen: Über Nacht wird es keinen wirklich wirksamen Klimaschutz geben, egal, wie wir uns auch anstrengen. Deshalb müssen aus unserer Sicht Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel viel stärker auf die politische Agenda gesetzt werden. Vor allem in den schon jetzt von Hitze, Dürre und Flut besonders stark betroffenen Ländern, aber auch bei uns: ›Klimanotstand‹ ausrufen reicht allein nicht, machen statt maulen – darum geht es.
Im Buch gibt es zudem einen »Service für Eilige«: Jedes Kapitel startet mit einer kurzen Auflistung der wesentlichen Aspekte. Am Schluss gibt es eine Reihe von Denkanstößen und Handlungsempfehlungen – unter dem Motto: So wird das was – zumindest in Ansätzen. Auch zum Diskutieren – so, wie es bei Familie Craft geschieht …
ÜBER GRÜNE FANTASIEN UND GRAUE WIRKLICHKEIT
DAS PROJEKT »ENERGIEWENDE«
»Wenn es keine Elektrizität gäbe, würden wir alle bei Kerzenschein fernsehen.«
George Gobel, US-Comedian, 1919 – 1991
Darum geht es:
Das Zeitalter der fossilen Energien geht seinem Ende entgegen. Nicht, weil es etwa keine Kohle oder kein Öl mehr gäbe, sondern weil es politisch so beschlossen wurde. Ja, es stimmt, das Verbrennen fossiler Energieträger treibt den Treibhauseffekt an und damit die Erderwärmung. Schon der simple Menschenverstand sagt einem, dass das auf Dauer nicht gut gehen kann. Wenn ich aber aus dem aussteige, was bisher der ganzen Welt zu mehr oder weniger Wohlstand verholfen hat und doch eine gewisse Garantie für das menschliche Überleben bietet, dann muss ich schon genau sagen können und wissen, was stattdessen unsere Energieversorgung sicherstellen soll.
Komisch, denken Sie jetzt vielleicht – das sind doch die erneuerbaren Energien, also Strom aus Windkraft oder von Photovoltaikanlagen. Im Prinzip richtig, aber: Derzeit macht Strom gerade einmal 20 % unseres gesamten Energieverbrauchs aus. 80 % entfallen auf Wärme und Treibstoffe. Und da sieht es noch ziemlich düster aus hinsichtlich der Klimaneutralität.
Für eilige Leser hier einige Aspekte zum Thema:
Mangelnder politischer Wille seit Jahrzehnten wirkt nachFehlende Erzeugungskapazität für rapide steigenden Ökostrombedarf.Schleppender Netzausbau blockiert die Entwicklung.Politischer Streit um notwendige Technologieoffenheit, vor allem bei Treibstoffen.Teure Klimaschutz-Fehlinvestitionen, z. B. in Wärmepumpen.Die Zeit für wirksamen Klimaschutz ist so gut wie abgelaufen. Daher gilt es, die großen Räder zu drehen. Würde z. B. die weltweite Stahlindustrie mithilfe von »grünem« Wasserstoff klimaneutral, würde das so viel CO2 einsparen, wie ganz Indien produziert. Dazu wird viel Ökostrom benötigt, sehr viel sogar: Lara Craft hat bei der Lesung gut zugehört: Für nur ein Stahlwerk wie etwa das in Bremen wären rund 160 Windkraftanlagen nötig, in Worten: einhundertsechzig!
Könnte es sein, dass da grüne Fantasien auf graue Wirklichkeit treffen?
Lara und die »Markant DoppelPlus«
Verärgert konnte Lara Craft nicht wirklich sein. Über 16 Jahre hatte ihre Waschmaschine treu und brav ihren Dienst getan – egal, ob Vollwaschprogramm, Gardinen knitterfrei oder auch mal Kleidungsstücke einfärben. Gekauft hatte die Bankkauffrau die Maschine gleich nach der Hochzeit mit Lennart. Immer hatte Lara auch das Flusensieb gereinigt, den Wasserhärtegrad nach jedem Umzug wieder korrekt eingestellt und vorschriftsmäßig verklebte Seifenreste aus der Waschmitteleinspülkammer entfernt. Nun war es so weit: Die Maschine Marke »Markant« hatte ihren elektrischen Geist aufgegeben, ganz offenbar war der Motor kaputt.
Lara warf einen mürrischen Blick auf den mittelgroßen Wäschestapel, verteilt auf zwei blaue Plastikwannen. In Kürze würde noch mehr Schmutzwäsche anfallen, denn ihr 16-jähriger Sohn Finn hatte seine Rückkehr aus dem Schulferiencamp schon für heute angekündigt, einen Tag früher als eigentlich geplant. Wegen Dauerregens und heftiger Gewitterstürme musste das Zeltlager abgebrochen werden. Und gerade jetzt! Waschmaschine ausgefallen!
Lara suchte ihr Smartphone, fand es in der Küche gleich neben der Brotschneidemaschine und wählte den »Markant«-Kundendienst. »Guten Tag, Ihr Markant-Kundendienst, was kann ich für Sie tun?«, meldete sich sofort nach dem ersten Klingelzeichen eine fürsorglich klingende Computerstimme. Für Lara kam das völlig unerwartet, denn wie immer hatte sie sich auf mindestens 40 Minuten Warteschleife eingerichtet. Sie wollte gerade das Smartphone auf Lautsprecher schalten und auf den Küchentisch legen. Dann hätte sie in der Wartezeit wenigstens schon mal den Geschirrspüler ausräumen können.
»Ja, hallo«, sagte Lara und kam sich irgendwie blöd vor, einen Computer am anderen Ende der Leitung überhaupt zu begrüßen. »Also, meine ›Markant‹ ist heute kaputtgegangen, und ich benötige sehr dringend eine neue Waschmaschine.« »Oh, das tut mir aber leid«, behauptete die Computerstimme, »und ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Ich bin Ken.« Ken? Wie der von Barbie?, dachte Lara nur für einen Moment. Denn sofort wollte Computer-Ken Details wissen. »Möchten Sie wirklich eine neue Waschmaschine oder lieber 1000 Wäschen kaufen, dann schicken wir Ihnen ein High-Performance-Leasing-Gerät, unsere ›Markant DoppelPlus‹.« Das brachte Lara noch weiter aus dem Konzept. »Wieso Wäschen kaufen? Was heißt das denn genau?« Kens Stimme wurde noch eine Spur geschmeidiger: »Also, eigentlich brauchen Sie ja gar keine eigene Maschine. Sie brauchen die Wäschen. Die Maschine müssen Sie nicht kaufen, nur die Dienstleistung ›Waschen‹. Das ist wesentlich umweltfreundlicher, denn wir können diese Maschinen viel besser auslasten, sie werden top gewartet und einfach ausgetauscht, sollte mal etwas kaputt sein. Warten Sie mal, ich sehe hier Ihre Adresse. Leopoldstraße 24. Korrekt?« Lara bestätigte die Adresse. »Dann schicke ich Ihnen jetzt sofort unsere Support-Service-Drohne. Der kleine fliegende Kollege wird sich bei Ihnen bemerkbar machen. Bitte öffnen Sie ein Fenster oder eine Balkontür, und lassen Sie ihn herein. Er wird den Standort der Waschmaschine suchen und sehr schnell finden – natürlich müssen Sie alle Türen im Haus aufmachen.« »Und was macht diese Drohne genau?« Irgendetwas klopfte an die südliche Terrassentür. »Der smarte Kollege vermisst den Weg zum Standort der Waschmaschine und den Standort selbst. Die Daten bekommen wir in Echtzeit. Dann wissen wir, ob wir Ihre neue Maschine am Stück liefern können oder besser zerlegt, wenn es irgendwo zu eng sein sollte. Dann werden z. B. die Seitenbleche erst bei Ihnen zu Hause anmontiert.« Lara war platt. Davon hatte sie noch nie gehört. Eine Support-Service-Drohne! »Moment mal, Ken« – tatsächlich sprach sie den Computer mittlerweile mit Namen an – »da klopft etwas an die Terrassentür.« Lara legte das Smartphone beiseite und schaute nach. Tatsächlich: Vor der Terrassentür schwebte eine Mini-Drohne, kleiner als die Plastikdose für Finns Pausenbrot. Die Drohne blinkte freundlich, jedenfalls interpretierte es Lara so, als sie die Tür öffnete. Das ferngesteuerte Flugobjekt schwebte langsam und fast geräuschlos herein. »Vielen Dank!«, hörte Lara plötzlich Kens Stimme aus der Drohne. Und schon schwebte der kleine Multikopter zielstrebig Richtung Keller, die Treppe hinunter und fand tatsächlich auf Anhieb die Waschküche. Die Drohne schwankte hin und her, stieß dabei blitzartig rotes Licht aus. Vermutlich ein Laserstrahl zur Vermessung, mutmaßte Lara. »Keine Angst«, sagte Ken aus der Drohne, »das ist ein ganz schwacher Laser; selbst wenn Sie direkt ins Licht blicken, würde Ihren Augen nichts passieren.« Drohnen-Ken, der Gedankenleser, schoss es Lara durch den Kopf. Plötzlich drehte die Drohne ab, Ken aus der Drohne rief noch: »Bis gleich am Smartphone …«, und schon sauste die Drohne auf dem gleichen Weg, auf dem sie gekommen war, wieder hinaus.
Noch leicht verwirrt vom Besuch der Drohne nebst Kens Stimme aus dem fliegenden Objekt, nahm Lara wieder ihr Smartphone in die Hand. Ken hatte auf Videoübertragung umgeschaltet. Wow, dachte Lara, der sieht ja für einen Avatar ziemlich gut und täuschend echt aus: blond natürlich und sonnengebräunt, Marke California Dream Boy. »Die Firma Markant lässt uns Kundendienstmitarbeiter immer so aussehen, dass sich vor allem unsere Kundinnen sofort angesprochen fühlen«, verriet Ken, der Avatar. Unglaublich, dachte Lara, das grenzt an Gehirnwäsche per KI. Schon redete Ken weiter: »Ich ahne, dass Sie sich für den Kauf von 1000 Wäschen entschieden haben«, und strahlte Lara über das Smartphone an. »Ja, stimmt, eigentlich brauche ich gar keine eigene Waschmaschine.« »Na prima«, befand Ken. »Ich habe gerade Ihre Daten aufgerufen und mal nachgeschaut; wir können Ihnen heute noch eine ›Markant DoppelPlus‹ liefern, generalüberholt und mit deutlich geringerem Stromverbrauch als Ihre alte Maschine.« Laras Stimmung hellte sich schlagartig auf. »Aber da ist noch eine Kleinigkeit: Die ›Markant DoppelPlus‹ braucht einen Internetanschluss oder muss sich in Ihr WLAN einloggen dürfen.« Erneut war Lara leicht irritiert. Eine Waschmaschine im Internet? Wozu denn das? »Sie wissen ja«, erklärte Ken weiter, »seit geraumer Zeit haben wir rund 60 % Strom aus sogenannten erneuerbaren Quellen im Netz. Also Strom aus Windkraft- oder Photovoltaikanlagen.« »Das ist mir bekannt«, gab Lara zurück, »wir beziehen schon seit Jahren 100 % Ökostrom.« »Na, dann kennen Sie ja die Grundproblematik. Es weht halt nicht immer genug Wind, und nachts scheint die Sonne bekanntlich nicht, dann gibt es eben keinen Strom aus Photovoltaikanlagen. Dafür wächst aber die Anzahl der Stromverbraucher extrem schnell. Das Netz muss ständig neu ausbalanciert werden, Stromnachfrage und Stromangebot müssen genau zueinanderpassen. Daher kann die ›Markant DoppelPlus‹ nur dann waschen, wenn genug Ökostrom im Netz ist, andernfalls geht sie ferngesteuert in einen Standby-Modus.« Lara wurde hellhörig. Wie, Standby-Modus? Ihr schwante Übles. »Also…«, Ken ließ eine Spur von Unsicherheit erkennen – etwa ein Programmierfehler? »Also, wenn die Maschine am frühen Abend geliefert und eingebaut wird, dann sagt unsere aktuelle Stromprognose: Leider keine Wäsche möglich. Erst wieder in … ja genau, voraussichtlich 36 Stunden ab jetzt. Schönen Tag noch und danke für den Auftrag!«
Lara war völlig entnervt. Die Berge voller Schmutzwäsche würden ungeahnte Höhen erreichen. Und morgen Nachmittag würde auch noch ihr Mann Lennart von seiner dreiwöchigen Dienstreise aus Abu Dhabi zurückkommen – mit voraussichtlich ölverschmierten Klamotten. Schließlich hatte er versucht, die A 340, den Regierungsflieger, zu reparieren. Ihm und seinem Team war das leider nicht gelungen. Vielleicht auch ein Fall für Service-Ken? Reparierte der auch Landeklappen? Völlig absurd, dachte Lara. Sofort wollte sie noch mal mit dem Computerwesen sprechen und fragen, ob es nicht doch besser wäre, ganz normal eine Waschmaschine zu kaufen. Hektisch wählte sie die Nummer vom Markant-Kundendienst. Diesmal meldete sich eine Computerstimme erst nach dem sechsten Klingelton. Und es war auch nicht Ken. Die Stimme verriet Lara, dass sie in der Warteschleife die Position 57 innehabe. Sie könne auch gerne ihr Anliegen per Mail schicken und, bitte, den Kundendienst weiterempfehlen.
Unter Hochspannung – unsere Stromnetze
Ja klar, diese kleine Episode ist frei erfunden. Sie spielt in unserer nahen Zukunft. Denn genau so könnte sich unser Alltagsleben in nur wenigen Jahren darstellen. Grund dafür sind die erneuerbaren Energien und die physikalischen Besonderheiten unseres Stromnetzes.
In der alten, rein fossilen Stromwelt gab es einige wenige Einspeisepunkte. Das waren die großen Kraftwerke, egal ob Kohle, Gas oder Atom: Sie konnten rund um die Uhr genau die Strommengen liefern, die gebraucht wurden, und hielten zudem die Wechselstromfrequenz von 50 Hertz auch mithilfe von Pumpspeicherkraftwerken stabil. Schon bei kleinsten Schwankungen von 0,02 Hertz gingen in den Leitwarten die roten Alarmleuchten an. Entweder mussten Kraftwerke zugeschaltet oder Großverbraucher vom Netz genommen werden.
Bei diesem sogenannten Lastabwurf werden z. B. Kühlhäuser oder Aluminiumhütten für kurze Zeit vom Netz getrennt. Das kann etwa für Aluminiumhütten problematisch werden. Denn dort sind die Schmelztiegel rund um die Uhr strombeheizt, die Aluminiumschmelze darf nicht erkalten. Passiert das doch, ist nicht nur die aktuelle Produktion dahin, sondern gleich der gesamte Kessel. Denn das erstarrte Aluminium lässt sich nie wieder ohne Schäden aus dem Tiegel lösen. Im »alten« Stromnetz passiert das äußerst selten, die vorhandene Netzarchitektur ist sehr stabil. Doch das Frequenzrisiko nimmt in dem Maße zu, wie wir erneuerbare Energien im Netz haben. Und hier liegt eine enorme Herausforderung für das neue Stromdesign: Strom aus Windkraft oder Photovoltaik kann man zwar ab-, aber eben nicht nach Belieben zuschalten.
Ein kompletter Blackout ist zwar eher unwahrscheinlich, aber was passiert eigentlich, wenn die 50-Hertz-Frequenz nur geringfügig, dafür über einen längeren Zeitraum nicht gehalten wird? Fanny Knoll und weitere Autoren[1] von der Universität Greifswald haben einen typischen Fall aufgegriffen: Im März 2018 haben sich Menschen in ganz Europa gewundert, dass Radiowecker und Uhren an Elektroherden und Mikrowellen die falsche Zeit anzeigten. Sie gingen sechs Minuten nach. Normalerweise dient das stabile Stromnetz mit seiner 50-Hertz-Frequenz als perfekter Taktgeber für diese sogenannten Synchronuhren. Bereits im Januar 2018 hatte sich die Laufzeit der Synchronuhren um wenige Sekunden pro Tag verlangsamt. Bis März hatte sich diese Verlangsamung auf jene sechs Minuten summiert. Knoll und Kollegen nennen dafür als Grund eine sich länger hinziehende politische Auseinandersetzung zwischen dem Kosovo und Serbien. Den Ländern ging es dabei um die Frage, wer eigentlich die sogenannte Sekundärregelenergie zur Stabilisierung des Stromnetzes zu welchen Konditionen bereitstellen sollte. Die Einigung ließ auf sich warten, das Netz, in diesem Fall sogar das europäische Verbundnetz vom Schwarzen Meer bis nach Portugal, kam aus dem Takt, die Uhren gingen nach.
Das mag am häuslichen Backofen nicht unbedingt zu dramatischen Auswirkungen geführt haben. Aber Zeittaktgeber, gesteuert vom Stromnetz, stecken z. B. auch in vielen industriellen Anwendungen. Heißt unter dem Strich: Auch eine Stromversorgung mit überwiegend erneuerbaren Energien braucht eine netztechnisch notwendige, garantierte 50-Hertz-Stabilität. Wie genau das beim weiteren Ausbau der Erneuerbaren dann in den Jahren nach 2030 funktionieren kann, stellt Wirtschafts- und Energieminister Robert Habeck Anfang Februar 2024 klar: Mit dem Bau neuer Gaskraftwerke! Zunächst soll eine Leistung von zehn Gigawatt ausgeschrieben werden, das entspricht in etwa sieben Atomkraftwerken. Mit rund 40 Milliarden Euro Subventionen will die Regierung den Kraftwerksbauern unter die Arme greifen. Zur Beruhigung der »grünen« Nerven müssen die neuen Gaskraftwerke auch mit klimaneutralem Wasserstoff (H2) zu betreiben sein. Die Umstellung erfolgt dann Mitte der 2030er-Jahre. Allerdings bleibt völlig rätselhaft, wo Deutschland die gewaltigen Mengen H2 herbekommen soll – aus heimischer Produktion jedenfalls nicht.
Damit niemand darüber nachdenkt, wird politisch ungebremst der Ausbau der Erneuerbaren weiter munter gefordert – ohne zu wissen, ob der Strom jemals dort ankommt, wo er gebraucht wird. So geht es einfach nicht. Da wäre es doch ein Gebot der Vernunft, die Entwicklungen so zu synchronisieren, dass nicht am Ende der schöne Ökostrom auf der Strecke bleibt, was heute übrigens nahezu regelmäßig der Fall ist. Kann das Netz keinen Strom mehr aufnehmen, weil eben die Kapazität nicht reicht, werden z. B. Windparks ferngesteuert abgeschaltet – was Sie bestimmt schon mehrfach selbst beobachtet haben, wenn nämlich der Wind ordentlich bläst, die Windräder aber wie eingefroren dastehen. Geregelt wird diese Zwangsabschaltung im Paragraf 13a Energiewirtschaftsgesetz (EnWG). Darin heißt es: »Absatz 1: Betreiber von Anlagen zur Erzeugung oder Speicherung von elektrischer Energie mit einer Nennleistung ab 100 Kilowatt sowie von Anlagen zur Erzeugung oder Speicherung von elektrischer Energie, die durch einen Netzbetreiber jederzeit fernsteuerbar sind, sind verpflichtet, auf Aufforderung durch Betreiber von Übertragungsnetzen die Wirkleistungs- oder Blindleistungserzeugung oder den Wirkleistungsbezug anzupassen oder die Anpassung zu dulden.«
Im Klartext: Wenn netztechnisch notwendig, kann der Netzbetreiber erzwingen, Anlagen abzuschalten oder in Betrieb zu nehmen (falls der Wind weht und/oder die Sonne scheint). Immer geht es dabei um den Erhalt der Netzstabilität. So wie im Jahr 2023: Die zwangsweise gedrosselten Offshore-Windkraftanlagen in der Nordsee konnten wegen überlasteter Netze an Land mit 19,24 Terawattstunden (TWh) rund 9 % weniger Strom liefern als 2022; das teilte der Netzbetreiber TenneT der Nachrichtenagentur dpa mit. Dieser »Schwund« kommt uns alle teuer zu stehen. Denn im Absatz 2 des Paragrafen 13a steht: »(2) Eine nach Absatz 1 Satz 1 vorgenommene Anpassung ist zwischen dem Betreiber des Übertragungsnetzes und dem Betreiber der Anlage zur Erzeugung oder Speicherung von elektrischer Energie angemessen finanziell auszugleichen. Der finanzielle Ausgleich ist angemessen, wenn er den Betreiber der Anlage (…) wirtschaftlich weder besser noch schlechter stellt, als er ohne die Maßnahme stünde.«
Heißt im Klartext diesmal: Der Anlagenbetreiber bekommt genauso viel Geld, als wenn er Strom geliefert hätte. Die Kosten dafür zahlen wir – über die Netzgebühren, die ja Bestandteil des Strompreises sind. Das müssen Sie sich bitte eine Weile auf der Zunge zergehen lassen – was noch mehr »Spaß« macht, wenn man mal einen Blick auf die Vergütungen wirft, die durch Zwangsabschaltungen bisher entstanden sind:[2] Satte 4,5 Milliarden Euro durften wir alle bis Ende 2021 für virtuellen Strom zahlen, der nie durchs Netz geflossen ist. Knapp 40 000 Gigawattstunden (GWh) waren es in den neun Jahren 2013 bis 2021. Aber das Auffälligste ist der Trend: Offenbar wurde und wird es Jahr für Jahr teurer. Das gilt auch für die Folgejahre. Und das bedeutet: Der Umstieg auf erneuerbare Energien ist nicht nachhaltig. Denn zur Nachhaltigkeit gehört auch die soziale Komponente. Durch die gesetzliche Regelung im Energiewirtschaftsgesetz und den seit zig Jahren verschleppten Ausbau unserer Stromnetze haben wir einen viel zu hohen Strompreis. Und mit der Strompreiserhöhung ging es Anfang Februar 2024 gleich weiter. Die EnBW hat die Strompreise um fast 16 % angehoben.[3] Das trifft natürlich vor allem die sozial Schwachen. So geht es wieder nicht. Die Entschädigungen für virtuellen Strom dürfen nicht über den Strompreis gezahlt werden, sondern aus allgemeinen Steuermitteln. Und eigentlich stellt sich die Frage, ob es überhaupt derartige Entschädigungen geben muss, vor allem in der immer noch garantierten Höhe. Diese Absicherung stammt ja aus der Anfangszeit der erneuerbaren Energien und sollte Investoren die Angst vor Verlusten nehmen. Mittlerweile weiß man aber, wie ein Windpark funktioniert, die unternehmerischen Risiken sind geringer geworden. Und daher wäre eine entsprechende Anpassung der Entschädigungsleistungen mit dem Ziel einer Vereinbarung über stetig sinkende Beträge mindestens diskussionswürdig.
Wie dem auch sei, die ökoelektrische Zukunft bleibt teuer. Stichwort Netzausbau: Sie ahnen natürlich längst, wer diesen gewaltigen Umbau unseres Stromversorgungssystems bezahlen darf: Genau, wir Stromkunden werden dann via steigender Netzentgelte zur Kasse gebeten. In den nächsten 15 Jahren dürften sich die Kosten dafür zwischen 210 und 270 Milliarden Euro bewegen. Das schätzte die Unternehmensberatung Oliver Wyman Anfang 2023.[4] Dass im Gegenzug der Preis für Wind- und Photovoltaikstrom wirklich sinken wird, ist im Augenblick, sagen wir, eine politisch motivierte Hoffnung vor allem von Anhängern des grünen Lagers. Der Ökostrombedarf wird dramatisch steigen, darin sind sich alle einig. Kein Wunder, denn die komplette Elektrifizierung aller Bereiche – Industrie, Mobilität, Wohnen mit Heizen und Kühlen – ist der Schlüssel zur CO2-Neutralität. Somit konkurrieren also Wärmepumpen (14 Millionen Stück bis 2045), E-Autos (15 Millionen Einheiten bis 2045), vor allem die Wasserstoffherstellung und nicht zuletzt die für das Netz erforderliche Regelenergie um ihren Anteil am grünen Strom. Von heute rund 500 TWh steigt der Strombedarf je nach Szenario auf bis zu 1300 TWh bis 2045. So hat es die Bundesnetzagentur aufgrund der Prognosen der vier großen Übertragungsnetzbetreiber – 50 Hertz Transmission GmbH, Amprion GmbH, TenneT TSO GmbH, TransnetBW GmbH – im Szenariorahmen des Netzentwicklungsplans festgehalten und am 7. Juli 2022 genehmigt.[5] Die Nachfrage nach grünem Strom steigt also gewaltig an. Jeder Marktwirtschaftler weiß: Bei steigender Nachfrage steigen auch die Preise.
Machen wir uns noch kurz ein Bild, was das alles für den Ausbau der erneuerbaren Energien bedeutet. Dazu schauen wir als Stichprobe einfach mal in die Nacht vom 29. auf den 30. August 2023. Woher kam da unser Strom? Insgesamt betrug die Netzlast knapp 42 000 Megawattstunden (MWh). Rund 32 300 MWh wurden in Deutschland erzeugt, der Rest importiert. Vom hierzulande erzeugten Strom entfielen auf Photovoltaik 0 MWh, auf Windkraft Land 3 500 MWh, auf Windkraft See 57 MWh, auf Gaskraftwerke 5 400 MWh, auf Steinkohle 4 000 MWh, auf Braunkohle 11 800 MWh, auf sonstige konventionelle Energiequellen noch 1 455 MWh. Mit 22 655 MWh haben die fossilen Energieträger den Löwenanteil zur nächtlichen Stromversorgung in Deutschland beigesteuert, vor allem die als Klimakiller geltende Braunkohle. Natürlich ändert sich das Bild am Tag, da dann die Photovoltaik in Gang kommt und je nach Sonneneinstrahlung einen nennenswerten Beitrag leistet.
Dennoch: Die Herausforderungen sind enorm, was sich auch in einer Pressemeldung des Statistischen Bundesamtes vom 9. März 2023 widerspiegelt:
»Kohle war im Jahr 2022 wie bereits in den Vorjahren der wichtigste Energieträger für die Stromerzeugung in Deutschland. (…) Ein Drittel (33,3 %) des in Deutschland erzeugten und ins Netz eingespeisten Stroms kam aus Kohlekraftwerken (2021: 30,2 %). Damit nahm die Stromerzeugung aus Kohle gegenüber dem Vorjahr um 8,4 % zu. Zweitwichtigste Energiequelle war die Windkraft, deren Anteil an der Stromerzeugung nach einem vergleichsweise windarmen Vorjahr um 9,4 % auf knapp ein Viertel (24,1 %) stieg (2021: 21,6 %). Insgesamt wurden im Jahr 2022 in Deutschland 509 Milliarden Kilowattstunden Strom erzeugt und eingespeist. Das waren 1,9 % weniger als 2021.«
Sicher hat der Verlust der russischen Gaslieferungen in Verbindung mit dem Ukraine-Krieg dazu geführt, mehr Kohlekraftwerke ans Netz zu bringen. Ohne Kohle wäre bei uns die Stromversorgung derzeit noch höchst problematisch. Deswegen wird es auch keinen schnellen Ausstieg aus allen Kohlekraftwerken geben können. Denn die Stromversorgung muss ja rund um die Uhr und in Krisenzeiten funktionieren. Und hier zeigt sich, dass die Volatilität der erneuerbaren Energien, also die durch Witterung bedingte Unzuverlässigkeit, eine große Rolle spielt. In den elektrischen Griff bekommt man das nur, wenn es gelingt, gigantische Stromspeicher im Netz zu integrieren, die tagsüber mit überschüssigem Strom aus Windparks und PV-Anlagen aufgeladen werden. Das bedeutet zweierlei: Die Kapazität der erneuerbaren Energien muss so dramatisch ausgebaut werden, dass nicht nur die Leistung der immer noch am Netz befindlichen fossilen Kraftwerke ausgeglichen werden kann, sondern auch der zu erwartende Strommehrbedarf abgedeckt wird. Zudem müssen die Batteriespeicher mit einer bisher noch nie realisierten Leistungsstärke von insgesamt einigen Zehntausend Megawatt ins Netz integriert werden. Davon aber sind wir – Stand Frühjahr 2024 – noch sehr weit entfernt.
Und dann ist da noch etwas, ein kleines Monster namens »Bürokratie«. Jedes Kohlekraftwerk braucht sogenannte CO2-Zertifikate. Das sind eine Art Erlaubnisscheine, um CO2 in die Atmosphäre schicken zu dürfen. Diese Zertifikate kann man kaufen und verkaufen über den europäischen Zertifikatehandel für Emissionen. Wird nun ein Kohlekraftwerk stillgelegt, dann wird die entsprechende Menge an Zertifikaten frei. Jeder normal denkende Mensch würde diese natürlich sofort im zentralen europäischen Zertifikate-Register löschen lassen. Leider gibt es da ein paar Missverständnisse zwischen der Bundesregierung und der EU über die formalen (!) Anforderungen des Löschantrags. Folge: Die Zertifikate können gekauft werden, z. B. von polnischen Kohlekraftwerken. Das heißt: Wir legen hier Kohlekraftwerke still, aber die gleiche Menge CO2 darf wie gehabt dann legal anderswo ausgestoßen werden. Bürokratie torpediert Klimaschutz. Es bleibt die Hoffnung, dass sich die Bürokraten aller Länder irgendwann einmal auf ein gemeinsames Vorgehen verständigen. Dann wäre nicht nur diese sonderbare Schieflage beseitigt.
Faktor 7 schneller
Wie schnell kommt eigentlich der Ausbau der erneuerbaren Energien generell voran und – vor allem – wie schnell müsste er vorankommen, um das Ziel der vollständigen Dekarbonisierung[6] des Stromsektors bis 2045 zu erreichen?
Klartext dazu liefert der Net-Zero-Economy-Index vom September 2023, herausgegeben von der Unternehmensberatung PwC. 2022 betrug danach die weltweite Dekarbonisierungsrate 2,5 %. 17,2 % Dekarbonisierungsrate wären aber erforderlich, um den Anstieg gemäß dem Pariser Klimaschutzabkommen bei durchschnittlich 1,5 Grad zu begrenzen. 17,2 zu 2,5: Dazwischen liegt ein Faktor sieben. Siebenmal schneller also müsste der Umstieg auf erneuerbare Energien oder das Einsparen von CO2 gehen. Ehrlich gesagt: Auch wenn der Ausbau der erneuerbaren Energien vorankommt – der Net-Zero-Index sieht ein Plus von gut 24 % bei der Solarenergie –, wie soll die Weltgemeinschaft das hinbekommen? So zeigt der PwC-Index eine wachsende Diskrepanz zwischen globalen Klimaschutzzielen und tatsächlichen Fortschritten. Seit der Jahrtausendwende hat kein G20-Land eine jährliche Dekarbonisierungsrate von mehr als 11 % erreicht. Die Dringlichkeit, jetzt zu handeln, könnte nicht höher sein. Das bestätigt auch der Emissions Gap Report des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP), der zwei Wochen vor der 28. UN-Klimakonferenz veröffentlich wurde. Darin heißt es: »Die Welt steuert auf einen Temperaturanstieg von 2,5 bis 2,9 °C über dem vorindustriellen Niveau zu, es sei denn, es gibt Länder, die ihre Maßnahmen verstärken und mehr liefern, als sie in ihren Zusagen für 2030 im Rahmen des Pariser Abkommens versprochen haben.«
In der EU sollen bis 2030 erneuerbare Energien 42,5 % des Gesamtenergieverbrauchs ausmachen. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen nach Angaben der Kommission die Kapazitäten mehr als verdoppelt werden: Mehr als 500 Gigawatt installierte Leistung seien bis 2030 notwendig. Ende 2022 waren EU-weit 204 Gigawatt installiert. Dem Windindustrieverband WindEurope zufolge machen den Herstellern von Turbinen etwa hohe Rohstoffpreise und die Inflation zu schaffen. Sorge bereite außerdem, dass immer mehr Produzenten aus dem Ausland, vor allem aus China, auf den europäischen Markt drängten. Auch die langwierige Genehmigung von Windrädern und Windparks hemmt den Ausbau. Von der Beantragung bis zum Bau von Windrädern dauert es europaweit mehrere Jahre (beste Grüße vom Bürokratie-Monster). Und fast immer laufen dann die anfangs kalkulierten Kosten aus dem Ruder.
In Deutschland gehen dann rechnerisch mindestens 2 % der Landesfläche allein für Windparks drauf. Das heißt, dass sich die Anzahl der Windräder in etwa verdreifachen bis vervierfachen wird – auch, wenn einige alte Windparks durch Repowering mehr Leistung als vorher bringen können, indem man auf den bestehenden Turm einen neuen, leistungsstärkeren Generator setzt. Egal: Man kriegt schon heute die Krise, wenn man durch Rheinhessen fährt oder Richtung Hunsrück, und erst recht, wenn es durch die norddeutsche Tiefebene geht. Hunderte Windräder sind kein schöner Anblick in der Landschaft. Dieser Aspekt der Energiewende scheint nicht richtig zu Ende gedacht und diskutiert zu sein. So darf man gespannt sein, was die Menschen sagen werden, wenn sie in wenigen Jahren von Windrädern umzingelt sind.
Allerdings halten auch diese nicht ewig. Für Windräder, die ihr technisches Lebensende erreicht haben bzw. nach 20 Jahren aus der EEG-Förderung fallen und dann nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben sind, gibt es bisher keine wirklich guten Recycling-Möglichkeiten. Klar, für den Stahlturm schon, der Generator aber dürfte hinüber sein. Vielleicht lassen sich auch einige Metalle und Magnete retten. Das Problem aber sind die gigantischen Flügel aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Nach vielen Jahren im Wind macht sich Materialermüdung bemerkbar. Auch würden sie gar nicht zu neuen Anlagen mit veränderten Dimensionen passen. Sie werden dann abmontiert und klein gehäckselt. So macht es z. B. das Recyclingunternehmen EURECUM aus Lutherstadt Eisleben in Sachsen-Anhalt. Befreit von metallischen Bestandteilen – Blitzableiter etwa –, dient das Windflügel-Granulat dann, man mag es kaum glauben, als Ersatzbrennstoff. Es wird verfeuert! Sarkastisch zugespitzt könnte man sagen, dass alte Windkraftanlagen die fossilen Öfen am Laufen halten. Denn natürlich steckt im Kunststoff jede Menge Öl. Das Ganze ist keine Kleinigkeit: Der Bundesverband Windenergie beziffert die Leistung der bis Ende 2025 zurückzubauenden Windkraftanlagen auf 16 000 Megawatt. Da können schon so um die 5000 oder mehr rückzubauende Windkraftanlagen zusammenkommen.
Schauen wir uns noch ein paar Zahlen an: Die Bundesnetzagentur gibt für das Jahr 2023 die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien im rechnerischen Durchschnitt mit 56 % an.[7] Daraus folgt, dass 44 % unseres Stroms noch aus anderen Quellen kommen, rund 30 % von Braun- und Steinkohlekraftwerken. Bis zum Jahr 2045 soll Deutschland laut Klimaschutzgesetz Treibhausgasneutralität erreichen. Das heißt nicht, dass keine Treibhausgase wie CO2 oder Methan mehr in die Atmosphäre gelangen dürfen. Vielmehr muss dann ein Gleichgewicht zwischen Treibhausgasemissionen und Treibhausgaseinlagerungen oder -abbau herrschen. Dazu müssen sowohl die natürlichen Treibhausgasspeicher, also vor allem Moore und Wälder, in die Lage versetzt werden, diese ökologische Leistung dauerhaft zu erbringen, als auch technische Lösungen forciert werden, um CO2 wieder aus der Atmosphäre zu entfernen. Letzteres ist durchaus umstritten, großskalige und wirtschaftlich vertretbare Lösungen zeichnen sich hier bisher nicht ab – auch wenn Anfang Februar 2024 Bundeswirtschaftsminister Habeck prinzipiell den Weg für das Einfangen und Einlagern von CO2 politisch geebnet hat. Und von einem parallel zur Energiewende laufenden, wirklich üppig angelegten Waldschutz- und Moorrenaturierungsprogramm ist bisher nichts zu hören. Waldbesitzer müssten z. B. sehr viele alte Bäume erhalten, auf den Holzverkauf verzichten und eben von der Gesellschaft, also von uns allen, dafür bezahlt werden, dass ihr Wald CO2 aus der Atmosphäre aufnimmt, für frische Luft sorgt und auch das Grundwassersystem schützt. Ohne diese und andere flankierende Maßnahmen bleibt die Energiewende unweigerlich im Reich der grünen Fantasien gefangen. Das wirkt schon einigermaßen befremdlich: Ausgerechnet in einer Regierung mit maßgeblicher Beteiligung der »Grünen« werden diese Themen nicht deutlicher bzw. überhaupt kommuniziert.
Die Sache mit den Aggregatzuständen
Wo war nur das verflixte Chemiebuch? Seit einer halben Stunde durchsuchte Lara das Haus. Der Erfolg war minimal: Nur ihr Poesiealbum förderte die Aktion zutage. Lara warf einen Blick hinein und musste über so manchen Spruch schmunzeln. Völlig »Old School« heutzutage, dachte sie, heute geht so etwas über Social Media, WhatsApp, TikTok & Co. Laras Blick fiel auf die Armbanduhr: Jeden Moment würde Finn kommen. Sie intensivierte die Suche – irgendwo musste das Buch doch stecken! Schließlich hatte sie alle ihre Schulbücher aufbewahrt. Lara fand, dass viele Dinge darin besser erklärt waren, als es in den angesagten digitalen Werken der Fall ist.
Arbeitszimmer, Bücherschrank im Wohnzimmer – alles Fehlanzeige. Mit dem Keller war sie nun auch »durch«, blieb nur noch der Speicher. Richtig: In einem Anfall von Aufräumwahnsinn hatte ihr Mann Lennart alles nicht Niet- und Nagelfeste in große Umzugskartons gepackt und auf den Dachboden befördert. In der vierten Kiste wurde Lara fündig. Da waren sie ja, ihre alten Schulbücher. Und noch nicht einmal ganz unten, Chemie, Oberstufe. Gerade noch rechtzeitig entdeckt, denn sie hörte, wie jemand die Haustür aufschloss.
»Ich bin jetzt da«, hörte Lara ihren Sohn Finn rufen. »Können wir bitte gleich anfangen? Ich bin nachher noch verabredet.« Unglaublich, dachte Lara, da schreibt der Bub morgen eine Chemiearbeit, erzählt beim Frühstück, dass er nicht in den Kopf kriegt, was genau passiert, wenn z. B. Wasser oder jedes andere Material mal fest, mal flüssig oder mal gasförmig erscheint. Wie überhaupt dieselbe Materie so völlig unterschiedlich daherkommen kann. Und was genau diese komischen Aggregatzustände eigentlich seien. Zustände bekam allerdings Lara daraufhin sofort, denn das, so erzählte Finn munter weiter, sei das Hauptthema der Arbeit. Und alle wüssten ja, er dürfe nicht schlechter als 12 Punkte schreiben, um den Misserfolg der vorherigen Arbeit auszugleichen. »Tschüss Mama, bis heute Nachmittag, dann erklärst du mir das mal, ja?« Sprach’s und verschwand in Richtung Schule.
Die morgendliche Frühstücksrunde hatte allerdings erst gegen Mittag die Suchaktion ausgelöst. Bis dahin dachte Lara, sie wisse genau, wo ihre Schulbücher zu finden seien. War aber nicht so. Nun also ein Crashkurs über Aggregatzustände. Lara kramte ihre Lateinkenntnisse aus den ziemlich unteren Schubladen ihres Gedächtnisses hervor. Das Verb »aggregare« … mmmh … heißt: »zusammenhäufen«, »aufhäufen«, »zugesellen«, »angliedern«. Würde dieser Verweis auf Latein einen chemieschwachen Schüler begeistern können? Lara war nicht sicher.
»So, Mama, es kann losgehen. Also: Warum kann Wasser mal fest, mal flüssig, mal gasförmig sein?« Immerhin hatte Finn soeben die drei wichtigsten Aggregatzustände exakt aufgezählt. Ein erster Lichtblick. Lara schöpfte Mut und legte los: »Also Finn, stell dir mal bitte vor, dass jede Materie, eben auch Wasser, aus sehr vielen, sehr kleinen Teilchen besteht; da sind Atome dabei, Moleküle, Ionen. Merke dir einfach nur: Wasser besteht aus unglaublich vielen kleinen Teilchen. Du kannst dir einfach ganz viele kleine Kugeln vorstellen.« »O. k., also viele kleine Teilchen.« Lara dozierte weiter: »Unter unserem normalen Luftdruck und bei Temperaturen über null bis 100 Grad ist Wasser ja flüssig. Für die Teilchen heißt das: Sie können sich gegenseitig verschieben, sie sind sozusagen flexibel und nicht ortsfest. In einem Gefäß füllen sie jede Lücke aus. Steigt nun die Temperatur, bekommen die Teilchen mehr Energie und haben einfach mehr Spaß daran, sich noch freier zu bewegen. Aber noch hängen die Teilchen aufgrund ihrer gegenseitigen Anziehungskraft aneinander. Das ändert sich, wenn es noch wärmer wird. Die Bewegungsenergie nimmt immer mehr zu, schließlich halten die Teilchen nicht mehr zusammen, jedes einzelne verabschiedet sich in den Raum. Das passiert bei Wasser, wenn der Siedepunkt erreicht wird, das Wasser kocht und verdampft, es wird gasförmig. Wobei Gas und Dampf bezogen auf den Aggregatzustand physikalisch dasselbe sind, also lass dich da nicht irritieren.« Finn runzelte die Stirn: »Und was passiert mit den Teilchen, wenn das Wasser zu Eis wird?« »Na, genau das Gegenteil. Den Teilchen wird beim Abkühlen die Bewegungsenergie entzogen, sie werden immer lahmer, immer starrer, bis sie in einer Art Gitterstruktur einen festen Platz einnehmen, von dem sie nicht mehr wegkommen. Dann heißt der Aggregatzustand ›fest‹. Alles klar?« »Mmmh, ja, also viel Energie, viel Bewegung in den Teilchen, erst flüssig, dann gasförmig. Wenig Energie und die Teilchen frieren ein …?« »Ja genau, das ist es!« Lara war stolz auf ihre soeben entdeckten pädagogischen Fähigkeiten. Finn strahlte übers ganze Gesicht: »Danke Mama, das war toll, die Idee mit den Teilchen! Tschüss, bis heute Abend.« Nicht meine Idee, dachte Lara und beobachtete Finn, wie er sich draußen auf sein Fahrrad schwang. Aufgeladen ganz offenbar mit erheblicher Bewegungsenergie.
LNG – Das große Schulterklopfen
Am 17. Dezember 2022 war es so weit. Bundeskanzler Olaf Scholz eröffnete zusammen mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, Bundesfinanzminister Christian Lindner und Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil das erste deutsche LNG-Terminal in Wilhelmshaven. »LNG« steht für »liquefied natural gas«, verflüssigtes Erdgas. Nach nur 194 rekordverdächtigen Tagen Planungs- und Bauzeit wurde es fertiggestellt und an das Gasnetz angeschlossen. Dabei besteht das Terminal vor allem aus einem großen Schiff. In Wilhelmshaven ist es die knapp 300 Meter lange Höegh Esperanza. Aus Spanien brachte sie 165 000 Kubikmeter LNG mit, wie der Energiekonzern Uniper damals mitteilte. Dies entspricht etwa 96 Millionen Kubikmeter Erdgas und kann zwischen 50 000 und 80 000 Haushalte für ein Jahr versorgen.
Die Höegh Esperanza und die anderen Terminals dienen dazu, das von den Spezialtankschiffen angelieferte flüssige Methan wieder in den gasförmigen Aggregatzustand zu bringen, damit es dann per Pipeline weitertransportiert werden kann. Die Bundesregierung hat insgesamt sechs dieser schwimmenden Anlagen gemietet, wie Robert Habeck in der ARD-Sendung Maischberger am 11. Oktober 2023 erklärte. Die täglichen Mietkosten werden auf 200 000 Euro geschätzt – pro Schiff. Also 1,2 Millionen Euro am Tag, 438 Millionen Euro im Jahr. Jede schwimmende Einheit soll eine Kapazität von mindestens fünf Milliarden Kubikmetern pro Jahr haben – jeweils etwas mehr als 5 % des deutschen Jahresverbrauchs. Wenn diese Rechnung stimmt, könnten also gut 30 % des deutschen Gasbedarfs auf diese Weise gedeckt werden. Zum Vergleich: Vor dem Ukraine-Krieg haben die russischen Gaslieferungen ungefähr 55 % des gesamten Gasbedarfs in Deutschland ausgemacht. Ab 2025 sollen aus den schwimmenden, provisorischen Terminals dann feste Anlagen an Land werden. Nur diese können dann auch Wasserstoff verarbeiten. Geplant sind elf derartige Stationen – was u. a. den Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) auf die ökologische Palme bringt.[8] In der Tat sieht die Ökobilanz für LNG nicht gerade »grün« aus. Also: Erdgas besteht zu 98 % aus Methan, rund ein Viertel des Erderwärmungseffekts geht auf sein Konto. Denn Methan ist rund 25-mal klimaschädlicher als CO2, bezogen auf den Treibhauseffekt. Das ist keine Lappalie, denn beim Umgang mit LNG ist grundsätzlich mit Leckagen zu rechnen.
Methan im Energiestrudel
Um Erdgas in den Aggregatzustand »flüssig« zu bekommen, ist sehr viel Energie nötig. Bei normalem atmosphärischem Druck wird es erst bei einer Temperatur ab ca. -161 °C flüssig. Und dabei schrumpft das Volumen des Gases auf ein Sechshundertstel. Wir erinnern uns an die Klassenarbeit von Finn: Dem Gas wird Energie entzogen, die Teilchen bewegen sich weniger, binden sich schließlich aneinander und werden zu dem, was wir »flüssig« nennen. Grob gesagt kann also ein Flüssiggastanker auf diese Weise 600-mal mehr Energie transportieren. Das ist der wirtschaftliche und praktische Grund für das Abkühlen. Natürlich müssen die -161 °C während des Transports per Schiff unbedingt gehalten werden. Methan also im Energiestrudel: Wir haben den energetischen Aufwand für die Verflüssigung (ob dazu erneuerbare Energien ohne CO2-Last verwendet werden, ist unklar), dann den Energieeinsatz für den Schiffsantrieb (das fährt evtl. dann leer zurück; die Leerfahrt zählt auch zur Ökobilanz) und dann noch mal den Energieeinsatz für die Rückführung in den gasförmigen Zustand. Dieser Prozess muss exakt kontrolliert und gesteuert ablaufen, um ungewolltes Entweichen des Gases oder gar Unfälle zu verhindern. Überhaupt ist der Umgang mit einer -161 °C kalten Flüssigkeit ein technisch durchaus anspruchsvoller Vorgang und verlangt hohe Sicherheitsstandards. All das macht unter dem Strich einen Energieverlust von rund 25 % einer Schiffsladung LNG aus!
Der BUND berichtet darüber hinaus, dass LNG aus den USA weitgehend mittels Fracking gefördert wird[9]. Die Risiken dieses Verfahrens werden höchst unterschiedlich bewertet. Der deutsche Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU) beschreibt die Gewinnung von sogenanntem Schiefergas in einem Gutachten so: »Schiefergas ist Erdgas, das in unkonventionellen Lagerstätten eingebunden ist und sich nur mithilfe des Hydraulic-Fracturing-Verfahrens, kurz Fracking, erschließen lässt. Bei dieser Technik wird mit verschiedenen Zusätzen angereichertes Wasser unter hohem Druck in die erdgashaltigen Gesteinsschichten verpresst. So entstehen Risse, die die Durchlässigkeit des Gesteins erhöhen und das Abströmen des Erdgases an die Oberfläche ermöglichen.«[10] Der SRU kam seinerzeit zu der Einschätzung, dass »Fracking erst auf der Basis positiver Erkenntnisse aus systematisch zu entwickelnden Pilotprojekten verantwortbar« sei. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Auf der Webseite des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz[11] ist zu lesen, dass »kommerzielle Fracking-Vorhaben in unkonventionellen Lagerstätten in Deutschland bis auf Weiteres nicht zulässig sind«. Das Verbot betrifft das Fracking bei der Erdgasgewinnung in Schiefer-, Ton-, Mergel- und Kohleflözgestein[12]. Frackingverbot also in Deutschland. Grünes Licht für Frackinggas-Importe vor allem aus den USA. Ist ja klar – wenn was schiefgeht, wird eben das Grundwasser in den USA





























