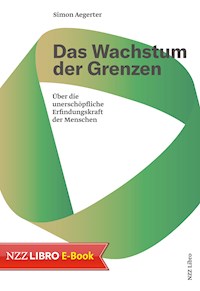
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Neue Zürcher Zeitung NZZ Libro
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Noch nie ging es so vielen Menschen so gut wie heute. Wie haben wir das geschafft? Die Geschichte zeigt, dass der Fortschritt immer wieder in Schüben erfolgte. Neuerungen meist technischer Art haben das Leben verändert – oft mit zunächst schmerzlichen Umwälzungen verbunden, aber schliesslich zum Besseren. Nun scheint es, als hätten wir alles erreicht, was wir erreichen können – wenn nicht sogar zu viel: Man sagt uns, wir konsumierten, als hätten wir drei Erden. Die Rohstoffe gingen zu Ende. Es drohe der Kollaps. Das ist ein Denkfehler. Die Angst vor der Zukunft blendet die Erfindungskraft von uns Menschen aus. Auch heute werden Lösungen gefunden – wir müssen sie nur anwenden. Der Physiker Simon Aegerter zeigt anschaulich und leicht verständlich auf, wie wir das anpacken könnten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 341
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Noch nie ging es so vielen Menschen so gut wie heute. Wie haben wir das geschafft? Die Geschichte zeigt, dass der Fortschritt immer wieder in Schüben erfolgte. Neuerungen meist technischer Art haben das Leben verändert – oft mit zunächst schmerzlichen Umwälzungen verbunden, aber schliesslich zum Besseren. Nun scheint es, als hätten wir alles erreicht, was wir erreichen können – wenn nicht sogar zu viel: Man sagt uns, wir konsumierten, als hätten wir drei Erden. Die Rohstoffe gingen zu Ende. Es drohe der Kollaps. Das ist ein Denkfehler. Die Angst vor der Zukunft blendet die Erfindungskraft von uns Menschen aus. Auch heute werden Lösungen gefunden – wir müssen sie nur anwenden. Der Physiker Simon Aegerter zeigt anschaulich und leicht verständlich auf, wie wir das anpacken könnten.
Simon Aegerter
Das Wachstum der Grenzen
Über die unerschöpfliche Erfindungskraft der Menschen
NZZ Libro
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© 2020 NZZ Libro, Schwabe Verlagsgruppe AG
Das E-Book folgt der gedruckten 1. Auflage 2020 (ISBN 978-3-03810-476-6)
Lektorat: Rainer Vollath, München
Umschlag: Katarina Lang, Zürich
Gestaltung, Satz: Claudia Wild, Konstanz
Datenkonvertierung: CPI books GmbH, Leck
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung dieses Werks oder von Teilen dieses Werks ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des Urheberrechts.
ISBN E-Book 978-3-03810-488-9
www.nzz-libro.ch
FürMichaelThomasNicoAmy
Sie und ihre Generation sollen nicht im Mittelalter leben müssen.
Vorwort
Dieses Buch hat eine lange Vorgeschichte. Dennis L. Meadows’ Grenzen des Wachstums (1972) und Paul R. Ehrlichs Die Bevölkerungsbombe über die Bevölkerungsexplosion haben mich bewegt und beunruhigt, weil ich schon vor 50 Jahren um die Bedrohungen des Klimawandels durch das anthropogene Kohlendioxid (CO2) wusste. Ich wunderte mich, dass dieses Problem bei Meadows kaum auftauchte.
Ich begann, mich vertieft mit diesen Fragen zu befassen, und ich stiess auf Erstaunliches: Nicht Fakten, nicht Forschungsergebnisse, nicht einmal Naturgesetze dienen als Leitlinien politischen Handelns, sondern – ganz profan – materielle Interessen. Ich erhielt sogar den Eindruck, dass wissenschaftliche Fakten – gewissermassen zum Selbstschutz – oft bewusst nicht wahrgenommen werden.
Was kann man dagegen tun? Man kann die Fakten immer wieder bekannt machen. Aber wie? Leserbriefe schreiben? Ja, aber es ist die Redaktion, die entscheidet, welche Briefe veröffentlicht werden. Und diese entscheidet vorwiegend aufgrund von Geschäftsinteressen. Das Gleiche gilt für Artikel und Gastbeiträge in Zeitungen und Zeitschriften. Seit etwa 20 Jahren gibt es die Möglichkeit, seine Meinung über das Internet zu verbreiten. Aber auch da ist die Reichweite beschränkt. Drei Jahre vor der Energieabstimmung in der Schweiz am 21. Mai 2017 verfasste ich ein Blog zu Energiefragen. Die höchste Leserzahl lag bei tausend.
Vielleicht dann doch lieber ein Buch schreiben? Ein Buch kann man immer wieder zur Hand nehmen.
Dabei stellten sich mir aber verschiedene Fragen. Welche Art von Buch sollte ich schreiben? Kann man Wissenschaft in eine spannende Geschichte packen? Ich hab’s versucht. Es hat mich nicht befriedigt. Vielleicht eine Serie von Comics? Das könnte gehen, aber mein Talent zum Zeichnen reicht nicht aus. Die Blogs aus dem Abstimmungskampf zu einem Buch zusammenfassen? Das wäre das Einfachste, aber wohl nicht besonders spannend, weil unzusammenhängend.
Also doch ein klassisches Buch mit Text und Illustrationen. Sie halten es in Ihren Händen. Es besteht aus drei Teilen. Falls Sie sich nicht für Geschichte interessieren, können Sie sich den ersten Teil sparen. Allerdings werden Sie dann einige Zusammenhänge verpassen, die Sie vielleicht noch nicht gekannt haben. Der zweite Teil zeigt, was die Menschheit erreicht hat. Was heisst das für die Zukunft? Davon handelt der dritte Teil. Was werden unsere Enkel erleben und was nicht?
Eine Warnung: Dieses Buch habe ich nicht für Fachleute geschrieben. Fachleute wie Historiker, Ärzte oder Molekularbiologen werden, wenn sie beim Lesen auf ihr Fachgebiet stossen, den Kopf schütteln, sich gar die Haare raufen. Ich habe vieles sehr stark vereinfacht, aber ich habe mich bemüht, nichts Falsches zu schreiben. Manches mag provozierend tönen. Das ist Absicht. Wenn dieses Buch heisse Diskussionen auslöst, freut es mich. Eine zweite Warnung: Meine Zahlenbeispiele verwenden gerundete Zahlen. Es geht mir um Grössenordnungen, deshalb gehen die Stellen nach dem Komma bisweilen verloren. Also bitte nicht nörgeln, wenn meine Zahlen eine Stelle nach dem Komma von Ihren abweichen.
Vieles sehe ich aus schweizerischer Warte, aber der globale Blick geht nicht vergessen. Die Leser nördlich und östlich des Rheins mögen mir den einen oder anderen Helvetismus nachsehen.
Die Leser? Und die Leserinnen? Die natürlich auch. Ja, in meinem Deutsch sind sie nicht nur mitgemeint, sondern voll dabei. Sie sind Menschen, und auf Deutsch heisst es «der Mensch». Ich halte es mit Wolf Schneider, dem Doyen des guten deutschen Sprachstils, der einst meinte: «Um ein berechtigtes Anliegen zu unterstützen, ist es nicht nötig, eine Sprache zu zerstören.» Schneider betont immer wieder den Unterschied zwischen dem biologischen und dem grammatikalischen Geschlecht. Die Person kann auch ein Mann sein, der Mensch eine Frau und das Individuum beides. Die kürzlich verstorbene Physikerin Verena Meyer, erste Rektorin der Universität Zürich, zeigte an einem Beispiel, dass geschlechtergerechte Sprache nicht funktionieren kann: «Mein bester Student war eine Frau», sagte sie. Geschlechtergerecht kann man das gar nicht ausdrücken. In gendergerechter Sprache wäre es ein Widerspruch in sich, und «Meine beste Studentin war eine Frau» wäre tautologisch. Das Partizip der Gegenwart funktioniert auch nicht: Die Studierenden studieren ja nicht immer. Manchmal sind sie Schlafende, Essende, Liebende. Gendersternchen, Binnen-I und Unterstriche gehen gar nicht. Nein, gutes Deutsch ist das Deutsch, das sich über viele Generationen entwickelt hat. Es ist das Deutsch, das zu schreiben ich mich bemühe.
Dieses Buch wäre nicht so geworden, wie es ist, wenn ich nicht die Hilfe meiner Frau Irene gehabt hätte, die mich immer wieder angespornt hat, hier eine lesbarere und dort eine präzisere Wendung zu finden. Danke, Irene. Geschrieben ist das Buch in erster Linie für unsere Enkel. Sie sollen dereinst nicht sagen müssen: «Unser Grossvater hat zwar gesehen, was auf uns zukommt, aber er hat uns nichts gesagt.»
Einleitung
Versklavt von Robotern? Verarmt wegen Ressourcenmangel? Auf der Flucht vor dem Krieg ums Wasser? Überrannt von Klimaflüchtlingen? Keuchend in verschmutzter Luft? Verstrahlt vom Atommüll?
Sieht so das Schicksal unserer Enkel aus? Wird das Leben auf der Erde von nun an immer schlimmer, schwieriger und gefährlicher? Leben wir jetzt und heute in der besten aller möglichen Welten? Oder haben wir diese vielleicht schon hinter uns? War in der «guten alten Zeit» alles besser?
Zeitungen, das Radio und das Fernsehen sowie die Internetmedien – alle machen es uns leicht, uns vor der Zukunft zu fürchten. Noch geht es uns gut! Eigentlich sehr gut. Wir ernähren uns mit erlesenen Speisen, wohnen geräumig und behaglich. Wir gönnen uns Tauchferien auf den Malediven. Wir verbringen den Lebensabend auf Kreuzfahrten und lernen neue Welten kennen. Und der Lebensabend wird immer länger: Die Lebenserwartung übertrifft die unserer Eltern und erst recht die unserer Grosseltern um viele Jahre. Sie nimmt immer noch zu. In der Schweiz jedes Jahr um fast einen Monat. Die Medizin hat die Geisseln der Menschheit – Pest, Tuberkulose, Syphilis – weitgehend überwunden. Pocken gibt es nicht mehr, Kinderlähmung bald auch nicht mehr. Es mangelt uns an fast nichts.
Aber so kann es doch nicht weitergehen, lesen und hören wir allenthalben. Wir plündern unseren Planeten. Wir leben, als hätten wir drei Planeten Erde zur Verfügung. Die Grenzen des Wachstums hat man uns schon 1972 aufgezeigt. Wir missachten sie. Wir haben sie überschritten. Der Kollaps sei unausweichlich.
Ist die Angst vor der Zukunft also begründet?
Schon immer standen die Menschen an der Schwelle zur Zukunft. Schon immer hatten sie Angst davor. Und fast immer kam es ganz anders, als befürchtet. Besser. Angenehmer. Gesünder.
Fast immer, aber nicht immer. Um 1913 und 1939, da war die Angst vor der Zukunft begründet. Sie wäre auch 1618 begründet gewesen – aber da erwartete niemand den verheerenden Dreissigjährigen Krieg.
Hundert Jahre später, 1719 – vor 300 Jahren, da drohte nichts besonders Furchterregendes. Da herrschte einfach die übliche Angst vor der Zukunft. Wie sah die Welt damals aus? In Frankreich war der achtjährige Ludwig XV. König. Der Sonnenkönig Ludwig XIV., sein Urgrossvater, war vier Jahre zuvor verstorben. In Leipzig komponierte Johann Sebastian Bach Kantaten und Fugen. Vornehme Männer trugen Perücken, Königs- und Fürstenhöfe waren prächtig mit Samt und Gold ausstaffiert. Es war das Zeitalter des Barocks.
Doch der allergrösste Teil der Menschen hatte keinen Anteil an der barocken Pracht. Sie waren Bauern. Sie lebten von der Hand in den Mund und arbeiteten sich dabei buchstäblich zu Tode. Das Land, das sie bebauten, gehörte ihnen nicht. Die Mütter gebaren zehn oder zwölf Kinder, von denen die Hälfte die Kindheit nicht überlebte. Viele junge Männer, die es schafften, erwachsen zu werden, starben als Söldner in fremden Kriegsdiensten.
Die hygienischen Verhältnisse stanken buchstäblich zum Himmel, besonders in den Städten, wo die Handwerker ein bescheidenes Auskommen suchten. Die Strassengräben waren offene Kloaken, gespeist durch die Ehgräben zwischen den Häusern, in die man das Nachtgeschirr entleerte.
Die Angst vor der Zukunft bezog sich auf die nahe Zukunft: Würde es gelingen, im Herbst eine gute Ernte einzufahren, oder würden Sturm, Hagel und Hochwasser zu Missernten und Hungersnot führen oder Seuchen das Vieh dahinraffen? Würde der Gutsherr die Abgaben erhöhen oder die Obrigkeit einen Krieg anfangen? Und wann endlich bessert sich Vaters Husten?
Niemand wusste, dass sich im fernen England eine neue Zeit anbahnte. Selbst wenn man gewusst hätte, dass es im abgelegenen Dudley einem Schmied namens Thomas Newcomen einige Jahre zuvor gelungen war, eine Maschine zu konstruieren, die Feuer in Kraft verwandelte, hätte sich niemand die Folgen ausmalen können. Vor 300 Jahren standen die Menschen in Europa an der Schwelle zur Moderne. Doch niemand ahnte es.
Hundert Jahre später war die Moderne da – und die Angst davor. Man hatte schwere Zeiten hinter sich. Die Napoleonischen Kriege waren endlich vorüber, und nach dem Wiener Kongress von 1815 schienen in Europa Frieden und Stabilität eingekehrt zu sein. Aber dann folgte das Jahr 1816, das Jahr ohne Sommer, und mit ihm Missernten und Hungersnöte. Niemand wusste, dass ein gigantischer Vulkanausbruch im fernen Indonesien die Ursache war. Man fürchtete, das könnte das neue Normale sein.
Noch konnten sich die Bauern mit Weben und Spinnen zu Hause ein Zubrot verdienen, aber aus England hörte man Beunruhigendes: Maschinen in Fabriken nahmen den Heimarbeitern angeblich die Arbeit weg. Auch auf dem Kontinent entstanden Fabriken. Überhaupt hörte man Schreckliches aus England: Es sollte dort maschinengetriebene Wagen geben, die, ohne von Pferden gezogen zu werden, von selbst fuhren, gar schneller als ein galoppierendes Pferd.
Zumindest in Frankreich war mit Ludwig XVIII. die königliche Ordnung wiederhergestellt. Die europäischen Herrscher von Gottes Gnaden konnten ihre Macht und ihren Prunk beruhigt weitergeniessen. Die absurde Idee, das Volk könne sich selbst regieren, hatte sich erledigt – ausser jenseits des Atlantiks, in den sogenannten Vereinigten Staaten von Amerika. Dort kamen sie seltsamerweise immer noch ohne einen König aus, auch nachdem die Engländer sie sechs Jahre zuvor zur Vernunft hatten bringen wollen und das Weisse Haus niederbrannten. Und dann waren da noch die starrköpfigen Schweizer.
Ist es die Ruhe vor einem weiteren Sturm? Die meisten waren überzeugt davon.
Hätten sie hundert Jahre vorausblicken können, sie hätten sich bestätigt gesehen. Das Jahr 1919 war alles andere als erfreulich. Zwar hatte das grosse Sterben in Flandern endlich ein Ende, aber jetzt raffte die Grippe die Menschen dahin. Die wirtschaftlichen Folgen des Kriegs waren drückend, und wieder kam der Hunger zurück nach Europa.
Angesichts dieses Elends war es leicht zu übersehen, wie viel besser es den Menschen ging als hundert Jahre zuvor. Die Industrialisierung hatte die Produktivität massiv gesteigert; alle waren wohlhabender geworden. Auf den Weltausstellungen am Ende des 19. Jahrhunderts hatte man die neuen Wunder der Technik bestaunen können: elektrisches Licht, elektrisch angetriebene Maschinen, selbstfahrende Kutschen. Eisenbahnen transportierten die Güter jetzt viel schneller als Fuhrwerke, und sogar in der Luft sah man neuerdings Maschinen.
Die Kinder hatten eine grössere Chance, erwachsen zu werden. Man hatte gelernt, was Hygiene bedeutet. Nachrichten verbreiteten sich fast augenblicklich. Anstelle von Schiffen, die wochenlang unterwegs waren, überbrachte der Telegraf die Neuigkeiten. Die Neue Zürcher Zeitung erschien dreimal am Tag.
Die Nachrichten waren aber nicht dazu angetan, sich auf die Zukunft zu freuen: Der deutsche Kaiser war abgesetzt, ebenso der russische Zar und der österreichisch-ungarische Kaiser. Auch der türkische Sultan klammerte sich mit letzter Kraft an die Macht. Die Welt war in Aufruhr, und niemand wusste, wie es weitergehen würde. Die Zukunft machte Angst.
Jetzt schreiben wir das Jahr 2020, und wir stehen da, wo wir schon immer gestanden haben: an der Schwelle zur Zukunft. Und wir fürchten uns immer noch davor. Wenn wir 300 Jahre zurückblicken, sehen wir – trotz der Rückschläge und Einbrüche – eine fast unglaubliche positive Entwicklung. Könnte es nicht so weitergehen? Können wir die Zukunft nicht erraten, indem wir die Vergangenheit extrapolieren, weiterschreiben?
So einfach geht es leider nicht. Aber wir können aus der Vergangenheit lernen. Dazu möchte ich mit diesem Buch anregen.
Im ersten Teil versuche ich, diese Vergangenheit in komprimierter Form in Erinnerung zu rufen. Wir werden sehen, dass die Entwicklung nicht anhaltend und stetig war. Sie verlief in Schüben, ausgelöst durch Neuerungen, die alles, was zuvor galt, infrage stellten. Ich nenne diese Neuerungen disruptiv.
Im zweiten Teil wollen wir uns umsehen und zusammenfassen, was wir erreicht haben und wie wir das erreicht haben – im Guten wie im Schlechten.
Im dritten Teil wage ich einen Blick in die Zukunft. Nein, ich wage keine Prognosen, ich zeige bloss Möglichkeiten auf. Möglichkeiten, die wir aufgrund des heutigen Wissens haben. Ob wir diese Möglichkeiten nutzen werden, wer sie nutzen wird und ob man sie missbrauchen wird – all das wage ich nicht vorauszusagen. Natürlich weissage ich nichts, was heute noch unbekannt ist. Aber technische Entwicklungen kann man mit einiger Sicherheit voraussagen, vor allem vermag man mit Sicherheit zu sagen, was es auch in hundert oder mehr Jahren nicht geben wird: Zum Beispiel freie Energie aus dem Nichts. Oder die Flucht der Menschheit auf einen anderen Planeten. Oder lauter Menschen, die nur lieb, gut und fürsorglich sind.
Gar nicht absehbar ist das gesellschaftliche und politische Umfeld, in dem sich diese Möglichkeiten darbieten werden. Eine Extrapolation ist in diesem Fall völlig unmöglich. Da herrscht im mathematischen Sinn Chaos: Eine kleine Begebenheit kann eine grundlegende Umwälzung auslösen. Man denke an den Mord von Sarajevo. Oder an den Fenstersturz von Prag, der den Dreissigjährigen Krieg auszulösen half. Und es kann ja auch negative Disruptionen geben.
Ist vielleicht der technische Fortschritt, wie wir ihn heute erleben, so eine negative Disruption? Steuern wir nicht sehenden Auges in eine Katastrophe? Sind Umweltzerstörung, Ressourcenverbrauch, Energieverschwendung und Bevölkerungsexplosion nicht Wege in den Untergang? Sollten wir nicht wieder natürlicher leben, auf Technik und Wachstum verzichten?
Ja, die technische und gesellschaftliche Entwicklung ist rasant, und sie kann beängstigend sein. Sie ist zurzeit für eine Mehrheit der Menschen offenbar eher beängstigend als vielversprechend. Diese Mehrheit gleicht einem Menschen, der erstmals fliegt, und das gleich auf dem Sitz des Kopiloten. Er sieht, wie das Flugzeug beim Start beschleunigt, er hört den Lärm der Motoren und spürt die Vibrationen. Alles wird immer schlimmer, und er sieht mit Entsetzen, wie das Flugzeug, in dem er hilflos ausgeliefert sitzt, immer schneller auf das Ende der Piste zurast, auf den Zaun, die Strasse mit dem dichten Verkehr und den Wald dahinter. Panik ergreift ihn, er möchte mit voller Wucht auf die Bremse treten – und würde damit eine Katastrophe verursachen, denn das Flugzeug lässt sich in dieser Phase des Startvorgangs nicht mehr rechtzeitig abbremsen. Es knallt in den Zaun, in die Autos und in die Bäume.
Der Pilot weiss das. Die kritische Geschwindigkeit ist überschritten. Was auch passiert, er hebt ab. Er fliegt. Er überfliegt das Ende der Piste, den Zaun, die Strasse und den Wald.
Wir, die Menschheit, sind in dieser Situation. Wir haben einen kritischen Punkt überschritten. Zum Bremsen ist es zu spät. Jeder Versuch, den Start abzubrechen, schlägt nicht nur fehl, sondern endet in einem Desaster. Jetzt sind Wissen und Können gefragt.
Noch nie in der Geschichte wussten wir so viel, hatten wir so viele technische Möglichkeiten und so viele Chancen, das Leben aller Menschen zu verbessern. Mit diesem Buch möchte ich Mut machen, dieses Wissen, diese Technik und diese Chancen zu nutzen, damit unsere Enkel ihr Leben meistern und geniessen können.
Woher kommen wir?
Leben: eine sprunghafte Karriere
Leben ist unvermeidlich
Lebendig scheint wie fest, flüssig und gasförmig eine Form der Materie zu sein: Unvermeidlich, wenn die Bedingungen stimmen.1 Leben erschien auf der Erde, kaum hatte sie ihre Glut mit einer dünnen Kruste überzogen. Man findet es heute im Wüstensand wie unter dem Eis der Antarktis, in kochenden Quellen und im Gestein 500 Meter unter der Erde. Seit die Astronomen Dutzende von Planeten entdeckt haben, die um fremde Sonnen kreisen und dabei einen Abstand halten, der flüssiges Wasser erlaubt,2 können wir annehmen, dass Leben im ganzen Universum vorkommt. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis es nachgewiesen wird.
Das Reich der Algen und Bakterien
Die Einzeller beherrschten die Erde während 3000 Millionen Jahren. Zuerst waren es einfache Eiweissklümpchen; später trennte sich der Bauplan vom «Gebäude»: Die in der DNA sitzenden Gene – die DNA ist ein Riesenmolekül in Form einer Doppelspirale – bestimmen seither bei allen Lebewesen, wie die Zelle aufgebaut ist. Die DNA bildet die Chromosomen. Diese sitzen bei allen höheren Lebewesen, den Eukaryoten – also den Pflanzen und Tieren –, im Zellkern. In Zellen ohne Zellkern schwimmt die DNA im Zytoplasma, der Zellflüssigkeit. Sie heissen Prokaryoten. Davon gibt es zwei unterschiedliche Versionen: die Bakterien und die Archaeen. Beide gibt es seit mehr als drei Milliarden Jahren.
Schliesslich lernten die Zellen, das Sonnenlicht als Energiequelle zu nutzen: Die Algen waren die ersten Pflanzen. Sie nutzen das Sonnenlicht, indem sie aus Wasser und Kohlendioxid die Substanzen herstellen, die ihre Körper aufbauen. Dabei produzieren sie Sauerstoff, eine neue Substanz in der Atmosphäre. Sauerstoff «vergiftete» die Uratmosphäre.3 Die bisherigen Lebewesen waren darauf nicht vorbereitet. Sie entwickelten Abwehrstrategien, zogen sich in sauerstofffreie Nischen zurück oder starben aus. Es war der erste Ökokollaps.
Die erste Revolution
Vor 540 Millionen Jahren erfand das Leben einen genialen Trick: Viele Zellen arbeiteten zusammen und spezialisierten sich. Sie bildeten vielzellige Lebewesen. Innerhalb von kaum zehn Millionen Jahren entstanden die Vorläufer der Schnecken, der Krebse und der Säugetiere.
Doch was heisst: «Das Leben erfindet»?
Es ist eine Metapher. Klar: Das Leben ist nicht eine Person, die Erfindungen macht. Wir sprechen von der Evolution. Die Evolution ist ein Prinzip, ein Vorgang. Er wurde erstmals 1859 von Charles Darwin (1809–1882) beschrieben. Evolution benötigt drei Voraussetzungen: Mutation, Fortpflanzung und Selektion.
Unter Mutation verstehen die Biologen eine spontane Veränderung der Erbmasse. Das kann durch einen Fehler beim Kopieren der DNA, also bei der Zellteilung, passieren oder bei einer Veränderung der DNA durch chemische Einwirkungen. Wenn die DNA verändert wird, entsteht ein Lebewesen mit leicht veränderten Eigenschaften. In den meisten Fällen sind diese neuen Eigenschaften nachteilig, und das Lebewesen stirbt und kann sich nicht fortpflanzen. In einigen wenigen Fällen ist die Mutation vorteilhaft und gibt dem Träger der Mutation eine bessere Chance, sich fortzupflanzen. Das ist die Selektion. Brutal vereinfacht gesagt: Was überlebt, überlebt. Und pflanzt sich fort. Fortan gibt es eine neue Lebensform.
So einfach das Prinzip ist, so machtvoll ist es, wenn man ihm genügend Zeit lässt. Gegen das Prinzip der Evolution wird etwa eingewendet, es beruhe ausschliesslich auf Zufall. Das sei, als ob eine Horde Affen auf Tastaturen herumtippe und man erwarte, dass dabei irgendwann einmal Schillers Lied von der Glocke entstehe. Das ist ein doppeltes Missverständnis. Erstens übersieht dieses Bild die Selektion: Bei jedem Anschlag müsste überprüft werden, ob der neue Buchstabe sinnvoll ist. So kann in der deutschen Sprache auf ein «D» nur ein Vokal oder ein «R» folgen. Auch Buchstabenkombinationen, die keine gültigen Wörter bilden, müssten abgelehnt werden. Auf diese Weise kann nach langer, aber absehbarer Zeit durchaus etwas Sinnvolles entstehen. Es muss nicht – und das ist das zweite Missverständnis – ein bestimmtes Gedicht sein. Es kann etwas sein, das noch niemand aufgeschrieben hat. Evolution ist nicht teleologisch, das heisst, sie hat kein Ziel vor Augen.
Nichts in der Biologie macht Sinn – ausser im Licht der Evolution. Theodosius Dobzhansky4 hat es eingängig formuliert. Die geniale Einsicht Darwins ist inzwischen 160 Jahre alt und immer noch umstritten. Eben (2017) wurde sie in der Türkei aus dem Lehrplan gekippt. Worum geht es? Woher kommt der Widerstand? Wovor hat man Angst?
Es ist die grosse Demütigung: Wir sind nicht die Krone der Schöpfung. Wir sind das Resultat einer unabsehbar langen Kette von Kopierfehlern. Aber eigentlich dürfen wir zufrieden und stolz sein: Wir sind nämlich das Resultat einer unabsehbar langen Kette erfolgreicher Kopierfehler.
Das Grundprinzip der Evolution ist erschreckend einfach und gerade deshalb so machtvoll. Es wirkt nicht nur in der Biologie. Wir begegnen ihm in allen Lebenslagen.5 Wir werden ihm in der Folge noch oft begegnen.
Fortpflanzung wird Teamwork
Einige der neuen Lebewesen begannen, die genetische Information paarweise zu vermischen: durch sexuelle Fortpflanzung.6 Damit wurden die im Zeitalter des Präkambriums – also vor mehr als 542 Millionen Jahren – angelegten Grundbaupläne zu einer unabsehbaren Vielfalt variiert. Warum? Es ist paradox – weil so die Möglichkeit von Kopierfehlern vervielfacht wurde und weil neue Kombinationen von Bauplänen für Zellen entstanden, die Elemente von zwei ganz leicht unterschiedlichen Bauplänen enthielten. Dadurch entstanden zwar viel mehr Lebensformen, die nicht überlebensfähig waren, aber eben auch viel mehr erfolgreiche neue Formen. Die Artenvielfalt explodierte gleichsam.
Raus aus dem Wasser!
Drei Milliarden Jahre lang spielte sich alles Leben im Wasser ab. Im Wasser hatte das Körpergewicht keine Bedeutung – und vor allem: Im Wasser war man vor den tödlichen ultravioletten Strahlen der jungen Sonne geschützt. Schliesslich verschwand diese Bedrohung. In der Atmosphäre hatte sich genügend Sauerstoff gebildet, sodass eine schützende Ozonschicht entstehen konnte.
In den Gezeitentümpeln entwickelten sich Lebensformen, die den Sauerstoff der Luft aufnehmen konnten; aus Schwimmblasen wurden Lungen, aus Flossen Frühformen von Gliedern. Evolution eben! Schliesslich eroberten Amphibien und Reptilien das trockene Land.
Mit der Eroberung des Landes erschlossen sich neue Lebensräume, und es entstand eine neue Vielfalt. Mehrmals wurde das Leben auf der Erde durch globale Naturkatastrophen beinahe ausgelöscht, zuletzt vor 64 Millionen Jahren, als die grossen Reptilien, die Dinosaurier, ausstarben.7 Jedes Mal folgte darauf eine Explosion des Artenreichtums, nach dem Ende der Saurier die der Säugetiere und der Vögel. Bald fanden sich Säugetiere auf allen Kontinenten – ausser in Australien – Säugetiere wie Nager, Paarhufer, Karnivoren – und Primaten: Lemuren, Affen und in Afrika Hominiden.
Eine kleine Urgeschichte
Woher kommen wir? Es mag für viele überraschend sein: Wir sind alle Afrikaner! In den letzten fünf bis acht Millionen Jahren entwickelte sich die Gattung Homo in Afrika. Die Wissenschaftler kennen heute mindestens ein Dutzend Variationen, Arten. Das sind Zweige, die vom Entwicklungspfad spriessen und fast immer nach ein paar Hunderttausend Jahren enden. Wir kennen den Homo erectus – den «aufgerichteten» Menschen, den Homo ergaster – den arbeitenden Menschen (weil er Werkzeuge schuf), den Homo habilis – den «geschickten» Menschen, den Homo neanderthalensis – den Menschen aus dem Neandertal, und schliesslich, seit etwa 250000 Jahren, den Homo sapiens – den «wissenden» Menschen.
Der Name «Neandertaler» verrät es: Der Mensch blieb nicht in Afrika – das Neandertal liegt in Deutschland! Die ersten Spuren eines frühen Eurasiers sind dort gefunden worden. Noch frühere Auswanderungen nach Eurasien endeten, wie die der Neandertaler, durch Aussterben. Man hat Überreste früher Hominiden in Heidelberg und Peking gefunden. Aber der grösste Teil der Entwicklung fand in den Steppen Ostafrikas statt.
Wir wissen nicht wirklich, wie unsere Vorfahren lebten. Was sie uns hinterlassen haben und was den Paläontologen, auf Deutsch: den Altertumswissenschaftlern, als Untersuchungsobjekte dient, sind ihre Knochen und Zähne, ihre Werkzeuge und manchmal ihre Lagerplätze.
Aus diesen Funden kann man einiges ableiten. Die Menschen lebten offenbar in kleinen Gruppen, wohl in Familien oder Grossfamilien. Schon aus sehr früher Zeit fand man Spuren von Feuer.
Bisher hatte das Feuer zu den Feinden der Menschen gehört. Wenn der Wald brannte, war Flucht angesagt. Wenn Blitze zuckten, suchte man Schutz. Jetzt wurde das Feuer zum Freund. Es wärmte die kalten Nächte, spendete Licht und verscheuchte Raubtiere. Ja, es diente sogar zur Verbesserung des Speiseplans. Das Essen wurde leichter verdaulich, wenn es gekocht war.
Man kann sich leicht vorstellen, auf welche Widerstände die Erfinder des Feuermachens gestossen sind. Man holt sich so etwas Gefährliches wie Feuer doch nicht in die eigene Höhle! Welch ein Unsinn – und welche Anmassung zu meinen, man könne ein Naturphänomen beherrschen! Natürlich gab es Unfälle. Klar geriet das Feuer auch mal ausser Kontrolle, und Menschen kamen dabei zu Tode. Trotz solcher Rückschläge setzte sich der Gebrauch des Feuers durch. Die Vorteile waren einfach zu gross. Auch das ist Evolution: Neue Ideen müssen, um zu überleben, den Test der Nützlichkeit bestehen. Das Feuer hat ihn bestanden. Holz wurde zur ersten Energiequelle. Es war, was wir heute eine «disruptive» Innovation nennen. Disruptiv heisst: Von nun an ist alles anders.
Die Beherrschung des Feuers brachte dem Menschen einen wesentlichen evolutionären Vorteil. Schon damals muss eine Bevölkerungsexplosion in kleinem Umfang stattgefunden haben, doch findet man davon keine Spuren. Der Überlebenskampf blieb hart. Der Mensch hat keine Zähne wie der Löwe, und er rennt nicht so schnell wie die Gazelle. Er musste sich etwas einfallen lassen: Er begann, aus Steinen und Knochen einfache Werkzeuge und Waffen herzustellen.
Es galt nicht nur, nicht gefressen zu werden, sondern auch zu essen. Der Tisch in der ostafrikanischen Steppe war nicht besonders reich gedeckt. Die Menschen ernährten sich von Kräutern, Beeren, Nüssen und Kleingetier. Gelegentlich gelang es, ein Wild zu erlegen. Der Familienclan hielt zusammen. Wenn sich die Jagdgründe mit denen eines anderen Clans überlappten, gab es Krieg.
Doch irgendwann scheint etwas Bemerkenswertes geschehen zu sein, wie Matt Ridley in seinem Buch The Rational Optimist8 beschreibt: Wenn zwei Gruppen feststellten, dass sie unterschiedliche Fertigkeiten hatten, wenn zum Beispiel die eine hervorragende Steinbeile hatte und die andere besonders feine Pfeilspitzen, dann könnten sie auf die Idee gekommen sein, diese Fertigkeiten zu kombinieren: Die eine Gruppe machte Steinbeile, die andere Pfeilspitzen, und zwar jeweils für beide Gruppen. Ridley nennt das die Erfindung der Arbeitsteilung.
Ich nenne es die Erfindung des Friedens.
Ja, es war nur der Friede zwischen zwei Gruppen, der Krieg gegen die anderen ging weiter. Die Idee der Arbeitsteilung war erfolgreich, und sie breitete sich aus. Es ist leicht, die Auswirkungen der Arbeitsteilung zu unterschätzen. In unserem Beispiel hat die Zusammenarbeit zur Folge, dass es jetzt doppelt so viele Leute gab, die über doppelt so viele Spitzenprodukte verfügten. Das sichert Überlegenheit! Vielleicht ist es das, was uns zu Menschen macht: die Zusammenarbeit über die Familienbande hinweg. Das ist ein Phänomen, das sonst im Tierreich unbekannt ist. Das war disruptiv, aber nicht disruptiv genug, um die Zahl der Menschen entscheidend zu vergrössern. Wie die Beherrschung des Feuers half die Arbeitsteilung, das Aussterben zu verhindern. Es waren immer wieder Erfindungen – neue soziale Strukturen, die Überwindung von Althergebrachtem –, die unseren Vorfahren neuen Schub verliehen und ihnen trotz körperlicher Mängel das Überleben ermöglichten.
Viele Menschenarten sind ja tatsächlich ausgestorben, wie der erwähnte Peking- und Heidelbergmensch zeigen. Unsere Vorfahren haben es mit Glück und Verstand geschafft, zu überleben. Sie schufen immer raffiniertere Waffen und Werkzeuge, und wenn die klimatischen Verhältnisse günstig waren, vermehrten sie sich sogar. Es kam so weit, dass sie sich neue Lebensräume schaffen mussten. Nach und nach wanderte ein Teil von ihnen aus Afrika aus und besiedelte den eurasischen Kontinent. Bereits der Homo erectus hatte das versucht. Aber er hat es nicht endgültig geschafft. Er ist ausgestorben. Warum? Wir können nur Vermutungen anstellen.
Vor etwa einer Million Jahren hatte sich das Klima der Erde grundlegend geändert. Die Meerenge zwischen Nord- und Südamerika hatte sich geschlossen und den Wasseraustausch zwischen dem Pazifik und dem Atlantik unterbrochen. Auf der Nordhalbkugel der Erde bildete sich eine Serie von Eiszeiten, zunächst alle 40000 Jahre, dann im Abstand von 100000 Jahren. Die grossen Eiszeiten der letzten 500000 Jahre verliefen immer nach dem gleichen Muster: Auf eine allmähliche Abkühlung über 80000 bis 90000 Jahre folgte eine abrupte Erwärmung, die bis zum Einsetzen der nächsten Abkühlung gut 10000 Jahre lang ein angenehmes Klima bescherte.9
Es ist anzunehmen, dass die Auswanderungen aus Afrika jeweils während dieser Zwischeneiszeiten stattfanden. Die Neuankömmlinge fanden eine lebenswerte Umgebung vor. Allerdings gab es eine Erfahrung, die für sie neu war: Es wurde regelmässig Winter! Natürlich war das nicht ein plötzlicher Schock, schliesslich dauerte die Auswanderung viele, viele Generationen – man hatte also Zeit, sich anzupassen, zu lernen, vorauszudenken und zu planen.
Die erfolgreichsten Menschen waren die, die wir heute die Neandertaler nennen. Sie besiedelten Europa und grosse Teile Asiens. 150000 Jahre lang waren sie auf dem eurasischen Kontinent wahrscheinlich die einzigen Hominiden. Neue Forschungen setzen da allerdings zwei Fragezeichen: Auf der indonesischen Insel Flores fand man vor einigen Jahren Überreste von Menschen, vom Homo floresiensis, die sehr altertümlich wirkten, die aber erst vor einigen Tausend Jahren ausgestorben sind.10 Die Floresmenschen waren auffallend kleinwüchsig, und deshalb hat man ihnen den Übernamen «Hobbits» gegeben. Ausserdem fand man in Ostsibirien Knochen einer Menschenart, die nicht genau den Neandertalern entspricht. Man klassifizierte sie als eigenständige Art, als Homo denisovensis.11
Wie auch immer, inzwischen tat sich in Afrika Entscheidendes: Aus einer der vielen Arten des Homo erectus entwickelte sich eine Art, die auf Veränderungen der Umwelt besonders flexibel reagieren konnte: der Homo sapiens – der «wissende» Mensch, unser direkter Vorfahr.
Ungefähr um die letzte Zwischeneiszeit oder kurz danach machte er sich nach Eurasien auf. Man darf sich das nicht als Völkerwanderung vorstellen. Das war eine allmähliche Ausweitung des Siedlungsgebiets über viele Generationen hinweg. Viele Homines sapientes blieben ja in Afrika!
Die letzte Eiszeit war aussergewöhnlich «wild». Scharfe Kältephasen wechselten innerhalb weniger Tausend Jahre mit relativ milden Perioden ab. Das setzte die Neuankömmlinge harten Überlebenstests aus.12
Das Kommen und Gehen der Warmzeiten stellte an das Leben am Rand des Eises besondere Anforderungen. Es entwickelten sich extreme Spezialisierungen: Riesenwuchs wie beim Mammut, Fresswerkzeuge wie die überdimensionierten Reisszähne des Säbelzahntigers und andere.
Jedes Mal, wenn das Klima wieder kippte, hatten die Spezialisten das Nachsehen. Die Umweltbedingungen änderten sich schneller, als die Evolution für Anpassung sorgen konnte.
Die Menschen hatten ein überdimensionales Grosshirn entwickelt. Damit gelang es ihnen, dem Wechselbad der Klimaschwankungen ein Schnippchen zu schlagen. Sie gingen gestärkt daraus hervor.
Es war allerdings knapp! Die Genetiker glauben nämlich, Hinweise zu haben, die auf mindestens ein Ereignis hindeuten, bei dem die Menschen fast ausgestorben wären. Es gab damals – wir wissen nicht genau, wann und wo – nur noch wenige Hundert Exemplare des Homo sapiens. Die Genetiker nennen das einen genetischen Flaschenhals.13
Die Neandertaler, 150000 Jahre lang die Herrscher Eurasiens, verschwanden vor etwa 35000 Jahren. Warum? Wir wissen es nicht. Der Homo sapiens übernahm. Allerdings gab es, wie neueste Forschungen belegen, eine Zeit der «Kohabitation». Homo sapiens und Neandertaler müssen sich begegnet sein, und sie kamen sich auch nah: Der Paläogenetiker Svante Pääbo hat nachgewiesen, dass wir Europäer etwa 2 bis 3 Prozent an Genen des Neandertalers in uns tragen.14 Das beweist auch, dass wir zur gleichen Art gehören, sonst hätte es keine gemeinsamen Nachkommen geben können.
Eine kleine Frühgeschichte
Allein auf weiter Flur besiedelte der Homo sapiens den ganzen eurasischen Kontinent, soweit er nicht von Eis bedeckt war. Im Gegensatz zu seiner afrikanischen Heimat, wo er wohl ein nomadisches Leben geführt hatte, finden wir ihn vor allem in Europa und im Nahen Osten halb sesshaft. Daher die populäre Bezeichnung «Höhlenmensch». Seine Werkzeuge wurden vielfältiger und raffinierter. Wir finden erste Scherben von Tontöpfen und Überreste von groben Geweben.
Die Menschen wurden so erfolgreich, dass sie sich manchmal einen kleinen Luxus leisten konnten: Sie erfanden die Kunst. In einigen Höhlen Südfrankreichs, Spaniens und anderenorts hinterliessen sie uns Wandzeichnungen von erstaunlicher Eindringlichkeit und Symbolik. Die Zeichnungen mögen eine magische Bedeutung gehabt haben und – in der Meinung der Künstler – durch die Verbesserung des Jagdglücks zum Nahrungserwerb beigetragen haben, aber uns Heutigen erscheint dieser Aufwand als Luxus mit hohen Opportunitätskosten, also mit Kosten verpasster Gelegenheiten, etwas Nützliches zu tun. Offenbar waren sie tragbar.
Das Ende der Eiszeit vor etwa 18000 Jahren hatte dramatische Klimaänderungen zur Folge, nicht nur dort, wo die kontinentalen Eispanzer nach und nach verschwanden, sondern auch in Nordafrika sowie im Nahen und Fernen Osten. Während der Eiszeit lag der Meeresspiegel bis zu 120 Meter tiefer als heute. Archipele wurden zu zusammenhängenden Landbrücken, Meerengen verschwanden. Von Sibirien aus erreichte man Alaska zu Fuss, und der indonesische Archipel wurde gewissermassen ein Anhängsel von Australien, denn die Timorsee war praktisch trockengelegt. Die Menschen, immer erpicht auf neue Erfahrungen, wanderten in Australien ein, möglicherweise vor mehr als 65000 Jahren.15 Erst viel später, nach dem Ende der Eiszeit vor 15000 Jahren, schafften sie es über die Beringstrasse nach Amerika.16
Während der letzten Eiszeit, als grosse Teile Nordamerikas und Europas von riesigen, kilometerdicken Eispanzern bedeckt waren, regnete es in der Sahara. Der ganze heutige Wüstengürtel der Subtropen hatte ein Klima, das eine reiche Vegetation ermöglichte.17 Es herrschten ideale Verhältnisse für die jagenden und sammelnden Menschen. Vor 18000 Jahren begann sich dies zu ändern. Der Regen fiel seltener, Dürreperioden wurden häufiger, der Druck auf die Menschenpopulation nahm zu. Wieder mussten sie sich etwas einfallen lassen, wenn sie überleben wollten.
Statt den seltener werdenden wilden Ziegen und Schafen nachzuhetzen, kamen sie auf die Idee, sie zu hegen, vor den immer hungrigen Löwen zu schützen und zu züchten. Dafür mussten sie Teile der Savanne schützen, um die gefangenen Tiere zu füttern. Dazu mussten sie bleiben, wo sie waren. Kurz gesagt: Aus Jägern und Sammlern wurden vor ungefähr 12000 Jahren Ackerbauern und Viehzüchter.18
Wir sprechen heute von der jungsteinzeitlichen Revolution. Grüne Fundamentalisten sprechen von der grössten ökologischen Katastrophe, die es bislang gab. Warum? Weil sich die Menschheit von da an explosionsartig vermehrte – jedenfalls für einige Zeit. Aber nicht nur deswegen: Zum ersten Mal lebten die Menschen nicht mehr als Teil der Natur von der Natur und mit der Natur – zum ersten Mal schufen sie sich ihr eigenes Stück Natur: einen Acker und eine Schafherde zum Beispiel. In den Augen der Ökofundamentalisten war das die Vertreibung aus dem Paradies.
Nach der Beherrschung des Feuers, der Erfindung von Werkzeugen und der Erfindung der Arbeitsteilung gelang den Menschen mit der Landwirtschaft ein weiterer lebensrettender, ja diesmal sogar lebensvermehrender Durchbruch.19 Er gelang natürlich nicht auf einen Schlag und auch nicht überall, wo Menschen lebten. Forscher nehmen heute an, dass es vor 12000 Jahren an drei Orten unabhängig voneinander passierte: im nördlichen Mesopotamien, im Tal des Jangtsekiangs und wohl 2000 oder 3000 Jahre später an der Westküste Südamerikas.
Uns Europäer interessiert natürlich der nahöstliche Brennpunkt ganz besonders. Die Idee, Viehzucht und Landwirtschaft zu betreiben, war so erfolgreich, dass sie sich schnell verbreitete. Es ist bis heute umstritten, wie das geschah. Besetzten die Nachkommen von Landwirten neue Gebiete, um sie zu nutzen, oder lernten jagende Nachbarn der Landwirte die neue Technik?
Wie auch immer, die Landwirtschaft erreichte Nordafrika und Europa, und vor etwa 6000 Jahren wurden die Europäer zu sesshaften Landwirten und Viehzüchtern. Das war die Zeit, als einige Menschen am Alpennordrand in Dörfern an Seeufern wohnten. Wir nennen sie die Pfahlbauer.
Man muss sich vor Augen halten, welch drastische Änderung im Leben der Menschen das bedeutete. Zehntausende Jahre lang waren sie dem Wild nachgezogen, hatten verzweifelt nach Essbarem gesucht, hatten versucht, sich vor Raubtieren in Sicherheit zu bringen, den Winter einigermassen gut vorbereitet zu überstehen – nur um doch in vielen Fällen zu verhungern, gefressen zu werden oder zu erfrieren. Jetzt lebten sie, mit Zäunen vor Raubtieren geschützt, mit ihren Herden zusammen – einem stattlichen Nahrungsvorrat – inmitten ihrer Pflanzungen unter einem schützenden Dach. Ich schildere das so bildlich, um zu zeigen, welch unvorhersehbare Auswirkungen eine einfache Idee, eine konsequente Abkehr vom Herkömmlichen haben kann – eine disruptive Innovation.
Die Versuchung ist gross, hier eine Weile zu verharren und uns mit der Jungsteinzeit näher zu befassen. Aber das ist nicht das Thema dieses Buchs. Immerhin lohnt es sich, kurz daran zu erinnern, welchen Schub an Innovationen die neue Leichtigkeit des Seins ausgelöst hat: Die Werkzeuge aus Stein, Horn und Knochen wurden raffinierter und präziser. Das Töpfern und das Weben erreichten neue Höhen der Qualität und der Originalität. Bald wurde aus der Steinzeit die Kupfer- und dann die Bronzezeit. Die Menschen erfanden das Giessen von Metallen. Jetzt explodierte die Kreativität: Waffen, Schmuck, Werkzeuge, Jagdgeräte und Gefässe entstanden in nie gekannter Vielfalt. Das Leben der Menschen in der Bronzezeit war vom Leben des jagenden und sammelnden Altsteinzeitmenschen vollständig verschieden. Es hatte eine Entwicklung begonnen. Diese sollte zu Änderungen führen, die man sich damals gar nicht vorstellen konnte, zu unvorstellbaren Gefahren und zu unvorstellbaren Chancen. Mit beidem wollen wir uns im Folgenden befassen. Doch zuerst folgen wir dem spannenden Weg dahin, zu den Chancen und zu den Gefahren.
Lernen und Lehren
Die Beherrschung des Feuers, der Werkzeuge und der Waffen, die Arbeitsteilung und die Zusammenarbeit – immer wieder gab es Neues. Ideen setzten sich durch. Sie waren erfolgreich und blieben es. Sie wurden, wie wir heute sagen, tradiert.
Tradieren bedeutet, etwas an die nächste Generation weiterzugeben. Das kann geschehen, indem die Eltern den Jungen eine Technik, eine Fertigkeit zeigen und sie zum Nachmachen animieren. Das kann man im Tierreich oft beobachten. Die Erdmännchen in Südafrika zum Beispiel zeigen ihren Kindern geduldig und ausdauernd, wie man einen giftigen Skorpion gefahrlos verspeist. Sie präparieren zunächst tote Skorpione ohne Giftstachel, dann gibt es lebende ohne Giftstachel. In der «dritten Klasse» lernen sie am toten Exemplar, was ein Giftstachel ist, und schliesslich kommt die «hohe Schule»: das Geniessen lebendiger Skorpione samt Giftstachel.20
Um komplexe Konzepte wie die Zusammenarbeit zu tradieren, braucht es aber mehr. Es bedarf der Weitergabe abstrakter Begriffe. Es braucht die Sprache.
Auch Sprache beobachten wir im Tierreich. Ein Leben im sozialen Verbund ist ohne Kommunikation nicht möglich. Sprache ist ein Mittel dazu. Der südamerikanische Titiaffe warnt seine Artgenossen differenziert vor Gefahren und kann sowohl die Art als auch den Ort einer Bedrohung mitteilen. Der Alarmruf tönt anders – je nachdem, ob er einer Raubkatze auf einem Baum oder einer Schlange am Boden gilt.21 Wenn ich im Frühling dem Amselmann zuhöre, wie er seine Rivalen warnt, möchte ich wissen, was all die verschiedenen Melodien und Modulationen bedeuten. Ich möchte «Amselisch» verstehen. Es ist eine sehr vielfältige Sprache.
Soweit wir wissen, kann kein Tier abstrakte Inhalte vermitteln. Es ist letztlich diese Fähigkeit, die uns von allen anderen Lebewesen unterscheidet. Meinungen austauschen, über Erfahrungen berichten, eine neue Idee teilen, einen Witz erzählen – das können, soweit wir wissen, nur wir Menschen. Wir können Informationen an die nächste Generation weitergeben, die nicht genetisch codiert ist. Das ist revolutionär neu. Lebenserfahrung stirbt nicht mehr mit dem Erfahrenen. Die Nachkommen können dort weiterfahren mit Erfahrungensammeln, wo ihr Vorfahre aufgehört hat. Sie müssen nicht von vorn beginnen.
Ursprünglich steckten die Fähigkeiten nur in den Genen: Spinnen können Netze spinnen, Hamster Vorräte anlegen, Vögel können fliegen, Mäuse graben, Otter schwimmen, weil sie so geboren werden.
Alles, was andere Tiere nur können, weil sie so zur Welt kommen, können Menschen erfinden und erlernen und an die Nachkommen weitergeben. Der Schatz an Wissen und Können vermehrt sich mit jeder Generation. Gibt es Grenzen des Wachstums für das Wissen?
Als die ersten Menschen zu lernen und zu lehren gelernt hatten, lebten sie wie alle Hominiden in Grossfamilien. Sie assen, was sie jagen und sammeln konnten. Erfahrung ist dabei ein Erfolgsrezept. Die Jungen lernten von den Alten. Diejenigen Familien waren die erfolgreichsten, bei welchen die Alten am längsten am Leben blieben, um ihre Erfahrungen weiterzugeben. Darum leben Grossmütter lange über ihre Reproduktionsfähigkeit hinaus. Erstmals war es von Vorteil, wenn die Alten alt werden.
Die Fähigkeit, Wissen und Können zu akkumulieren, machte die Menschen allen Konkurrenten überlegen. Dieses im Lauf von Generationen angesammelte Wissen und Können bezeichnet man als Kultur. Genau genommen gilt heute der Teil des Wissens und Könnens als Kultur im weiteren Sinn, der nicht zum Überleben benötigt wird, aber für unsere Diskussion ist das unerheblich.
Kultur führte nämlich zu einem völlig neuen Phänomen: Nach der biologischen Evolution entstand eine kulturelle Evolution.22
Die kulturelle Evolution ist ein völlig neues Phänomen. Genau wie die biologische Evolution setzt sie drei Dinge voraus: Sind es bei der biologischen Evolution Mutation, Fortpflanzung und Selektion, so sind es bei der kulturellen Variante Innovation, Publikation und Bewährung. Das Faszinierende und Beängstigende an der kulturellen Evolution ist ihre Geschwindigkeit: Sie beschleunigt die Entwicklung um das Millionenfache! Ist das unvorstellbar? Ist es unglaublich? Einige Beispiele belegen es:
– Sehen: Die biologische Evolution benötigte einige Hundert Millionen Jahre, um aus der ersten lichtempfindlichen Zelle eines Wurms das vollständige Auge eines Reptils zu entwickeln. Dagegen schaffte es die kulturelle Evolution in gerade einmal 400 Jahren von den ersten Versuchen, ein Teleskop zu bauen, bis zum Hubble-Teleskop, das in die entferntesten Winkel des Universums schauen kann.
– Fliegen: Von dem Moment, als den ersten Reptilien an den Vorderbeinen Federn wuchsen, bis der erste Vogel flog, dauerte es über 50 Millionen Jahre. Schon 50 Jahre nach dem ersten motorisierten Hüpfer der Gebrüder Wright flogen Flugzeuge mit Überschallgeschwindigkeit.
–





























