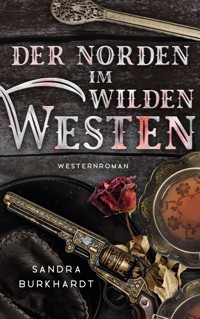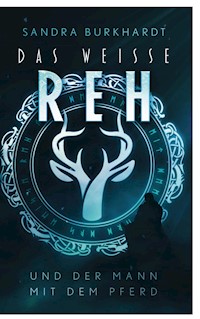
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Das weiße Reh
- Sprache: Deutsch
Versteckt im Schatten der Wälder lebt ein zartes Reh mit schneeweißem Pelz. Kaum einem hat sich die weiße Ricke je gezeigt. Doch jene erwartet die unschuldige Liebe oder der grausame Tod. Inmitten des umkämpften Königreichs Wessex zieht ein stoischer Söldner durch die Lande. Sein engster Freund, das treue Pferd stets an seiner Seite. Der Tod ist ihm längst ein vertrauter Gefährte, ebenso wie die Furcht, jemand könne entdecken, was sich unter seinen Handschuhen verbirgt. Bis er der wunderschönen weißen Ricke begegnet, welche ihn gar zu verfolgen scheint. Nach einem Überfall der Nordmänner droht sich die Legende des sagenumwobenen Tieres, unwiderruflich zu bewahrheiten. Doch was bedeutet die weiße Ricke für ihn und sein Pferd? Die unschuldige Liebe oder den grausamem Tod? Sicher ist nur, seit jeher verlangte die weiße Ricke Blut.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 434
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Nathan und Johanna
Die Geschichte ist frei erfunden, aber die Personen existierten wirklich.
Great Britain
Kingdom of the West Saxons – Wessex
913 n. Chr.
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Reading
Snelsmore
Marlborough
Devizes
New Sarum
Lynhest
New Forest
Hamwic
South Stoke
Bristemestune
Northsea
Vadheim
Haugesund
Epilog
Prolog
Der Knabe mit dem erdbraunen Haar verstand nicht, was vor sich ging. Verängstigt hielt der Junge seine jüngere Schwester fest. Seit der wütende Mob ihr Haus gestürmt hatte, versteckten sie sich zitternd unter dem Stroh im anliegenden Stall. Ihr Vater hatte gerade noch versucht, die Menge zu beruhigen, aber die Bewohner dieses Dorfes hatten ihre Meinung längst gebildet.
Die Mutter des dämonischen Knaben musste es mit dem Teufel getrieben haben, um das gezeichnete Kind zu zeugen. Schließlich war der Knabe vor zwölf Wintern ihrem Leib entsprungen. Die Hebamme hatte es selbst an den Füßen herausgezogen und war vor purem Entsetzen in die Ohnmacht gekippt. Einzig die bodenlose Fassungslosigkeit der Mutter und die Beteuerungen des Vaters sowie ein ausreichendes Schweigegeld hatten das frische Leben damals geschützt. Denn der Vater brauchte einen Nachfolger, einen Sohn für den kleinen Bauernhof und angesichts seines nicht gänzlich sündenfreien Lebens, kam diese Bestrafung Gottes nicht völlig unerwartet. Inständig beteten sie zum Herren, dass dieses Mal nur eine Warnung war und keinerlei Einfluss auf das Leben des Jungen oder der Familie hatte.
Doch nun, seit Einbruch des viel zu frühen Winters, plagte eine Krankheitswelle das kleine Dorf an der Küste. Als auch die letzten Geburten ausschließlich leblose, schwächliche Kinder hervorgebracht hatten, konnte es nur eine Strafe Gottes sein, dessen waren sich die ältesten Bewohner einig. Schnell fiel der Verdacht auf den gezeichneten Jungen und seine teuflische Mutter. In zorngeschürten Drohgebärden hatten die Dorfbewohner, die um Unschuld flehende Frau hinausgerissen. Die verzweifelten Einwohner warfen ihr jede sündige Schandtat vor, ohne die Möglichkeit auf Erklärung. An den Haaren zerrten sie das weinende Hexenweib hinaus, um gleich darauf auch den gezeichneten Jungen zu suchen. Aber die Mutter hatte den Tumult früh genug bemerkt und ihren Kindern befohlen, sich im benutzten Stroh des Stalles zu verstecken. Der Junge nahm seine Schwester bei der Hand, hob sie durch das Fenster zum Stall, um dann selbst hinterher zu klettern. Geängstigt von dem furchtverzogenen Ausdruck im Gesicht seiner Mutter, zog er sie in das feuchte Stroh und bedeckte sie mit dem Mist. Auch er verscharrte sich unter den Pferdeäpfeln, direkt neben den mächtigen Hufen des noch angeschirrten Ackergauls seines Vaters. Im Dreck des Tieres verharrten sie zitternd und hörten die flehenden Schreie ihrer Mutter. Dazwischen vernahm er die Stimme seines um Gnade bettelnden Vaters. Brüllend aus Verzweiflung versuchte der Gatte, sein Eheweib vor den zornigen Dorfbewohnern zu verteidigen. Doch es nützte nichts.
Der Knabe streckte die Hand nach seiner kleinen Schwester aus, die sie dankbar aber weinend annahm. Als die qualvollen Rufe seiner Eltern aus dem Haus heraus auf die Straße verhallten, kamen die Hexenjäger plötzlich in die verwitterte Stallung gelaufen. Sie jagten die zwei quiekenden Schweine auf, rissen die flatternden Hennen aus ihren Nestern und traten das Holzbrett zur Bucht des jungen Ackergauls auf. Der Knabe drückte seiner wimmernden Schwester die Hand auf den Mund, innerlich flehend, dass das Pferd beide nicht zu Tode trampelte. Aber das große Tier blieb erstaunlich ruhig. Nur die Ohren zuckten aufgeregt zu den brüllenden Menschen. Es wirkte, als würde es die Kinder hinter seinem massigen Körper verbergen wollen. Die Männer drängten in die enge Bucht hinein, um das Heu und Stroh zu durchsuchen, aber der breite Hintern des Pferdes verhinderte ihr Durchkommen. Sie schlugen auf das Tier ein, damit es zur Seite ging, doch der sture Gaul bewegte sich nicht, sondern legte die Ohren an und drohte mit seiner mächtigen Hinterhand. Fluchend gaben sie die Suche auf und schwuren zugleich, dass sie die Kinder fanden, damit auch die Teufelsbrut im Höllenfeuer verbrennen würde. Harsche Flüche ausstoßend verließen sie die durchwühlten Stallungen, um der Vernichtung der Hexe beizuwohnen. Gleich darauf hallte ein entsetzlicher Schrei durch die Straßen.
Der Knabe riss seine steingrauen Augen auf. Er wusste, dass diese Schreie nur den Tod seiner Mutter bedeuten konnten. Dann herrschte ein Moment verheißungsvolle Stille, gefolgt von tosendem Jubel über die geköpfte Hexe. Die Leute schrien, dass man den Körper der Teufelshure verbrennen müsse. Gelähmt vor Angst und Entsetzen hielten beide Kinder sich im Schatten des Ackergauls aneinander fest. Nie zuvor hatte der Junge solche Furcht verspürt. Dann hörte er die festen Schritte seines Vaters in den Stallungen. In der Hoffnung auf Trost und Sicherheit sprangen die Kinder auf, aber statt Erleichterung, seine Kinder wohlauf vorzufinden, stand nur Abscheu in den nassen Augen des Mannes, der eben den Kopf seiner Frau über die Straße hatte rollen sehen. Sofort wichen die Geschwister zurück. Der Junge verbarg seine Schwester hinter seinem schmächtigen Körper. Doch der Vater packte ihn bereits gewaltsam am dünnen Arm. Mit aller Kraft schlug er seinem Sohn ins Gesicht. Nicht wie sonst, mit der flachen Hand, sondern gar mit der Faust prügelte er auf das schreiende Kind ein. Die Schwester flehte den Vater um Nachsicht an, doch auch sie stieß er gewaltsam zurück in die Bucht, des nun doch unruhig werdenden Ackergauls. Er beschimpfte den Knaben als Teufelsbrut, als Satansbraten, gar als den Teufel selbst, während er unaufhörlich auf den zusammengekrümmten Jungen einschlug.
Das gottlose Kind hatte den Tod der Mutter sowie die Entehrung des bereits angeschlagenen Familiennamens heraufbeschworen. Nur dieser gezeichnete Knabe war an dem Unheil schuld, dabei hatte er ihn trotz der Zeichnung durch den Teufel als seinen eigenen Sohn großgezogenen. Sogar den Hof wollte er dieser Höllenfrucht vererben. Aber jetzt wünschte er nur noch, dass es ihn niemals gegeben hätte. Diese Ausgeburt der Unterwelt sollte samt seiner Schwester verschwinden und auf ewig in Vergessenheit geraten. Doch plötzlich trat der nervösgewordene Junggaul mit der Hinterhand gegen den prügelnden Vater. Beide Hinterhufe schleuderten den wutberauschten Mann durch die Stallung in die aufgeregten Schweine hinein. Geistesgegenwärtig sprang der verwundete Junge auf und hinauf auf das nervös trampelnde Tier. Mit der blutenden Hand riss er seine Schwester ebenfalls zu sich hoch. Sie krallte sich an ihm fest, während er die langen Fahrleinen nahm und das Pferd daran herumriss. Voller Schmerzen, doch mit der Angst vor dem Vater, der seinen Sohn jetzt unter allen Umständen totprügeln wollte, gab er dem Ackergaul die Fersen. Sofort sprang es hinaus und überrannte den Vater. Mit aufgerissenen Augen galoppierte es mit den beiden Kindern quer über das gepflegte Kohlfeld. Der Schneeschlamm spritzte hinauf bis zu den Gesichtern der Geschwister. Immer weiter trieb der Knabe das verschreckte Tier an. Mit aufgeblähten Nüstern galoppierte es zwischen den Dorfhütten den Hügel hoch. Der Schneeregen prasselte dem geprügelten Jungen wie tausend Nadeln in sein aufgeschlagenes Gesicht. Noch nie hatte der Knabe wahrhaftig geritten, aber es war, als hätte er nie etwas anderes in seinem Leben getan. Seine Schwester krallte sich so sehr an ihm fest, dass es ihm auf den gebrochenen Knochen die Luft nahm. Nie hatte er einen Ackergaul so schnell laufen gesehen, dass es einem der feinen englischen Herrenpferde gleichen könnte. Es hatte sogar seinen Schweif in die Höhe gereckt, als würde es demonstrieren, dass es einem solch edlen Ross entsprach.
Bevor der wütende Mob sich auf seine eigenen Pferde schwingen konnte, damit sie die Verfolgung der Teufelsbrut aufnehmen konnten, waren die Kinder mit dem geschirrten Gaul im Wald verschwunden. Immer weiter hetzte der Junge den Junghengst durch den halbverschneiten Forst. Es sprang trotz des schweren Kummets über die gestürzten Bäume. Unaufhörlich flüchteten die Kinder mit ihrem vierhufigen Retter. Erst als das Tier der Erschöpfung nahe war, ließ der Junge es in den Trab übergehen. Die ganze Nacht hindurch trug der Ackergaul die Geschwister auf dem breiten Rücken durch den dichten Wald. Auf unbekannten Wegen, doch als kannte es einen sicheren Pfad, brachte es die Halbwaisen in Sicherheit. Noch nie waren die beiden Kinder so weit von ihrem Dorf entfernt gewesen. Im Inneren wusste der Junge, dass er seine Heimat niemals mehr wiedersehen würde. Irgendwann brachte das Tier die Geschwister auf eine Lichtung. Erschöpft blieb es stehen, steckte seine Nase in den Schnee und fraß die wenigen Grashalme, die es aus dem matschigen Weiß befreien konnte. Zitternd vor Kälte rutschten die beiden Kinder von dem breiten Rücken. Die Schwester erschrak, als sie das aufgeschwollene Gesicht ihres Bruders sah. Fürsorglich nahm sie den kühlen Schnee in ihre steifen Finger, um ihm über die blauen Schwellungen das Blut von seiner Stirn und den Wangen zu wischen. Er ließ sie gewähren, obwohl die Berührungen schmerzten. Besorgt betrachtete er seine kleine Schwester. Ihr geflochtener Zopf war zerzaust, sodass einige der hellbraunen Strähnen in ihr verdrecktes Gesicht fielen. Der schöne Wollmantel war von Schlamm überzogen und ihre ledernen Stiefelchen kaum noch zuerkennen. Auch seine Kleidung war von der Flucht und den Schlägen seines Vaters gezeichnet. Beide konnten froh sein, dass sie ihre wollene Winterkleidung trugen, dennoch kroch ihnen die Kälte in die Glieder. Der Knabe sah, dass ihr Ackergaul von der kräftezehrenden Flucht schwitzte. Sein fuchsfarbenes Fell war dunkler und die dunkelblonde Mähne klebte an seinem mächtigen Hals. Das Tier durfte keinesfalls erkranken, war es doch alles, was den Geschwistern blieb. Der Junge zog seinen Umhang aus Schafwolle aus und rieb sie über den schwitzenden Gaul. Er befahl seiner Schwester, den jungen Hengst mit beiden Händen trockenzureiben. Das würde auch sie wärmen.
Es war im Dorf bekannt gewesen, dass der Knabe ein Händchen für Tiere insbesondere für Pferde hatte. Der Beweis war dieses Tier selbst. Sein Vater hatte diesen Ackergaul vor einem Jahr für einen schmalen Taler erwerben können, weil der Junge sah, dass dieses Fohlen an einer leichten Lahmheit in der rechten Vorhand litt. Obwohl der Knabe wusste, dass diese Unreinheit im Gang einer unbedeutenden Fehlstellung der Schulter des Fohlens entsprang, erklärte er dem Pferdehändler diese Feststellung als Schlachturteil. Noch dazu verriet das Räubermaß, dass dieser Hengst kläglich klein für einen Suffolk Punch werden würde. Damit hatte der gerissene Knabe auch den letzten Käufern das Interesse genommen, sodass dem Händler nichts anderes übrig blieb, als das Fohlen an den Vater zu verkaufen.
Die Kinder beschlossen, das Zuggeschirr im nächsten Dorf gegen Proviant und wärmende Kleidung einzutauschen. Nur das Kopfstück würden sie behalten. Im Morgengrauen setzten sie ihren Ritt fort, nun deutlich ruhiger, doch in einem gleichmäßigen Trab. Seine Schwester konnte die kurzen, aber gewichtigen Schritte nicht anständig sitzen, sodass der Junge sie vor sich nahm, damit sie sich am Kummet festhalten konnte und er sie mit seinen Armen vor einem Sturz schützte. Sie entschieden Richtung Norden zu reiten. Gegen Mittag erreichten die Geschwister eine kleine Stadt am Meer. Wie geplant, verkauften sie das Geschirr bei einem Sattler und besorgten sich ein Laib Brot bei einem Bäcker, der die verdreckten Kinder nach dem Verkauf direkt aus der Backstube jagte. Danach erbaten sie ein Messer bei dem Schmied, der über den geprügelten Knaben spottete, aber ihm gab, was er verlangte. Schlussendlich kauften sie eine Decke bei einer dicken Weberin, die wohl ein wenig Mitleid mit den gebeutelten Kindern hatte. Stets hielt der Junger seine rechte Hand hinter seinem Rücken verborgen. Vermutlich hielt sie es für eine Lähmung oder einen Bruch. Mit dem ersten Lächeln seit dem grausamen Vorfall in ihrem Dorf erhielten sie eine Decke für einen schmalen Taler als auch zwei Paar Handschuh. Sie wünschte den Kindern eine sichere Reise und das Gott den Geschwistern beistand.
Nie waren die Geschwister zu tiefem Glauben erzogen worden, obwohl sie stets vor dem Mahl beteten, dem Herrn zu den Feiertagen dankten und sonntags in der Kirche dem Gemeindepfarrer lauschten. Doch seit dem qualvollen Tod der Mutter hatte der Knabe den Glauben an die Güte des Herren endgültig verloren. Sein feuerrotes Teufelsmal auf der rechten Hand und dem Unterarm war der Beweis, dass seine Seele längst dem Teufel gehörte. Nur mit dem Glauben an ihren treuen Ackergaul ritten die beiden Kinder im kräftigwerdenden Winter weiter gen Norden.
Doch nach einigen Nächten im Schnee hustete seine Schwester so fürchterlich, dass Blut und grüner Schleim aus ihrem Mund kam. In jedem Dorf, jeder Stadt, gar an jeder alleinstehenden Hütte flehte der Knabe um Hilfe. Aber niemand half seiner kranken Schwester. An einem grauen Tag, inmitten des fallenden Schnees brach das sieben Winter alte Mädchen in seinen Armen zusammen. Schlimmer als je zuvor hustete sie mehr Blut als grünen Schleim. Aus ihren bläulich verfärbten Lippen roch er bereits den Tod und er wusste, dass es mit ihr zu Ende ging. Der treue Ackergaul hatte sich hinter das sterbende Mädchen gelegt, sodass sie an seinem warmen Bauch in den ewigen Schlaf entgleiten konnte. Der Junge weinte bitterlich um seine sterbende Schwester, war sie doch alles, was ihm noch neben dem treuen Tier von seiner Familie blieb. Dabei hatten die Kinder sich ihre Zukunft erträumt. Sie wollten ein Stückchen Land kaufen, um einen Hof zu errichten. Er hatte ihr versprochen, dass er sie nur an einen edlen Ritter oder gar Prinzen zur Hochzeit geben würde und ihr treuer Ackergaul bekäme einen Stall, der gerade für ein feines Ross gutgenug wäre. Aber der Knabe wusste, dass nun nicht der Prinz die Hand seiner Schwester annehmen würde, sondern sie in das Reich des Herren selbst übergehen würde. Das erste Mal seit dem Tag ihrer Verbannung betete der Junge zum heiligen Vater. Er sollte seine geliebte Schwester in den Himmel aufnehmen, da sie stets nach den Geboten des Glaubens handelte, auch wenn sie die Tochter einer Hexe war. Das Mal zeichnete nur ihn und nicht sie. Er würde ihre Sünden auf sich nehmen und im Fegefeuer brennen, solange sie das Paradies erleben dürfte. Die Schwester öffnete noch einmal die Augen und sah ihn lächelnd an. Sie zwang ihn, zu versprechen, dass er sich ein hübsches Mädchen zur Frau nehmen würde und sie stets so gütig behandelte, wie er sie, sobald er das heiratsfähige Alter erreicht haben sollte. Der Knabe versprach es seiner Schwester an dem schneeweißen Sterbebett im dichten Fell ihres Ackergauls. Weinend betete er, bis sie den letzten Atemzug tat.
Als keine Träne mehr übrig war, erhob sich das kräftige Tier und stieß ihn sanft mit den weichen Nüstern an. Der tieftraurige Junge hielt sich in der dunkelblonden, vereisten Mähne fest und ließ sich aufziehen. Kraftlos stieg er auf den breiten Rücken und ritt hinfort, ohne sich noch einmal umzudrehen.
1 Reading
«Die Dänen!», schrie jemand.
«Dänen! Dänen!» Weitere Warnungen erhellten die verräterische nächtliche Ruhe.
Gleich darauf dröhnte das donnernde Horn dieser gottlosen Heiden durch den Wald. Sogleich sprang ich von dem Strohbett auf und griff nach meinem Schwert. Betrunken vom Schlaf hasteten auch die anderen Männer von ihren Pritschen. Mit der Hand am Griff meines Spathas eilte ich in die Nacht.
«Auf die Pferde!», befahl die raue Stimme des Grafen Athelstan von Radingas seinen Soldaten. «Stellung einnehmen! Das Lumpenpack voran!», rief er brüllend wie ein aufgeschreckter Keiler.
Der Knappe, noch im Nachthemd gekleidet, brachte ihm sein prächtiges Ross. An den Zügeln zerrte er den riesigen, weißgrauen Hengst vor seinen Herren, sodass dieser sich mit Schwung in den edlen Sattel schmiss. Eilends rannte der Junge weiter, um dem nächsten Edelmann sein Schlachtross zu bringen.
«Bewegt eure faulen Ärsche! Verteidigt die Stellung! Auf, ruchloses Lumpenpack!», keifte der Graf von Radingas und gab seinem aufsteigenden Hengst die metallenen Fersen.
Lumpenpack, damit waren die erkauften Soldaten, wie meiner eins gemeint. Zumeist zwielichtige Gestalten, die sich für einige Wochen gegen gute Bezahlung in den Dienst einer Grafschaft stellten. So nutzte auch die Grafschaft von Radingas diese Dienste, um die erobernden Dänen zurückzudrängen.
«Mach schon! Komm!» Ein Knappe hatte einen fuchsfarbenen Suffolk Punch aufgesattelt und hing verzweifelt an den Zügeln, doch das Pferd hielt sich stur an seinem Stand.
Mit geöffnetem Maul brachte es dem jammernden Blondschopf nur den wuchtigen Schädel ein Stück entgegen. Während andere Reiter schreiend vorbei hasteten, Fußsoldaten im Kampfrausch den Reitern nacheilten und so jeden Gaul, jedes Ross, gar jeden Ochsen in helle Aufregung versetzten, blieb dieses Pferd, wie festgekettet auf seinem Stand. Stracks rannte ich dem Knappen entgegen, der nun mit Schlägen das störrische Tier in Bewegung setzen wollte.
«Aus dem Weg, Pimpf!», rief ich und riss ihm die Zügel aus den kleinen Händen.
«Aber, Sir, Ihr seid ein Söldner! Die Pferde sind für die Ritterschaft.» Verschreckt sah der blonde Knabe mich an, als ich mich auf das Pferd schwang.
Es gab nicht viele erkaufte Soldaten, die sich den Prunk eines Rosses leisteten. In diesem Heer war ich gar der Einzige. Aber ich besaß ja auch kein Ross, sondern nur ein Pferd.
«Mach die Augen auf, Junge! Welchem deiner Edelleute willst du denn einen Ackergaul vorsetzen? Das Pferd ist mein Tier! Jetzt mach, dass du verschwindest!» Zornig sah ich zu ihm herunter, damit er endlich das Weite suchte, bevor die Dänen ihm seinen blonden Schopf von den Schultern schlugen.
Eine Hand an den Zügeln, in der anderen das gezogene Schwert, gab ich meinem Pferd die Fersen. Ohne starrsinniges Zögern sprang er in den Galopp. Das Bärengebrüll der Dänen schallte durch das Zeltlager. Die Schlacht hatte unlängst begonnen. Die Donnerhörner waren verstummt, als das Krachen aufeinanderschlagenden Metalls die Luft durchflutete. Kampfesschreie und Todesgebrüll hallten vom Hügel hinauf. Die Dänen wollten das Stück Land zurück, das wir die vergangenen Wochen mühsam zurückerobert hatten. Es war klar, dass Graf Athelstan von Radingas keine Elle an diese Heiden freigeben würde. Wild entschlossen, dieses Land zu verteidigen, galoppierte ich an den Fußsoldaten vorbei. Die Hufschläge aller Rösser donnerten in den Waldboden. Junge Fackelträger begleiteten den Aufmarsch zum Angriff.
«Skjoldvæg!», brüllte der Anführer der Dänen.
Mit diesen heidnischen Worten im Ohr preschte ich aus dem Wald auf den freien Hügel. Unsere aufgestellten Nachtwachen hielten den nordischen Kriegern nicht stand, sodass ihre Todesschreie die kalte Nacht durchbrachen. Äxte in den Pranken bärengroßer Männer spalteten den englischen Soldaten die Schädel. Einzelne Krieger zerschlugen die Leiber der Soldaten, dass die Eingeweide durch die neblige Nachtluft flogen. Der Großteil dieser Heiden jedoch verkroch sich hinter einer schier undurchdringlichen Mauer aus bunten Rundschildern und walzte über die schreienden Fußsoldaten hinweg.
Ich sah, wie die Ersten, der erkauften Soldaten, im Angesicht der Bedrohung nun zur Flucht, statt zum Kampf zogen. Einen Augenblick stand mir ebenfalls der Sinn zum Rückzug, doch meine Entlohnung war mir wichtiger, aber vor allem nötiger. Graf Athelstan von Radingas befahl den Ersten seiner Ritterschaft den frontalen Angriff. Klägliche Schreie der an den Sperren aufgespießten Rösser und darunter begrabenen Edelleuten schmerzten in meinem Gehör.
Einem frontalen Angriff, wie es von Radingas im Rausch des Kampfes befahl, würde ich mich und mein Pferd nicht aussetzen, doch wir mussten den unaufhaltsamen Vormarsch der Dänen stoppen. Es war schließlich unsere Pflicht als englische Soldaten. Für einen Moment überblickte ich das wilde Blutbad des Schlachtfeldes. Der Herzschlag meines Pferdes pulsierte durch meinen Leib hindurch. Meine Augen fanden einen Weg zwischen den kämpfenden Männern und brüllenden Heiden hindurch, direkt an die Mauer aus Rundschilden und Speeren. So gleich lenkte ich mein Pferd am Gerangel vorbei, an die Flanke der Front.
«In den Kampf, feiger Hurensohn!» Ein Rittersmann verstand mein Vorhaben nicht und interpretierte es fälschlicherweise in eine Flucht.
Verächtlich schnaubte ich aus. Ich hatte der Grafschaft Radingas meinen Kampfeswillen verkauft, also sollten sie ihn doch auch bekommen. Die führenden und unfehlbaren Edelleute merkten gar nicht, dass die Dänen mit ihrem nächtlichen Überraschungsangriff, genau die ungeplante und wutgesteuerte Unordnung von uns Sachsen zu ihrem Vorteil nutzten. Der hohe Graf von Radingas versuchte verzweifelt, sein Land Kraft gegen Kraft nach vorne zu verteidigen, statt es sich einfach von der Seite ohne die Spitzen der Speere zurückzuholen.
In einem Bogen ritt ich auf den Kern des Schlachtfeldes zu. Bevor die gottlosen Krieger ihre Speere in meine Richtung zielen konnten, preschte ich in nur einer Klingenlänge an der Mauer aus Rundschilden entlang. Das Holz der Speere gab krachend nach, als die Brust meines Pferdes dieses wie morsche Äste zerbrach oder es den Kriegern aus der Hand riss. Durch die Wucht meines seitlichen Angriffs öffnete sich ungewollt der Schildwall, sodass ich mein Schwert durch die gewaltigen Kehlen der schockierten Dänen ziehen konnte. Warmes Blut spritzte mir entgegen. Röchelnd brach die erste Linie Schilde zusammen. Konzentriert auf den Schwung meiner Klinge, bemerkte ich die prüfenden Blicke der Rittersleute nicht. Gerade als der letzte Speer in unbrauchbare Teile zerbrach, sah ich, wie hinter mir die gewaltigen Schlachtrösser die erneut zum Schutz gehobenen Schilde durchbrachen. Die mächtigen Nordmänner wurden von den noch massigeren Hufen der englischen Streitrösser zu Tode geschlagen. Gleich darauf stürmten die Fußsoldaten nach und stießen ihre Schwerter in die Leiber der überrollten Dänen.
«Tilbagetog!», schrie der dänische Kriegsführer.
Brüllend kämpften seine verbliebenen Männer nun nicht mehr Richtung Wessex, sondern zum rettenden Rückweg. Damit war mein Dienst getan. Den Rest würde Graf Athelstan von Radingas selbst in die Hand nehmen. Allemal, um nicht dem verschmähten Lumpenpack diesen Sieg zusprechen zu müssen. Mein Pferd wechselte an der äußersten Flanke des Schlachtfeldes in einen schnellen Trab und ich klopfte ihm lobend den blutverschmierten Hals. Der direkten Konfrontation hielt ich mich gewissenhaft fern, solang es mir möglich war. Nicht, weil ich den Kampf fürchtete. Nein. Ich hatte das aufgestachelte Hochgefühl lieben gelernt, wenn sich die Blutrinne meiner Klinge mit der tiefroten Flüssigkeit des Lebens füllte. Aber weder wollte ich mich selbst, noch mein gutes Pferd für einen erkauften Kriegswillen verletzen. Das erging den Meisten meiner Berufskameraden so.
Das Getöse der Schlacht verhallte in den Nachthimmel, als der letzte Däne das Weite suchte. Statt Todesschreie grölten nunmehr Jubelrufe aus den Kehlen meiner Landsleute. Begeistert von dem Sieg schlugen die Männer ihre Schwerter in heiterem Getose aneinander. Heldenhaft zog Graf Athelstan von Radingas sein blutbesudeltes Ross in die imposante Levade. Auch die anderen edlen Rösser zeigten sich und ihre Reiter in dieser beeindruckenden Stellung. Nur mein Pferd blieb ruhig auf der Stelle stehen und beobachtete mit mir den Siegesjubel. Ein zufriedenes Lächeln umspielte meine Lippen. Ein Sieg beflügelte auch meinen Herzschlag. Unter den vom Triumph berauschten Soldaten waren die kläglichen Laute der Verwundeten, beinahe nicht zu hören.
«Folgt mir, Ihr Siegreichen!» Mit erhobenem Schwert scharrte der Graf von Radingas seine Ritterschaft um sich.
Die Männer von hohem Stand versammelten sich um den Grafen und ritten in seinem Gefolge zurück zum Lager. Auch wir erkauften Soldaten erfreuten uns an dem erlangten Sieg. Schließlich wurden wir nun mit Ale und saftigen Braten entlohnt. Keiner der Edelleute würde sich je persönlich an unseren schäbigen Zelten am Rand des Lagers sehen lassen, um seinen Dank auszusprechen. Aber das war mir gleich, denn ein gutes Stück Fleisch, statt des täglichen Getreidebreies war mir allemal lieber als die Worte eines aufgeblasenen Königsknechts.
Mein Blick schweifte zurück auf das blutrote Schlachtfeld. Die Ersten hatten ihre verwundeten Kameraden aufgehievt und stemmten sich mit ihnen zum Rückweg. Die kaufbaren Soldaten schlossen sich oftmals zu kleinen Bündnissen zusammen, damit sie im Falle einer Verletzung auf die Hilfe eines Kameraden hoffen konnten. Meist waren es Brüder oder Freunde seit den jüngsten Kindheitstagen. Nur dann war man bereit, ein solches Vertrauen zu pflegen und sich eine solche Last aufzubürden. Mein Begleiter seit jungen Knabenjahren war dieser Ackergaul. Damit hatte ich dennoch weit mehr, als diese armen Teufel, die nun zurückgelassen im Blut der Dänen und Sachsen lagen. In gemächlichen Schritten trug mich mein Kamerad zurück in den Wald.
«Niedergewalzt hast du sie. Das soll dir mit einem großen Eimer Getreidebrei belohnt werden.» Lobend klopfte ich ihm auf den mächtigen Hals.
Zufrieden schnaubte er seine heiße Atemluft in dichten Nebelschwaden aus. Auf dem Rückweg bekundeten die triumphierenden Soldaten immer wieder ihre Siegfreude. Selbst vom Nachhall des Kampfes berauscht schlug auch ich in die entgegengestreckten Hände ein oder knallte meine Klinge an die erhobenen Schwerter. Mein Pferd trottete ungeachtet des Jubels zurück zu seinem Stand. Ich befreite ihn vom schweren Sattel, als unerwartet der blonde Knappe mit einem Eimer Wasser hineinkam.
«Sag, Junge. Warum trägst du immer noch dein Nachtkleid?» Ernst musterte ich ihn.
Er war kaum stramm genug, den Eimer Wasser zu tragen und wohl nicht einmal in dicken Wollsachen der nassen Winterkälte gewappnet.
«Es war keine Zeit, mich umzukleiden, Sir. Die Pferde...» Schüchtern erklärte er sich.
«Dann tu es jetzt, bevor die Kälte in deine Lungen kriecht!», befahl ich schroff.
«Aber euer Pferd, Sir.», sagte er mit unsicherer Stimme.
«Mein Pferd versorge ich selbst. Mach, dass du wegkommst, Pimpf.» Entschlossen, den Knaben zu vertreiben, riss ich ihm den schweren Eimer aus den zitternden Händen.
«Ja, Sir.» Eilig nickte er und rannte hinfort.
«Der Junge wird sicher einmal ein lobenswerter Ritter, wenn ihn sein Pflichteifer nicht vorher umbringt.» Lachend schüttelte ich den Kopf, während ich mein Pferd von dem Blut der Feinde freiwusch und sicherging, dass er nicht mehr als ein paar Schrammen davon getragen hatte.
Danach rieb ich sein fuchsfarbenes Fell trocken. Eine Krankheit konnten wir uns beide nicht leisten. Zögerlich zog ich meine ledernen Handschuhe aus und legte meine Hand auf sein dichtes Haarkleid. Das rote Mal auf meiner Haut verschwamm mit seiner Fellfarbe. Er war das einzige Geschöpf auf Erden, dass ich ohne den Schutz meiner Handschuhe berührte. Schließlich war er wohl auch der Einzige, der nicht sofort rückwärts sprang, drei Mal das Kreuz auf seinen Schultern schlug und den Herrn Gott um Vergebung bat, wenn mein Teufelsmal ihn anrührte. Wohl deshalb auch, war mein Kamerad das Pferd und kein Mann. Obwohl die gekauften Soldaten ein sündiges Leben führten und sich meist erst im Angesicht des Todes dem Herrn zuwandten, fürchteten sie um ihr längst verlorenes Seelenheil in Gegenwart von mir gezeichneten Teufelsbrut. Deshalb verbarg ich mein rotes Mal stets unter dem Leder meiner Handschuhe. Sah es in einem unvorteilhaften Moment doch einmal jemand, jagte man mich augenblicklich davon oder wollte mich direkt ins Höllenfeuer zerren. Ich glaubte, die wüsten Beschimpfungen und das Knacken des entflammten Scheiterhaufens in meinem Kopf zu hören. Gedankenverloren starrte ich auf meine gezeichnete Haut.
«Woher habt ihr das Pferd, Sir?» Unter der unreifen Knabenstimme erschrak ich mich.
Justament riss ich meine Hand hinter meinen Rücken.
«Du solltest dich umkleiden, Pimpf!», fuhr ich ihn an, ohne zu merken, dass er bereits seine dicke Stoffkleidung trug.
«Das habe ich, Sir.» Eifrig nickte der Junge.
Hinter meinem Rücken zog ich hastig die Handschuhe über, damit mein Geheimnis gehütet blieb.
«Was willst du dann hier? Hast du keine edlen Rösser, die deiner Aufmerksamkeit bedürfen?» Skeptisch kniff ich die Augen zusammen und musterte ihn.
«Nein, Sir. Die Rösser der Edelleute sind versorgt. Doch Eures sollte noch etwas Heu bekommen.» Bestrebt zu gefallen, sah er mich an.
«Es ist ein Ackergaul, kein Ross, Junge. Aber wenn du deine Nacht lieber mit Arbeit vergeuden magst, dann bring einen Eimer Haferbrei für mein Pferd herbei. Da sollte etwas übrig sein, wenn der verehrte Graf von Radingas uns mit besseren Speisen dankt.» Mit dem Kinn nickte ich hinaus.
Gehorsam eilte der engelsgleiche Knabe in den aufstrebenden Morgen.
«Du hast die Neugier in den Augen des kleinen Blondschopfes gesehen, nicht wahr?», flüsterte ich und strich lächelnd über die breite Stirn meines Pferdes.
Zustimmenden schnaubte er. Wenige Atemzüge später, kam der Junge mit dem Eimer Haferbrei zurück. Augenblicklich drehte mein Pferd sich unachtsam herum, schubste mich beiseite und steckte seinen massigen Schädel in den Eimer, sodass seine Nüstern gänzlich im weißgelben Schleim versanken. Damit riss er den schmalen Knaben gleich mit um. Ich zerrte den überrumpelten Blondschopf am Arm zurück auf die Beine.
«Ich sagte ja, er ist ein verfressener Ackergaul.» Schmunzelnd stieß ich meinem Pferd den Ellenbogen in die Schulter, doch er stopfte weiter gierig den Haferbrei in sich hinein.
«Woher habt Ihr das Pferd, wenn ihr mir die Frage erlaubt, Sir?» Mit großen, neugierigen Augen schaute der Knappe mich an.
«Unterstellst du mir etwa, ich hätte den Ackergaul gestohlen?» Mit gespieltem Zorn presste ich die Lippen aufeinander und verengte die Augen.
Bedrohlich langsam schritt ich auf den verschüchterten Blondschopf zu. Es mag nicht richtig sein, den schmächtigen Knaben zu ängstigen, doch diese Neugierde, gegenüber solchen undurchsichtigen Gestalten wie mir, war gefährlich.
«Nein, Sir. Bitte vergebt mir. Ich wollte Euch nicht beleidigen, Sir. Es ist nur, ein Söldner zu Pferd ist mir bisher nicht begegnet!», stotterte er und wich zurück.
Doch ich packte ihn bei seinem Umhang.
«Behalte deine Fragen für dich, Pimpf. Ein Anderer da draußen hätte dir wohl für deine Wissbegierde die Zunge herausgeschnitten! Jetzt mach, dass du verschwindest.» Grob stieß ich den Knaben aus dem Pferdestand.
Er stürzte auf seinen Hintern, richtete sich aber mit Entsetzen im Gesicht wieder auf und flüchtete sogleich zu den Zelten der Ritterschaft. Ein Kind hatte zwischen uns erkauften Soldaten, nichts verloren. Ein Neugieriges gleich gar nicht. Hoffentlich würde er sich an diese Lebenslektion erinnern.
Lachend schüttelte ich den Kopf über diese kindliche Einfältigkeit. Außerdem schmeckte ich bereits den versprochenen Braten in meinem Mund. Es blieb zu hoffen, dass der Graf sich dieses Mal an sein Wort hielt. Es wäre doch eine Unverschämtheit, wenn heute nur mein Pferd gut speisen würde.
Ich ging zur Feuerstelle, an der die Männer sich tosend unterhielten. Was hatte sie von der Feierlaune in solch aufbrausende Stimmung versetzt? Dann sah ich neben dem züngelnden Feuer lediglich einen Korb voll mit Brotkanten. Wo waren der Braten und das Ale, dass uns für jeden siegreichen Kampf versprochen wurde? Schon wieder hatten wir nur altes Gebäck gestellt bekommen.
«Ein paar alte Brotkrumen und mistiges Fuselöl, Soldat! Das ist dein Kampfeswille dem Grafen von Radingas wert.» Verachtend spuckte ein schnauzbärtiger Soldat neben den Eimer, in dem die schaumige Brühe schwamm.
«Dieser knickrige Sohn einer Hündin hat uns Fleisch und guten Alkohol für jeden Sieg versprochen!» Ein Anderer schlug mit der Faust voller Zorn auf den Baumstamm, auf dem er seinen Hintern breit saß.
«Während die edle Ritterschaft vergnüglich speist, bekommen wir diesen Hühnerfraß vorgesetzt!» Der Nächste zerrte mit seinen vergilbten Zahnstumpen an dem trocknen Brotlaib.
«Er weiß wohl nicht, wem er die Erfolge der letzten Wochen zu verdanken hat.» Grimmig von der wiederholten Zuwiderhandlung des Grafen nahm auch ich mir ein Stück des knochenharten Gebäcks.
«Wenigstens ein paar Huren hätte er uns überlassen können.», knurrte einer.
Zustimmend nickte ich, während ich versuchte, in das harte Brot zu beißen.
«Ich verlange meinen Sold und verschwinde. Es gibt andere Shire, die Kampfeswillen kaufen.» Der Schnauzbärtige stieß den Eimer Fuselöl um.
Das schaumige Gebräu versank im Laub des matschigen Waldbodens
«Hauptsache der Schweinehund kann uns bezahlen.», grimmte einer.
«Er wird uns bezahlen.», knurrte ich mit vollem Mund.
Das tagealte Brot rutschte einfach nicht meine vom Ärger geschwollene Kehle hinunter. Wie ich es verabscheute, wenn ein Mann sich nicht an seine Abmachungen hielt. Wir riskierten unser Leben für den Mistkerl, erwarteten keine hochrangige Dankbarkeit, sondern nur anständige Speisen für geleistete Arbeit. Doch wir erhielten nur diesen Abfall als vermeintliche Belohnung.
Verärgert spuckte ich den ungenießbaren Brocken Saufraß wieder aus. Scheinbar ging dem Grafen von Radingas das Geld aus. Dass er schon das dritte Mal die Abmachung brach, war der Beweis. Nach vier Monaten kam wohl meine Zeit, weiterzuziehen.
«Wir sollten ihm gemeinsam unseren Sold abverlangen. Zehn Schwerter sind überzeugender als eines.» Der Schnauzbärtige zog seine Klinge ein Stück aus der Lederscheide.
«Ich stimme dem zu.» Fest schaute ich in seine entschlossenen Augen und zog mein Schwert mit dem schneidenden Geräusch ebenfalls ein Stück hinaus.
«Ich auch. Lang genug hab ich mir dieses Drecksloch jetzt angetan.» Ein Anderer tat es uns gleich.
Weitere stimmten ein. Nur einige unerfahrene Soldaten, die wohl ihren ersten Dienst hier angetreten hatten, zogen sich zurück. Sie würden begreifen, wenn es schon zu spät wäre, dass der Graf ihren Sold wohl nicht mehr zahlen konnte. Das musste ich in meinen ersten Jahren als erkaufter Soldat auch schmerzlich lernen. Deshalb war man mit einem frühen Weiterziehen gut beraten, solange noch die Möglichkeit auf ausreichende Entlohnung bestand. Acht Männern standen mit mir auf und wir stampften zum großen Zelt des Grafen. Noch bevor wir vor dem Heeresführer standen, hielten uns zwei Rittersleute auf.
«Was wollt Ihr?» Abwehrend streckte einer die Hand aus.
«Unseren Sold, Sir!», knurrte ich mit knirschenden Zähnen.
«Wieso jetzt?», fragte er ohne Ausdruck in seinem blankrasierten Gesicht.
«Das dritte Mal haben wir den Hühnerfraß vorgesetzt bekommen, wo uns doch Fleisch und Ale versprochen wurde. Wir wollen unseren Sold und verschwinden.», sagte der Schnauzbärtige.
«Es ist Winter! Die Entbehrungen durch die gottverdammten Heiden zwingen das ganze Shire zur Sparsamkeit.», erwiderte der Rittersmann gleichgültig.
«Wenn der Graf sein Wort nicht halten kann, wollen wir auch das unsere nicht mehr halten!» Zum Nachdruck legte ich meine Hand an den Griff meines Schwertes.
«Ganz Recht!», lärmten die acht Männer zu meinen Seiten.
«Männer! Lasst das verweichlichte Lumpenpack gehen, wenn es den Lohn für ihre unzureichenden Leistungen nicht zu schätzen weiß.» Graf Athelstan von Radingas trat aus dem Zelt und zog sich sein Hemd in die Hose, während er verachtend in den Waldboden rotzte.
Er hatte wohl gerade eine Dirne bestiegen, wohingegen wir seit Wochen kein Weib gesehen hatten. Es war wirklich an der Zeit, zu gehen. Sollte der stutzerhafte Königsknecht doch selbst sehen, wo er im Kampf gegen die Dänen blieb. Die letzten Siege hatten seine Eitelkeit wohl mächtig anschwellen lassen.
«Nicht einmal mein Pferd hätte die trockenen Brotkrumen gefressen, die ihr uns als vermeintliche Entlohnung geschickt habt.» In meinen Augen glänzte der Zorn.
«Der schäbige Ackergaul stand meinen Schlachtrössern nur im Angriff. Euer Verschwinden ist kein Verlust.» Ungeachtet wollte der Graf sich hinter dem Schutz seiner Rittersleute wieder abwenden.
«Ihr vergaßt unseren Sold, Graf von Radingas!», rief der Schnauzbärtige.
Nun legten alle Männer ihre Hand an die Waffen.
«Gebt diesen feigen Hurensöhnen je einen Beutel Münzen. Dann sollen sie ihre Ärsche aus meinem Shire bewegen.» Gleichgültig drehte er uns den Rücken zu.
Der eitle Mistkerl glaubte, dass seine Worte Eindruck schindeten, doch da er uns ohne ein Widerwort den ausgemachten Sold zahlte, war er sich wohl bewusst, dass wir wahre Ernsthaftigkeit in unseren Blicken hatten. Die Rittersleute brachten uns die Münzen und entließen uns somit dem Dienst.
Zufrieden gingen wir zurück zu dem Schlafzelt. Ich packte den Sold in meine Ledertaschen und sattelte mein Pferd auf.
«Komm. Wir verschwinden. Andere werden unseren Platz einnehmen.» In Aufbruchsstimmung klopfte ich meinem Pferd auf den Hals.
«Im Westen soll es noch einige gutzahlende Shire geben.» Der Schnauzbärtige legte seine Hand auf meine Schulter.
Unter der freundlich gemeinten Geste verkrampfte ich mich und blickte sicherheitshalber auf meine gutsitzenden Handschuhe.
«Ich werde dorthin gehen, wohin mein Pferd mich bringt. Der Sold reicht für ein paar gute Wochen.» Mein Mundwinkel zuckte zu einem halbherzigen Lächeln, als ich meine Satteltaschen befestigte.
«Wie du meinst. Gott sei mit dir.» Zum Abschied klopfte er mir abermals auf die Schulter, sodass meine Fäuste sich für einen Moment schlossen.
«Gott sei mit dir.» Ich nickte ihm ernst zu, schwang mich auf mein Pferd und ritt in den Morgen.
2 Snelsmore
In seinem stuckerigen Trab brachte mein Pferd mich über das nasse Laub, querfeldein durch den Winter erstarrten Wald. Wie immer, wenn ich reiste und noch kein Ziel wusste, gab ich meinem Pferd die Führung. So manches Mal brachte er mich an wundersame Orte, aber nie in Gefahr. Der Nebel stieg in den blätterlosen Baumkronen auf in den Himmel, wo graue Wolken einen gewöhnlichen englischen Tag voraussagten. Ein leichter Wind fuhr mir durch mein erdfarbenes Haar, das mir in einigen fettigen Strähnen ins Gesicht fiel. Die letzten vier Monate zwischen dreißig stinkenden Männern hatten auch an mir Spuren hinterlassen. Die Tümpel bei Reading waren kaum zum Baden geeignet. Nur für eine leichte Wäsche hatte es gereicht.
«Ein anständiges Wirtshaus sollte uns beiden guttun.», sprach ich nachdenklich zu meinem Pferd.
Der nasse Boden schmatzte unter den breiten Hufen, das Leder rieb quietschend aneinander und mein Atem hauchte hörbar in der kalten Winterluft.
Die Ohren meines Pferdes zuckten gleichsam in eine Richtung, sodass auch ich den Blick dorthin warf. Für eine bessere Sicht kniff ich die Augen konzentriert zusammen und beobachtete die Sträucher zwischen den Bäumen. Räuberbanden waren keine Seltenheit. Schon so manches Mal hatten diese wildlebenden Gruppen Gesetzloser versucht, mich zu überfallen. Ich ließ mein Pferd im zügigen Trab, aber behielt das Ziel, welches er mit seinen Ohren anpeilte ebenfalls im Blick. Dann offenbarte sich zwischen den kahlen Zweigen das Geräusch, das ich nicht hörte, aber mein Pferd sehr wohl.
Eine Gruppe Rehwild war von den Hufschlägen aufgeschreckt worden. Mit aufgerissenen Augen starrten sie uns an, nur um gleich darauf in hohen Sprüngen zu flüchten. Doch dann sah ich etwas, sodass ich mein Pferd augenblicklich stoppte. Zwischen den dunklen Stämmen und dem orangebraunen Laub stand eine Ricke in schneeweißem Fellkleid. Die Nüstern und Lippen waren von zartem roséfarbenen Ton. Ihre eisblauen Augen fesselten mich an ihren unbeschreiblichen Anblick. Dieses Tier war von solcher Schönheit, wie ich kein Wesen zuvor gesehen hatte. Mir stockte der Atem, als diese sagenhafte Ricke scheinbar direkt in mein Innerstes hineinsah. Erst als sie in eleganten, doch schnellen Schritten ihrer Herde folgte, konnte ich wieder Luft holen.
Starr blickte ich ihr nach. Dass sie mich so einfach zurückließ, hinterließ ein unangenehmes Ziehen in meiner Brust. Was in Gottes Namen war gerade geschehen?
«Hast du diese Schönheit gesehen?» Noch immer fasziniert von der Begegnung schaute ich zu meinem Pferd.
Auch er hatte seinen Kopf in ihre Richtung gedreht, als würde er ihren Anblick zurückwünschen. Ich schlug die Lider auf und zu, um wieder zur Besinnung zu kommen. Das musste Zauberei gewesen sein. Nur Magie vermochte, so ein schönes Wesen zu erschaffen und mich in einen solchen Einfluss zu ziehen.
Ein Schnalzen mit der Zunge weckte auch mein Pferd wieder in die Wirklichkeit. Langsamen Schrittes durchquerten wir weiter den schlafenden Wald. Mächtige Buchen und alte Eichen säumten unseren Weg. Suchend schaute ich an den dunklen Stämmen vorbei und hoffte, das schöne Tier erneut sehen zu dürfen, aber sie kreuzte kein weiteres Mal unseren Ritt.
Stattdessen war plötzlich das knarrende Geräusch eines Wagens, zu hören. Aufmerksam sah ich mich nach einem Weg um, der für eine Kutsche befahrbar war. Hinter den Zweigen einiger laubfreien Büschen zwischen ein paar jungen Buchen erkannte ich den Wagen, der mit einem einzelnen Mann besetzt war. Geradewegs ritt ich auf den alten Kutscher zu, der sich seinen Weg in dieser verlassenen Einöde bahnte. Ein dürrer Gaul, geführt von einem genauso dünnen Greis, zog den morschen Karren durch den Schlamm. Mein Pferd wieherte dem klapprigen Gaul eine Begrüßung zu, als er auf den verschlammten Weg trat.
«Seid gegrüßt, alter Mann.», empfing ich den Greis.
«Den Herrn zum Gruße, mein Sohn.» Der alte Mann zog an den Zügeln und nickte.
«Sagt, führt dieser Weg zu einem Dorf mit einem gescheiten Wirtshaus?», fragte ich.
«Ganz Recht. Ich bin selbst auf dem Weg nach Snelsmore. Begleitet mich doch, es ist nicht mehr weit.» Auf seinen eingefallenen Lippen zeigte er ein vertrauensvolles Lächeln.
«Gern, alter Mann.», stimmte ich zu.
«Jipp, Jipp, Maria!», rief er seinem dürren Gaul zu, der sogleich mühsam den Karren anzog.
«Ein wahrlich seltsamer Name für einen alten Müllersgaul.» Schmunzelnd betrachtete ich das rabenschwarze Kleinpferd mit dem Namen der heiligen Jungfrau.
«Woher wisst Ihr, dass ich einst Müller war?» Ein wenig verwundert über meine wissenden Worte schaute er mich durch seine trüben, alten Augen an.
«Es ist das Mehl auf Eurem Karren, dass Euch verraten hat. Kaum eine Familie wird zehn Säcke Mehl brauchen, meint Ihr nicht?» Freundlich betrachtete ich den Greis, auf dessen faltigem Gesicht das arbeitstüchtige Leben tiefe Spuren hinterlassen hatte.
«Ganz Recht. Aber auch einem Bäcker hätten diese Mengen Mehl gehören können, warum also ein Müller?», fragte er interessiert.
«Das stimmt. Doch ein Bäcker hätte kein ganzes Korn zwischen den morschen Planken seines Wagens.» Meine Beobachtungsgabe hatte ich als junger Knabe recht schnell perfektioniert.
«Ein kluges Köpfchen verbirgt sich unter Eurem schmutzigen Haar.» Der Greis lachte auf, sodass er die letzten Zähne zeigte, die ihm verblieben waren.
«Verzeiht all den Dreck, hinter dem ich mich verberge, alter Mann. Die letzten Monate waren entbehrlich. Nach einem guten Essen wird ein heißes Bad den Schmutz hinunterwaschen.» In Vorfreude auf das warme Wasser entwich ein Seufzen meinen Lippen.
«Das gönne ich Euch, mein Sohn. Ich empfehle Euch, die Rahmfladen zu wählen. Das saftige Brot ist aus meinem Mehl gebacken und gefüllt mit Speck und Knollzwiebeln wird es Euch die Entbehrungen vergessen lassen.» Begeistert schaute er auf das Ende des Waldes, dass eine moosige Hügellandschaft offenbarte.
Seine Beschreibung ließ mir das Wasser im Mund zusammenlaufen. Für solch gutes Essen hatten sich die verkauften Wochen sicherlich gelohnt.
«Genauso werde ich es wählen, alter Mann.» Zustimmend nickte sogar mein Pferd.
«Wollt Ihr mir verraten, warum Euer dürrer Müllersgaul den Namen der heiligen Jungfrau trägt?» Es interessierte mich ernsthaft.
Hatten die meisten Tiere doch, sofern man sie mit Benennung rief, einen bedeutungslosen oder amüsanten Namen. Ausgenommen natürlich die edlen Rösser der Rittersleute, deren Bezeichnung meist solch hochrangige Aussagekraft hatten wie die Namen ihrer Herren. Außerdem war ich mir sicher, dass der alte Mann sich an einem Zuhörer, der seinen Geschichten lauschte, erfreute.
«Ich sage Euch, das ist ein unglaubliches Geschehen, dass sie diesen Namen trägt. Aber ich spreche die Wahrheit!» Mit erinnerungsbehaftetem Ausdruck blickte er auf seinen Gaul, der den schweren Karren angestrengt den Hügel hinaufzog.
«Vor vielen Wintern hatte ich diesen alten Müllersgaul als glänzende Jungstute von einem Bauern gekauft. Von Beginn an verrichtete sie treu ihre Arbeit. Aber eines kalten Frühlingsmorgens kam ich in ihre Bucht hinein, um sie vor den Karren zu spannen. Doch neben ihr lag ein rostfarbenes Fohlen, nur wenige Augenblicke alt. Ich sag Euch, ich bin mit aufgerissenen Augen zurückgewichen und beinahe in Ohnmacht gekippt. Das Geschirr hatte ihr die letzten Monate wie am ersten Tag gepasst. Ich besaß auch nur diese Stute, mittlerweile schon weit über einem Jahr. Und im ganzen Dorf gab es keinen Hengst, der sie hätte besteigen können und doch lag dort im Stroh das rostrote Fohlen. Ein Wunder Gottes musste geschehen sein.» In seinen trüben Augäpfeln glänzte das Glück der Erinnerung an diesen Tag.
«Eine unbefleckte Empfängnis, also.» Schmunzelnd nickte ich ihm zu, während ich insgeheim doch einen entlaufenen Hengst hinter dem Fohlen vermutete.
«Ganz Recht. Eine unbefleckte Empfängnis gleich der heiligen Jungfrau Maria. Ich brachte das gottgesandte Fohlen mit der Stute in die Kapelle und berichtete dem Pfarrer das Unglaubliche. Er wollte es kaum begreifen und segnete die Tiere im Angesicht des Wunders.», berichtete der alte Mann voller Euphorie.
Ein heißeres Lachen entwich meiner Kehle, als ich mir vorstellte, wie der alte Mann den Gaul mit Fohlen in die heilige Kirche zerrte. Der arme Pfarrer musste wahrlich vom Glauben abgefallen sein.
«So lacht nicht derart spöttisch, mein Sohn. Es ist wahrlich so geschehen. Ein Zeichen des Herrn in meinem Stall. Ich bin selbst mit reichlich Kindern gesegnet und auch mein ältester Sohn hat mit gerade sechsundzwanzig Wintern bereits sieben stramme Müllerssöhne. Die nächsten kommen im Frühling, es sind so viele Bälger, dass die Mutter es kaum gestemmt bekommt. Aber wahrlich keiner entsprang einer unbefleckten Empfängnis.», tadelte er ärgerlich und stolz zugleich.
«Nun seid nicht so verärgert. Ich glaube Euch, alter Mann.» Durch ein breites Lächeln verbarg ich das Gelächter, das durchaus meinem Unglauben entsprungen war.
«Wie ist denn Euer Name? Ihr kommt von den Kämpfen mit den Dänen, nicht wahr?», fragte er mit betrachtender Miene.
«Ja, bei Reading habe ich die letzten Monate gegen die gottlosen Heiden gekämpft.», antwortete ich.
«Dann verstehe ich Euren Zustand und die Freude auf das Wirtshaus. Aber wie ist nun Euer Name, mein Sohn?», wiederholte er seine unbeantwortete Frage.
«Ich bin nur ein Durchreisender. Ein Mann mit seinem Pferd, nichts weiter.», antwortete ich wahrheitsgetreu.
«Ihr wundert euch über den Namen meines Gauls, aber tragt selbst nicht einmal einen? Ein seltsamer Reisender seid Ihr mir.» Skeptisch kniff er die faltigen Augen zusammen, wahrscheinlich damit er mich besser erkennen konnte.
Albern, dass er mich als seltsam bezeichnete, hatte er doch mir gerade die Geschichte einer unbefleckten Empfängnis seines Gauls berichtet. Aber ich schmunzelte über den wunderlichen Greis auf der Kutsche. Eine Weile ritt ich einfach schweigend neben dem knarrenden Wagen her, bis sich mir eine Frage aufdrängte.
«Alter Mann, wenn Ihr schon lange hier lebt, könnt Ihr mir sicher eine Frage beantworten.», durchbrach ich das Schweigen.
«Sprecht offen, mein Sohn.» Wieder wendete er den trüben Blick zu mir.
«Auf meinem Weg durch den Wald sah ich ein zartes Reh mit schneeweißem Pelz. Könnt Ihr mir darüber etwas erzählen?», fragte ich geradeheraus.
«Ihr habt es also gesehen. Das betrübt mich, zu hören.» Nachdenklich richtete er den Blick auf den Weg, ohne wahrhaftig hinzusehen.
«Wessenthalben bekümmert?» Erwartungsvoll betrachtete ich den Greis von der Seite. Auf, dass er weitersprach.
«Man erzählt sich von der schneeweißen Ricke, dass sie die unschuldige Liebe oder den grausamen Tod bringt.», begann er.
«An den östlichsten Kreidefelsen ist dieses wundersame Tier dem Schaum der heranrollenden Wellen entsprungen. Aus reiner Schönheit wurde dieses Reh geboren. Doch die Schönheit ist stets ein zweischneidiges Schwert.» Nun richtete sich sein Blick mit warnender Ernsthaftigkeit an mich. «Das weiße Reh verlangt seit Jahrhunderten nach Blut. Ihr unschuldiger Anblick ist der Mantel des Unheils, dass sie heraufbeschwören kann. Berührt sie nicht! Seht sie nicht an! Verjagt sie von euren Wegen und vergesst diesen engelsgleichen Dämon. Keine Liebe ist den Tod wert.», erklärte er mit verheißungsvoller Stimme.
Die schöne, weiße Ricke sollte den Tod bringen? Erzählte mir der alte Greis eine weitere Geschichte aus dem Märchenreich? Konnte es nicht möglich sein, dass sie einfach ein wunderschönes Tier in weißem Pelz war, welches meinen Weg versehentlich kreuzte?
«Nun, ich habe sie nicht berührt. Sie hat mich nur mit ihrem Anblick gebannt. Und als Bedrohung erschien sie mir auch nicht.» In Gedanken an das rätselhafte Geschöpf sah ich ebenfalls auf den verschlammten Weg, der nun den dritten Hügel wieder hinunterführte.
«Gebt Acht, mein Sohn. Die Tücken der Schönheit sind allgegenwärtig. Wie bei den verruchten Meerjungfrauen, die unschuldige Fischersjungen mit ihrem sündhaften Antlitz in Versuchung führen, um sie aus ihren Booten hinauszuzerren und auf dem Grund des Meeres zu ertränken. Womöglich will dieses schneeweiße Reh Euch in seinen tödlichen Zauberbann ziehen.» Sein sorgenvoller Blick ließ mich schmunzeln.
«Nur keine Sorge, alter Mann. Die weiße Ricke wird mich wohl kaum mit ihren zarten Hufen im Laub ertränken können.», sagte ich beruhigend.
Der Tod war mir so vertraut, dass ich mich nicht davor fürchtete.
«Ich hoffe, Ihr überschätzt Euch nicht.», gab er zum Nachdenken.
Doch ich schenkte seiner Warnung keine Beachtung. Ein so schönes Geschöpf, wie diese Ricke würde wohl kaum meinen Tod verursachen können. So ritten wir in Stillschweigen weiter, bis in der Ferne einige Hütten auf einer Hügelkette erschienen.
«Das gute Snelsmore, mein Sohn. Euer gesuchtes Wirtshaus steht gleich an dritter Stelle.» Mit seinen knochigen Fingern zeigte er auf das große Holzhaus, aus dessen Schornstein Rauch emporstieg.
«Ich danke Euch, alter Mann. Möge Eure heilige Maria noch lange in Eurem Dienste stehen.», verabschiedete ich mich mit einem Wink und schickte mein Pferd in den Trab.
Die Ungeduld trieb mich nun. Schließlich brach auch die Nacht nach dem langen Ritt über uns herein.
«Möge der Herr Euch vor dem weißen Reh schützen, Mann mit dem Pferd!», rief er mir nach.
Lächelnd nickte ich dem alten Greis nochmal zu, aber hoffte insgeheim, dass der Herr mich nicht vor der schönen Ricke schützte und ich ihr ein weiteres Mal begegnen konnte.
Ich ritt in den Eingang der kleinen Siedlung, wo die Bewohner mich kritisch beäugten, während sie ihre Hütten auf die Nacht vorbereiteten. Einige Kinder spielten auf der verschlammten Kopfsteinstraße, als Mütter sie zum Abendessen in ihre Häuser riefen. Die Bewohner schienen Reisende wie mich, schon oft gesehen zu haben. Durch diese Siedlung nahe der Grenze kamen sicher einige Händler, Soldaten und Halunken, deshalb gab es wohl auch ein solch wohlhabendes Wirtshaus. Das lange Gebäude war im unteren Stockwerk mit grauen Steinen erbaut und oben von rohem Holz verkleidet. Aus dem Gastraum schallten bereits betrunkenes Gelächter und freudiges Geplapper. Der Geruch von gebratenem Fleisch und gebrautem Bier zog sich wohlig durch meine Nase.
«Wir werden uns hier anständig bewirten lassen, Pferd.» Mit einem verschmitzten Lächeln auf den Lippen klopfte ich ihm auf den Hals.
Er schnaubte zustimmend. Ein warmer Stall, gutes Getreide und duftendes Heu in Gesellschaft anderer Reittiere würden auch ihm gefallen. Der Wirtsjunge kam durch die dunkle Eichentür, wodurch das Getöse aus dem Gastraum lauthals auf die Straße lärmte.
«Sing, Musiker! Sing!», grölten tiefe Männerstimmen.
Es schien sich wohl, auch ein Spielmann hierher verirrt zu haben. Hoffentlich wäre er mit Talent gesegnet. Kein krächzender Minnesänger sollte mir die Vorfreude auf Mahl, Bad und Weib jetzt nehmen.
«Bursche! Habt Ihr noch ein Bett für die Nacht frei?», fragte ich den schwitzenden Wirtsjungen, der die Eimer mit undefinierbarem Inhalt auf die Straße kippte.
«Ja, Herr!» Er stellte die geleerten Eimer beiseite und nahm mein Pferd an die Zügel.
«Gebt ihm ausreichend Heu und einen Eimer Hafer, wenn Ihr habt.», sagte ich und nahm meine Satteltaschen ab.
«Wie Ihr wünscht, Herr. Geht hinein, mein Vater zeigt Euch das Zimmer.» Der Bursche, fast schon ein Mann, nahm mein Pferd mit sich.
Ich nickte und ging in das überfüllte Gasthaus hinein. Die stickige Luft war so dicht von Rauch und Atem, dass ich sie mit dem Schwert hätte zerschneiden können. An allen Tischen saßen lachende Männer, die in heiterem Gejohle ihre Krüge aneinanderstießen. Ach, was hatte ich diese sorgenlose Stimmung der Sünde vermisst. Die Männer rülpsten gesättigt von den deftigen Speisen und kippten das Ale in ihre Kehlen, sodass der Schaum durch ihre ungepflegten Bärte floss. Der junge Spielmann in albernen bunten Kleidern, dass er fast aussah wie ein Hofnarr, wurde von einem kräftigen Kerl auf den Tisch gehievt.
«Nun spiel schon, Musiker!», befahl der sichtlich angetrunkene Mann.
Die Huren ringsrum klatschten fordernd in die Hände, sodass er doch beginnen möge. Mit einem schelmischen Grinsen auf den Lippen setzte er den Bogen auf seine Fidel und begann eine fröhliche Melodie. Immerhin spielen konnte er. Klatschend, stampfend und johlend begleitete der volle Gastraum den jungen Spielmann.
«Ey! Fremder! Was verlangst du?» Die brummende Stimme des dicken Wirts dröhnte durch die Musik zu mir.
Hinter dem Tresen, wo diese Wirtsmänner eher herrschten, als bedienten, zapfte er gerade drei neue Krüge Ale, während er mich fordernd musterte. Seine buschigen Augenbrauen, hoben sich erwartungsvoll.
«Ale, einen großen Rahmfladen und ein Bett für die Nacht!», rief ich lauthals zurück, damit er mich verstand.
Er nickte nur, rieb sich seine dreckigen Hände an der noch dreckigeren Schürze und verschwand in der Küche.
«Setz dich, Schönling!», rief ein blonder Mann meines Alters herüber.
Schönling, ja, so nannte man mich ab und an auch. Wahrscheinlich weil ich deutlich besser aussah, als so manch anderer Mann in diesem sündhaften Metier, in dem ich mich herumtrieb. Allerdings mochte ich es nicht, wenn man mich so nannte. Auch wenn diese Bezeichnung allemal besser war, als die der Teufelsbrut. An dem langen Tisch saßen bereits drei Männer, bei denen es sich scheinbar um Brüder handelte. Die Ähnlichkeit in ihren Gesichtern zeigte die Verwandtschaft. Der Älteste drückte sein vom Alkohol aufgedunsenes Gesicht gerade in den mächtigen Busen einer dicken Hure, die lachend den Kopf in den Nacken legte. Ich lachte mit, als das Freudenweib ihn an den dunkelblonden Strubbelhaaren aus ihren Brüsten zog. Sie trugen keine Waffen, daher konnte ich der Einladung mit beruhigtem Gewissen folgen. Mit der Satteltasche auf meinen Schultern setzte ich mich zu dem Mittleren, der nachdrücklich auf die Holzbank neben sich klopfte.
«Ihr seid ein Söldner, wie es mir scheint?», fragte er und begutachtete das Schwert an meiner Seite.
«So ist es. Ein Hungriger noch dazu.» Ungeduldig warf ich einen Blick an den mit getrocknetem Ale- und Essenresten besudelten Tresen.
In Wirtshäusern vor allem im Gastraum war es oftmals dreckiger als in einem Schweinestall, aber irgendwann hatte ich festgestellt, desto schmutziger der Wirtsmann und der Tresen, umso besser das Essen.
«Siehst aus, als kämst du direkt aus dem Scheißhaus eines Schlachtfelds, Söldner.» Der Jüngste der drei Strubbelköpfe musterte mich.
Ihm wuchs noch nicht einmal ein Bart am Kinn und doch erdreistete er sich, mich so respektlos anzusprechen.
«Melvin! Du bist nicht bei Trost! Nicht ein Haar am Sack und keinen Respekt vor einem Mann, der unser Land beschützt.» Der Mittlere gab ihm einen Klaps auf den Hinterkopf, sodass ihm beinahe die tannengrüne Mütze vom Haupt viel.
«Er beschützt kein Land, sondern nur den Geldbeutel von dem adligen Arsch, der ihn bezahlt, Marvin!», grummelte der Jüngste und richtete sich die Kopfbedeckung.
Eigentlich hatte der dreiste Rüpel Recht, doch es war ungezogen, es so kundzutun. Hätte sein Bruder ihn nicht bereits gemaßregelt, hätte es meine Faust getan.
«Verzeiht, Söldner. Er ist ein Trottel und wird vom Ale immer mürrisch!», entschuldigte der Mittlere sich.