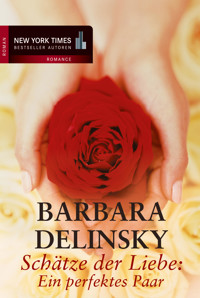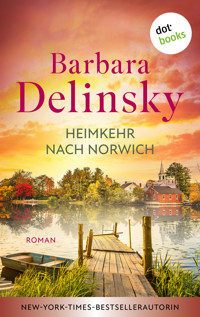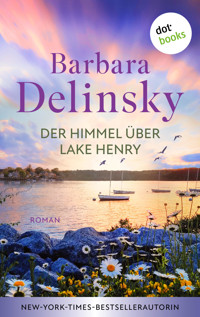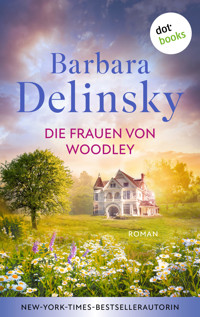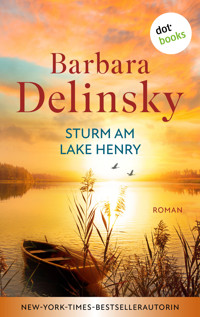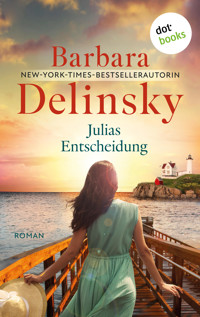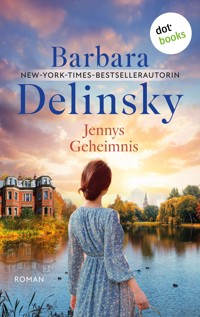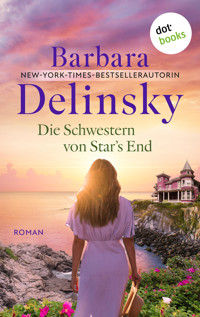5,99 €
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Brücke zwischen den Zeiten … Der bewegende Schicksalsroman »Das Weingut am Meer« von Barbara Delinsky jetzt als eBook bei dotbooks. Ein Weingut an der Küste von Rhode Island – ein Ort, der zwei Frauen für immer miteinander verbindet … Voller Liebe zum Detail restauriert Olivia alte Familienfotografien für ihre Kunden – und wird doch immer schmerzhaft daran erinnert, dass sie und ihre kleine Tochter nur einander haben. Als sie von Natalie Seebring, der das alte Weingut am Meer gehört, darum gebeten wird, ihr beim Verfassen ihrer Memoiren zu helfen, sagt sie darum voller Neugier zu. Warum will diese Frau, die doch mitten im Leben steht und gerade ihre zweite Heirat plant, ausgerechnet jetzt ihre Erinnerungen festhalten? Natalie scheint ein Geheimnis zu hüten, das ihre gesamte Familie erschüttern könnte – und auch Olivias Leben, die sich auf dem Weingut zum ersten Mal seit langer Zeit zuhause fühlt … »Große Gefühle, eine wunderschöne Landschaft und lebensnahe Charaktere machen diesen Roman zu einem Lese-Muss.« Booklist Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der mitreißende Familiengeheimnisroman »Das Weingut am Meer« von New-York-Times-Bestsellerautorin Barbara Delinsky wird alle Fans von Lucinda Riley und Nora Roberts begeistern. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 510
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Über dieses Buch:
Ein Weingut an der Küste von Rhode Island – ein Ort, der zwei Frauen für immer miteinander verbindet … Voller Liebe zum Detail restauriert Olivia alte Familienfotografien für ihre Kunden – und wird doch immer schmerzhaft daran erinnert, dass sie und ihre kleine Tochter nur einander haben. Als sie von Natalie Seebring, der das alte Weingut am Meer gehört, darum gebeten wird, ihr beim Verfassen ihrer Memoiren zu helfen, sagt sie darum voller Neugier zu. Warum will diese Frau, die doch mitten im Leben steht und gerade ihre zweite Heirat plant, ausgerechnet jetzt ihre Erinnerungen festhalten? Natalie scheint ein Geheimnis zu hüten, das ihre gesamte Familie erschüttern könnte – und auch Olivias Leben, die sich auf dem Weingut zum ersten Mal seit langer Zeit zuhause fühlt …
Über die Autorin:
Barbara Delinsky wurde 1945 in Boston geboren und studierte dort Psychologie und Soziologie. Nach der Geburt ihres ersten Sohnes arbeitete sie als Fotografin für den Belmont Herald, erkannte aber bald, dass sie viel lieber die Texte zu ihren Fotos schrieb. Ihr Debütroman wurde auf Anhieb zu einem großen Erfolg. Inzwischen hat Barbara Delinsky über 70 Romane veröffentlicht, die in mehr als 20 Sprachen übersetzt wurden und regelmäßig die New-York-Times-Bestsellerliste stürmen. Sie engagiert sich außerdem sehr stark für Wohltätigkeitsvereine und Aufklärung rund um das Thema Brustkrebs. Barbara Delinsky lebt mit ihrem Mann in New England und hat drei erwachsene Söhne.
Die Website der Autorin: barbaradelinsky.com/
Bei dotbooks veröffentlichte Barbara Delinsky auch ihre Romane:
»Die Schwestern von Star’s End«
»Jennys Geheimnis«
»Julias Entscheidung«
»Sturm am Lake Henry«
»Im Schatten meiner Schwester«
Weitere Romane sind in Planung.
***
eBook-Neuausgabe Juni 2023
Die amerikanische Originalausgabe erschien erstmals 2000 unter dem Originaltitel »The Vineyard« bei Simon & Schuster, New York. Die deutsche Erstausgabe erschien 2002 unter dem Titel »Der Weingarten« bei Knaur.
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe 2000 by Barbara Delinsky
Published by Arrangement with Barbara Delinsky
Copyright © der deutschen Erstausgabe 2002 bei Droemersche Verlagsanstalt Th. Knaur Nachf., München
Copyright © der Neuausgabe 2023 dotbooks GmbH, München
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © shutterstock
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (mm)
ISBN 978-3-98690-678-8
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Das Weingut am Meer« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Barbara Delinsky
Das Weingut am Meer
Roman
Aus dem Amerikanischen von Georgia Sommerfeld
dotbooks.
Kapitel 1
Als Susanne Seebring Malloy an einem Junitag in Manhattan, der sich bisher kaum von ihren anderen Junitagen in Manhattan unterschieden hatte, nach einem Mittagessen mit Freundinnen in ihr Backsteinhaus auf der Upper East Side zurückkehrte, fand sich unter den inzwischen eingetroffenen Briefen ein Umschlag, der ihr Rätsel aufgab. Der Poststempel von Asquonset, Rhode Island, das Firmenlogo in der linken oberen Ecke und der Freesienduft, den das Kuvert verströmte, deuteten darauf hin, dass ihre Mutter ihr geschrieben hatte. Natalie – ihr großes Vorbild! Susanne schnitt eine Grimasse, schleuderte ihre hochhackigen Pumps von sich und ließ sich in einen Sessel fallen. Sie fühlte sich leer.
Und wessen Schuld war das?, fragte sie sich verärgert. Es war Natalies Schuld! Sie hatte die Rolle der Ehefrau und Mutter streng nach Vorschrift gespielt, und für Susanne war es selbstverständlich gewesen, ihr nachzueifern. Als die Frauenbewegung sich schließlich durchsetzte, war sie vollauf damit beschäftigt, Mark und die Kinder zu umsorgen, und an einen Einstieg ins Berufsleben war nicht zu denken. Jetzt waren die Kinder erwachsen und betrachteten ihre Fürsorge als Verletzung ihrer Privatsphäre, und Mark hatte Angestellte, die die kleinen Dinge für ihn erledigten, die sie früher für ihn erledigt hatte. Sicher, sie begleitete ihn noch hin und wieder auf seinen Reisen, und er beteuerte, dass er sie gerne mitnahm, aber heutzutage tat er es nicht mehr, weil er sie nicht brauchte. Sie war nur noch Staffage. Jetzt hatte sie Zeit für einen Einstieg ins Berufsleben, und auch an Energie mangelte es ihr nicht – aber sie war sechsundfünfzig!
Mit sechsundfünfzig konnte man nicht mehr auf den Zug aufspringen – er war abgefahren.
Also blieb ihr nichts anderes übrig, als ihr bedeutungsloses Wohlstandsleben fortzusetzen und die nagende Unzufriedenheit als einen Bestandteil davon zu akzeptieren.
Der Gedanke schoss ihr durch den Kopf, das Problem bei Natalie zur Sprache zu bringen, doch sie verwarf ihn gleich wieder. Erstens war nicht zu erwarten, dass ihre Mutter Empfindungen wie Langeweile oder innere Unruhe nachfühlen konnte, und zweitens sprach Natalie grundsätzlich nicht über Probleme. Sie sprach über Kleidung, über Tapeten, über Dankschreiben auf handgeschöpftem Bütten nach einer Dinnerparty. Sie war eine Expertin in Manieren.
Das war Susanne ebenfalls – aber sie hatte alle diese Dinge satt. Sie waren langweilig. Sie waren albern. Sie waren nutzlos wie die Bouillabaisse, die sie gestern gekocht hatte, bevor sie sich daran erinnerte, dass Mark ein Arbeitsessen in einem Restaurant angesetzt hatte, oder die Berge von Vorspeisen und Backwaren, die sie in den letzten sechs Monaten für die Gäste vorbereitet und eingefroren hatte, die nicht mehr kamen.
Das erinnerte sie wieder an den Umschlag, den sie noch immer in der Hand hielt. Post von ihrer Mutter zu bekommen, war an sich nicht ungewöhnlich. Natalie schickte ihr ständig Kopien von Kritiken des einen oder anderen Asquonset-Weines, und wenn nicht eine Kritik, dann eine handgeschriebene Lobeshymne eines Weinbauern aus Kalifornien oder Frankreich – und all das, obwohl Susanne sich nicht im Geringsten dafür interessierte. Das Weingut war das Ein und Alles ihrer Eltern – Natalie und Alexander – gewesen, nicht ihres. Sie hatte jahrzehntelang versucht, ihnen das klar zu machen, doch wie bei allem anderen in ihrem Leben hatte sie auch damit kein zufrieden stellendes Ergebnis erzielt.
Aber dieses Kuvert war verwunderlich. Zwar aus dem schweren Papier, das Natalie bevorzugte, aber nicht wie sonst elfenbeinfarben und mit burgunderroter Tinte schwungvoll beschriftet, sondern safrangelb mit blauen, kunstvollen Druckbuchstaben. Und es war nicht an Susanne allein adressiert, sondern an Mr und Mrs Mark Malloy.
Was hatte das zu bedeuten? Susanne drehte den Umschlag unbehaglich hin und her. Bei den letzten Telefongesprächen war Natalie irgendwie seltsam gewesen. Was sie sagte, klang optimistisch – Asquonset erholte sich offenbar besser von seiner Führungslosigkeit nach Alexanders Tod als erwartet –, Susanne aber hatte den Eindruck, dass ihre Mutter etwas Wichtiges verheimlichte. Da sie annahm, es handelte sich um Geschäftliches, und nicht darin verwickelt werden wollte, bedrängte sie Natalie nicht. Vielleicht war die unterschwellige Anspannung ja auch nur eine Begleiterscheinung der Trauerarbeit, dachte sie dann, aber auch darauf wollte sie ihre Mutter nicht ansprechen. Jetzt fragte sie sich plötzlich, ob dieser Umschlag wohl in einem Zusammenhang mit jener Anspannung stand.
Sie öffnete ihn und zog eine ebenfalls safrangelbe Karte heraus.
Bitte machen Sie uns die Freude, am Labor-Day-Sonntag um sechzehn Uhr im Haupthaus des Weingutes Asquonset unsere Hochzeit mit uns zu feiern.
Natalie Seebring und Carl Burke
Susanne las den Text ein zweites Mal.
Hochzeit?
Sie las die Einladung ein drittes Mal, doch die Worte blieben die gleichen. Natalie wollte wieder heiraten? Das konnte nicht sein!
Natalie wollte Carl heiraten? Das konnte erst recht nicht sein! Carl Burke war seit fünfunddreißig Jahren der Verwalter des Weingutes. Er war ein Angestellter, wenn auch leitender, er war ein einfacher Mann ohne Vermögen, nicht im Entferntesten mit Alexander Seebring zu vergleichen – Susannes Vater –, mit dem Natalie achtundfünfzig Jahre verheiratet gewesen und der vor knapp sechs Monaten gestorben war.
Sicher, Susanne wusste, dass Carl ihrer Mutter in dieser schweren Zeit eine große Hilfe gewesen war – Natalie hatte oft von ihm gesprochen –, aber musste sie ihn deswegen gleich heiraten?
Auf der Suche nach ein paar erklärenden Worten drehte Susanne die Karte um, doch da stand nichts.
Sie las den Text ein viertes Mal, und als sie einsah, dass nicht an seinem Inhalt zu rütteln war, schnürten ihr Tränen die Kehle zu. Sie war tief gekränkt. Wie konnte ihre Mutter ihr diese schockierende Nachricht in Form einer neutralen Einladungskarte mitteilen, als seien sie einander fremd? Das waren sie nicht!
Sie telefonierten einmal in der Woche und sahen sich durchschnittlich einmal im Monat. Zugegeben, sie hatten kein inniges Verhältnis, aber das rechtfertigte nicht, dass Natalie sie nicht vorgewarnt hatte. Nun ja – vielleicht hatte ihre Mutter sie ja durch die Blume vorwarnen wollen, indem sie Carl so oft erwähnte. Aber wie konnte sie annehmen, dass dieser mehr als dezente Hinweis verstanden würde? Schließlich war sie offiziell noch in Trauer!
Susanne las die Einladung ein letztes Mal und hob dann, noch immer fassungslos, den Telefonhörer ab.
Als Greg Seebring, Susannes Bruder, am gleichen Nachmittag die Haustür des kleinen Klinkerbaus in Woodley Park, Washington, D.C., öffnete, spürte er einen Widerstand und hörte ein Schaben. Beides rührte, wie sich zeigte, von dem Berg Post her, der sich unter dem Briefschlitz aufgetürmt hatte und unmöglich die Ausbeute eines einzigen Tages sein konnte. Er war drei Tage verreist gewesen – aber wo war seine Frau? Er überlegte, ob Jill irgendwelche Pläne gehabt hatte. Falls ja, so hatte sie sie ihm jedenfalls nicht mitgeteilt. Allerdings hatten sie während seiner Abwesenheit nicht miteinander gesprochen. Er war die ganze Zeit im Stress gewesen, hatte das Hotel frühmorgens verlassen und war abends erst spät zurückgekommen und dann zu erledigt, um zum Telefonhörer zu greifen. Er hatte gedacht, sie würde sich freuen, wenn er eher heimkäme als erwartet. Und nun war sie nicht einmal da.
Er hätte sie anrufen sollen.
Sie hätte ihn ja auch anrufen können.
Er schloss die Finger um die Griffe seiner Reisetasche, um sie ins Schlafzimmer hinaufzutragen, doch nachdem er sie kurz angehoben hatte, setzte er sie wieder ab, nahm nur seinen Laptop und sammelte die Post vom Boden auf.
Vielleicht war Jill zu ihrer Mutter geflogen, dachte er. Mit diesem Gedanken hatte sie schon eine ganze Weile gespielt. Er ließ die Briefe auf den Küchentisch fallen, schloss den Laptop ans Telefon an und fuhr ihn hoch. Während er wartete, trennte er die Spreu vom Weizen, indem er die Reklame aussortierte. Übrig blieben ein Umschlag von dem Komitee, das Michael Bonner unterstützte, ein Freund von Greg, der für den Senat kandidierte, ein Brief von einer Freundin aus Jills Collegezeit, ein Kuvert mit dem Poststempel von Akron, Ohio, wo Jills Mutter lebte – offenbar abgeschickt, bevor Jill sich zu dem Besuch bei ihr entschloss –, und eines mit einem noch vertrauteren Poststempel und einem unverwechselbaren Duft.
Verwunderlicherweise war es nicht wie gewohnt elfenbeinfarben und burgunderrot beschriftet, sondern safrangelb, mit kunstvollen, blauen Druckbuchstaben, was die Vermutung in ihm weckte, dass es eine Einladung enthielt.
Der Zeitpunkt verwunderte ihn allerdings ebenfalls, denn zum einen fanden für gewöhnlich nur zwei Feste im Jahr auf dem Weingut statt – eines, um den Beginn des Frühlings zu begehen, und eines anlässlich der Lese –, und zum anderen erschien es ihm unpassend, dass seine Mutter so kurz nach dem Tod ihres langjährigen Ehemannes schon wieder ans Feiern dachte. Alexander Seebring hätte es jedoch wahrscheinlich sogar gutgeheißen. Er hatte hart gearbeitet und Asquonset schließlich zu einem Begriff gemacht. Als das Gut nach schwierigen Anfangsjahren schließlich einen ansehnlichen Gewinn erwirtschaftete, bewies er, dass er nicht nur zu schuften verstand, sondern auch zu genießen. Natalie war in ihrem Element, wenn sie rauschende Feste arrangierte, die Leute vom Partyservice, Floristen und die jeweilige Musikkapelle freundlich-energisch mit ihren Vorstellungen vertraut machte. Greg lächelte, als er sie jetzt im Geiste vor sich sah, eine zierliche Frau mit einer starken Persönlichkeit, tüchtig und lebensbejahend. Offenbar war sie der Ansicht, lange genug getrauert zu haben. Sie hasste Schwarz, hatte sich für die Beerdigung eigens ein Kleid kaufen müssen, weil sie kein schwarzes besaß.
Plötzlich kam ihm ein Gedanke. Seine Mutter hatte von ihm erwartet, dass er nach dem Tod seines Vaters die Führung des Weingutes übernahm, doch er war ihrem Wunsch nicht nachgekommen. Vielleicht hatte sie ja einen Käufer gefunden und wollte diesen nun im Rahmen einer Party vorstellen? Nein – das hätte sie ihm doch wohl vorher mitgeteilt. Na ja – vielleicht auch nicht. Immerhin hatte er ihr seine Einstellung zu dem Weingut in deutlichen Worten dargelegt. Er war selbständiger Meinungsforscher, er war es gerne, und er war erfolgreich. Der Wein war die Passion seines Vaters gewesen – nicht seine.
Was aber nicht hieß, dass ihm das Schicksal von Asquonset gleichgültig gewesen wäre. Wenn Natalie das Gut verkaufte, käme Geld herein, das eines Tages zur Hälfte ihm gehören würde. Darum war er entschlossen, einen potenziellen Käufer unter die Lupe zu nehmen, denn er wollte vermeiden, dass seine Mutter den Besitz unter Wert aus der Hand gab.
Er legte den Umschlag auf die Arbeitsplatte, zog den Laptop zu sich heran und gab sein Passwort ein, doch dann wanderte sein Blick zu dem Kuvert zurück. Seine Neugier siegte. Er riss es auf und zog eine Briefkarte heraus.
Bitte machen Sie uns die Freude, am Labor-Day-Sonntag um sechzehn Uhr im Haupthaus des Weingutes Asquonset unsere Hochzeit mit uns zu feiern.
Natalie Seebring und Carl Burke
Er starrte verdattert auf den Text hinunter.
Seine Mutter und Carl wollten heiraten?
Seine Mutter wollte Carl heiraten? Was war das denn für eine Schnapsidee?
Natalie war sechsundsiebzig. Sollte sie plötzlich senil geworden sein? Und Carl? Der musste sogar noch ein paar Jahre älter sein. Was dachte er sich dabei?
Carl arbeitete schon seit einer Ewigkeit auf dem Weingut. Alexander hatte einen Freund in ihm gesehen. Aber ein Freund würde sich nicht sechs Monate nach dem Tod eines Mannes dessen Witwe schnappen.
Allerdings bewies auch Natalie mit diesem Schritt einen erschütternden Mangel an Loyalität.
Greg hatte sich nichts dabei gedacht, dass sie Carl in letzter Zeit öfter erwähnt hatte – schließlich war es verständlich, dass sie nach Alexanders Ableben Rat und Hilfe bei ihm suchte –, aber als er die Gespräche jetzt im Geiste rekapitulierte, wurde ihm bewusst, dass seine Mutter regelrecht ins Schwärmen geraten war, wenn sie auf den Verwalter zu sprechen kam.
War es eine Liebesgeschichte? Ging es etwa um Sex? Waren sie dafür nicht schon ein wenig zu alt? Greg war vierzig und verlor zusehends das Interesse daran. Sex bedeutete Anstrengung, wenn er befriedigend sein sollte. Nun ja – vielleicht waren die Ansprüche der beiden nicht so groß wie seine. Es bereitete ihm schon Unbehagen, überhaupt daran zu denken, dass seine Mutter »es tat«, aber bei der Vorstellung, dass Carl ihr Partner war, sträubten sich seine Nackenhaare.
Wahrscheinlich wollte der alte Bock nur seinem Sohn, Simon, das Weingut sichern, dem er, als er in den Ruhestand ging, die Verwaltung übertragen hatte. Na schön – genau genommen hatte Alexander das getan, aber Carl war so lange Geschäftsführer gewesen, dass er bei der Wahl seines Nachfolgers bestimmt ein Wörtchen mitzureden gehabt hatte. Gregs erster Impuls war, Natalie anzurufen und ihr die Augen über ihren berechnenden Bräutigam zu öffnen, doch dann verwarf er den Gedanken wieder. Erstens wusste er nicht genau, ob der Mann tatsächlich unlautere Motive hatte, und zweitens konnte er schlecht zu ihr sagen: »Ich will das Weingut nicht, aber ich will auch nicht, dass Simon es bekommt.«
Vielleicht sollte er erst einmal seine Schwester anrufen. Sie hatte einen engeren Kontakt zu Natalie als er, und sie wusste vielleicht, was da vorging. Allerdings hatte er auch zu ihr keine nennenswerte Beziehung. Sie war sechzehn Jahre älter als er, und das Einzige, was sie gemeinsam hatten, war die Mutter.
Leise fluchend, öffnete er den obersten Hemdknopf. Diese Hochzeit passte ihm nicht nur prinzipiell nicht in den Kram, auch vom Termin her nicht, denn er hatte für das Labor-Day-Wochenende einen Angelausflug nach Ontario geplant und bereits alles gebucht. Auf keinen Fall würde er seinen hart verdienten Kurzurlaub abblasen, um auf Asquonset Blumen zu streuen.
Jill allerdings hätte sich, vor die Wahl gestellt, für Asquonset entschieden – seine Frau war gerne dort. Zumindest glaubte er das. In letzter Zeit war sie sehr verschlossen. Irgendetwas stimmte nicht mit ihr. Konnte man mit achtunddreißig eine Midlifecrisis haben? Die Vorstellung war irritierend, aber nicht so irritierend wie die, dass Natalie Carl heiraten würde.
Er durchquerte die Küche und öffnete die Tür zur Garage. Jills Wagen war nicht da, was wahrscheinlich bedeutete, dass sie ihn am Flughafen stehen gelassen hatte. Also besuchte sie tatsächlich ihre Mutter, dachte er. Dann kam ihm eine Idee. Vielleicht könnte er in dem Brief von seiner Schwiegermutter an Jill einen Hinweis darauf finden, was seine Frau beschäftigte. Er würde einfach sagen, er habe das Kuvert bei der Durchsicht der Post versehentlich geöffnet. »Lieber Greg«, las er.
Lieber Greg? Verdutzt zog er das Kuvert zu Rate: Es war nicht von seiner Schwiegermutter an ihre Tochter adressiert, sondern von seiner Frau an ihn! Mit einem unguten Gefühl in der Magengegend las er weiter.
***
In Cambridge, Massachusetts, saß Olivia Jones in einer zum Fotoatelier umfunktionierten Hinterhofgarage, die zu einem alten, in einer schmalen Seitenstraße gelegenen, weiß gestrichenen viktorianischen Gebäude gehörte, und träumte vor sich hin. Das war einer der reizvollen Aspekte ihrer Tätigkeit. Sie restaurierte Fotografien, eine Aufgabe, die Geduld, gute Augen und eine ruhige Hand erforderte. Sie brachte diese drei Voraussetzungen mit und dazu eine ausgeprägte Phantasie, dank der sie sich in fast jede Szenerie, die auf ihren Tisch kam, hineinversetzen konnte. Im Augenblick befand sie sich, während sie mit verschiedenen Tönen grauer Tusche ein Gesicht wiederherstellte, Anfang der dreißiger Jahre in Kalifornien bei einer Familie von Wanderarbeitern. Die Wirtschaftskrise war in vollem Gange, das Leben hart und die Ernährung mangelhaft. Kinder arbeiteten mit ihren Eltern und Großeltern Stunde um Stunde, wo immer eine Ernte einzubringen war. Sie gingen schmutzig aufs Feld hinaus und kamen noch schmutziger von dort zurück. Ihre Gesichter waren ernst und hager, die Augen darin gespenstisch groß. Sie saßen dicht beieinander auf der Veranda einer verwitterten Holzhütte. Olivia schlängelte sich an ihnen vorbei und ging hinein.
Entlang der Wände standen Pritschen, in der Mitte des kleinen Raumes ein Herd und ein paar Stühle. Die Behausung war ärmlich, aber der Duft des frisch gebackenen Brotes auf dem primitiven Tisch und des brodelnden Eintopfes auf dem Herd schuf eine behagliche Atmosphäre. Auf einem Brett an der Wand gaben sich mehrfach angeschlagene Tongefäße ein Stelldichein mit Blechtellern und -bechern. Sie würden klappern, wenn die Familie später gemeinsam äße. Olivia hörte es jetzt schon. Als sie wieder auf die Veranda hinaustrat, wurde sie ein Mitglied der Gruppe, war mit den Menschen verbunden, wie sie miteinander verbunden waren, neun Menschen aus drei Generationen, die aus ihrem Zusammenhalt die Kraft schöpften, ihr trostloses Dasein zu ertragen. Sie hatten keine materiellen Güter – nur einander. Olivia war fünfunddreißig. Sie hatte eine zehnjährige Tochter, einen Job, eine Wohnung, einen Fernseher, einen Videorecorder, einen Computer und einen Wäschetrockner. Sie hatte ein Auto. Sie hatte Markenkleidung im Schrank und eine alte, wertvolle Kamera. Und doch beneidete sie die Wanderarbeiterfamilie – und zwar um ihre innige Beziehung.
»Das waren schwere Zeiten damals«, kam eine barsche Stimme über ihre Schulter. Sie schaute zu ihrem Boss, Otis Thurman, auf, der mit finsterer Miene das Foto musterte. Es gehörte zu einer erst kürzlich entdeckten Serie, die der berühmten Dorothea Lange zugeschrieben wurde. Das Metropolitan Museum in New York hatte Otis beauftragt, sie zu restaurieren, und er hatte den Auftrag an Olivia weitergegeben.
»Es waren aber auch einfachere Zeiten«, sagte sie.
»Das meinen Sie nur, weil Sie sie nicht erlebt haben«, erwiderte er schroff. »Ich gehe jetzt. Vergessen Sie nicht, nachher hinter sich abzuschließen, wenn Sie Feierabend machen.« Mit einem für seine fünfundsiebzig Jahre erstaunlich forschen Schritt steuerte er auf die Tür zu. Er war den ganzen Tag brummig gewesen, aber nach fünf Jahren bei ihm nahm Olivia seine Stimmungen längst nicht mehr persönlich. Otis wäre gerne ein großer Maler geworden, doch seine Kreativität blieb weit hinter seinen Fähigkeiten als Restaurator zurück. Aber die Hoffnung auf den großen Wurf würde er bis zu seinem letzten Atemzug nicht aufgeben. Wenn er in den Ruhestand träte, bis wohin es jetzt noch sieben Wochen waren, wollte er sich voll und ganz der Malerei widmen.
Er freute sich darauf, Olivia nicht. Er rechnete ihr die Stunden vor. Olivia versuchte, es nicht zu hören. Wir sind ein gutes Team, versuchte sie, ihn umzustimmen. Ich bin zu alt für diese Arbeit, hielt er ihr entgegen. Das war der Punkt, der sie an dieser Wanderarbeiterfamilie faszinierte. Der älteste der Männer auf dem Foto war ein Greis gegen Otis, aber er war immer noch mit von der Partie, immer noch ein produktives Mitglied der Gruppe.
Heute war das anders. Die Menschen brannten aus, und das war kein Wunder. Sie schritten allein und ohne Netz über das Hochseil des Lebens. Olivia sah Otis’ Ruhestand auch um seinetwillen besorgt entgegen. Sie stellte sich vor, wie er tagein, tagaus zu Hause saß und Bilder malte, die seinen hohen Ansprüchen nicht genügten, und niemanden hatte, an dem er seine Frustration auslassen konnte. Er würde nicht glücklich werden. Irrtum, Olivia, korrigierte sie sich. Er hat jede Menge Freunde in Künstlerkreisen und eine Menge Geld gespart. Er wird die Zeit genießen. Auf dich kommen Probleme zu.
Sie hatte endlich ihre Nische gefunden. Fotografien zu restaurieren, lag für einen Menschen, der etwas von Kameras verstand und eine künstlerische Ader besaß, nahe, und auf Olivia traf beides zu, doch es hatte lange gedauert, bis sie darauf gekommen war. Sie hatte gekellnert. Sie hatte als Telefonverkäuferin gearbeitet. Sie hatte Kleidung verkauft. Anschließend waren es Kameras gewesen, und dabei hatte sie ihre Liebe zur Fotografie entdeckt. Dann war Tess zur Welt gekommen, woran sich eine kurze Lehrzeit bei einem Fotografen und eine freiberufliche Tätigkeit für ein Museum anschlossen, in dessen Auftrag sie die Ausstellungen dokumentierte. Danach war sie bei Otis gelandet, und seitdem hatte sie zum ersten Mal wirklich Freude an ihrer Arbeit. Fotografien zu restaurieren, entsprach ihr mehr als alles, was sie davor gemacht hatte. Sie konnte sich stundenlang in alten Fotos verlieren. Allein der Geruch war schon berauschend für sie. In ihren Augen war die Welt von gestern romantischer als die von heute. Sie hätte gerne damals gelebt.
Olivia machte es Freude, mit Otis zusammenzuarbeiten, und das beruhte auf Gegenseitigkeit. Nur wenige Menschen waren ihr in ihrem fünfunddreißigjährigen Leben fünf Jahre erhalten geblieben. Zugegeben, sie sah ihm seine Launen nach, und Otis wusste, was er an ihr hatte, aber darüber hinaus mochte er sie auch wirklich. Das bewies das Zwanzig-auf-fünfundzwanzig-Foto an der Wand, das er letzte Woche von ihr gemacht hatte, als sie mit raspelkurzen Haaren zur Arbeit gekommen war. Der Kahlschlag war ihr eigenes Werk gewesen, das Ergebnis eines Augenblicks, in dem ihre langen Haare sie angesichts der momentanen Hitzewelle genervt hatten. Die Reue war auf dem Fuße gefolgt. Ein Friseur hatte den Schaden begrenzt, aber sie war trotzdem mit ihrem großen Strohhut im Atelier erschienen – den Otis ihr sofort vom Kopf genommen hatte.
Ausnahmsweise hatte ihr Boss etwas Nettes zu ihr gesagt. Er meinte, die kurzen Haare stünden ihr, gäben ihr etwas Unbeschwertes, Fröhliches, und dann hatte er sie vor die nackte Betonwand gestellt, um diese Ausstrahlung auf Zelluloid zu bannen. Sie hatte sich zutiefst unbehaglich in ihrem langen Etuikleid und mit den unter dem Saum aus zierlichen Sandalen hervorlugenden Zehenspitzen gefühlt. Zudem war sie es nicht gewohnt, auf dieser Seite der Kamera zu stehen, außerdem war ihr ihre Frisur peinlich, und so hatte sie in ihrer Unsicherheit die Arme um ihre Taille gelegt, die Schultern hochgezogen.
Otis hatte durch die Positionierung des Scheinwerfers und die Wahl des Aufnahmewinkels das Kunststück zuwege gebracht, dass sie biegsam anstatt dünn wirkte und durchgeistigt anstatt schüchtern, der verunglückte Schnitt ihrer rotblonden Haare modisch und der rotbraune Lack auf ihren Zehennägeln exotisch. Aus dem fein geschnittenen Gesicht blickten ihr große Augen entgegen. Irgendwie hatte er es geschafft, dass sie hübsch aussah. Als ihr Blick zu dem daneben hängenden Foto weiterwanderte, steigerte sich ihr Lächeln zum Strahlen, denn darauf war sie mit der damals neunjährigen Tess zu sehen. Der Fotograf hatte sie auf ihren Wunsch hin wie zwei Tanzmädchen aus einem Saloon im Wilden Westen ausstaffiert. Otis fand das »entsetzlich kitschig«, aber sie hatten einen Riesenspaß beim Verkleiden gehabt. Für diesen Sommer planten sie ein elisabethanisches Outfit – falls sie sich noch mal ein Wochenende an der Küste leisten könnten. Ohne den Kindesunterhalt hatte sie ganz schön zu knapsen.
Jared Stark hatte sie in jeder erdenklichen Weise enttäuscht. Sie war davon ausgegangen, dass er sie ewig lieben würde. Das erwies sich als Irrtum. Sie war ebenfalls davon ausgegangen, dass er ihr gemeinsames Kind lieben würde und dann, nach der Trennung, dass sie zumindest mit einer finanziellen Unterstützung bis zu dessen Ausbildungsende rechnen konnte. Aber was hatte er getan? Er war gestorben! Ein Timer schnarrte. Olivia schob den Zorn beiseite, der die Trauer verdrängt hatte, und stellte den Alarmton ab. Es war Zeit, Tess, die große Liebe ihres Lebens, von der Schule abzuholen. Sie schraubte die Tuschefläschchen zu, wusch die feinen Pinsel aus und deponierte die kostbaren Fotografien im Tresor. Dann schuf sie im Büro Ordnung, packte ihre Aktentasche mit Papierkram voll, den sie zu Hause erledigen wollte, und ging zur Ausgangstür. Als sie sie öffnete, stand der Postbote vor ihr.
Sie nahm ihm den Stapel ab, den er ihr hinhielt, und kehrte ins Büro zurück, wo sie sich ans Sortieren machte. Otis’ private Post wurde aufeinandergelegt, die ans Studio daneben. Unter den großformatigen Sendungen befanden sich ein Supermarkt-Prospekt, eine Zuschrift des American Institute for Conservation of Historie and Artistic Works, die aktuelle Ausgabe der Time und ein brauner DIN-A4-Umschlag. Als sie das Logo erkannte, erwachte Freude in ihr: Eine stilisierte, burgunderrote Traube auf elfenbeinfarbenem Grund, die aus einem Weinglas quoll. Darunter, in den ihr inzwischen vertrauten Lettern gesetzt der Absendername: Weingut und Weinhandlung Asquonset, Asquonset, Rhode Island. Die Adresse war handgeschrieben, unverkennbar von Natalie Seebring.
Olivia hob das Kuvert an die Nase, schloss die Augen und atmete tief den Freesienduft ein, den sie ebenso gut kannte wie die Handschrift. Er war vornehm, vermittelte Wohlstand und Geborgenheit. Sie schwelgte einen Moment in diesem Gefühl, wendete sich dann der Realität zu und ging zu dem Tisch hinüber, auf dem die letzten Seebring-Fotos lagen. Sie waren in den frühen fünfziger Jahren aufgenommen worden und hatten eines unterschiedlichen Aufwandes an Restaurationsarbeit bedurft, die Olivia mit Begeisterung ausgeführt hatte. Jetzt waren die Bilder bereit zur Rücksendung – und nun war ein neuer Schwung gekommen. Natalies Timing hätte nicht besser sein können.
Olivia hatte die alte Dame nie kennen gelernt, aber ihr war, als kenne sie sie genau. Fotografien erzählten Geschichten, und was sie nicht erzählten, dichtete Olivia hinzu. Natalie Seebring war in den zwanziger Jahren ein entzückendes Kleinkind gewesen, in den dreißiger Jahren ein hinreißender Backfisch, in den vierziger Jahren die zauberhafte Braut eines blendend aussehenden Soldaten und in den fünfziger Jahren eine lächelnde, zweifache Mutter. Den Fotografien zufolge kleidete sie sich elegant und lebte im Luxus. Der Salon mit dem kostbaren Orientteppich, der sichtlich teuren Sitzgruppe, den Gemälden an den Wänden entsprach ganz dem Bild wohlsituierter Weingutsbesitzer, und der selbst auf den Schwarzweißaufnahmen farbenprächtig wirkende üppige Garten rundete den Eindruck ab. Hier hatte sie es weder mit einer armen Wanderarbeiterfamilie zu tun, noch waren diese Fotos künstlerisch wertvoll wie die von Dorothea Lange, aber sie hatte sich genauso mit der Familie befasst und sich in den Reichtum und die daraus resultierende Lässigkeit hineinversetzt wie in die Armut und die daraus resultierende Verhärmtheit. Es hatte nicht lange gedauert, und Olivia war in ihrer Phantasie zu einer Seebring geworden. Ihre eigene Lebensgeschichte hatte überhaupt keine Ähnlichkeit mit der, die die Seebring-Fotografien dokumentierten. Sie hatte ihren Vater nie kennen gelernt – ihre Mutter kannte nicht einmal seinen Namen. Olivia war lediglich das Ergebnis eines alkoholumnebelten Geschlechtsakts in einer Silvesternacht in einem Durchgang abseits des Times Square von Manhattan.
Feministinnen hätten den Akt vielleicht als Vergewaltigung bezeichnet, aber als die damals siebzehnjährige Carol ein paar Monate darauf begriff, dass sie schwanger war, erklärte sie ihren Eltern trotzig, es sei Liebe gewesen. In den Augen dieser gottesfürchtigen Menschen brachte ihre rebellische Tochter das Fass mit ihrer Eröffnung zum Überlaufen. Sie verstießen sie, und Carol nahm, ihrem rebellischen Naturell entsprechend und überzeugt, die Eltern damit zu strafen, nichts mit als ihren Namen: Jones.
Damit war Olivia nicht geholfen. Leute, die Jones hießen, gab es in jedem Telefonbuch seitenweise, und im New Yorker Telefonbuch waren es wahre Heerscharen. Und so konnte sie ihre Großeltern nicht finden, so wie sie ihre Mutter nicht finden konnte, die irgendwohin verschwunden war. In ihrem Leben gab es somit keine Verwandten – nur Tess und sie –, aber Olivia kam damit zurecht, denn ihre Tochter wog dieses Manko mehr als auf.
Das hieß jedoch nicht, dass sie keine Wunschträume hatte, und neuerdings malte sie sich aus, mit Natalie Seebring verwandt zu sein. Ihre Enkelin zu sein erschien ihr übertrieben, aber auf einigen der Vorkriegs-Asquonset-Fotos gab es eine Frau, die angesichts einer entfernten Ähnlichkeit mit Carol Jones Olivias Großmutter hätte sein können. Auf den Fotos der Nachkriegszeit hatte sie sie nicht mehr entdeckt, aber dafür fand Olivia schnell eine Erklärung. Vielleicht war sie beim Women’s Army Corps gewesen, hatte sich in einen Soldaten verliebt und war mit ihm nach New York gezogen. Vielleicht war ihr Mann ein befehlsgewohnter Offizier gewesen, der ihr den Kontakt mit ihrer Familie untersagt hatte; vielleicht war er nur eifersüchtig gewesen und wollte sie ganz für sich allein haben. War diese Frau Natalies Schwester, dann wäre Natalie Olivias Großtante, und wenn sie nur eine Kusine war, wäre sie auch mit Natalie blutsverwandt. Olivia schaute auf die Uhr: Es war höchste Zeit, Tess abzuholen. Aber ihre Neugier war stärker als ihr mütterliches Pflichtgefühl. Sie öffnete das große Kuvert und schüttete den Inhalt auf den Tisch. Starker Freesienduft entströmte den Dutzenden Schwarzweißfotografien, aus denen ein safrangelber Umschlag hervorblitzte. Sie zog ihn heraus. Er war an Otis gerichtet, die Adresse nicht mit dem gewohnten Schwung von Natalie geschrieben, sondern in kunstvollen Druckbuchstaben kalligraphiert. Olivia schloss daraus, dass es sich um die Einladung zu einem Fest auf dem Weingut handelte und nahm sich vor, Otis darum zu bitten, ihn begleiten zu dürfen. Sollten die Leute ruhig denken, dass sie seine Freundin sei, und hinter vorgehaltener Hand lästern. Sie wollte Asquonset sehen – und Natalie kennen lernen.
Sie legte das Kuvert auf den Privatpost-Stapel, nahm ihn jedoch gleich wieder weg und steckte ihn zusammen mit den Fotos in den braunen Umschlag zurück. Otis würde nicht vor morgen früh ins Atelier kommen, und der Gedanke, die Einladung über Nacht bei sich zu Hause zu haben, gefiel ihr irgendwie. Also verstaute sie das große Kuvert in ihrer Aktentasche. Nach einem letzten, prüfenden Blick in die Runde verließ sie das Studio und schloss hinter sich ab. Mit Natalies heutiger Fotosendung würde sie sich am Abend beschäftigen, wenn alles andere getan wäre.
Von Vorfreude beflügelt, lief sie durch die engen, von dicht beieinander stehenden Häusern, Bäumen und geparkten Autos gesäumten Straßen. Es war ein schwüler Junitag. Als sie – zehn Minuten zu spät – an der Schule ihrer Tochter ankam, war sie schweißgebadet. Die meisten Kinder waren bereits weg und ein paar Nachzügler auf dem Spielplatz mit sich beschäftigt. Tess stand allein in einer Ecke des Schulhofs. Der bücherschwere Rucksack zog ihre Schultern herunter. Mit dem nach innen gedrehten rechten Fuß, der fast bis auf die Nasenspitze gerutschten Brille und dem unglücklichen Gesichtsausdruck bot sie einen herzzerreißenden Anblick.
Kapitel 2
»Hi, Süße«, begrüßte Olivia sie, um Munterkeit bemüht.
Ihre Umarmung wurde nur andeutungsweise erwidert, und als sie ihrer Tochter die ungebärdigen braunen Locken aus dem Gesicht strich, brachte ihr das einen ungeduldigen Blick ein.
»Du kommst zu spät«, konstatierte Tess.
»Ich weiß. Es tut mir Leid. Gerade, als ich gehen wollte, kam die Post, und ich wurde aufgehalten. Wie war dein Tag?«
Tess zuckte mit den Schultern und setzte sich in Bewegung. Sie legte ein solches Tempo vor, dass Olivia Mühe hatte, mit ihr Schritt zu halten, obwohl ihre Beine ein ganzes Stück länger waren.
»Tess?«, hakte sie nach.
Noch immer trotziges Schweigen.
»War der Tag schlimm?«
»Das ist gar kein Ausdruck! Ich bin dumm. Ich bin einfach dumm.«
»Nein, das bist du nicht.«
»Doch! Ich bin die Dümmste in der Klasse.«
»Du bist die Klügste in der Klasse. Dein IQ ist Schwindel erregend hoch. Du bist nur Legasthenikerin.«
»Nur?«, echote Tess aufgebracht und blieb stehen. Ihre Sommersprossen wirkten wie dunkle Tintenspritzer auf dem blassen Gesicht. Die großen braunen Augen hinter der randlosen Brille, deren dicke Gläser sie noch größer erscheinen ließen, schwammen plötzlich in Tränen. »Sie hat mich wieder nachsitzen lassen, Mom, weil meine Schulaufgabe so schrecklich aussah. Ich kann nicht richtig schreiben. Sie kann meine Schrift nicht lesen. Und ich kann nicht richtig buchstabieren. Und ich habe nicht gemacht, was wir machen sollten, weil ich sie nicht verstanden habe. Ich kann also auch nicht richtig hören!«
Olivia nahm das Gesicht ihrer Tochter in die Hände. »Du kannst hervorragend hören. Du hörst jedes Wort, das ich sage – sogar, wenn ich leise spreche, weil etwas nicht für deine Ohren bestimmt ist.«
Tess befreite sich mit einem Kopfschütteln und stürmte weiter. Olivia holte sie erst ein, als sie um die Ecke bog, und musste ihren Laufschritt noch einige Blocks weit beibehalten, bis Tess sich endlich abreagiert hatte und erneut stehen blieb. Sie nahm ihr kleines Mädchen in den Arm, und diesmal spürte sie keine Ablehnung. Nach einer Weile setzten sie ihren Weg fort, bogen rechts in eine Straße ein und kurz darauf links in eine andere.
»Es ist wie in einem Labyrinth«, meinte Olivia, als sie erneut die Richtung wechselten, in der Hoffnung auf ein Lächeln. Stattdessen erntete sie ein mürrisches »Ja – und wir sind Ratten.«
»Und welche Belohnung erwartet uns am Ende?«, ging Olivia auf die Bemerkung ihrer Tochter ein, aber sie erhielt keine Antwort.
Und dann waren sie endlich zu Hause. Sie wohnten in dem Anbau eines kleinen Ziegelhauses, das in seiner Hochzeit jemandem aus Cambridges Möchtegern-Society gehört hatte. Die Tatsache, dass der Abstand zu den Nachbarn auf beiden Seiten geringer war als allgemein ortsüblich, wurde durch dicht stehende Bäume kaschiert, die darüber hinaus einst verhindert hatten, dass die Nachbarn beobachten konnten, wie die Eigentümer auf der einen Seite ihre Veranda zumauerten und ein Schlafzimmer und ein Bad anbauten, um danach das Ganze als Wohnung zu vermieten. Olivia war das vorläufige Schlusslicht einer langen Reihe von Mietern dieser kleinen Wohnung. Die Kochnische stammte aus den Fünfzigern, und die Badezimmerausstattung hatte ebenfalls einige Jahrzehnte auf dem Buckel, aber Olivia hatte sich in das Apartment verliebt, noch bevor sie es von innen gesehen hatte, war der Romantik der efeubewachsenen Mauern und des von blühendem Bergahorn gesäumten Plattenweges verfallen, der zu ihm führte.
Erst nach dem Einzug wurde ihr klar, wie winzig ihr neues Reich war. Sicher hätte sie für den geforderten Preis etwas Größeres finden können, aber wahrscheinlich nichts mit diesem Charakter und Charme. Sie überließ Tess das kleine Schlafzimmer, strich die Decke himmelblau, malte an die Wände hohe Bäume, womit sie die Illusion einer Lichtung schuf. Sie selbst bezog das Wohnzimmer, stellte ein Schlafsofa hinein, dem sie zur Linken und Rechten eine Hummerfalle stellte, die als Beistelltisch und Lampenuntersatz diente. Eine alte Holztruhe auf einem Rollwagen – beides grün gestrichen wie die Hummerfallen – fungierte als Kommode, die sich dank der Räder abends leicht aus dem Weg rollen ließ. In der Ecke stand ein Polstersessel, in dem Olivia und Tess für die allabendliche Gutenachtlektüre mit Leichtigkeit zu zweit Platz fanden. In etwa einem Meter Abstand von der Küchenzeile scharten sich vier Stühle um einen Tisch, der wie die Stühle aus der frühamerikanischen Epoche herübergerettet worden war. Olivia hatte sich dieses antike Kleinod im vergangenen Jahr selbst zum Geburtstag geschenkt und brachte seitdem Stunden um Stunden damit zu, sich auszumalen, in welchen Häusern der Tisch früher wen zum Essen eingeladen hatte.
In dem Moment, in dem sie die Tür aufschloss, begann das Telefon zu klingeln. Mutter und Tochter wechselten einen wissenden und genervten Blick.
»Das ist Ted«, sagte Tess.
»Mmm.«
»Wir sind zehn Minuten später zu Hause als sonst. Ich wette, er versucht schon eine Weile, dich zu erreichen.« »Mmm.«
»Wahrscheinlich ist er wieder mal hektisch wegen irgendwas«, meinte Tess in einem verächtlichen Ton, für den ein Tadel wegen Respektlosigkeit fällig gewesen wäre, wenn Olivia ihre Vermutung nicht im Stillen geteilt hätte. Ted war häufig hektisch, ein Mann der immer auf Hochtouren lief. Olivia hatte ihn, einem Impuls folgend, an der Kasse einer Buchhandlung angesprochen. Dass er bei dieser ersten Unterhaltung kein einziges Mal gelächelt hatte, hätte ihr zu denken geben müssen, aber sie war beeindruckt, dass er ihr, während er mit ihr sprach, im Gegensatz zu den meisten anderen Männern in die Augen schaute, dass er im Gegensatz zu den meisten anderen Männern gesprächig war, und dass er sich, im Gegensatz zu allen anderen Männern dafür interessierte, was sie las und warum sie es tat.
Natürlich nahm sie zu Beginn an, dass sein Eifer aus Verliebtheit resultierte. Er schenkte ihr Blumen, er führte sie zum Essen aus, er besorgte Kinokarten. Er rief sie so oft an, dass sie ihn schließlich bat, sich damit auf den Feierabend zu beschränken. Zu dieser Zeit hatte sie längst begriffen, dass er ganz und gar nicht aus einem Überschwang der Gefühle heraus handelte, sondern ihre Beziehung genauso neurotisch handhabte wie sein restliches Leben. Sie gingen jetzt seit fünf Monaten miteinander aus, und das Ende war abzusehen.
Es überraschte Olivia nicht – sie hatte einfach kein Händchen für Männer. In einen verliebte sie sich wegen seiner schönen Augen, in einen anderen wegen seiner erotischen Stimme, und damals in Pete Fitzgerald, weil er kochen konnte. Er kochte irisch, italienisch, koscher und griechisch, und er backte die luftigsten russischen Blinis, die sie je gegessen hatte – aber abgesehen von diesem einen Vorzug war er, wie all die anderen auch, ein Blindgänger.
Als das Telefon nicht zu klingeln aufhörte, riss sie den Hörer von der Gabel und meldete sich gereizt mit einem knappen »Ja, bitte?«
»Hi«, sagte Ted. »Ich wollte mich nur mal melden. Hier war heute der Teufel los, eine Konferenz nach der anderen, als ginge es darum, die Welt für immer zu verändern, und nicht um einen Fünfjahresplan für eine mickrige Firma, die wahrscheinlich den Jahreswechsel nicht erleben wird. Warum bist du erst so spät zu Hause?«
»Ich wurde aufgehalten«, antwortete Olivia und sandte einen Blick gen Himmel, der Tess unterdrückt losprusten ließ.
»Und jetzt habe ich keine Zeit, mit dir zu telefonieren.« »Ich kenne das, ich bin seit heute früh auch noch nicht zum Durchatmen gekommen, musste ohne Unterbrechung reden und bin selbst total geschafft. Ich rufe in zehn Minuten noch mal an.«
»Das geht nicht – Tess und ich haben zu tun. Ich melde mich nachher bei dir.«
»Okay, auch gut. Lass mal sehen ... Ich bin noch eine Stunde hier und anschließend eine Stunde im Fitnesscenter – vorausgesetzt, die Geräte, die ich brauche, sind frei, was eine kühne Hoffnung ist, denn meistens belegen irgendwelche Muskelprotze die Gewichte mit Beschlag. Ich bin zwar kein Schwächling, aber wenn die eine drohende Miene aufsetzen, ziehe ich mich zurück. Falls ich also warten muss und länger als eine Stunde dort bin ... rufst du mich um acht zu Hause an?«
»Wenn ich dazu komme. Jetzt muss ich aber wirklich auflegen. Bis dann.« Erschöpft ließ sie den Hörer auf die Gabel sinken. Ted war anstrengender als ein Hundertmetersprint. »Mrs Wright hat mir einen Brief für dich mitgegeben«, eröffnete Tess ihrer Mutter übergangslos.
»Oje.« Ted war vergessen. Olivia atmete tief durch. Sie hoffte inständig, dass der Brief in einem verschlossenen Umschlag steckte.
»Ich habe ihn zerrissen.«
»Das ist nicht dein Ernst!«
»Zerrissen und weggeworfen.«
»Oh, Tess. Ich hätte ihn doch lesen müssen.«
»Nein. Mrs Wright ist nur eine Lehrerin. Die weiß auch nicht alles.«
Auch wenn der Brief in einem verschlossenen Umschlag gesteckt hatte – ihre Tochter kannte den Inhalt offensichtlich. »Wo ist der Brief?«
Tess senkte trotzig den Blick.
Olivia umfasste ihr Kinn und hob es an. »Wo ist der Brief?« Tess’ Blick floh zur Zimmerdecke hinauf. Seufzend gab Olivia sie frei und trat einen Schritt zurück, und dann entdeckte sie die zerfetzte Ecke eines Kuverts, die aus einer Tasche von Tess’ Jeans lugte. Sie zog einen Teil heraus, einen zweiten und schließlich einen dritten, trug ihre Beute zu der schmalen Arbeitsfläche zwischen Herd und Spüle und setzte das Puzzle zusammen.
»Liebe Mrs Jones«, stand da, »wir müssen dringend darüber sprechen, wie es mit Tess weitergehen soll. Ich verstehe natürlich, dass Ihnen die Vorstellung unangenehm ist, sie die Klasse wiederholen zu lassen, aber meine Briefe zu ignorieren löst das Problem nicht.«
»Welche Briefe?«, fragte sich Olivia, und ein naheliegender Verdacht keimte in ihr auf.
»Am kommenden Montag fällt die endgültige Entscheidung über die Zusammensetzung der nächstjährigen Klassen. Wenn ich bis dahin nichts von Ihnen höre, werde ich meine Empfehlung vorbringen, Tess noch einmal für die vierte Klasse einzuteilen. Mit freundlichen Grüßen, Nancy Wright.« In Olivias Kopf überschlugen sich die Gedanken. Tess war getestet worden, und es war Legasthenie diagnostiziert worden. Sie hatte dreimal pro Woche Nachhilfe in der Schule, und bei Olivias letztem Gespräch mit beiden Lehrkräften war ihr eine leichte Besserung von Tess’ Buchstabiervermögen mitgeteilt worden. Aber sie versagte weiterhin bei Prüfungsarbeiten, weil sie entweder die Anweisungen falsch las oder die Antworten voller Schreibfehler waren. Sie konnte nicht lesen. Das war ein schreckliches Problem. Sie konnte nicht lesen!
Der Nachhilfelehrer behauptete zwar, dass Tess es im Laufe der Zeit lernen würde. Olivia aber hätte gerne gewusst, im Laufe welcher Zeit. Tess schien immer weiter hinter ihren Klassenkameraden zurückzubleiben. Dabei hatte sie Freude am Unterricht. Wenn Olivia ihr vorlas, folgte sie der Geschichte begeistert, und ihre Einwürfe verrieten eine wache Intelligenz. Schritt für Schritt war sie in der Lage, auch komplizierte Zusammenhänge zu begreifen. Auf sich selbst gestellt, fehlte ihr jedoch die Fähigkeit, diese Zusammenhänge zu erkennen. Dreimal in der Woche eine halbe Stunde Nachhilfe genügte einfach nicht – wenn sich wirklich etwas tun sollte, wäre selbst die doppelte Anzahl nicht ausreichend. Im Grunde hätte sie auf eine spezielle Schule gehen müssen, doch daran war nicht zu denken, und so tat Olivia, was sie konnte, indem sie ihr bei den Hausaufgaben half und sich bemühte, die Lehrerin freundlicher zu stimmen. Was Letzteres anging, so war es natürlich nicht hilfreich, dass Tess ihr offenbar die Briefe der Lehrerin unterschlagen hatte.
»Bitte schimpf nicht mit mir«, bat Tess, den Tränen nahe. »Ich habe dir die anderen Briefe nicht gegeben, weil ich genau weiß, was sie tun will. Ich sehe es ihrem Gesicht an, wenn sie meine Arbeiten anschaut und dann mich. Ich dachte, wenn ich mich noch mehr anstrengen würde, würde ich besser werden, und dann würde sie mich nicht mehr so anschauen, aber sie tut es immer noch.«
Olivia zog Tess in ihre Arme und drückte sie fest an sich. Sie verstand ihre Tochter – und sie teilte ihre Meinung. Es war ihr von Anfang an ein Gräuel gewesen, Tess in Mrs Wrights Klasse zu wissen. Die Frau war eine Paragrafenreiterin, und Anweisungen befolgen zu müssen stellte Tess vor ein Riesenproblem. Sie geriet in Panik. Sie begann zu schludern. Sie verlor die Übersicht. Und dann begann sie wild drauflos zu raten, was wohl gemeint sein könnte. Die andere Viertklasslehrerin verstand sich bedeutend besser auf lernschwache Kinder, aber wie der Rektor von oben herab erklärt hatte, konnte sie natürlich nicht alle in ihre Klasse aufnehmen. Olivia begriff nicht, warum Nancy Wright nicht zum Telefonhörer gegriffen hatte, als ihre Briefe keine Reaktion zeitigten. Eigentlich wäre ein Anruf überhaupt angemessener gewesen als diese Schreiberei. Das Versagen eines Kindes in einem Brief festzuhalten und diesen Brief dem Kind dann mit nach Hause zu geben, erschien Olivia als ein Akt seelischer Grausamkeit. Nicht auszudenken, welchen Schaden das Selbstwertgefühl ihrer Tochter in diesem letzten Jahr genommen hatte. Zugegeben, das wäre vielleicht auch bei einem anderen Lehrer nicht ausgeblieben – Tess war in einem kritischen Alter –, aber noch ein paar solche Nackenschläge, und ihre Tochter würde nicht mehr nur Nachhilfe brauchen, sondern auch noch eine Psychotherapie.
Olivia wusste einen Nachhilfelehrer, der in den Sommerferien mit Tess arbeiten würde, aber Nachhilfe kostete Geld, und die Unterhaltszahlung, die auch nach Jareds Tod noch einige Monate lang per Dauerauftrag auf ihrem Konto einging, endete von heute auf morgen, als Jareds Eltern plötzlich behaupteten, dass Tess nicht seine Tochter sei.
Tess nicht seine Tochter sei! Diese Anschuldigung tat ihr heute noch weh.
»Natürlich ist sie das!«, erklärte Olivia dem Rechtsanwalt, der ihr die Entscheidung ihrer Schwiegereltern mitgeteilt hatte, zornbebend.
»Können Sie es beweisen?«
Selbstverständlich konnte sie das – schließlich war Tess in Fleisch und Blut vorhanden!
Aber Olivia kannte auch die Fernsehserie »The Practice« und wusste daher, wie Anwälte dachten. Anwälte verlangten in solchen Fällen einen DNA-Test.
»Mein Mandant wurde eingeäschert«, sagte der Anwalt der Schwiegereltern, »und seine Asche über den Great Smokies ausgestreut. Wenn nicht aus einer früheren Zeit ein Testergebnis vorliegt, haben Sie ein Problem. Die Familie ihres Exmannes wird kein Testmaterial zur Verfügung stellen. Sie werden klagen müssen.«
Olivia schwor sich, das umgehend in Angriff zu nehmen, doch keine zwei Minuten später siegten ihre Muttergefühle. Sie konnte Tess unmöglich einen Vaterschaftsprozess zumuten. Außerdem brauchte man Geld, um Geld erstreiten zu können.
Und so wurde die Stark-Verbindung gekappt, der Schlusspunkt unter eine traurige Geschichte gesetzt, denn es ging überhaupt nicht um Geld. Es ging um Liebe. Olivia hatte Jared geliebt. Er war ein brillanter Kopf, ein Wissenschaftler, der ständig irgendwelche Abhandlungen über geheimnisvolle Dinge schrieb, wie zum Beispiel über den Zusammenhang zwischen dem Verzehr von Karotten und der Fähigkeit, bei Nacht Vogelstimmen erkennen zu können. Er behauptete, was er tue, sei von essenzieller Bedeutung für die Menschheit, und Olivia glaubte das selbst noch, als er das Interesse an ihr verlor. Sie hatte nicht geplant, schwanger zu werden. Als es dann so weit war, sah sie darin Gottes Methode, Jared zu bedeuten, bei ihr zu bleiben. Er tat es nicht, verließ sie schon lange vor Tess’ Geburt, doch mehr als neun Jahre bezahlte er regelmäßig und ohne zu murren Unterhalt für die Tochter.
Olivia hatte gehofft, dass seine Eltern diesem Umstand eine gewisse Bedeutung beimessen würden. Sie hatte gehofft, dass sie Tess in ihr Herz schließen würden, weil sie zumindest zu einem Teil den Sohn verkörperte, den sie verloren hatten. Wie sich zeigte, sahen sie die Sache ganz anders.
Ihre Tochter war allein auf sie angewiesen. Olivia hätte ein Darlehen aufgenommen, um zusätzliche Nachhilfestunden finanzieren zu können, wenn das in Tess’ Sinn gewesen wäre – aber Tess stand der Sinn nach ganz etwas anderem: Sie wünschte sich glühend Ferien im Tennis-Camp, weil zwei der beliebtesten Mädchen aus ihrer Klasse dort sein würden, und sie es als ihre einzige Chance sah, sich zu profilieren. Sie hatte zwar noch nie Tennis gespielt, aber sie war recht gut in Leichtathletik, und wenn sie sich wirklich dahinterklemmte, wäre nichts unmöglich.
Natürlich hatte Olivia auch kein Geld für das Tennis-Camp. Sie würde in sieben Wochen nicht einmal mehr Geld für Lebensmittel haben, wenn sie bis dahin keinen anderen Job fände. In der Hoffnung auf eine Festanstellung als Hausrestauratorin hatte sie an Dutzende von Museen Bewerbungen geschickt. Die bisherige Ausbeute bestand in sechs Absagen. Wahrscheinlich könnte sie wieder in irgendeinem Fotoladen Kameras verkaufen, aber davor graute ihr.
Sie fotografierte mit Begeisterung und besaß auch eine echte Begabung dafür, aber anderen etwas beizubringen, was ihr selbstverständlich erschien, erforderte ein Maß an Einfühlungsvermögen und Geduld, das sie nicht besaß. Ihr Verstand funktionierte anders als der der meisten Menschen. Tess’ Legasthenie kam nicht von ungefähr. Was sollte sie tun? Plötzlich hatte sie eine Idee. Sie legte den Zeigefinger unter das Kinn ihrer Tochter, hob es an und verliebte sich zum millionsten Mal, als sie auf das hinreißende, sommersprossige Gesicht hinunterschaute, das eine Flut brauner Locken umrahmte – ein Erbteil ihres Vaters, der nichts von ihr hatte wissen wollen. »Hast du Lust auf chinesisches Essen?«
Tess’ Augen leuchteten auf. »Bei General Gao?« Olivia nickte. »Aber erst nach den Hausaufgaben.« »Ich bin schon am Verhungern!«
Olivia öffnete den Kühlschrank und goss Milch in ein großes Glas.
»Das wird dich rüberretten. Jetzt fang an. Je eher du fertig bist, umso eher können wir gehen.«
Tess trank einen großen Schluck. »Ich muss zwanzig Seiten lesen.«
»Zwanzig?« Zwanzig Seiten waren eine unüberschaubare Menge für eine zehnjährige Legasthenikerin. »In welchem Buch?«
Tess brachte es ihr. Ein geografischer Text!
»Okay«, überspielte Olivia ihre Verzagtheit, »dann leg schon mal los, während ich mich umziehe. Den Rest lesen wir dann gemeinsam.« Sie sammelte die Post vom Boden auf und sah sie auf dem Weg zum Schrank durch. Auf halbem Weg machte sie kehrt und ließ sich auf das Sofa sinken. Sie hielt ein Kuvert in der Hand. Es befand sich kein Absender darauf, nur ein Chicagoer Poststempel, doch der genügte.
Das Herz schlug ihr bis zum Hals. Die Schrift sah anders aus, aber es war ja schon vier Jahre her, dass ihre Mutter ihr zuletzt geschrieben hatte. In der Zwischenzeit konnte alles Mögliche passiert sein, das diese Veränderung erklärte. Vielleicht hatte sie sich den Arm gebrochen und trug einen Gipsverband. Vielleicht hatte sie den rechten Arm durch einen Unfall verloren. Vielleicht hatte sie einen Schlaganfall erlitten. Vielleicht ... vielleicht war sie nur so aufgeregt gewesen, als sie an ihre Tochter schrieb, dass ihre Hand zitterte.
Olivia riss den Umschlag auf. Enttäuschung schnürte ihr die Kehle zu, als sie ihren letzten Brief an die Mutter herauszog. Ihm war eine kurze Notiz beigelegt: »Wer immer Sie sind, hören Sie auf, Briefe an diese Adresse zu schicken. Es gibt hier keine Carol Jones.«
Olivia beugte sich vor und schlang die Arme um die Knie. Diese Adresse war die neueste, die sie hatte. Entweder war ihre Mutter unmittelbar nach ihrem letzten Brief umgezogen, oder sie hatte irrtümlich eine falsche Anschrift angegeben. Die Betonung bei dieser Variante lag auf »irrtümlich«. Olivia weigerte sich zu glauben, dass ihre Mutter es absichtlich getan hatte. Sie weigerte sich zu glauben, dass ihre Mutter keinen Kontakt zu ihr haben wollte. Zugegeben, der letzte Brief war kurz und distanziert gewesen, aber Carol hatte nicht geschrieben, ihre Tochter könne ihr gestohlen bleiben. Das hatte sie nie getan. Sie war eine Woche nach Olivias Highschool-Abschluss einfach verschwunden. Ihrer Meinung nach hatte sie ihre Mutterpflicht nun erfüllt. Andere Mütter sahen das auch so. Es war nicht tragisch.
Etwas anderes jedoch war tragisch: Wenn Carol ihren letzten Brief nicht bekommen hatte, dann konnte sie auch nicht wissen, wo sie, Olivia, jetzt lebte. Vielleicht schrieb Carol ihr ebenfalls Briefe und bekam sie zurück. Sie hatte den Nachsendeantrag zwar länger terminiert als üblicherweise gestattet, doch inzwischen war er längst erloschen. Was sollte sie tun?
Das Telefon klingelte. Tess nutzte die Gelegenheit, ihrer Lektüre zu entfliehen, und sprang auf, aber Olivia kam hoch, beorderte sie mit einem energischen Zeigefinger auf ihren Stuhl zurück und nahm selbst den Hörer ab. »Hallo?«
»Ich bin’s wieder – auf dem Sprung zum Fitnesscenter. Wahrscheinlich werde ich nicht vor acht zu Hause sein, und dann kommen auf CNN die Nachrichten, und bis ich schließlich was gegessen habe, wird es zu spät sein – aber ich muss wissen, ob es bei morgen Abend bleibt.«
Olivia griff sich ratlos in ihre kurzen Haare. »Morgen Abend?«
»Wir wollten doch ins North End Bistro.« Das war ein italienisches Restaurant. Es hatte vor knapp einem Monat eröffnet, und er hatte Lobeshymnen darüber gehört und es so eilig, dort zu essen, als fürchte er, es würde demnächst wieder schließen.
»Ich muss passen, Ted«, antwortete Olivia. »Wochentags kann ich abends ganz schlecht weg, das habe ich dir doch erklärt.«
Sie hatte ihm gesagt, Tess bei den Hausaufgaben helfen zu müssen, doch das war nur die halbe Wahrheit: Nach Verabredungen mit Ted war sie jedes Mal völlig erledigt. Man konnte sich in seiner Gegenwart nicht entspannen. Keine Sekunde.
»Aber für die nächsten drei Samstage sind sie bereits ausgebucht. Da siehst du, was für ein Renner der Laden ist. Du musst es irgendwie möglich machen.«
»Wenn der Laden so ein Renner ist, dann wird es ihn in einem Monat auch noch geben. Reservier uns für dann einen Tisch. Morgen geht es wirklich nicht.«
»Okay, okay – ich warte mit der Rücknahme der Reservierung noch, falls du es dir doch anders überlegst. Ruf mich nachher an, ja?«
»Lass uns in ein, zwei Tagen wieder telefonieren.«
»Aber was ist mit dem North End Bistro?«
Olivia ballte ihre freie Hand zur Faust. »Ich habe Nein gesagt.«
»Du hast gesagt, dass du es dir vielleicht doch anders überlegst.«
»Das hast du gesagt. Ich habe gesagt, dass ich nicht wegkann.«
»Du klingst höllisch gereizt – Otis muss dich mal wieder tierisch genervt haben. Der Mann ist eine Zumutung als Chef. Bloß gut, dass er in Pension geht. Noch ein paar Jahre mit ihm, und du wärst ein Fall für die Klapsmühle. Ich ruf dich später noch mal an.«
Olivia atmete tief durch. »Nein, Ted. Gönn mir eine Atempause, um Himmels willen!«
»Hey, reg dich nicht auf ... Großer Gott, so spät schon, ich muss los, sonst haben die Muskelprotze das Center in ihrer Gewalt. Sie verbringen ihre Abende da, für die ist Gewichtheben Kultur. Ich ruf dich morgen an.« Er legte auf, bevor sie protestieren konnte. Olivia überlegte gerade verzweifelt, wie sie zu diesem Mann durchdringen könnte, als Tess sagte: »Vielleicht ist er Legastheniker. Er kann auch nicht hören.«
»Du hörst wie ein Luchs«, erwiderte Olivia über den Sarkasmus ihrer Tochter lächelnd, doch, das zweite Mal auf dem Weg zu ihrem Kleiderschrank, wurde sie von Selbstmitleid gepackt. Eine Schuldkrise, ein ungeöffnet zurückgesandter Brief an ihre Mutter und Ted waren reichlich viel in einer Stunde. Sie hatte ein Trostpflaster verdient.
Wieder machte sie kehrt, diesmal um ihre Aktentasche zu holen, die sie beim Hereinkommen neben der Tür abgestellt hatte. Sie trug sie zum Sofa und ließ sich erneut darauf nieder. Als sie sie öffnete, stieg zarter Fresienduft auf. Sie nahm Natalie Seebrings Umschlag heraus und drückte ihn an ihre Brust. Enttäusch mich nicht, Natalie, dachte sie, und klappte die Lasche ein zweites Mal hoch, holte diesmal jedoch nur die Fotos heraus. Sie stapelte sie auf ihrem Schoß und machte sich daran, eines nach dem anderen eingehend zu betrachten.
Inzwischen kannte sie die Darsteller dieser Familiensaga. Da waren Aufnahmen von Natalie und ihrem Mann und von Natalie, ihrem Mann und den Kindern. Auf einigen war ein neues Baby zu sehen. Ein neues Baby! Aber auf keiner davon auch der ältere Sohn. Nie waren die drei Kinder gemeinsam fotografiert. Merkwürdig.
Nein – genauer betrachtet ganz einleuchtend. Das Baby war ein Nachzügler und der ältere Sohn inzwischen vielleicht schon auf der Universität. Sicherlich in Harvard. Sie rechnete beinahe damit, einen Schnappschuss zu entdecken, auf dem er den Dress des dortigen Footballteams mit dem entsprechenden Namenszug auf der Brust trug.
Der wurde ihr nicht beschert, aber ein Hochzeitsbild der Tochter. Es folgten Fotos von Natalies Mann auf dem Weingut, mit und ohne Weingärtner. Den langen Koteletten der Männer nach zu urteilen, stammte diese Serie aus den Sechzigern. Außerdem wurden Bauabschnitte eines neuen Gebäudes auf dem Gelände dokumentiert, das, wie ein Schild besagte, eine Weinhandlung beherbergen sollte. Olivia war gespannt, wie es am Ende aussehen würde.
Sie war noch nie auf einem Weingut gewesen, aber die Fotografien, die sie von Asquonset in die Hände bekommen hatte, vermittelten den Eindruck von Wohlstand, Beschaulichkeit, viel Sonnenschein, süßen Trauben und Heiterkeit.
Sie konnte es kaum erwarten, die Weiterentwicklung in den Achtzigern und Neunzigern zu verfolgen. Wahrscheinlich gab es mittlerweile Horden von Enkelkindern, die über dem Verandageländer des Haupthauses lümmelten, gemeinsam mit ihren Eltern auf der breiten Treppe posierten oder beim Fest anlässlich der Weinlese an langen Tischen aufgereiht saßen.
Die Fotos von heute wiesen keine schlimmen Schäden auf, nur hier und da ein paar Flecken, ein paar Stellen, an denen die Entwicklerflüssigkeit Blasen geworfen hatte, ein paar Eselsohren und ein paar Knicke. Das große Problem war das Verblassen, doch da konnte sie Abhilfe schaffen, indem sie das jeweilige Foto auf Multigrade-Papier mit einem harten Filter kopierte. Nur selten bedurfte es, wie bei den Dorothea-Lange-Fotos, der Handarbeit. Bei Natalies Bildern ging es im Großen und Ganzen weniger um Restaurierung als um Erhaltung. Darauf legte sie größten Wert, und Olivia konservierte sie dementsprechend wie Urkunden. In der Hoffnung, dem Begleitbrief Näheres über die Fotos zu entnehmen, fischte sie ihn aus dem braunen Umschlag. Wie auf dem Kuvert prangte auch auf dem elfenbeinfarbenen Papier das burgunderrote Asquonset-Logo in der linken oberen Ecke, und wie die Adresse auf dem Kuvert war auch der Brief handgeschrieben, in der weichen, ausdrucksvollen Schrift, die Olivia mit Natalies Stimme assoziierte.
»Lieber Otis«, las sie, »anbei finden Sie die nächste Teilsendung. Ich bin tief beeindruckt, welche Wunder Sie bei den älteren Fotos vollbracht haben. Diese hier sind neueren Datums. Eine Ecke des Hochzeitsfotos meiner Tochter verunziert ein Weinfleck. Wenn er von der Hochzeit stammte, hätten wir ihn vielleicht aus Sentimentalität unangetastet gelassen, doch es ist ein frischer Fleck, und zu allem Unglück bin auch ich noch für ihn verantwortlich. Ich trank ein Gläschen unseres neuen Estate Cabernet, während ich die Fotos durchsah, und meine Hände sind neuerdings ein wenig zittrig. Aber immerhin besser ein Weinfleck als ein Whiskyfleck – so hat er wenigstens einen Bezug zu unserem Broterwerb.«
Natalie hatte einen feinsinnigen Humor, dachte Olivia lächelnd.
»Ich hoffe«, las sie weiter, »Ihnen nächste Woche die letzten Fotos schicken zu können. Wie ich Ihnen zu Beginn mitteilte, möchte ich die ganze Sammlung am ersten August wieder in Händen haben. Dann bleibt mir ein Monat, um sie meiner Vorstellung entsprechend zu ordnen.
Im Zusammenhang damit habe ich ein Anliegen. Im Sommer ist auf dem Weingut immer Hochbetrieb, und ich werde so viel anderes zu tun haben, dass ich fürchte, meinen Anteil an diesem Projekt nicht ohne Hilfe in einer Weise bewältigen zu können, der Ihrer hervorragenden Restaurierung meiner Fotos gerecht wird. Sie sollen nämlich von Text begleitet werden, aber dieser Text besteht im Moment noch aus einer Flut von Notizen, die geordnet und redigiert werden müssen. Darum bin ich auf der Suche nach einem Assistenten. Er muss Computererfahrung, aber auch einen Blick für Kunst und Sprachgefühl besitzen.«
Ich habe einen Blick für Kunst, dachte Olivia.
»Ich möchte jemanden, der systematisch arbeitet und ordentlich ist – und angenehm. Ich brauche einen neugierigen Menschen, der mir Fragen stellt und so hartnäckig ist, dass er mir Dinge entlockt, die ich sonst vielleicht für mich behalten würde.«
Ich arbeite systematisch und ordentlich, dachte Olivia. Angenehm bin ich auch. Und neugierig? Ich habe tausend Fragen zu den Fotos, die ich restauriert habe.
»Ein Student wäre das Richtige. Ich werde zwar in der Sonntagszeitung inserieren, aber viel lieber wäre mir jemand mit einer persönlichen Empfehlung. Sie haben so hervorragende Arbeit geleistet, Otis, dass ich überzeugt bin, auf eine Empfehlung von Ihnen voll und ganz vertrauen zu können, und so hoffe ich, dass Sie jemanden in Cambridge kennen, der eine künstlerische Ader hat und schreiben kann.«
Oje. Da tat sich ein Problem auf. Olivia konnte schreiben, sie tat sich nur schwerer damit als manch anderer. War sie Legasthenikerin?
Sie wusste es nicht. Zu ihrer Schulzeit gab es dafür noch keine Tests. Sie wurde einfach als langsam beurteilt. Sie lernte langsam, aber sie lernte. Sie erfüllte die Anforderungen. Es dauerte eine Weile, aber sie schaffte es.
Natalies Angebot wurde noch besser. »Ich biete Kost und Logis – im Haupthaus von Asquonset ist mehr als genug Platz – und ein ansehnliches Honorar. Die Zeit drängt. In Erwartung Ihrer Empfehlung, mit Dank und meinen besten Wünschen, Natalie.«