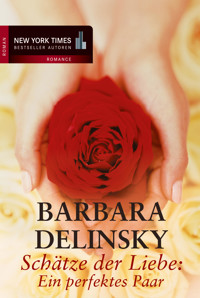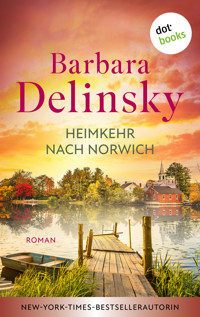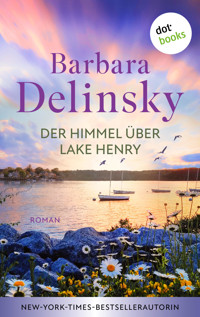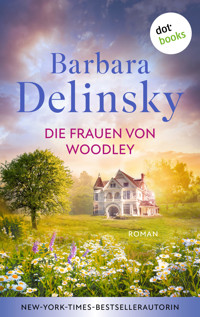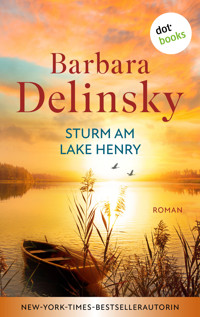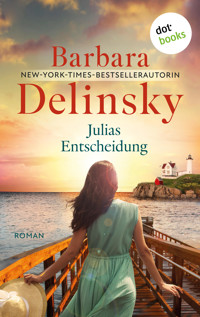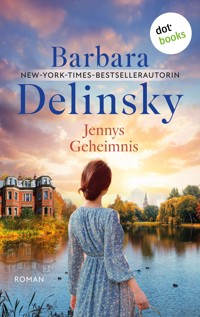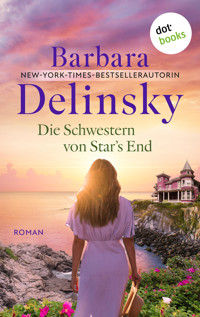
1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Vier Frauen und die Geheimnisse einer Familie: Der berührende Roman »Die Schwestern von Star's End« von Barbara Delinsky jetzt als eBook bei dotbooks. Ein altes Haus am Meer – ein Ort voller Geheimnisse … Viele Jahre sind vergangen, seitdem die Schwestern Caroline, Annette und Leah das Anwesen ihrer Familie besucht haben. Zu viele komplizierte Gefühle sind damit verwoben: Während Caroline ganz in ihrer Anwaltskarriere aufzugehen scheint, widmet Annette sich mit Leidenschaft ihrer Familie … und Leah? Die genießt ihr unbeschwertes Partyleben in vollen Zügen. Nun ruft ihre Mutter sie aus allen Himmelsrichtungen zusammen – doch als die drei Frauen auf »Star's End« ankommen, warten dort nur Briefe mit rätselhaften Anweisungen auf sie. Welches Geheimnis verbirgt sich dahinter? Und ist in Wahrheit keine der Schwestern so glücklich und erfüllt, wie sie es vorgibt zu sein? Plötzlich scheint nur noch eins gewiss: Diese stürmischen Tage am Meer werden ihre Leben für immer verändern … Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der bewegende Familiengeheimnisroman »Die Schwestern von Star's End« von New-York-Times-Bestsellerautorin Barbara Delinsky wird alle Fans von Danielle Steele und Lucinda Riley begeistern. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 515
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Über dieses Buch:
Ein altes Haus am Meer – ein Ort voller Geheimnisse … Viele Jahre sind vergangen, seitdem die Schwestern Caroline, Annette und Leah das Anwesen ihrer Familie besucht haben. Zu viele komplizierte Gefühle sind damit verwoben: Während Caroline ganz in ihrer Anwaltskarriere aufzugehen scheint, widmet Annette sich mit Leidenschaft ihrer Familie … und Leah? Die genießt ihr unbeschwertes Partyleben in vollen Zügen. Nun ruft ihre Mutter sie aus allen Himmelsrichtungen zusammen – doch als die drei Frauen auf »Star’s End« ankommen, warten dort nur Briefe mit rätselhaften Anweisungen auf sie. Welches Geheimnis verbirgt sich dahinter? Und ist in Wahrheit keine der Schwestern so glücklich und erfüllt, wie sie es vorgibt zu sein? Plötzlich scheint nur noch eins gewiss: Diese stürmischen Tage am Meer werden ihre Leben für immer verändern …
Über die Autorin:
Barbara Delinsky wurde 1945 in Boston geboren und studierte dort Psychologie und Soziologie. Nach der Geburt ihres ersten Sohnes arbeitete sie als Fotografin für den Belmont Herald, erkannte aber bald, dass sie viel lieber die Texte zu ihren Fotos schrieb. Ihr Debütroman wurde auf Anhieb zu einem großen Erfolg. Inzwischen hat Barbara Delinsky über 70 Romane veröffentlicht, die in mehr als 20 Sprachen übersetzt wurden und regelmäßig die New-York-Times-Bestsellerliste stürmen. Sie engagiert sich außerdem sehr stark für Wohltätigkeitsvereine und Aufklärung rund um das Thema Brustkrebs. Barbara Delinsky lebt mit ihrem Mann in New England und hat drei erwachsene Söhne.
Die Website der Autorin: barbaradelinsky.com/
Bei dotbooks veröffentlichte Barbara Delinsky bereits ihre Romane:
»Jennys Geheimnis«
»Das Weingut am Meer«
»Julias Entscheidung«
»Sturm am Lake Henry«
»Im Schatten meiner Schwester«
Weitere Romane sind in Planung.
***
eBook-Neuausgabe Juni 2023
Die amerikanische Originalausgabe erschien erstmals 1994 unter dem Originaltitel »For my Daughters« bei HarperCollins Publishers, New York. Die deutsche Erstausgabe erschien 1996 unter dem Titel »Virginias Töchter« bei Droemer Knaur.
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe 1994 by Barbara Delinsky
Published by Arrangement with Barbara Delinsky
Copyright © der deutschen Erstausgabe 1996 bei Droemersche Verlagsanstalt Th. Knaur Nachf., München
Copyright © der Neuausgabe 2023 dotbooks GmbH, München
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Covergestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © shutterstock
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (rb)
ISBN 978-3-98690-663-4
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Die Schwestern von Star’s End« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Barbara Delinsky
Die Schwestern von Star’s End
Roman
Aus dem Amerikanischen von Georgia Sommerfeld
dotbooks.
Karen und Amy
für ihren Kampfgeist,
Steve, Eric, Andrew und Jeremy
für ihre Liebe;
den Lesern in aller Welt,
die wie ich glauben.
Vorwort
Mein letzter Blick auf ihn war ebenso verboten wie alles, was davor zwischen uns gewesen war ‒ aber nicht weniger kostbar. Es war früh am Morgen. Die Küstenluft war frisch und roch nach Salz. Ich spürte ihre Feuchtigkeit auf meiner Haut und in meinen Haaren und registrierte ihren Duft mit einer Intensität, die ihn zu einem unauslöschlichen Farbtupfer auf der Leinwand meiner Erinnerung machen sollte. Der September hatte eben erst begonnen, doch die Morgenkühle ließ keinen Zweifel daran, daß der Sommer sich seinem Ende entgegen neigte ‒ und mit ihm verschwand ein Leuchten, das ich nie zuvor gesehen hatte und nie wieder sehen würde.
Er stand in der Tür des Gartenhäuschens, umrahmt von Holz, das die Farbe der flechtenüberzogenen Granitlandschaft hatte, deren Ausläufer sich am Fuß des Steilufers im Meer verloren. Das Häuschen hatte, wie der Mann, vielen Winterstürmen getrotzt. Es war sein Heim und hatte sich in unseren gemeinsamen Sommernächten mehr als ein Zuhause erwiesen als irgendeiner meiner geräumigen, eleganten und teuren Wohnsitze.
Er war eine überwältigende Erscheinung, gut einen Kopf größer als ich, schlank, aber kräftig gebaut, wie es seiner Arbeit entsprach. Rücken und Schultern waren gerade, seine Haut sonnengebräunt. Die Augen, die ich anfangs als fast unheimlich geheimnisvoll empfunden hatte, drückten jetzt, da sie das letzte Mal in meine blickten, eine Mischung aus Vorwurf und Verlangen aus. Alles an ihm atmete die Unerschütterlichkeit, die aus dem harten Leben an der zerklüfteten Küste von Maine resultierte.
Ein unbeteiligter Betrachter hätte vielleicht geglaubt, er sei zornig, und möglicherweise schwang ein Anflug davon mit. Wir waren übereingekommen, daß wir uns nicht Wiedersehen würden, daß es nach der Nacht zu schwierig wäre. Aber ich konnte nicht anders ‒ ich brauchte einen letzten Blick, einen Eindruck bei Tageslicht, einen Eindruck, der mir für den Rest meines Lebens im Gedächtnis bleiben würde.
Ja, möglicherweise war er ein wenig zornig. Wahrscheinlich jedoch fühlte er sich, als sterbe er innerlich ‒ wie ich. Gequält von dem Bewußtsein, daß wir etwas Unbezahlbares gefunden hatten und nun darauf verzichteten. Aus freiem Willen.
Aus freiem Willen.
Aber war der Wille je wirklich frei? Gab es tatsächlich Momente im Leben eines verantwortungsbewußten Menschen, in denen er eine Entscheidung fällen konnte, ohne einen Gedanken an die Vergangenheit oder die Zukunft zu verschwenden? Ich war unglücklicherweise ein verantwortungsvoller Mensch ‒ und ich hätte mich ebensowenig anders entscheiden können wie Will Cray.
Drüben im Herrschaftshaus warteten meine gepackten Koffer auf der Vorderveranda darauf, in den verbeulten Kombi verladen zu werden, der in Downlee als Taxi fungierte. Und im Herrschaftshaus wartete auch Dominick St. Clair, seit vier Jahren mein Mann, der Mann, dem ich ‒ als Gegenleistung für seinen Edelmut ‒ Liebe, Ehrerbietung und Gehorsam gelobt hatte. Und darin lag meine Herausforderung. Der Sommer, der der Wiederherstellung und der Wiederentdeckung hatte dienen sollen, hatte diesen Zweck erfüllt ‒ aber auf unerwartete und zerstörerische Weise. Jetzt war es meine Aufgabe, die Scherben des von mir gewählten Lebens aufzusammeln und zu einem irgendwie akzeptablen Ganzen zusammenzusetzen.
Ich nahm nichts von Will mit. Nicht die rosafarbenen Apfelrosen, die er gezüchtet, die ich am Kleid getragen, deren Duft ich eingeatmet und die ich schließlich gepreßt hatte; nicht die Fotos, die einen solchen Aufruhr in dem winzigen, spießigen Downlee ausgelöst hatten; nicht das schmale Lederband, das er geflochten und mir geschenkt hatte, damit ich es nachts am Finger trüge. Heute trug ich einen schweren, goldenen Ehering und den dazugehörenden Ring mit rechteckigen, brillant geschliffenen Diamanten, und beides symbolisierte, so gut wie nichts anderes es gekonnt hätte, die Welt, in die ich zurückkehrte.
Ich war siebenundzwanzig in jenem Sommer, wußte um die materiellen Bedürfnisse des Lebens, war jedoch, was Herzensdinge betraf, naiv genug, um zu glauben, daß ich auch ohne ihn ein vollständiges, menschliches Wesen sein könnte.
Wie ich mich irrte! Mein Herz blieb bei Will Cray, bei der salzigen Luft, dem Duft der Tannen und des wilden Geißblatts, bei dem dunkelroten Farbfleck, den die Dahlien bildeten, die er gepflanzt hatte. Tränen schnürten mir die Kehle zu, als ich ihn zum letzten Mal anschaute, als ich mich eine letzte Minute lang von seiner Wärme einhüllen ließ und in der Erinnerung daran dahinschmolz, als jede Faser in mir nach ihm schrie und die Trennung an den zartesten, empfindsamsten und auf Geben eingestellten Regionen meiner Seele zerrte.
Die Tränen zurückhaltend ‒ und die Zweifel, die mich, wie ich wußte, in den kommenden Jahren peinigen würden ‒, drehte ich mich um und begann den Weg hinunterzugehen. Als alles vor meinen Augen verschwamm, glaubte ich plötzlich, den warnenden, traurigen Klang des Nebelhorns auf den Houkabee Rocks zu hören, und trotzdem setzte ich weiter einen Fuß vor den anderen. Ich stolperte. Kurz darauf stolperte ich noch einmal, und ich hätte es vielleicht als Schicksalswink gedeutet und wäre zu ihm zurückgerannt, wenn mein Pflichtgefühl nicht so ausgeprägt gewesen wäre.
Rückblickend sehe ich ein, daß ich von etwas sehr viel weniger Noblem als Pflichtgefühl geleitet wurde, und meine Strafe dafür war hart. Die Tränen, die ich an jenem Morgen zurückdrängte, als ich ihn verließ, erstarrten in meiner Kehle zu Eis, wurden hart wie Stein, zu einer Barriere, die Gefühle nur selten durchbrachen, denn indem ich Will verließ, hatte ich mich zu einem Leben ohne Emotionen verurteilt.
Das war es, was ich jetzt korrigieren wollte.
Kapitel 1
Die Mienen der Geschworenen verhießen nichts Gutes ‒ Caroline St. Clair entnahm das Urteil ihren Gesichtern, noch bevor es an den Richter weitergereicht wurde. Keiner der zwölf konnte ihr in die Augen schauen. Ihr Klient war für schuldig befunden worden.
Vom Verstand her wußte sie, daß es so das beste war. Der Mann hatte seine Exfrau entführt, sie drei Tage lang als Geisel gehalten und wiederholt vergewaltigt. Als geachtetes Mitglied der Staatslegislative mit einer ansonsten blütenweißen Weste würde er seine Strafe in einem der relativ komfortablen Bundesgefängnisse absitzen, die für ihn notwendige, psychologische Hilfe erhalten und auf Bewährung entlassen werden, wenn er noch jung genug wäre, um neu anzufangen. In gewisser Weise wäre ein Freispruch, der ihn zu einem gefundenen Fressen für die Medien und andere Neugierige gemacht hätte ‒ und das zu einer Zeit, da er ebenso angeschlagen war wie seine Exfrau ‒, grausamer gewesen.
Doch für Caroline war jeder Sieg von großer Wichtigkeit. Siege brachten Publicity, und die brachte neue Fälle, und neue Fälle bedeuteten Fett auf den Rippen der Bilanz, und die war bei den überwiegend männlichen Partnern in der Kanzlei Holten, Wills & Duluth das Goldene Kalb. Wie so viele ihrer Art hatte die Anwaltsfirma den größten Teil zweier Jahrzehnte als personeller »Wasserkopf« existiert, doch während andere Pleite machten, blieb Holten, Wills & Duluth obenauf. Um sich dort zu halten, gingen die Geschäftsprinzipien dahin, unnötigen Ballast abzuwerfen, die freiwilligen Sozialleistungen einzuschränken, die Arbeitsvorgänge zu rationalisieren ‒ und sich um Vermögensverwaltungen zu reißen.
Caroline war einer der neueren und sogar mit ihren vierzig Jahren einer der jüngeren Partner. Die Zukunft der Firma ruhe auf ihren Schultern, predigten ihr ihre älteren Kollegen, und im gleichen Atemzug schacherten sie mit ihr um jeden Dollar Honorar. Es widerstrebte ihnen zutiefst, ihren Wohlstand zu teilen, und was noch schlimmer war: Sie mochten keine Frauen. Caroline mußte doppelt so hart arbeiten und doppelt so gut sein, um die gleiche Anerkennung zu gewinnen wie die Vertreter des anderen Geschlechts, sie mußte in der Gesetzesauslegung raffinierter sein, Staatsanwälten energischer gegenübertreten und Geschworene besser überzeugen können.
Sie hätte diesen Sieg dringend gebraucht.
Einer der ebenfalls jüngeren Partner erschien in der Tür zu ihrem Büro. »Verdammtes Pech«, meinte er. »Angesichts der politischen Position Ihres Klienten wäre pressemäßig viel Positives für Sie dringewesen. Jetzt bekommen Sie negative Publicity.« Caroline warf ihm einen Blick zu, der unwirscher gewesen wäre, wenn er jemand anderem gegolten hätte, aber sie und Doug waren zur gleichen Zeit in die Firma eingetreten, beide aus dem Büro des Staatsanwalts gekommen, und obwohl er zwei Jahre vor ihr zum Partner aufgestiegen war, nahm sie ihm das nicht übel. Sie konnte es sich nicht leisten, denn er war ihr stärkster Verbündeter in der Kanzlei.
»Verbindlichsten Dank«, knurrte sie. »Das habe ich gebraucht!«
»Tut mir leid, aber es stimmt.«
»Glauben Sie, daß mich dieser Gedanke letzte Nacht nicht länger als ein, zwei Minuten wachgehalten hat?« Sie tippte abwechselnd mit dem Zeige- und dem kleinen Finger auf die Schreibtischplatte. »Ich war mir der möglichen Vorteile dieses Falles für mich bewußt, als ich ihn übernahm, und ich dachte, es sei ganz einfach, ihn zu gewinnen.«
»Unzurechnungsfähigkeit nachzuweisen, ist nicht einfach.«
»Aber abgesehen von dieser einen Entgleisung, hat John Baretta ein vorbildliches Leben geführt«, gab sie zu bedenken, so wie sie es auch in beredter und ausführlicher Weise vor den Geschworenen getan hatte. »Ich dachte, das würde ins Gewicht fallen.«
»Dann glauben Sie, daß er vorübergehend unzurechnungsfähig war?«
Caroline hatte es glauben müssen, sonst hätte sie ihn nicht überzeugend verteidigen können. Was ihr leider trotzdem nicht gelungen war. »Der Mann war verrückt nach seiner Frau. Er wurde nicht damit fertig, daß sie ihn verlassen hatte. Aber er war vorher nie gewalttätig gewesen. Er schämt sich und bereut, was er getan hat, und er ist keine Gefahr für die Gesellschaft. Er braucht eine Therapie ‒ das ist alles.«
»Und sie brauchen eine Zigarette.«
Sie hörte auf mit den Fingern zu trommeln. »Das kann man wohl sagen, aber ich werde keine rauchen. Ich werde mir den Entzug nicht noch einmal antun, und ich werde nichts tun, was mich krank machen würde. Stellen Sie sich nur vor, was die Firma dann mit mir machen würde!« Mit einem lauten »Fffff« ließ sie ihren Atem entweichen. »Meine Freunde verstehen das nicht. Sie denken, daß der Partnerstatus eine gewisse Garantie beinhaltet ‒ daß die Firma mich beispielsweise mit Babysachen überhäufen würde, wenn ich morgen schwanger würde. Aber statt dessen würde ich rausfliegen. Sie würden einen Weg finden, den Tatbestand der Diskriminierung zu umgehen und mich aus irgendeinem anderen Grund vor die Tür setzen.« Sie seufzte. Plötzlich fühlte sie sich unendlich müde. »Dieses Ding, genannt Partnerschaft, steht auf wackligen Füßen ebenso wie die Karriere. Ich frage mich, ob das die Schufterei wirklich wert ist.«
»Das kann ich Ihnen nicht beantworten. Aber welche Alternative haben wir?«
»Weiß ich auch nicht. Aber etwas stimmt da nicht, Doug. Ich bedaure mich mehr dafür, daß ich den Prozeß verloren habe, als meinen Klienten, und schließlich ist er es, der ins Gefängnis muß. Irgendwie sind meine Prioritäten durcheinandergeraten. Das ist bei uns allen passiert.«
Sie hatte den Satz gerade beendet, als einer der Seniorpartner in der Tür erschien. »Sie haben zu viele Frauen als Geschworene zugelassen«, konstatierte er. »Die haben sich auf die Seite des Opfers gestellt.«
Doug zog den Kopf ein, als Caroline erwiderte: »Die Geschlechtszugehörigkeit ist kein Grund für eine Ablehnung.«
»Dann hätten Sie eben einen anderen finden müssen«, erwiderte er und setzte seinen Weg den Flur hinunter fort.
Caroline hatte kaum begonnen, sich eine Antwort zurechtzulegen, als ein weiterer Partner erschien. »Sie hätten ihn nicht in den Zeugenstand rufen dürfen. Bis dahin wirkte er mitleiderregend, doch als er den Mund aufmachte, klang er aalglatt.«
»Ich fand, er klang aufrichtig.«
»Die Geschworenen fanden das offenbar nicht«, lautete die tadelnde Erwiderung.
»Hinterher können wir alle brillante Taktierer sein«, entgegnete Caroline, »aber die Wahrheit ist, daß keiner von uns weiß, was die Jury zu ihrer Entscheidung bewogen hat.«
Sie grübelte gerade über diese Frage nach, als der nächste Partner hereinschaute, und von diesem bekam sie etwas, das man mit viel gutem Willen als Ermutigung verstehen konnte. »Haken Sie die Schlappe ab, Caroline, sie brauchen einen Sieg. Schauen Sie Ihre Fälle durch, suchen Sie sich den vielversprechendsten heraus und knien Sie sich rein.«
Caroline warf einen Blick auf den Aktenstapel auf ihrem Schreibtisch. An jeden Ordner waren telefonische Nachrichten und Notizen geheftet, die sich angesammelt hatten, während sie bei Gericht gewesen war. Sie überlegte, daß sie sich eigentlich damit befassen sollte, jedoch nicht in der Stimmung dazu war, als ein weiterer Partner von der Tür her rief: »Versuchen Sie bitte, den Namen der Kanzlei unerwähnt zu lassen, wenn Sie mit der Presse sprechen, ja?«
Als sie Sekunden später auf die leere Türöffnung starrte, stieg ein Gefühl in ihr auf, das viel Ähnlichkeit mit Verzweiflung hatte, und plötzlich erschienen ihr ihre durcheinander geratenen Prioritäten als das kleinste aller Übel. Viel schlimmer waren Selbstsucht, Habgier und Parteilichkeit, ganz zu schweigen von Angeberei und Eitelkeit und Überheblichkeit.
Da sie schon einmal dabei war, warf sie noch Rücksichtslosigkeit mit in den Topf, und in diesem Moment konnte sie nicht begreifen, warum sie Wert darauf legte, die Partnerin dieser Leute zu sein.
Ohne sich darum zu scheren, daß sie sich den Zorn der Seniorpartner zuziehen würde, wenn sie die Kanzlei vor Sonnenuntergang verließe, füllte sie ihren Aktenkoffer mit den Ordnern von ihrem Schreibtisch, die in den frühen Morgenstunden, wenn sie nicht schlafen könnte, der ideale Lesestoff wären, informierte ihre Sekretärin darüber, welche Termine sie für den nächsten Tag vereinbaren solle, und machte sich auf den Heimweg.
Draußen schlug ihr die für Chicago typische Aprilkälte entgegen, doch nach den vielen angespannten Tagen im Gerichtssaal und den arbeitsreichen Nächten im Büro war der Wind eine echte Wohltat. Im Gegensatz zu den von Hektik bestimmten letzten Wochen nahm sie heute kein Taxi, sondern knöpfte ihren Wintermantel zu, band sich ein Halstuch um und ging zu Fuß. Als sie nach fünfzehn forschen Gehminuten ihr Ziel erreichte, war sie in der Lage, für den Portier ein Lächeln auf ihr Gesicht zu zaubern, der sie mit Namen begrüßte, ihr die Tür aufhielt und den Lift für sie holte, während sie nach Post schaute.
Ihre Wohnung lag im achtzehnten Stock und führte auf den See hinaus. Von ihrem Wohnzimmersofa aus konnte sie den Ausblick so begrenzen, daß sie nichts mehr von der Stadt sah, sondern nur die Segelboote auf dem Wasser. An einem Schönwettertag war das ein Anblick, der einen ins Träumen geraten ließ.
Heute war der Himmel bedeckt. Caroline legte Aktenkoffer, Mantel und Halstuch auf den Stuhl neben der Tür und sah die Post durch. Das einzig Interessante war ein dickes Kuvert, dessen Philadelphia-Stempel ebenso verräterisch war wie die handgeschriebene Adresse.
Sie hätte nicht überrascht sein dürfen, denn es paßte zu diesem Tag, daß ihre Mutter ein Lebenszeichen von sich gab. Ginny hatte nicht gewollt, daß sie Anwältin wurde, fand diesen Beruf »unmöglich für eine Frau«. Daß Caroline heute einen Prozeß verloren hatte, wäre Wasser auf Ginnys Mühlen ‒ zusätzlich dazu, daß ihre Tochter abends beim Nachhausekommen weder von Mann noch Kindern empfangen wurde.
Caroline und Ginny St. Clair hatten die Stellung der Frau nie mit den gleichen Augen gesehen. Sie hatten kaum jemals etwas mit den gleichen Augen gesehen. Ginny mißfiel der superkurze Schnitt von Carolines dunklen Haaren ebenso wie ihre nüchtern-strenge Kleidung. Es mißfiel ihr, daß Carolines Nägel nicht manikürt waren und daß sie kein Parfüm benutzte. Sie begriff nicht, daß Caroline nicht den Mutterinstinkt ihrer Schwester Annette besaß oder den gesellschaftlichen Ehrgeiz ihrer Schwester Leah.
In einem Punkt allerdings waren sie sich einig: Daß es müßig war, über eines dieser Themen zu diskutieren. Und so hatten sie eine Beziehung entwickelt, die auf einem bestimmten Rollenverhalten oder oberflächlicher Freundlichkeit basierte. Sie sahen einander zu familiären Anlässen und telefonierten hin und wieder miteinander, und Caroline kam mit dieser Regelung gut zurecht. Sie hatte schon vor langer Zeit aufgehört, Zuneigung oder Verständnis bei Ginny zu suchen.
Mit einem kleinen Was-hätte-sein-können-Seufeer ließ sie das dicke Kuvert und die übrige Post auf ihre anderen Sachen fallen, ging den Flur entlang zu ihrem Schlafzimmer und zog das pflaumenblaue Schneiderkostüm aus, das die Geschworenen ebensowenig beeindruckt hatte wie ihre Argumentation. Dann kehrte sie barfuß, in Jeans und einem alten Hemd mit hochgekrempelten Ärmeln ins Wohnzimmer zurück und ließ sich aufs Sofa fallen.
Die Welt jenseits des Fensters war wolkenverhangen und grau, regelrecht deprimierend, und die Nüchternheit ihres Apartments mit seiner Einrichtung aus Chrom und Glas wirkte auch nicht gerade stimmungsaufhellend. Sie fror, fühlte sich ungerecht behandelt und sabotiert, doch diese Empfindungen entbehrten jeglicher vernünftigen Grundlage. Sie war eine erfolgreiche Anwältin und Partnerin in einer angesehenen Kanzlei. Sie hatte genügend Prozesse gewonnen, um die heutige Schlappe als Ausrutscher bezeichnen zu können, und sie würde in der Zukunft noch viele gewinnen. Es gab keinen Grund für sie, sich als Versagerin zu fühlen, nicht den geringsten. Und doch tat sie es. Das Telefon läutete und sie zählte die Klingelzeichen. Mit aufgestütztem Kinn hörte sie ihrer eigenen Ansage zu und dann der Stimme, die sich anschloß.
»Hier ist Mark Spence von der Sun-Times. Ich hätte gerne eine Stellungnahme für die Morgenausgabe. Rufen Sie mich unter …«
Sie ließ den Anrufbeantworter seine Nummer aufnehmen, obwohl sie bezweifelte, daß sie darauf zurückkommen würde. Sie hatte nach der Urteilsverkündung bereits vor dem Gerichtsgebäude mit der Presse gesprochen, das obligatorische Vertrauen in ihren Klienten bekundet, in das Rechtssystem und die Möglichkeit der Berufung. Und dem hatte sie nichts hinzuzufügen. Mit einem Klicken schaltete der Anrufbeantworter ab. Die Türklingel summte. Caroline schloß die Augen und wünschte denjenigen, der unten stand, zum Teufel, doch das intervallmäßige Summen wurde hartnäckig fortgesetzt. Unfreundliche Bemerkungen über Privatsphäre und die Presse murmelnd, ging sie widerstrebend zur Sprechanlage hinüber und schnauzte ein »Ja?« hinein.
»Hi, hübsche Lady.«
Nach einer kleinen Pause lächelte sie, stützte die Stirn an die Wand und ließ mit einem Atemzug ihren aufgestauten Ärger entweichen.
Es war Ben. Ihr Ben, der ebenso vorhersehbar auftauchte, wenn sie ihn brauchte, wie ihre Mutter nicht da war.
»Hi, Ben.«
»Brauchst du eine Aufmunterung?«
»Darauf kannst du wetten.«
»Dann mach auf.«
Sie drückte auf den Knopf und lehnte sich an die Tür und fühlte sich so entspannt wie seit einer halben Ewigkeit nicht mehr. Mit seinem trägen Lächeln und seiner unbekümmerten Art war Ben Hammer alles, was sie nicht war, und wenn sie ihn auch nicht täglich hätte genießen können ‒ in Streßzeiten wirkte er so erholsam wie ein Glas guten Weines.
Als er aus dem Lift trat, hatte sie die Tür bereits geöffnet. Er bewegte sich mit der für ihn charakteristischen, tänzerischen Grazie auf sie zu, wirkte so ausgeglichen wie immer und sah mit seiner Lederkluft und den durch den Motorradhelm, den er jetzt unter dem Arm trug, zerzausten sandfarbenen Haaren so unseriös aus wie eh und je.
»Ganz schön gefährlich, die Tür aufzumachen, ehe du durch den Spion geschaut hast«, tadelte er sie, als er den Flur entlang auf sie zuschlenderte.
»Kein Mensch könnte deine Stimme imitieren«, erwiderte sie. Das war eine der wenigen, feststehenden Tatsachen im Leben. »Wie gehts dir, Ben?«
Er zauberte ein Sträußchen Gänseblümchen hinter seinem Rücken hervor. »Besser als dir, wette ich. Ich habe es in den Nachrichten gesehen. Verdammtes Pech.«
Sie nahm die Blumen, bat ihren vom Wind durchgefrorenen Freund herein und schloß die Tür. »Danke, die sind süß. Ein Trostpreis.«
»Hm, sie sind als Glückwunsch gedacht.«
»Aber ich habe den Prozeß verloren.«
»Na und? Gewonnen oder verloren, du hast deine Sache bravourös gemacht.«
»Nicht bravourös genug«, murmelte sie auf dem Weg zur Küche. Sie steckte die Gänseblümchen in eine viereckige Vase und stellte sie im Wohnzimmer auf den niederen Glastisch. Ihr Ambiente hätte eigentlich nach etwas Eleganterem als Gänseblümchen verlangt, aber nichts hätte fröhlicher wirken können. Ben lehnte mit geöffneter Motorradjacke am Durchgang und schaute sie an. Als sie seinen Blick erwiderte, stieg Dankbarkeit in ihr auf. »Ich hätte wissen müssen, daß du kommen würdest. Schließlich tust du das immer, wenn ich Zuspruch brauche.« Sie streckte die Hand aus, um ihm seinen Helm abzunehmen.
»Ich nehme an, deine geschätzten Partner waren nicht gerade begeistert.«
»Das ist stark untertrieben.« Sie legte den Helm auf ihren Aktenkoffer: ein Zeichen der Verachtung für jene »geschätzten Partner«. »Mitgefühl ist in den Firmenstatuten nicht vorgesehen ‒ es ist ein Zeichen von Schwäche.«
»Das glaubst du doch nicht.«
»Meine Partner tun es, und nur das zählt.«
»Nicht, solange du dort arbeiten mußt. Wie hältst du das aus?«
»Ich habe hart gearbeitet, um dorthin zu kommen, wo ich bin.«
»Das kann man wohl sagen, aber du hast Herz. Oder du hättest es, wenn deine Partner das nicht als unnütz betrachten würden. Es sind keine netten Leute. Stört dich das nicht?«
»Natürlich tut es das. Aber dann flattert mir ein Fall auf den Tisch, an den ich nie gekommen wäre, wenn ich nicht zu dieser Firma gehörte, oder der gute Ruf der Firma verschafft mir Klienten, und ich erkenne, daß es eine Symbiose ist.« Das war der Schluß, zu dem sie auf dem Heimweg gekommen war. »Wir leben voneinander, die Firma und ich.«
»Aber sie schneiden bei dem Handel besser ab.«
»Du bist voreingenommen.«
»Stimmt«, nickte er und grinste.
Die Entspanntheit, die Caroline empfunden hatte, steigerte sich zu süßem Dahinschmelzen. Sie schlang die Arme um seinen Hals und seufzte genießerisch.
Ben kam einer »besseren Hälfte« für sie so nah, wie sie es ihrer Natur nach zulassen konnte Während viele andere Männer sich zunächst durch ihren verbissenen Ehrgeiz während des Studiums, anschließend durch ihr Engagement im Büro des Staatsanwalts von Cook County und schließlich durch ihre Selbstaufopferung bei Holten, Wills & Duluth hatten abschrecken lassen, war er seit ihrem Kennenlernen vor zehn Jahren nicht von ihr abzubringen gewesen.
Dabei hätte er sie damals eigentlich nicht mögen dürfen. Sie war seinerzeit die stellvertretende Bezirksstaatsanwältin gewesen, die seinen jüngeren Bruder wegen Computerhacken ins Gefängnis geschickt hatte. Aber sie sei fair, hatte er mit einem Lächeln gesagt, mit dem er sie im Sturm erobert hatte. Als er sie zum Essen einlud, sagte sie zu, und als sie danach im Bett landeten, schien es das natürlichste von der Welt zu sein.
Sein Leben war der Gegenpol zu ihrem. Ais Künstler brachte er Wochen damit zu, durch die Welt zu reisen und zu fotografieren, und dann Monate, diese Bilder auf Siebdruck zu übertragen. Und die Ergebnisse raubten Caroline fast ebenso nachhaltig den Atem wie sein Lächeln. Kunstberater erwarben ganze Sets seiner Drucke als Schmuck für Wände von Gemeindebauten, und ortsansässige Galerien verkauften seine Arbeiten mit Begeisterung. Aber als Caroline ihm vorschlug, seinen Aktionsradius zu erweitern und in San Francisco, Boston oder New York auszustellen, zuckte er nur die Schultern. Er war so wenig ehrgeizig wie sie ehrgeizbesessen war. Jedesmal, wenn er eine Serie von Drucken fertiggestellt hatte, tat er lange Zeit absolut nichts.
Caroline hatte niemals absolut nichts getan. Sie wußte nicht, ob sie das überhaupt könnte. Mit dem Heiraten, was er Dutzende von Malen angesprochen hatte, war es ebenso. Sie hatte es Dutzende von Malen abgelehnt, doch er kam immer wieder damit an, was einer der Gründe dafür war, daß sie ihn liebte. Er war nicht kleinzukriegen, und er brachte sie zum Lächeln.
Auch jetzt lächelte sie und schüttelte den Kopf, jedoch nicht in Ablehnung des Unvermeidlichen, sondern in amüsierter Resignation. Er nippte nur kurz an ihren Lippen, legte den Arm um ihre Schulter Und führte sie den Flur entlang. Im Schlafzimmer angekommen, küßte er sie so lange, bis auch der letzte Rest Anspannung aus ihrem Körper verschwunden war.
Wie üblich zog er zuerst sich selbst aus. Caroline vermutete, daß er sich im Zustand der Erregung nackt einfach wohler fühlte, doch auch wenn tatsächlich Egoismus dahintersteckte, so hatte sie daran nichts auszusetzen. Ihn zu betrachten, erregte sie ‒ so sehr, daß sie sich, als er schließlich sie ohne Hast von ihren Kleidern befreite, weit mehr wünschte als nur zu schauen.
Er gab es ihr ohne Vorbehalte, liebkoste jeden Quadratzentimeter ihres Körpers, bis sie auf die Dauer der köstlichen Momente des Orgasmus jedes Gefühl für Zeit und Raum verlor. Bei all ihrer Verschiedenheit paßten sie in dieser Hinsicht ideal zusammen, und als es vorbei war, als ihr Atem sich normalisierte und ihre Körper sich abzukühlen begannen, genossen sie gemeinsam die zufriedene Erschöpfung, die folgte.
»Wärst du auch gekommen, wenn ich gewonnen hätte?« fragte sie mit einem Flüstern, das die lohfarbenen Haare auf seiner Brust streichelte.
»Darauf kannst du wetten. Ich wäre auf jeden Fall gekommen. Ich klebte förmlich am Bildschirm, und sobald ich das Urteil gehört hatte, führ ich los.« Er schaute auf sie herunter. »Kommst du übers Wochenende mit?«
Sie schüttelte den Kopf. »Ich habe unheimlich viel aufzuarbeiten.«
»Nimm dir doch was mit.«
Er lebte eine Autostunde nördlich der Stadt in einer Hütte im Wald. Zwischen dem Duft der Föhren, dem Konzert der Naturtöne und dem vielen Glas, das seine Hütte zu einem Atelier machte, kämpfte sie auf verlorenem Posten. »Ich kann mich bei dir nicht konzentrieren.«
»Weil es dir so gut gefällt. Gibs zu.«
»Ich gebe es zu.«
»Warum ziehst du dann nicht zu mir? Verkauf die Wohnung, sage deinen hartherzigen Partnern, sie sollen sich ins Knie ficken, und laß dich von mir ernähren.«
Sie lachte, denn von ihnen beiden war sie diejenige mit dem Geld. Was nicht hieß, daß er ihr nicht alles gegeben hätte, was er besaß. »Das wäre kein Leben für mich, ich bin ein Stadtmensch.«
»Du bist eine Masochistin.«
»Ich bin arbeitssüchtig.«
»Nicht, wenn du mit mir zusammen bist.«
»Ich weiß. Du übst einen schlechten Einfluß auf mich aus.«
»Quatsch. Ich halte dich bei Verstand.«
Sie vermutete, daß daran durchaus etwas Wahres war. »Wahrscheinlich.«
Er seufzte. »Du wirst mich also nicht heiraten?«
»Nicht diese Woche ‒ ich habe zuviel zu tun.«
Doch im Augenblick hatte sie es nicht eilig, irgend etwas zu tun. Sie fühlte sich wohl in Bens Armen und war nicht bereit, sie zu verlassen.
Zu bald für ihren Geschmack gab er ihr einen liebevollen Kuß und stand auf. Sie sah ihm beim Anziehen zu, warf sich dann einen Morgenrock über und brachte Ben zur Tür, wo sie einen weiteren Kuß bekam. Als nur noch ein schwacher Moschusduft auf ihrer Haut daran erinnerte, daß er dagewesen war, brühte sie sich eine Kanne Tee auf und goß sich eine Tasse ein. Sie trank sie und noch eine zweite, ehe sie sich stark genug fühlte, das Kuvert zu öffnen, das ihre Mutter geschickt hatte.
Liebe Caroline, schrieb Virginia St. Clair. Da ich von Dir oderDeinen Schwestern nichts Gegenteiliges gehört habe, gehe ich davon aus, daß dieser Brief Dich bei guter Gesundheit erreicht.
Caroline stieß einen kleinen, traurigen Laut aus. Ihre Schwestern würden es nicht wissen, wenn sie krank wäre, denn sie hatte seit Wochen mit keiner von beiden gesprochen.
Ich bin letzten Dienstag aus Palm Springs zurückgekommen. Das Wetter war schön und die Gesellschaft angenehm wie immer, aber es tut gut, wieder zu Hause zu sein. Es ist ruhiger hier. Ich habe den Verdacht, daß sich mein Alter allmählich bemerkbar macht. Ich kann nicht mehr von einer Dinnerparty zur anderen gehen, wie ich es früher tat. Lillian sagt, ich entwickle mich zu einer Einsiedlerin. Sie könnte recht haben.
Das bezweifelte Caroline. Ihre Mutter war ihr ganzes Leben lang ein geselliger Mensch gewesen. Die Vormittage verbrachte sie bei dem einen oder anderen Frauenverein, die Nachmittage auf dem Golfplatz und die Abende mit Bridgespielen. Wenn sie nicht zu einem Dinner in den Club ging, dann gab sie selbst eines. Der Tod ihres Mannes, des Vaters der Mädchen, eines harmlosen Bären von einem Mann, hatte diesen Fluß der gesellschaftlichen Aktivitäten nicht nennenswert gestaut.
Oh, Ginny hatte ihn durchaus betrauert. Sie war vierundvierzig Jahre lang mit Nick verheiratet gewesen und vermißte nun einen guten Freund. Hatte sie tagelang geweint? Nein. Das war nicht ihre Art und Nicks auch nicht. Er besaß die Gelassenheit, die es mit sich brachte, in Reichtum hineingeboren worden zu sein. Er war selbstsicher, friedfertig und anspruchslos.
Caroline verachtete ihn dafür, daß er nicht mehr forderte, ebenso wie sie ihre Mutter dafür verachtete, nicht mehr zu geben. Aber Nick wußte nicht, wie man Forderungen stellte, und Ginny gab alles, was sie zu geben hatte, der Gesellschaft. Caroline konnte sich nicht vorstellen, daß das Alter sie zu bremsen vermochte.
Und deshalb las sie mit Überraschung: Ich habe mein Haus hier verkauft und werde im Juni umziehen. Mein neues Haus liegtweiter nördlich ‒ sehr viel weiter nördlich, um genau zu sein ‒ bei einem kleinen Ort namens Downlee an der Küste von Maine.
Caroline verstand das nicht. Ihre Mutter war nie in Maine gewesen. Ihre Mutter kannte niemanden in Maine.
Sieh es als ein Geburtstagsgeschenk an, das ich mir selbst mache ‒ ein Geschenk der Ruhe und der Erholung. Ist Dir klar, daß ich im Juni siebzig werde?
Ja, das war Caroline klar. Der Altersunterschied zwischen ihr und ihrer Mutter betrug exakt dreißig Jahre, was bedeutete, daß sie immer gleichzeitig »runde« Geburtstage hatten. Andere Familien hätten zu diesen Gelegenheiten rauschende Gemeinschaftsfeste veranstaltet. Nicht so die St. Clairs.
Das Haus ist alt und reparaturbedürftig, doch das Grundstück ist atemberaubend. Es grenzt ans Meer und erstreckt sich auf der anderen Seite landeinwärts, und es gibt einen Salzwasser-Pool und eine Flut von Heidekraut, Wildrosen, Schlüsselblumen, Pfingstrosen und Iris ‒ aber Blumen interessieren Dich ja nicht, das weiß ich. Und ich weiß auch, wie beschäftigt Du bist, und deshalb komme ich jetzt zur Sache.
Ich möchte Dich um einen Gefallen bitten, Caroline, und ich bin mir durchaus bewußt, daß die Möglichkeit besteht, daß Du ihn mir verweigerst. Du hast das Gefühl, daß ich Dir nicht genug gegeben habe, und deshalb habe ich in der Vergangenheit darauf geachtet, nicht viel von Dir zu verlangen. Aber es liegt mir sehr viel an diesem neuen Haus, und deshalb schreibe ich Dir jetzt. Wenn es je einen Zeitpunkt geben sollte, da ich mir die wenigen Gefühle, die Du für mich hast, zunutze machen kann, dann ist er jetzt gekommen.
Caroline war erstaunt über Ginnys Durchblick und verspürte einen Anflug von Schuldgefühl.
Ich möchte, daß Du mich berätst.
Wie bitte?
Du hast ein sicheres Stilempfinden. Mein Geschmack mag nicht so zeitgemäß sein wie Deiner, aber ich bewundere, wie Du Dein Apartment eingerichtet hast.
Schmeicheleien helfen dir gar nichts, Mutter. Andererseits … Caroline las weiter. Vor allem hast Du einen sicheren Blick für Kunst. Die Stücke, die Du ausgesucht hast, verleihen Deiner Wohnung Warme. Ich denke dabei besonders an das Ölgemälde in Deinem Wohnzimmer. Ich glaube, ein Freund von Dir hat es gemalt.
Carolines Blick flog zu dem fraglichen Bild hinüber. Ben hatte es vor ihren Augen an einem einzigen Nachmittag geschaffen: eine Mischung aus Farbtupfern in verschiedenen Grün-, Blau- und Goldtönen, die er einer Wiese in der Nähe seiner Hütte entlehnt hatte. Caroline hielt dieses Werk für den Beweis für das Genie dieses Mannes. Sie liebte seine Einfachheit und, ja, seine Wärme. Aber es war eher abstrakt als realistisch, und damit eigentlich ganz gegen Ginnys Geschmack.
Du setzt Kunstwerke ein, um die harten Linien des modernen Dekors zu mildem, das Du bevorzugst. Diese harten Linien sind denen der Felsenlandschaft bei Downlee nicht unähnlich. Ich glaube, Du könntest in Stars End Wunder vollbringen.
Caroline fühlte eine dunkle Vorahnung in sich aufsteigen, als sie das dicke Kuvert musterte, dem sie den Brief entnommen hatte.
Ich habe Dir Flugtickets beigelegt, mit denen Du am fünfzehnten Juni vom O’Hare abfliegen und Ende des Monats dorthin zurückkehren kannst.
Carolines Unterkiefer klappte nach unten.
Ja, ich weiß, zwei Wochen sind eine lange Zeit, und Du hast einen Job. Damm schreibe ich Dir schon heute. Zwei Monate sollten Dir genügen, um Dir Deine Arbeit entsprechend einzurichten. Ich bin sicher, daß Du inzwischen eine Position hast, die Dir das gestattet, aber falls nicht, kannst Du immer noch einen familiären Notfall vorschützen. In gewissem Sinn wäre das nicht einmal gelogen. Ich bin nicht mehr jung ‒ ich weiß nicht, wieviel Zeit mir noch bleibt.
Oh, ich bitte dich! stöhnte Caroline und ließ das Kuvert in ihren Schoß fallen. Eine zweiwöchige Abwesenheit würde sie arbeitsmäßig ins Chaos stürzen. Es war gar nicht daran zu denken, daß sie Ginnys Wunsch entsprach, wie weinerlich ihre Mutter auch klingen mochte.
Die Frau hatte wirklich Nerven, das mußte Caroline ihr lassen. Sie war in Carolines Kinder- und Jugendzeit keine bemerkenswerte Mutter gewesen, meistens anderweitig beschäftigt, und wenn anwesend, dann nur körperlich. Sie war gefühlsmäßig nicht engagiert genug gewesen, um Caroline beizustehen, als diese sich von ihrem ersten Freund getrennt hatte oder als sie von dem College ihrer Wahl abgewiesen worden war, und am Tag der Abschlußfeier, die das Jurastudium krönte, hatte Ginny Grippe. Oh, sie hatte angeboten, der Zeremonie trotzdem beizuwohnen, doch das Angebot war nur halbherzig, und so hatte Caroline nicht darauf bestanden.
Caroline schuldete Ginny nichts.
Nicht das geringste.
Andererseits ‒ siebzig war siebzig.
Und Ginny war ihre Mutter. Schön, Caroline hatte allen Grund, sich zu bemitleiden, aber sie hätte schon völlig gefühllos sein müssen, wenn der Gedanke an den Tod ihrer Mutter ihr nicht einen Stich versetzt hätte. Schließlich war sie der einzige Elternteil, den Caroline noch hatte.
In völlig anderer Weise frustriert als früher an diesem Tag, las Caroline weiter. Ginny, ihre Haushälterin und die Möbel würden erst einen Tag vor Caroline eintreffen, was bedeutete ‒ obwohl Ginny das nicht erwähnte ‒, daß Caroline beim Auspacken würde helfen müssen.
O ja, Ginny war durchtrieben und selbstsüchtig und dreist. Und sie war eindeutig der Meinung, daß ihre Bedürfnisse Vorrang vor Carolines Arbeit hatten.
Caroline seufzte. Angesichts des heute ergangenen Urteils hatte ihre Mutter damit vielleicht sogar recht.
Andererseits war das heute ergangene Urteil vielleicht ein Beweis dafür, daß Caroline Urlaub brauchte. Der Gedanke, zwei Wochen am Meer zu verbringen, weit weg vom Büro, sich von einer Haushälterin verwöhnen zu lassen und ‒ abgesehen vom Auspacken ‒ wenig mehr tun zu müssen, als ihre Ansicht darüber zu äußern, wo was hin sollte, hatte einen gewissen Reiz.
Vielleicht käme sie bei ihren Partnern ja mit dem »familiären Notfall« durch.
Seit sie in die Firma eingetreten war, hatte sie noch nie mehr als drei Tage hintereinander freigenommen. Aufgrund ihres Fleißes konnte sie davon ausgehen, daß sie bis Mitte Juni arbeitsstundenmäßig ihre bisherige Bestzeit erreichen würde, und wenn das ihren Seniorpartnern bei Holten, Wills & Duluth nicht genügte, dann könnte sie ihnen auch nicht helfen. Außerdem waren sie ab Ende Juni ihrerseits verreist und machten in imposanten Seeufer-Anwesen selbst Urlaub.
So sehr es sie auch empörte, daß ihre Mutter es wagte, das Ansinnen an sie zu richten, ihr zwei kostbare Wochen ihres Lebens zu opfern, war die Idee doch verlockend. Und außerdem verspürte sie gegen ihren Willen einen Anflug von Stolz darauf, daß Ginny ihren Geschmack bewunderte. Sie hatte nicht Annette um Hilfe gebeten, und auch nicht Leah.
Und dann waren da noch die abschließenden Zeilen des Briefes: Wir hatten keine enge Beziehung, Du und ich, und ich würde das gerne korrigieren, wenn ich darf. Wenn Du kommst, hätten wir Zeit, uns zu unterhalten. Was meinst Du?
Was Caroline meinte, war, daß Ginny ein raffiniertes, altes Biest war. Sie hatte Caroline das einzige angeboten, das sie nicht ablehnen konnte.
Es war unfair. Es war ungerecht. Ginny verdiente es, zurückgewiesen zu werden.
Caroline war davon überzeugt, daß Ginny sich im umgekehrten Fall, wenn also Caroline ihre Mutter »eingeladen« hätte, mit einer plausiblen Erklärung höflich aus der Affäre gezogen hätte.
Aber sie war nicht Ginny. Sie brächte das niemals fertig. Seit sie sich erinnern konnte, hatte sie sich um Ginnys Zuneigung bemüht und war gleichzeitig von dem Wunsch beseelt gewesen, anders zu sein als Ginny. Und das würde sie jetzt nicht plötzlich ändern.
Kapitel 2
Das letzte, dessen man Annette St. Clair hätte bezichtigen können, war Ähnlichkeit mit ihrer Mutter. Virginia war klein und zierlich, Annette hochgewachsen; Virginia war blond, Annette dunkelhaarig; Virginia war kühl, Annette warmherzig. Körperlich ähnelte Annette am meisten ihrer älteren Schwester Caroline, eine Tatsache, die sie jahrelang verflucht hatte. Caroline war eine reine Einserschülerin gewesen, Klassensprecherin, eine »Macherin«. Dieses Vorbild war ein Alptraum für Annette gewesen, deren Stärke nicht so sehr der geistige, sondern mehr der charakterliche Aspekt war. Sie war die »Briefkastentante« ihrer Klasse, Freunde holten sich Trost und Unterstützung bei ihr. Sie hörte zu und gab Ratschläge und wurde von ihren Freunden vergöttert.
Unglücklicherweise wurden keine Urkunden über Bewunderung ausgefertigt, und auf den Zeugnisformularen war keine Spalte dafür vorgesehen, doch das machte nichts. Annette hatte nie ein Zeugnis gebraucht. Sie war eine Vollzeitmutter, und das war ihrer Meinung nach der wichtigste Job der Welt. Sie war stolz darauf, daß sie ihn gut machte, verwendete täglich bis zu sechzehn Stunden darauf, und erntete die Früchte in Form eines liebenden Ehemanns und fünf wundervoller Kinder.
Caroline hatte nichts dergleichen, und so sehr Annette sie als Kind beneidet hatte, jetzt würde sie nicht mit ihr tauschen wollen.
Und auch nicht mit Leah, der armen, bemitleidenswerten Leah, deren Leben ebenso seicht war wie Ginnys. In die Idee des Verliebtseins verliebt, hatte Leah sich mit neunzehn Hals über Kopf in eine Ehe gestürzt und sich mit zwanzig wieder scheiden lassen, mit zweiundzwanzig einen neuerlichen Versuch gemacht, der diesmal nach drei Jahren endete. Jetzt, mit vierunddreißig, lebte sie für die Nächte, doch bei all ihrem Herumflattern auf Partys blieb sie gleichgültig.
Annette war alles andere als gleichgültig, und darum ließ sie auch zunächst die Finger von dem dicken Kuvert, das mit der übrigen Post auf dem Küchentresen lag. Der Philadelphia-Stempel und die elegante Schrift, die den Umschlag an St. Louis und Mrs. Jean-Paul Maxime adressiert hatte, gestatteten keinen Zweifel an seinem Ursprung. Und er konnte warten. Er konnte lange warten, sehr lange. So lange, wie Annette darauf gewartet hatte, von ihrer Mutter in den Arm genommen zu werden und ein ehrliches, zärtliches »Ich liebe dich« von ihr zu hören.
Nein, Ginny hatte sich nicht das Recht darauf verdient, Annettes Zeit zu beanspruchen ‒ nicht, wenn Annette soviel zu tun hatte. Sie hatte den Tag damit begonnen, Aufsicht bei einem Ausflug der Klasse des zwölfjährigen Thomas zu führen und anschließend bei Neiman Marcus hineingeschaut, um Kleider zu kaufen, die ihre sechzehnjährigen Zwillinge für den Tanzabend in zwei Wochen brauchten. Da sie schon einmal dabei war, nahm sie auch gleich noch dazu passende Schuhe und die entsprechende Unterwäsche mit und schleppte jetzt, als das Ein-Uhr-Mittags-Geläute in der Halle einsetzte, ihre Einkäufe die breite Wendeltreppe hinauf.
»Warten Sie, ich helfe Ihnen«, rief Charlene, die Haushälterin, und kam hinter ihr hergelaufen.
Annette überließ ihr die Pakete, die sie obenauf balanciert hatte, und ging weiter ins Zimmer der Mädchen, wo sie die Kleider auspackte und dekorativ auf dem jeweiligen Bett arrangierte. Charlene machte große Augen. »Sie sind wunderschön!«
Das fand Annette auch. »Ich glaube, sie sind ideal: Rauchblau für Nicole und Rot für Devon. Wahrscheinlich wäre ihnen Schwarz lieber, ich höre sie schon: Alle kommen in Schwarz!
Aber Gott sei Dank haben sie keine Zeit, selbst einkaufen zu gehen, und so ergeben sie sich hoffentlich in ihr Schicksal. Falls nicht, falls sie meine Wahl absolut ablehnen, kann ich die Kleider zurückbringen und mein Glück ein zweites Mal versuchen, aber zumindest sind erst mal zwei da.« Zufrieden schaute sie auf die Uhr. »Gerade noch Zeit für einen schnellen Bissen. Ich habe einen Termin bei den Zweitklaßlehrern«, für Nat, den Jüngsten, »und um drei fängt Robbies Spiel an.«
Sie machte sich daran, die Treppe hinunterzugehen. Als das Telefon in der Küche klingelte, beschleunigte sie ihre Schritte. »Hi, Mom, ich bins.«
»Robbie! Eben habe ich an dein Spiel gedacht.«
»Darum rufe ich an. Bitte komm nicht, Mom.«
»Warum nicht?«
»Weil ich nicht spielen werde.«
»Warum denn nicht?«
»Weil der Trainer es mir gerade gesagt hat.«
»Aber du warst letztes Jahr spitze.«
»Das war bei der Junior-Varsity-Mannschaft. Jetzt spielt das Varsity-Team.«
»Aber du bist ein unglaublicher First Baseman.«
»Hans Dwyer ist besser, und er ist ein Senior. Ich bin nur ein Junior.«
Mitleid mit ihrem Sohn stieg in Annette auf. »Du wirst überhaupt nicht spielen?«
»Vielleicht bei den letzten Innings, wenn wir weit vorne liegen oder weit hinten.«
»Aber das ist nicht fair!«
»Es ist an der Tagesordnung.«
»Ich komme trotzdem, für den Fall, daß du doch eingesetzt wirst«, beschloß Annette.
»Bitte nicht, Mom.«
»Es macht mir nichts aus«, insistierte sie. »Wirklich.«
»Aber mir! Ich will nicht, daß du kommst. Es ist schon schlimm genug, daß ich auf der Reservebank hocken muß, und wenn du zuschaust, ist es noch zehnmal schlimmer!«
»Aber ich will das Team anfeuern!«
»Nein, Mom!«
»Hör zu«, sagte sie beschwichtigend, »laß uns nicht streiten. Du gehst zu deinem Spiel und gibst dein Bestes. Wenn ich komme, bin ich da, wenn nicht, dann nicht.« Sie wußte, daß sie hinfahren würde. Sie hätte körperlich behindert sein müssen, um ein Ereignis zu versäumen, an dem eines ihrer Kinder beteiligt war, selbst wenn, wie in Robbies Fall, nur auf der Reservebank. Annette betrachtete es als ihren Lebenszweck, für ihre Kinder da zu sein, und sie wollte ihnen das Gefühl ersparen, jemals nur andere Eltern im Publikum zu sehen und nicht ihre eigenen.
Jean-Paul tat sein Mögliches: Er besuchte Spiele, Konzerte und Schülerwettkämpfe, wann immer er konnte, doch das war nicht oft der Fall, und das mit gutem Grund. Er war Neurochirurg. Sein Arbeitstag dauerte von sieben Uhr morgens bis sieben Uhr abends, und danach mußte er zu Hause lesen.
Und so war es doppelt wichtig, daß Annette Ereignissen wie Baseballspielen beiwohnte. Sie war sicher, daß Robbie nur protestiert hatte, weil er glaubte, sich das als Siebzehnjähriger schuldig zu sein, und sich insgeheim freuen würde, wenn sie käme.
Aus diesem Grund war sie auch nicht gekränkt, als er sie unter den Zuschauern zwar entdeckte, jedoch nicht zur Kenntnis nahm, und nach dem Spiel mit einer andeutungsweise zum Gruß erhobenen Hand an ihr vorbeirannte. Und sie wartete auch nicht. Er würde schon irgendwann heimkommen, und außerdem mußte sie Thomas vom Trompetenunterricht abholen und zur Mathenachhilfe fahren und anschließend Nat bei seinem Freund abholen und zum Dinner nach Hause bringen. Sie hatte kaum die erste Schicht abgefuttert, als die Mädchen hereinstürmten und sie mit Berichten über ihren Tag überschütteten. Wie befürchtet, waren sie nicht begeistert von den Kleidern, aber nicht wegen der Farben. »Wir hatten vor, morgen nach der Schule mit Susie und Beth einkaufen zu gehen«, sagte Nicole.
Das hielt Annette für nicht realisierbar. »Dazu werdet ihr keine Zeit haben, ihr habt übermorgen zwei Schulaufgaben.«
»Wir haben schon gelernt«, versicherte Devon ihr.
»Wirklich?«
»Na ja, ein bißchen, aber den Rest können wir nach dem Einkaufen machen.«
»Ehrlich, Mom«, insistierte Nicole. »Wir haben das schon ewig ausgemacht.«
»Aber was ist mit diesen Kleidern?« Annette deutete auf die Betten.
»Sie sind toll.«
»Aber sie sind dein Geschmack ‒ nicht unserer.«
»Sie würden euch großartig stehen«, verteidigte Annette ihre Wahl. »Sie sind sensationell.«
»Aber wir wollten uns selbst welche aussuchen.«
»Du machst immer alles für uns, Mom.«
»Weil ich so gerne für euch einkaufe.«
»Nur, weil Grandma es für dich nie getan hat und du das vermißt hast, aber uns hat da nie was gefehlt.«
»Apropos Grandma«, sagte Devon. »Was hat sie denn geschickt?«
Es dauerte einen Moment, bis Annette sich an das Kuvert erinnerte, das noch immer in der Küche lag. »Ich weiß es nicht.«
»Du hast den Umschlag nicht aufgemacht?«
»Noch nicht.«
»Bist du denn nicht neugierig?«
»Nicht besonders«, antwortete Annette mit einem Lächeln und streckte die Hände nach ihren Töchtern aus. Berührungen waren wichtig, auch kleine. »Ihr beide interessiert mich bedeutend mehr. Wollt ihr gleich essen oder später?«
Sie entschieden sich für ersteres. Annette leistete ihnen Gesellschaft, und sie setzte sich auch zu Robbie, als er heimkam. Sie selbst aß erst mit Jean-Paul und steckte gerade den letzten Teller in den Geschirrspüler, als plötzlich das Kuvert aus Philadelphia vor ihrem Gesicht auftauchte.
»Übersiehst du das absichtlich?« fragte Jean-Paul mit seiner ruhigen, leicht akzentgefärbten Stimme. Es war eine besänftigende Stimme, eine Zuversicht vermittelnde Stimme, die Vertrauen bei seinen Patienten weckte und tröstlich auf Annette wirkte.
»Kann schon sein.«
»Als Retourkutsche?«
Sie lachte leise, ertappt.
Er wedelte auffordernd mit dem Umschlag. Sie nahm ihn zwischen Daumen und Zeigefinger und warf ihn auf den Tresen. »Später. Wenn ich mit allem anderen fertig bin.« Als erstes kamen ihre Kinder. Sie wollte nicht, daß irgend etwas ihre Zeit mit ihnen beschnitt, und die wie auch immer geartete Kommunikation mit ihrer Mutter hatte genau diese Auswirkung. Immer. Es fiel ihr leichter, ihre Schwestern zu verdrängen, als Ginny. Da blieb zu viel Ablehnung im Gedächtnis, ausgelöst durch Erinnerungen an nur gespielte Nähe und ein sporadisches Familienleben. Ginny war dagewesen, ohne da zu sein. Annettes Maxime war, immer da zu sein.
Sie wollte verdammt sein, wenn sie sich jetzt von ihrer Mutter in dem gewohnten Tagesablauf behindern ließe.
Aber sie konnte den Abend nicht ewig in die Länge ziehen. Irgendwann lagen Nat und Thomas in den Betten, und die älteren waren entweder mit Lernen oder Telefonieren beschäftigt. Jeder hatte sie auf die sanfte Tour mit einem enthusiastischen Gutenachtkuß verabschiedet.
Und so schlüpfte Annette schließlich in ihr Nachthemd und glitt neben Jean-Paul ins Bett. Er hatte sich die Kissen in den Rücken gestopft, seine Lesebrille saß auf seiner edlen, gallischen Nase, die die Zwillinge gütigerweise geerbt hatten, seine langen Beine lagen nackt und entspannt unter der Decke.
Erst jetzt, als sie mit seinem Trost rechnen konnte, faltete sie den Brief ihrer Mutter auseinander und begann zu lesen. Bereits Sekunden später schnaubte sie aufgebracht.
»Quoi?« fragte Jean-Paul.
»Sie fängt damit an, daß sie annimmt, daß es uns sieben gutgehe, da sie weder von mir noch meinen Schwestern etwas Gegenteiliges gehört habe. Arme Mutter. Sie tut immer noch so, als seien wir eine große, glückliche Familie. Aber weder Caroline noch Leah wüßten es, wenn einer von uns krank wäre, ich habe seit Wochen nicht mit ihnen gesprochen.«
»Das ist traurig«, erwiderte er, ohne kritischen Unterton. »Wie würdest du dich fühlen, wenn unsere Kinder zu Fremden heranwachsen würden?«
»Schrecklich! Und deshalb erziehe ich sie so, daß sie später einmal unsere Freunde sind. Sie müssen nicht um meine Zeit oder Zuneigung wetteifern, wie meine Schwestern und ich das bei Ginny tun mußten. Ich habe soviel von beidem, daß es für alle reicht.«
Sie las weiter ‒ und stieß einen Moment später einen abschätzigen Ton aus. »Sie ist gerade aus Palm Springs zurück und schreibt, daß es in Philadelphia ruhiger …« Sie schnappte nach Luft. »Du liebe Güte! Sie hat das Haus verkauft! Und ein neues gekauft, in Maine?« Sie runzelte die Stirn. »Das verstehe ich nicht.«
»Warum nicht?«
»Mutter ist vor allem anderen ein geselliges Geschöpf. In Maine kennt sie keine Menschenseele.« Sie sprach leise weiter, während sie die nächsten Sätze las. »Und sie zieht nicht mal nach Portland, sondern in einen kleinen Küstenort ‒ anscheinend so eine Art Künstlerkolonie. Sie wird siebzig.« Wieder hob Annette den Blick zu Jean-Paul, diesmal, um sich Zuversicht bei ihm zu holen, denn so jämmerlich sie Ginny in ihrer Rolle als Mutter auch fand, hatte der Gedanke an ihr Alter doch etwas Beunruhigendes. »Mit siebzig wird’s langsam ernst.«
»Dein Vater war älter, als er starb.«
»Aber Mutter ist anders, sie sieht kaum wie sechzig aus.«
»Und außerdem ist sie eine Frau, und darum identifizierst du dich mit ihr.«
»Nein, das tue ich nicht. Kein bißchen!« Sie entzog sich Jean-Pauls amüsiertem Blick, indem sie weiterlas, setzte ihre leisen Kommentare dabei jedoch fort. »Stars End ‒ so heißt das Anwesen ‒ ist ihr diesjähriges Geburtstagsgeschenk an sich selbst. Sie schreibt, es habe einen traumhaft schönen Garten. Leah wird hingerissen sein, da kann sie nach Herzenslust ihren gärtnerischen Ambitionen frönen. Allerdings wird es da oben in Maine niemanden von Wichtigkeit geben, der in Begeisterungsstürme ob ihres künstlerischen Genies ausbricht.«
»Annette!« tadelte er.
Aber Annette mußte ihre alte Wut loswerden. »Kein Problem: Mutter wird die Begeisterungsstürme liefern. Leah war immer ihr Liebling.«
»Ach, komm …«
»Es stimmt. Leah war die einzige von uns, die Geschmack am Country Club fand. O-oh! Mutter schreibt, sie wolle mich um einen Gefallen bitten.« Sie stieß ein freudloses Lachen aus. »Sie schreibt, sie sei sich bewußt, daß ich vielleicht ablehnen werde. Wie einfühlsam, Ginny.«
»Annette!«
Jetzt meldete sich ein Anflug von schlechtem Gewissen. »Tut mir leid, aber wenn es um Ginny geht, werde ich leicht bissig.« Diesmal schwieg sie beim Weiterlesen. Die Stille zog sich hin, bis Jean-Paul sie dadurch unterbrach, daß er raschelnd seine Papiere beiseite legte.
»Quoi?«
»Die Frau ist erstaunlich. Wirklich.« Sie spähte in den Umschlag und schleuderte ihn dann ans Fußende des Bettes. »Da ist ein Flugticket drin. Sie will, daß ich die letzten zwei Juniwochen zu ihr komme und ihr beim Einrichten helfe. Sie schreibt, daß sie immer die Behaglichkeit unseres Hauses hier bewundert hat. Als ob eine Einrichtung Behaglichkeit vermitteln könnte! Begreift sie nicht, daß die von Menschen geschaffen wird und nicht von Dingen?«
»Sie möchte, daß du ihr neues Haus einrichtest?«
»Nicht direkt. Eher, daß ich ihr dabei helfe, es einzuweihen.«
»Das klingt, als ob es Spaß machen würde«, sagte Jean-Paul so ernst, daß Annette von ihm abrückte.
»Ich fliege nicht!«
»Weshalb nicht?«
»Ich habe hier Verpflichtungen, Verpflichtungen, die mir sehr viel wichtiger sind, als meiner Mutter einen Gefallen zu tun. Ich kann nicht einfach alles für zwei Wochen liegen und stehen lassen. Ich schulde ihr das nicht, sie hat es auch nie für mich getan. Die Sache läge anders, wenn sie auch für dich und die Kinder Tickets geschickt hätte, aber das ist ihr nicht in den Sinn gekommen. Sie hat keine Ahnung, was meine Familie mir bedeutet.«
»Wahrscheinlich hat sie angenommen, daß die Kinder zu dieser Zeit in der Schule seien.«
»Wenn das stimmt, dann zeigt das nur, wie weltfremd sie ist. Die Kids hängen zum fraglichen Zeitpunkt genau zwischen Schule und Sommerplänen. Thomas und Nat werden bis zum Beginn der Campferien nur Blödsinn anstellen, und Robbie und die Mädchen fangen erst am Ende des Monats mit ihren Jobs an. Die zwei Wochen wären die allerungünstigsten für eine Abwesenheit meinerseits. Aber ich würde auch zu einem anderen Termin nicht hinfliegen wollen.«
»Deine Mutter bewundert deinen Geschmack.«
»Hm.«
»Sie würde dich nicht um Hilfe bitten, wenn sie das nicht täte. Sie hat sich nicht an Caroline oder Leah gewandt, sondern an dich.«
Annette mußte zugeben, daß diese Tatsache etwas Befriedigendes hatte. Von den drei Schwestern verkörperte sie in größtem Maße, was Ginny versucht, aber nicht geschafft hatte.
Jean-Paul schaute schweigend vor sich hin. Als er nicht zu seiner Lektüre zurückkehrte, stupste sie ihn in die Seite. Er legte seine Brille beiseite und sagte: »Ich finde, du solltest es dir noch mal überlegen.«
»Es ist jenseits jeglicher Diskussion.«
»Das sollte es aber nicht sein. Sie bittet dich um einen Gefallen. Ja, ich weiß, du glaubst, ihr nichts schuldig zu sein ‒ aber immerhin hat sie dir das Leben geschenkt. Wenn sie das nicht getan hätte, hätte ich dich nicht, und unsere Kinder wären nie geboren worden. Sie ist deine Mutter, Annette.«
»Aber ich werde hier gebraucht.«
»Ja, davon sind wir alle durchdrungen«, sagte er mit einem Seufzen, »aber wäre es nicht schön, festzustellen, daß wir zwei Wochen unseres Lebens ohne dich auskommen können?«
»Natürlich könnt ihr das.«
»Wirklich? Wenn wir es nicht versuchen, werden wir es nie erfahren.«
»Aber der Zeitpunkt ist so ungünstig.«
»In Wahrheit ist er das gar nicht«, erwiderte Jean-Paul langsam. »Rob und die Mädchen werden da sein, um ein Auge auf Thomas und Nat zu haben. Sie könnten sich abwechselnd mit ihnen beschäftigen.«
Annette studierte sein Gesicht. »Du meinst es ernst.«
Es dauerte eine Minute, bevor er mit einem nachdenklichen »Ja« antwortete.
»Aber es geht um meine Mutter, Jean-Paul. Du weißt, wie ich zu ihr stehe.«
»Ja, ich weiß, wie, aber ich habe nie ganz verstanden, warum. Was hat sie denn so Schreckliches getan?«
Annette rückte sich die Kissen zurecht. »Das Schreckliche war, daß sie nichts getan hat.« Sie ließ sich in die Kissen zurückfallen und entzog sich so Jean-Paul als Strafe für seine Zweifel. »Sie war eine Roboter-Mutter. Sie führte die richtigen Bewegungen aus und tat alles, was von ihr erwartet wurde, doch sie war nie gefühlsmäßig engagiert. Nicht wirklich. Ich habe dir von dem Schlafzimmervorfall erzählt ‒ der ist ein perfektes Beispiel dafür.«
»Ich habe nie begriffen, was so schlimm an dem war, was sie getan hat.«
»Jean-Paul«, beschwerte sich Annette, »sie hat mich wie einen Niemand behandelt!«
»Weil sie dein Zimmer umdekorieren ließ, während du im Sommerlager warst?«
»Weil sie mich nicht einbezogen hat. Sie hat mich nicht nach meinen Wünschen gefragt. Sie hat mich nicht einmal gefragt, ob ich überhaupt etwas anders haben möchte. Nein, sie entschied, was geschehen sollte und wann, und nicht nur bei mir. Bei Caroline und Leah machte sie es genauso. Sie gestaltete während des Sommers unsere Zimmer um, ohne unsere Charaktere auch nur im mindesten zu berücksichtigen. Als wir aus den Ferien zurückkamen, fanden wir Zimmer vor, die sensationell gestylt waren, fast identisch und unpersönlich.«
»Sie wollte euch eine schöne Umgebung schaffen.«
»Sie schuf uns eine Umgebung, die ihren Vorstellungen entsprach, nicht unseren. Es interessierte sie nicht, was wir wollten, und sie war uns niemals wirklich nah. Da war immer eine Mauer. Als Kinder hatten wir ständig das Gefühl, ihr Mißfallen zu erregen und suchten die Schuld für ihre mangelnde Zuwendung bei uns. Immer hatten wir den Eindruck, etwas falsch gemacht zu haben.«
»Vielleicht lag das einfach an ihrem Wesen. Nicht jeder Mensch ist so warmherzig wie du, und nicht jeder geht so in der Familie auf wie du.«
»Aber das ständige Gefühl, daß wir ihr nichts rechtmachen konnten, wirkte sich nachhaltig auf unsere Entwicklung aus. Bei Caroline wurde es zur Besessenheit, die beste Rechtsanwältin der Welt zu werden, und vielleicht ist sie das sogar, auch wenn sie kalt wie ein Fisch ist. Bei Leah wurde es zur Besessenheit, geliebt zu werden, und vielleicht wird sie das sogar hier und da für eine Nacht.«
»Und bei dir wurde es zur Besessenheit, die beste Mutter der Welt zu werden.«
»Nicht zur Besessenheit, das ist ein zu hartes Wort.«
»Aber zutreffend. Es ist das Wichtigste für dich.«
»Kann sein«, gab sie zu. »Aber was ist dagegen zu sagen?«
»Im Grunde nichts, aber es führt dazu, daß du Angst hast, uns auch nur für zwei kurze Wochen alleinzulassen.«
»Nicht ›Angst‹.«
»Ich denke doch.«
Annette wäre beleidigt gewesen, wenn sie Jean-Pauls Liebe weniger sicher gewesen wäre, aber sie waren zu allem anderen auch noch die besten Freunde. »Erklär mir das«, forderte sie ihn auf. Es dauerte eine Weile, bis er ihrer Bitte nachkam, und dann war seine Stimme sanft. »Wir sind dein Leben. Du hast dich einzig und allein uns verschrieben. Die Liebe in unserer Familie verkörpert alles, was du als kleines Mädchen vermißt hast. Und du hast Angst, es zu verlieren.«
Sie schüttelte den Kopf, doch er führ fort.
»Du hast Angst, daß etwas verlorengeht, wenn du nicht bei jedem Niesen mit einem Taschentuch für uns bereitstehen kannst. Deiner Meinung nach bist du dann nachlässig wie deine Mutter, und die Liebe wird erlöschen.«
Sie schnaubte. »So schlimm bin ich nicht.«
»Aber du hast Angst. Du befürchtest, wenn du dich nicht intensiv um unsere Kinder kümmerst, werden sie dich ablehnen und sich von dir entfernen, wie du dich von deiner Mutter entfernt hast.«
»Jede Frau fürchtet den Tag, an dem ihre Kinder das Nest verlassen.«
»Aber du brauchst das nicht«, sagte er mit eindringlicherer Stimme. »Deine Kinder lieben dich. Sie wissen, wie sehr du sie liebst und wie viel du für sie tust. Ihre Erfahrungen mit dir unterscheiden sich völlig von deinen Erfahrungen mit Virginia. Sie haben eine enge Bindung an dich, Annette. Wenn du nicht da bist, werden sie dich vermissen.«
»Da hast dus ‒ und genau deshalb werde ich Mutters Wunsch nicht nachkommen.«
Er senkte die Stimme und sagte ernst: »Aber sie müssen lernen, daß sie dich vermissen und trotzdem ohne dich überleben können. Das gehört nun mal zum Heranwachsen. Sie müssen ohne dich zurechtkommen können und sich dann freuen, wenn sie dich wiederhaben.«
»Aber warum sollen sie ohne mich zurechtkommen, wenn keine Notwendigkeit dazu besteht?«
»Die Notwendigkeit besteht durchaus. Manchmal bist du zu fürsorglich, Annette. Du mußt den Kindern Luft zum Atmen lassen.«
»Und was ist mit dir?« fragte sie alarmiert. »Brauchst du auch Luft zum Atmen?«
Er lächelte. »Oh, ich kann sehr gut atmen mit dir an meiner Seite.« Sein Lächeln wurde traurig. »Aber du mußt selbst atmen.«
»Ich atme, wenn ich hier bei meiner Familie bin.«
»Du mußt dich als Individuum sehen, das braucht jeder Mensch. Ich kann dies in der Arbeit tun, aber bei dir ist Arbeit gleich Zuhause und zu Hause gleich Arbeit, und es gibt keine Trennung, keine Möglichkeit, alles ins richtige Verhältnis zu setzen. Und dann ist da deine Mutter. Du hast recht ‒ allmählich wird es ›ernst‹. Die Siebzig zu erreichen, ist schon ein Geschenk an sich. Du weißt nicht, wieviel Zeit ihr noch bleibt.«
»Genau das hat sie geschrieben«, murmelte Annette. »Der Druck auf die Tränendrüse.«
»Du solltest Frieden mit ihr schließen.«
»Wir haben Frieden.«
Er schaute sie forschend an, schüttelte langsam den Kopf, sagte jedoch nichts.
»Na ja ‒ so eine Art Frieden«, gestand Annette ihm zu. Ginnys abschließende Sätze gingen ihr nicht aus dem Kopf. Wir haben uns in der Vergangenheit nicht nahegestanden, doch das bedeutet nicht, daß wir keine gemeinsame Basis finden können. Ich fände es schön, Zeit miteinander zu verbringen. Wir könnten reden.
»Du kannst ihn verbessern.«
»Aber ich will nicht zu ihr.«