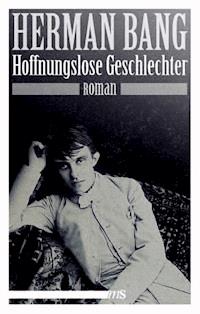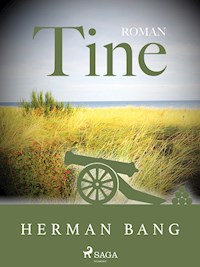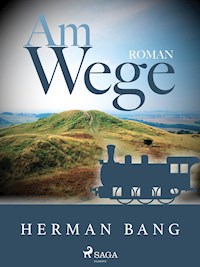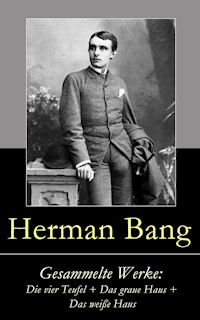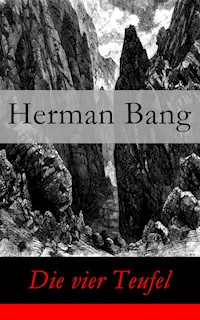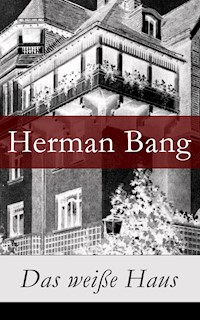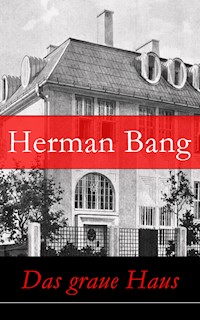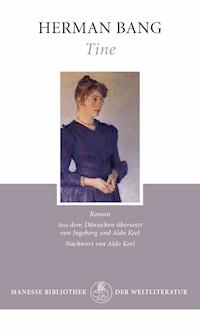Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Romane und Novellen
- Sprache: Deutsch
Die Werke Herman Bangs (1857-1912) gehören zu den bedeutendsten der dänischen Literatur, teils wegen ihres tiefen Einblicks in die mensch-liche Seele, teils wegen ihres impressionistischen, filmischen Stils, der die Prosa seiner Zeit veränderte und noch immer die Literatur der Neuzeit prägt. Die auf zehn Bände angelegte Neuübersetzung der Romane und Novellen fußt auf der großen historisch-kritischen Gesamtausgabe der „Danske Sprog- og Litteraturselskab“, Kopenhagen 2008–2010.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 543
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Das weiße Haus
Anmerkungen
Nachwort
Anhang
Das graue Haus
Anmerkungen
Nachwort
Sommerfreuden
Anmerkungen
Nachwort
Hinweis
Das weiße Haus
Für einen Freund
– DIE KINDHEIT IST DER GRUNDTON FÜR DAS GANZE LEBEN, MAMA. DIE ANDEREN FARBEN WERDEN NUR AUFGETRAGEN. ALS ICH EMPFANGEN WOLLTE, HABE ICH DEINE KÄMPFE, DEINE QUAL EMPFANGEN. IN DEM ALLGEMEINEN CHAOS HIELT ICH NUR EINS FÜR GLÜCK, WEIL ICH FÜHLTE, DAß ES DICH GLÜCKLICH MACHTE: RUHE, RUHE. SCHON ALS KIND. UND DAS TIEFSTE, WAS EIN JUNGE ERFÄHRT, DAS WEIB, IST MEINEN AUGEN NICHT ERÖFFNET WORDEN. ICH HABE JA DAS LEBEN SO LIEB, MAMA, ICH WEIß, WIE STARK DAS LEBEN IST UND ATME LEISE MIT, DEN BLÜTENDUFT DER LIEBE, ABER DAS BESTE IST DOCH IMMER MEINE SEHNSUCHT – ICH BIN EIN BETTLER AM WEGE, WENN DIE MÄDCHEN AN MIR VORÜBERZIEHEN IN DEN FRÜHLING HINAUS …
– UND DEINE WERKE, MEIN SOHN, HAST DU NICHTS ERLEBT, WAS DU DEN MENSCHEN GEBEN KANNST?
ICH HABE IHNEN VON MEINEN SCHMERZEN GEGEBEN; DAS HAT SIE GERÜHRT – FÜR MICH WAR ES NICHTS, ICH HABE MEIN HERZ DABEI VERSCHWENDET, OHNE ZU EMPFANGEN, OHNE FROH ZU SEIN.1– –
GEORG HIRSCHFELD
Tell me the tales,
that to me were so dear,
long long ago
long long ago.2
Long, long ago –
long ago.
Kindheitstage, ich will Euch zurückrufen, Zeiten ohne Haß, freundliche Zeiten, an euch will ich mich gerne erinnern.
Meiner Mutters sachte Schritte werden durch helle Stuben klingen, und Menschen, die nun unter der Bürde des Lebens grau sind, werden lachen wie die, die ihr Schicksal nicht kennen. Laßt sie, die starben, wieder mit milden Stimmen reden, und alte Weisen werden sich durch den Chor der Erinnerungen winden.
Aber auch bittere Worte werden erklingen, schwere Worte, welche die sprechen, die die bittere Abrechnung mit dem schweren Leben kennen.
Tell me the tales,
that to me were so dear,
long long ago
long long ago.
Es war zuhause die Stunde der Dämmerung.
Draußen fielen, leise, Schleier auf Schleier über den leuchtenden Schnee. Die Seitenflügel entschwanden, die großen Pappeln verloren sich. Nur Jens, der Stallknecht, schlich drüben bei den Ställen mit seiner Laterne umher.
Drinnen saßen wir, die Kinder, im Kreis auf Schemeln. Die Stube war groß, die Winkel weit auseinander. Vielleicht versteckten wir die Köpfe hinter einer Gardine, weil es so dunkel war.
Mutters Stimme klang so zärtlich, die Saiten des Klaviers klangen eher wie eine Harfe:
Tell me the tales,
that to me were so dear,
long, long ago
long long ago.
Der Gesang verstummte. Kein Laut war zu hören. William, der am nächsten bei der Mutter saß, war auf seinem Hocker eingeschlafen.
„Mutter, sing weiter!“
Es fiel etwas Licht auf die weißen Tasten, weiter über alle Möbel und entschwand. Stallknecht Jens schlich mit seiner Laterne geschäftig an den Fenstern vorbei.
„Mutter, sing weiter!“
Eine Tür wurde geöffnet, ganz vorsichtig. Es war die des Vaters.
Hr. Peder grub wohl Runen in den Steg,
Dort, wo Klein-Hellen oft nahm ihren Weg.
Drauf lichtet er den Anker,
Dem Winde durft er trau’n,
Er segelte von Dänemark
Und von den dän’schen Fraun.
Schöne Worte
Rühren manches Herz,
Schöne Worte
Brachten mir viel Schmerz,
Schöne Worte.3
Es ist still. Schlank und fein sehen wir die Mutter als Schatten. Schweigt der Schatten, hört man die große Uhr.
Schöne Worte
Rühren manches Herz,
Schöne Worte
Brachten mir viel Schmerz,
Schöne Worte.
Draußen wird sachte eine Türklinke gedrückt. Es sind die Mädchen, die zuhören wollen. Rund um den Messingleuchter auf dem Küchentisch lauschen sie, während „die gnädige Frau“ singt.
Der Großknecht huscht herein. Die Holzschuhe hat er vorsichtig vor sich hingestellt; er lehnt sich an den Türpfosten neben dem Wassereimer.
„Kinder!“
„Ja, Mutter?“
„Singt mit!“
Die Mutter erhebt ihre Stimme, schlägt die zitternden Tasten etwas fester an und singt wieder:
Schön ist die Erde,
Prächtig Gottes Himmel,
Schön der Seelen Pilgrimsgang.4
Etwas ängstlich vor der Dunkelheit kommen aus der Ecke die Stimmen der Kinder durch das Dunkel, von Mutters Stimme angeführt:
Hin durch die weiten Reiche der Erde
Gehn wir zum Paradies mit Gesang.
Draußen in der Küche sitzen die Mädchen immer noch still um die brennenden Kerzen.
Die vierschrötige Marie wischt eine Träne mit dem Rücken ihrer schwieligen Hand weg:
„Das“, sagt sie, „möchte die gnädige Frau gesungen haben, wenn sie einmal sterben wird.“
Alles ist ruhig. Nur die große Uhr an der Tür spricht.
Dann sagt aus seiner Ecke einer der Jungen leise:
„Mutter, sing es noch einmal, ich habe es nicht verstanden.“
Mutters Schatten schweigt noch. Dann ertönen wieder – aber schwächer – die harfenähnlichen Tasten:
Tell me the tales,
that to me were so dear
long, long ago
long long ago.
– – – –
Kindheitstage, ich will Euch zurückrufen – zarte Zeiten ohne Schuld, als das Herz froh war. Sachte Tage, als die Tränen lind waren.
Kindheitstage, als Mutter noch lebte.
Ich erinnere mich an einen Tag, als wir Brombeeren sammelten – Mutter, wir Kinder und Tine von der Schule.
Es gab so viele Beeren, und die Ranken waren so schön.
Hinab in die Gräben ging es, und an den Hecken liefen wir entlang.
Wir Kinder blieben an den Ranken hängen und kreischten.
Unsere Gesichter waren verschmiert, so daß wir den Kindern von Lars, dem Schmied, glichen.
„Schaut euch den Jungen an, schaut euch den Jungen an!“ rief Mutter.
Aber Tine hatte eine mächtige Ranke ergriffen, die voll von dunklen Beeren war, und warf sie schnell um Mutters Schulter:
„Ach, Sie schöne Frau“, sagte sie …
Die Mutter stand an der Hecke, die Ranke um ihre Brust. Hoch gegen den leuchtenden Himmel.
– – –
Kindheitstage, euch will ich zurückrufen.
Das weiße Haus
Es war ein weißes Haus, und drinnen im Haus waren die Tapeten hell.
Alle Türen standen offen, auch im Winter, wenn mit Holz gefeuert wurde.
Zwischen den Mahagonimöbeln standen Marmortische und auch weiße Wandtischchen, die von Augustenburg5 stammten, vom Schloß, als eine Auktion stattfand. Um die alten Porträts waren Strohblumen gewunden, und es gab viel Efeu, denn ihn liebte die gnädige Frau, wenn er sich an einer hellen Wand emporrankte.
Der Wintergarten war so weiß, als leuchtete er.
Die Kinder liebten diesen Wintergarten und die Treppe zum Garten, wo sie das weißgemalte Geländer hinabrutschten.
„Kinder, Kinder! Lehnt euch nicht an“, rief Mutter, „lehnt euch nicht an das Geländer!“
„Um Gottes Willen“, sagte sie zu Tine, der Lehrerstochter, „es endet eines schönen Tages damit, daß sie sich den Hals brechen!
Wir lassen auch nie den Schreiner kommen!“
Das Geländer wackelte und wurde nie instandgesetzt.
Aber die Tür zum Garten wurde früh geschlossen, die Läden zugemacht und die grünen Vorhänge über die weißen geschoben, so daß es gemütlich wurde. Denn Mutter mochte den Garten und die große Allee nicht, wenn die Sonne nicht auf sie schien, Sonne, die lange am Himmel stand.
„Gott weiß, wie es im Kräutergarten aussieht“, sagte sie plötzlich zu Lehrers Tine, während sie nachmittags miteinander Kaffee tranken.
Dreiviertel des Jahres kam sie nicht in den Kräutergarten.
Dieser war weit weg hinter der Pappelallee und und hinter der Einfahrt, und die Kinder durften auch nicht hochlaufen, denn dann bekämen sie nasse Füße. Aber manchmal, wenn die Wegverhältnisse am allerschlimmsten waren und man auf dem ganzen Hof vor lauter Morast keinen Grund fand, wollte die Mutter hin, um nach dem Garten zu sehen.
In den Holzpantinen der vierschrötigen Marie und mit geraffter Schürze zog sie davon, über den Hof.
Alle Dienstmädchen standen draußen auf der Treppe, um ihr nachzusehen.
„Kinderchen, Kinderchen“, rief sie; sie kam keine zehn Schritte weit, bis sie mit den Holzschuhen stecken blieb.
Wenn sie nach Hause kam, brauchte sie warmen Zwieback zur Stärkung.
„Meine Liebe“, sagte sie zur Tochter des Lehrers: „Daß doch kein Mensch im Winter drinnen bleibt.“
Die Kinder spielten auf dem Teppich. Er war rot und grau mit vielen großen Feldern. Die Felder waren Königreiche, über die die Kinder herrschten und um die sie kämpften. Sie stritten sich und vergossen Tränen. Sie verbarrikadierten ihre Königreiche mit Möbeln. Die ganze Wohnstube glich einer babylonischen Verwirrung.
„Was die Kinder doch für einen Krach machen“, sagte Mutter zur Jungfer (dabei feuerte sie sie selbst zum Lärm an):
„So, so, nun verliert Stella wieder ihre Höschen.“
Mit den Höschen ging es ewig schief. Einmal wurden sie zerknittert, und dann gingen sie im Streit der Königreiche verloren.
Vor den Fenstern lag der Schnee. Der Großknecht und der Knecht und der Stallknecht waren mit ihren Arbeiten beschäftigt. Bedächtig und langsam gingen sie vom Stall zur Tenne.
Öffnete man die Stalltür, hörte man die Kühe brüllen.
„Mutter“, sagte Stella: „Jetzt brüllt Williams Kuh.“
Aber es konnte geschehen – wenn der Hausherr weg war – daß die gnädige Frau den Stallknecht bat, „nur einen Augenblick“ alle Kühe in den weißen Hof zu lassen. Und dann sprangen sie, alle vierzehn, die rote, die weiße und die gefleckte, im Schnee umher, während die Kinder johlten.
„Schließt die Koppel, schließt die Koppel!“ rief Mutter. Sie lachte mitten auf der Treppe am lautesten.
Aber in die gefleckte war der Teufel gefahren.
Aber wenn „der Herr“ nach Hause kam, war die Stalltür geschlossen, und der Hof war wieder wie zuvor. Aber die gnädige Frau hatte Zahnschmerzen bekommen, weil sie baren Hauptes auf der Treppe zum Hof gestanden war.
Tine mußte geholt werden.
Tine mußte immer geholt werden.
Tine kam mit der Kittelschürze auf ihrem Kopf.
„Gott, diese Kälte, die Sie mitbringen“, sagte Mutter, die immer fror und fröstelte, wenn nur eine Tür geöffnet wurde.
„Tine, ich habe Zahnschmerzen“, sagte sie.
Der Toilettenspiegel wurde hervorgeholt und auf einen großen Tisch gestellt, und es mußte mit einigen kleinen Zweigen eines Busches, der im Garten des Lehrers wuchs, „geräuchert“ werden.
Alle Kinder, Tine und die Jungfer standen rund um den Tisch.
Die ganze Schlafkammer war voller Rauch, während Mutter den geöffneten Mund über die rauchenden Zweige hielt.
„Tine, Tine, jetzt!“ rief Mutter.
Tine mußte mit einer Haarnadel in die Zähne stechen.
„Da ist er, da ist er!“ rief Mutter:
„Schau, der Wurm!“
Tine hatte sich so angestrengt, daß ein Stück Emaille vor dem Toilettenspiegel herabfiel.
Mutter glaubte felsenfest daran, daß es ein Wurm sei, und seien drei, vier Würmer gekommen, habe sie plötzlich nie mehr Zahnschmerzen.
Aber Tine war die einzige, die sie herausstechen konnte. Sie stach sie gewissenhaft auch aus allen Zähnen der Kinder.
„Mein Lieber“, sagte Mutter zum Vater, der Einwände erhob: „Ich sehe doch die Würmer mit meinen beiden Augen.
Aber es muß mit Zweigen vom Busch aus Kærbølling6 geräuchert werden.“
Der Amtsarzt von Sonderburg7 sagte, der Rauch von den Büschen des Lehrers sei sehr giftig.
Eine Zahnschmerzbehandlung konnte gut einen halben Nachmittag dauern, bis es dunkel wurde.
In der Dämmerung war es im Waschhaus schön. Der warme Dampf erfüllte den ganzen Raum, und das Feuer unter dem Kessel glich einem großen roten Auge. Die Mädchen schlugen die Wäsche mit Hölzern, daß es nur so hallte.
Mutter saß mitten im Lärm auf einem Schemel.
Nie gab es Ort und Zeit, wo die Mädchen so viel tratschten wie im Waschhaus.
Der ganze Dorftratsch kam durch die Waschküchentür.
Mutter konnte stundenlang auf ihrem Schemel zuhören, bis sie plötzlich wieder in die Stube lief.
Und mit unweigerlicher Sicherheit sagte sie nach solchen Stunden im Waschhaus zum Vater:
„Gott bewahre mich, was solche Menschen für Ideen haben!“
Und es war, als schöbe sie mit ihren wunderschönen Händen etwas von sich.
„Daß du das alles hören magst!“
„Ja, denn sie sehen so unterhaltsam aus“, sagte Mutter, und sie ahmte die Mädchen nach.
Sie konnte jeden Menschen, der das Haus betrat, nachahmen.
Aber an den meisten Tagen blieb sie während der Dämmerung in der Wohnstube. Dort sang sie. Aber es gab andere Stunden im Dunkel, wo sie auf dem Podest am Fenster sitzen blieb, im hohen Rohrstuhl, die Hände in ihrem Schoß.
Dann sprach sie leise in die stille Stube hinein.
Sie mochte am liebsten darüber reden, wie es wäre, wenn sie alt würde und wenn sie graues Haar bekäme, ganz graues Haar.
Und wenn sie Witwe wäre und alle ihre Kinder erwachsen wären, und wenn sie arm wäre.
„Entsetzlich arm“, sagte sie.
Dann kam abends nichts anderes auf den Tisch als Butter und Käse in der alten Kristallkäseglocke.
„Aber die Butter muß gut sein“, sagte sie.
Und sie malte sich aus, wie weiß das Tischtuch sein müßte und wie wir alle von unserer Arbeit kämen und am Tisch Tee tränken, wo sie säße, grau und still und alt, und arm wäre. Denn Armut war für sie eine Art träumender Sorglosigkeit.
Sie hatte wohl nie andere „Arme“ gesehen als die in den kleinen weißgetünchten Häusern längs der Dorfstraße.
Wenn man Tee getrunken hatte und „der Herr“ auswärts war, kamen die besten Stunden. Es war die Zeit, wo die Puppen hervorkamen. Der Eßtisch wurde wie zu einer Gesellschaft ausgezogen, und Mutter thronte über all ihren Pappschachteln. Dort waren die Puppen verstaut.
Jetzt, jetzt konnten sie hervorgeholt werden, denn nun war Vater weg.
Geholt wurden sie, zu hunderten. Es waren Figuren aus Modezeitschriften, auf einen Holzklotz geklebt. Jede hatte einen Namen, auf die Rückseite geschrieben, jede war eine eigene Persönlichkeit – alle wurden sie auf dem ganzen Tisch aufgestellt. Und die Komödie begann, während Mutter dirigierte.
Die Puppen hielten Gesellschaft ab, und sie statteten Besuche ab.
Sie unterhielten sich und verbeugten sich und knicksten.
Mutter wurde vor Anstrengung rot, und sie schaltete und waltete, die Arme über dem Tisch.
Die Kinder hatten auch ihre Puppen, und die Jungfer hatte ihre eigenen. Aber nie machten es diese Puppen aus Pappe Mutter recht, und sie redete für sie alle.
„Fräulein Jespersen, Fräulein Jespersen, Sie vergessen Fräulein Løvenskjold.“
„Fräulein Løvenskjold“ war stehengeblieben, wo sie sich doch hätte bewegen müssen. Für Mutter waren es keine Puppen. Für Mutter waren dies Menschen. Sie redeten und sie handelten und sie sangen. Sie spielten Hunderte Komödien. Bald war es in einem Badeort, und bald war es in Paris.
Wir Kinder sahen zu, als stolzierte die ganze Welt, vornehm und fein, vor uns auf dem Tisch.
Die Mädchen kamen herein. Sie wollten zuhören. Sie verstanden kein Wort, sondern standen da, rank und schlank, die Hände unter den Schürzen. Wenn mit den Puppen etwas Trauriges geschah, weinten sie.
Aber mitten in der ganzen Komödie fuhr Mutter hoch, und alle Puppen wurden umgeworfen – in die Schürzen, in die Schachteln. Vater kam nach Hause.
„Den Tisch zusammen, den Tisch zusammen!“
Mädchen und Kinder hatten es eilig. Mutter gab vor lauter Schreck alles auf.
„Gott, die Kinder sind ja noch auf “, sagte sie.
Und die Kinder kamen schnell ins Bett, Hals über Kopf.
Und die Mutter saß mitten auf dem Sofa mit den zwei Mahagonischränken am Ende und war so entsetzt, daß sie Marmelade und Zwieback haben mußte …
Manchmal verkleidete sie auch die Mägde.
Eines Abends war sie allein mit den Kindern zuhause.
Da schlug es hart an das Hoftor, und die Jungfer mußte hinaus und aufmachen und kam schreiend zurück:
„Es ist ein Landstreicher … Es ist ein Landstreicher…“
Und der Landstreicher betrat die Stube, während Mutter laut schrie. Häßlich war er, und die Kinder kreischten. Aber plötzlich entdeckte einer der Jungen, daß es „die große Marie“ war.
„Mutter, das ist ja die große Marie“, schreit er.
Aber im gleichen Augenblick flüstert Mutter Marie zu:
„Gib Stella eine Ohrfeige.“
Und Stella bekam eine Ohrfeige, daß es nur so rauchte, von Maries Faust.
Da glaubten wir natürlich, daß es ein Landstreicher war.
Aber danach bot Mutter Marie, dem Dienstmädchen, einen Schnaps an, und diesen mußte sie hinabstürzen, denn sie war ja jetzt ein richtiger Mann.
– – –
Weißes Haus, du weißes Haus, wie eine jubelnde Schar kommen die Erinnerungen – kommen und sammeln sich um eine.
Könnte ich mit Worten nur ein Bild malen, das unvergänglichen Bestand hätte – ein Bild, das unvergänglich bestünde – ein Bild, aus Jugend und Lächeln, Anmut und Trauer, Freude mit traurigen Augen, Schwermut, die mit einem gespitzten Mund lachte; hilflose Hände, die nur die Not der anderen zu lindern wüßten, feine Glieder, die in der Sonne sich regten, und frören, wenn die Sonne unterging.
Ein Bild von der, die das Leben liebte und aus Trauer darüber starb.
Sie starb wie eine anmutige Blume, die abgerissen wird. Keine Rose, auch keine Lilie.
Eine seltsamere Blume mit besonderen Fibern, in späten Jahren von einem geduldigen Gärtner aufgezogen; ein vielfarbener Kelch, so schön im Licht, der sich aber zur Abendzeit scheu schließt …
Ein Siegeslied, das der Schmerz in der Kehle erstickte …
Eine Fremde auf Erden, die doch wie ein seltener Gast geliebt wurde.
Weißes Haus, weißes Haus meiner Kindheit – so war sie, die deine Seele war.
– – –
Aber der Herbst verging, und es ging auf Weihnachten zu.
Mutter und Lehrers Tine blieben lange auf, und die Kinder bekamen Zwetschgen, um sich zeitig ins Bett zu legen.
Die alte Kutsche rollte jeden zweiten Tag vor der Tür vor, und der ganze Flur war mit Fußwärmern gefüllt. Es mußten so viele Fußwärmer sein, wenn Mutter fahren wollte. Und Sonderburg war nicht wie Augustenburg, etwas, das gerade um die Ecke läge, es waren zwei Meilen8 und eine richtige Reise.
Aber wenn Mutter nach Hause kam, lachte sie und plauderte und versteckte, während wir Kinder in der Schlafkammer eingeschlossen wurden, denn wir durften nichts sehen. Wir hörten nur den Kutscher, der hinaus- und hereinging und Kisten schleppte. Es war aus Kopenhagen. So war „es“ gekommen.
Es war die große Frage, ob „es“ kam – all die Geschenke vom Großvater. Denn kam es nicht, blieb es ja auf den Weihnachtstischen leer. Eines Jahres gab es Eis und Schnee, so daß die Kisten ausblieben. Mutter schickte einen Boten nach Sonderburg, und Mutter fuhr selbst, und Mutter ließ Vater telegrafieren – es waren die ersten Jahre, wo man einen Telegrafen hatte – aber die Kisten, sie kamen nicht.
Mutter weinte und wußte keinen Rat. Hunderte Male drehte sie ihr altes Portemonnaie. Es war löchrig, so daß das Geld in ihre Tasche rollte. Aber schließlich legte sie Tannenzweige auf alle Weihnachtstische, und so sah es aus, als läge dort eine Masse.
Aber jetzt waren die Kisten gekommen, und drinnen im Schlafzimmer konnten wir hören, wie Tine sich abmühte, sie aufzubekommen.
Mutter selbst hatte keine Ruhe:
„Tine, Tine, sehen Sie, da …!“
Tine schaute.
„Tine, so, jetzt geht das Brett auf.“
Wir Kinder flitzten aus dem Bett, aber in das Schlüsselloch war Papier gesteckt worden.
Drinnen in der Wohnstube lag Mutter auf dem Boden – das erzählten die Dienstmädchen – vor sich die Kisten. Der ganze Teppich war von Paketen und Stroh und Sachen übersät.
Mutter rief:
„Nein, nein, das ist für Stella …
Schaut doch, schaut doch, das ist für William …“
Und sie suchte weiter, in Stroh und Papier. Es gab keine Stelle, die nicht übersät gewesen wäre.
„Der Herr Gott bewahre uns, was gibt es doch für ein Durcheinander, wenn die gnädige Frau sich einmal abmüht“, sagten die Mädchen.
Sie gingen auch herum, gespannt und neugierig. Fertig wurden sie erst weit in der Nacht. Denn frische Würste mußten gestopft werden, und Teig mußte ausgerollt werden und alle Lappen des Hauses mußten auf Weihnachten hin gewaschen werden.
Mutter saß mitten beim Würstemachen, in der Waschküche, mit hochgebundener Schürze und stimmte die Lieder an.
Einige kannten die Dienstmädchen, und Mutter sang nur die Melodien:
„Denn, mein Mädchen“, sagte sie, „die Wörter sind zu schlimm.“
Die Wurstlieder von Als waren die schlimmsten Landsknechtslieder im Land.
„Aber zur Weihnachtszeit“, sagte Mutter: „glaube ich wirklich nicht, daß Maren selbst versteht, was sie singt.“
Jeden Tag sang Maren, die Waschfrau, nie etwas anderes als Lieder vom Ersten Schleswigschen Krieg9 und König Friedrich VII10 …“
Sie waren so traurig, daß sie dabei weinte.
In den letzten Tagen wurde gebacken.
Das ganze Haus war voll von Apfel- und Kuchenduft, und die Tür zur blauen Gästekammer stand nicht still. Denn dort wurden die Äpfel und Gewürze und Zwetschgen und alles, was gut war, aufbewahrt. Aber Tine sprang die Treppen hinauf, daß ihre Röcke flogen:
„Hallo, Kindchen, nun wird gebraten!“ rief sie.
Wir Kinder formten Männer und Frauen aus braunem Teig, die zuletzt auseinanderflossen.
Mutter hatte eine weiße Schürze an, und Vater ging umher und hatte Angst davor, er könne seinen Händen schaden.
Die Mutter mußte immer das Letzte machen, sie, die Eiweiß auf die Kuchen strich und den braunen Männern die Augen setzte.
„Nun muß ich, nun muß ich“, sagte sie.
Und ihre weiße Schürze flog im Trubel um sie, während alle Kinder hinter ihr herliefen.
Was für ein Dampf es war; und welch ein Duft von Gewürzen und Klappern von Backblechen und Lärm von Öfen; denn die Öfen gingen auf und wieder zu, und Kuchenbleche kamen hinein und wieder heraus. Aber Lehrers Tine schlug den Teig für die weißen Plätzchen, während sie die Steingutschüssel zwischen ihre Schenkel klemmte, denn für die weißen Plätzchen brauchte man Kräfte, und die Eier mußten ewig lang geschlagen werden.
„Jetzt will ich“, sagte Mutter.
Und sie ergriff die Steingutschüssel und rührte mit dem großen Löffel.
„Puh, das ist heiß“, sagte sie und hörte wieder auf.
Und sie begann zu singen, auf dem Hackklotz sitzend, im Dampf, mit roten Wangen, fröhlich:
Lisbet! Lisbet!
Oh, wie bist du süß und nett!
Schau mich nur an,
Lisbet! Lisbet!
Ach, wie bist du süß und nett!11
Sie sangen alle mit in Dampf und Rauch, die Mädchen und die Kinder und Tine, aber Mutter war schon in der Wohnstube:
„Tine, Tine“, rief sie, „lassen Sie sie jetzt!“
Sie war in den Schaukelstuhl gesunken. Sie war von all diesen vielen Nichtigkeiten müde geworden.
Alle Türen standen offen, so daß der Duft vom Kuchen hereindrang; die Schneebesen gingen und die Ofentür klapperte.
„Ach, Tine, holen Sie mir meine Briefe!“ sagte Mutter.
Es waren die Briefe aus dem Sekretär, alle Jugendbriefe Mutters und von ihrer Mutter und ihren Freundinnen und ihrem Vater. Sie waren schön verpackt, vergilbt, zusammengefaltet wie zu jener Zeit, als man noch keine Umschläge kannte, verwelkte Veilchen dazwischen, mit Bändern gebunden.
Mutter liebte sie.
Sie las sie nicht. Aber sie blieb mit ihnen im Schoß sitzen.
Und sie erzählte.
Von ihrem Vater, dem alten Postmeister mit dem hohen Stehkragen – einem der richtigen Beamten, einem von denen, die immer glaubten, sie müßten böse sein, wenn sie ihr Amt ausübten. Die Bauern nannten ihn „Vater “, aber sie zitterten, wenn sie ihm „Ungelegenheit“ bereiteten.
Und von ihrer Mutter, wegen ihrer Gicht auf den Rollstuhl angewiesen, so zart und fein, als hätte sie keinen Körper, und bleichen Gesichts, einem Gesicht ohne Farbe und einem der Münder, die nicht gerne sprechen, denn sie haben sich müde gesprochen und verbergen nun ihre Geheimnisse.
„Ja, sie schwieg“, sagte die Mutter und blickte vor sich hin, die Briefe in ihrem Schoß.
Es sollte die Zeit kommen, da ihre eigenen schönen Augen, mattblank, dem großen Schmerz entgegenstarrten, aber ihr Mund, der schwieg.
Sie erzählte von ihren Freundinnen, den jungen Mädchen vom weißen Hof:
„Ach, wir hatten große Stuben ganz oben im Turm“, sagte sie, „und wenn wir unsere Fenster aufmachten, dann sahen wir das Meer …“
Die Mutter legte ihre Hände in den Schoß:
„Ja, Gott weiß, wie“, sagte sie, „aber es ist für sie alle schlimm ausgegangen.“
Schlecht waren sie verheiratet, Pech hatten sie gehabt und waren in aller Welt.
Das einzige, was sie bewahrt hatten, waren Geld und Vornehmheit.
„Sie hatten zu heißes Blut“, sagte Mutter und pustete.
Manchmal kamen Briefe von ihnen, aus den Städten und den Ländern, wo sie als Baronessen und Gräfinnen lebten, verheiratet mit Landflüchtigen und Spielern.
Eine von ihnen wohnte in Norditalien.
Mutter weinte immer, wenn sie von ihr Briefe bekam:
„Ach, sie hat“, sagte sie, „den alten Knacker geheiratet:
Manche sagen, es sei ein Lord, und manche, er sei Schuhmacher.“
Aber jedes Jahr kamen von dieser Freundin auch Briefe aus Kopenhagen.
Sie war zuhause – – um ihren Sohn zu besuchen.
„Das ist ja das einzige, was sie hier in der Welt liebt“, sagte Mutter zu Tine.
Diesen Sohn hatte sie gewiß unehelich bekommen; und dann hatte sie fortreisen müssen und hatte geheiratet, unten in Norditalien, diesen Lord oder Schuhmacher.
„Aber sie lebt ja in Reichtum“, sagte Mutter.
Es war gleichsam, als berührte sie der Lebensschmerz, wenn sie von dieser Freundin redete.
„Ja, Gott weiß, wie das sein kann“, sagte sie wieder:
„Aber es ging ihnen allen schlecht.“
Der Vater ihrer Freundin kam manchesmal, immer unverhofft, und blieb nur ganz kurz.
Ein großer Mann, mager, mit der Haltung dessen, der, ohne den Rücken zu beugen, daran gewöhnt ist, an einem Hof zu verkehren.
Die Mädchen konnten dann ganz unvermutet melden:
„Es ist der Hofjägermeister12.“
Und er kam herein und verneigte sich so merkwürdig tief und so eigentümlich bewegt vor Mutter, die ihm entgegentrat. Und er setzte sich immer in großem Abstand und redete mit einer Stimme, als käme sie von weit her und wäre aus Trauer ermattet.
Und er ging wieder, so plötzlich wie er gekommen war.
Aber Mutter weinte, wenn er gegangen war, und die Kinder hatten Angst, denn es war etwas an ihm, als wäre dort ein Gespenst gewesen.
„Ich wollte Sie nur kurz besuchen“, sagte er, wenn er wieder ging, und er verbeugte sich wieder und küßte Mutters Hand.
Er kam, um die nennen zu können, die weit weg waren …
… Aber Mutter blieb im Weihnachtsdampf sitzen, mit den Briefen ihrer Jugend in ihrem Schoß. Lehrers Tine saß auf einem Schemel neben ihrem Stuhl.
Mutter erzählte aus der Zeit ihrer Verlobung.
Sie kam ja aus der Provinz, und nichts kannte sie und nichts wußte sie, und fremd war sie im alten Haus der Exzellenz.
Es war etwas Neues und ganz Entsetzliches, mit den Ørsteds13 und den Mynsters14 in den Stuben und im Haus Oehlenschlæger15 oben im zweiten Stock.
Das war ein Leben, die Lüster immer angezündet, und Schwiegermutter in schwarzem Samt, und die alten Geschlechterwappen auf alle Kissen gestickt, und Silberkannen auf Etageren gestellt, und Gemälde an den Wänden, so festlich wie in einer Kunstsammlung.
Mutter bewegte sich ganz erschreckt.
Aber zum Verlobungsschmaus, als sie einander zutranken und die Exzellenz selbst das Lied verfaßt hatte, da schlich Mutter hinaus auf die Treppe, die Treppe hinauf zu Oehlenschlæger, und dort saß sie und weinte; das Gesicht in ihren Händen weinte sie und weinte.
Der Diener stieß auf sie.
Er mußte Vater holen.
„Nein, nein, ich will nicht hinein“, sagte sie.
„Lassen Sie mich nach Hause – lassen Sie mich nach Hause!“
Und sie weinte, als verlöre sie ihr Leben.
„Ja, Gott, wie ich heulte“, sagte sie zu Tine.
Mutter erzählte weiter, die Briefe in ihrem Schoß, von ihrer Jugend, von den Tagen, die verschwunden waren.
„Aber, ach, wie war es schön, Schlittschuh zu laufen“, sagte sie plötzlich.
Dann eilte sie hinaus zu den weißen Plätzchen. Nun mußte der Eischnee untergehoben werden. Oder sie mußte plötzlich Lorbeerblätter auf die Marmelade legen:
„Denn alles muß jetzt gemacht werden“, sagte sie und begann umherzulaufen. Während Tine alles machte – –
– – –
Kindertage –
Zu euch bin ich zurückgeflüchtet,
Ob ihr meines Herzens Weh lindern könntet.
Niemand zählt die Tränen,
Die verweinte Augen
So gerne weinen möchten.
Kindheitstage,
Kindheitserinnerungen,
Lindert meines Herzens Weh.
Du, Mutter,
Die du selbst littest,
Schlank wie eine Blume,
Die jäh geknickt wird,
Du, Mutter,
Die selbst liebte,
Bleib nun bei mir
Unter meines Herzens Weh.
Weit muß der Mensch gehen
Und so hart muß er treten –
Kindheitserinnerungen,
Kommt mit eurer Freude
Lindert
– Nur für eine Stunde –
All meines Herzens Weh.
Kindheitserinnerungen,
Was soll ich erbitten:
Daß ihr meines Herzens Weh lindern könntet.
– – –
Aber Mutters größter Tag war der Tag vor Heiligabend.
Denn das war der Tag der Armen.
Schon morgens – und es war sicherlich der einzige Tag des Jahres, an dem sie so früh aufstand – hatte Mutter Reis in Beutel gefüllt und Kaffeebohnen in Tüten, und Kandiszucker dazu.
Eine Waage stand auf dem Tisch, und Tine wog ab.
Gerecht sollte es sein und gleich viel in jeder Tüte.
Aber die Mutter füllte nach, und nie paßte es:
„Du lieber Gott“, sagte sie, „als ob Weihnachten mehr als einmal im Jahr wäre!“
Wenn alle Tüten gefüllt waren, gab es im Haus weder Zucker noch Kaffeebohnen.
„Dann nehmen wir eben von unseren eigenen“, sagte Mutter, wenn es knapp war.
Dann kamen nachmittags die Häuslerfrauen herbeigeschlurft. Es war gerade so, als schlichen sie sich merkwürdig zum Haus hinauf, wenn sie kamen. Und sie stellten die Holzschuhe in einer Reihe in den Flur, und sie kamen auf schwarzen Socken in die Stube und sprachen kein einziges Wort, sondern bekamen nur das Ihrige und gaben einen schlaffen Händedruck mit einem „Danke.“
Aber die Mutter hatte viel zu tun und fragte: Dieser brauchte dringend das und jener jenes.
Es gab nicht mehr viel überflüssige Kleider in der Kammer der Kinder, wenn die Häuslerfrauen wieder draußen waren.
„Tinchen“, sagte Mutter: „ Wir bekommen es sicher immer wieder.“
Sie sank in einem Sessel zusammen, ließ alle Fenster aufreißen und ließ mit Kölnischwasser sprühen.
„Denn, liebe Kinder“, sagte sie, „die Reinlichsten stinken nach Schmierseife.“
Vater befahl dem Stubenmädchen, alle Türklinken abzuwischen.
Im übrigen stritten die Eltern verhalten. Vater behauptete, Mutter habe natürlich ihren letzten Unterrock verschenkt. Aber Mutter blieb ihm keine Antwort schuldig:
„Lieber Fritz, du solltest nur am besten nicht mitreden.“
Er mußte es aber unbedingt. In der Frage, sich ausplündern zu lassen, war Vater berühmt: Alle Landstreicher der ganzen Gegend schnitten sich, bevor sie bei ihm auftraten, ins Zahnfleisch, so daß sie Blut speien konnten, und ihm vormachten, sie seien brustkrank.
„Lieber Fritz“, sagte Mutter: „Ich erinnere mich noch daran, daß du Häusler-Jens ein paar Seidenunterhosen gegeben hast.“
Es gab kein Kleidungsstück von Mutter, das man nicht an der einen oder anderen Stelle bei den Häuslersfrauen finden konnte.
Am nächsten Tag wurden die Weihnachtstische gedeckt. Das war beschwerlich, und Mutter brauchte lange dazu. Denn jeder sollte gleichviel bekommen. Den ganzen Tag ging Mutter umher und wog und maß mit den Augen, und war auf einem Tisch etwas zu wenig, stahl sie ein bißchen von einem anderen.
† Hier fügte Bang in der zweiten Auflage den im Anhang zum Nachwort beigefügten Text „Heiligabend im ‚Weißen Haus“ ein.
– – –
Nach Weihnachten kam die Zeit, wo man las.
Tine kam in der Dämmerung und bekam den Inhalt der Bücher erzählt.
Mutter saß vor dem Kachelofen, die weißen Hände um ihre Knie und erzählte und dichtete um. Es gab kein Buch, das in ihren Gedanken das gleiche blieb.
Oehlenschlæger war in so feierlichen, schwarzen Bänden, und es waren so viele Markierungen auf den Seiten. Mutter konnte die Tragödien fast auswendig, und doch las sie sie immer wieder. Wenn sie die Augen vom Buch erhob, während die Kinder zuhörten, war es, als wären ihre Augen doppelt so groß geworden.
„Mutter, lies weiter!“ sagte der älteste Junge.
„Müssen denn die Kinder nie ins Bett?“ fragte Vater aus seiner Stube.
„Doch, Fritz, gleich“, antwortete Mutter und las weiter.
Ihre Stimme war mild, so wie traurige Liebkosungen sind, und Tränen standen in ihren Augen.
Am liebsten las sie Thoras Worte16, wie sie vom Leichnam Hakons Abschied nimmt.
Tine schniefte wie ein Seehund.
„Sollen die Kinder ins Bett?“
„Gleich, Fritz, gleich …“
Und Mutter las weiter.
Oft war es Christian Winther17. Am meisten „Des Hirsches Flucht“. Die Strophen wanden sich so zärtlich um ihre Stimme.
„Ach, niemand liest wie die gnädige Frau“ sagte das Zimmermädchen. Sie hörte drüben in der Ecke beim Bücherschrank zu.
Schließlich wurde der Vater ungeduldig, und die Kinder mußten ins Bett.
Dann weinten sie und bekamen Zwetschgen, um artig dem Kindermädchen zu folgen.
Aber Mutter begleitete Tine baren Hauptes die Allee hinauf.
In klaren Nächten ging sie dort lange. Sie liebte die Sterne so sehr. Lange konnte sie auch stehenbleiben und zählen, wie viele sie auf einem Fleck sehen konnte.
Tine stand dabei.
Sie fragte, wie die Sterne hießen.
Aber Mutter hatte sie nach den Namen ihrer Freunde benannt.
Das war der Stern ihrer Mutter …
„Haben Sie ihn gesehen?“
„Und das war Alices – sehen Sie ihn? Denn er ist so betrübt.“
Es gab so viele betrübte Sterne, und sie liebte sie am meisten.
„Dora“, rief Vater aus der Dachstube:
„Thora, du erkältet es dich.“
„Ich schaue nur die Sterne an“, antwortete sie, und sie ging still hinein.
Aber nach den Sternen zu sehen, war für sie fast eine Leidenschaft.
„So bin ich“, sagte sie, „mit all meinen Freunden zusammen.“
Manchmal begleitete sie Tine bis zum Friedhof, aber nie weiter. Denn sie hatte große Angst vor Gespenstern. An diese glaubte sie felsenfest, und sicher war es, daß es in der blauen Kammer zuhause spukte, ganz sicher.
Sie bekräftigte dies immer mit einem Nicken:
„Das weiß auch Fritz“, sagte sie.
Aber das, was in der blauen Kammer spukte, war eine weiße Dame, und sah man sie, mußte jemand sterben.
Mutter hatte sie ein mal gesehen, und dann starb der alte Postmeister.
Sonst kannte sie viele Gespenstergeschichten und erzählte sie in der Dämmerung, so daß die Kinder schauderten.
Am liebsten erzählte sie die von Aaholm18, denn von der wußte sie, daß sie wahr war, weil sie einer ihrer Tanten zugestoßen war.
„Auf Aaholm hat es schon immer gespuckt“, sagte Mutter: „Aber das ist wahr, denn Olivia machte sich gerade zum Ball zurecht, als sie auf einmal eine Dame aus der Wand kommen sieht – leibhaftig – sie sah sie im Spiegel … In grauem Seidenkleid mit großen Rosenbuketten kam sie und stellte sich hinter ihren Stuhl.
Aber Olivia fuhr hoch und stürzte auf den Gang hinaus und schrie und schrie …
Aber gut war es, daß die Dame sie nicht an der Hand genommen hatte. Denn dies war ja einer Gesellschaftsdame zugestoßen … und sie kam auf den Gang hinausgestürzt, die Treppe hinauf, hinein zur Gräfin und rief: ‚Eine Dame trat aus der Wand, zu mir hin, direkt zu mir und ergriff mich an der Hand – – und drehte mich im Kreis …‘
Und im selben Augenblick verlor die Gesellschaftsdame ihren Verstand …
Nicht zu retten, sie war verrückt geworden.“
Erzählte Mutter.
Aber sie erzählte auch, daß schließlich der Graf von Aaholm an dieser Stelle in der Wand graben ließ und daß sie in einem geheimen Raum ein Skelett gefunden hätten.
„Sie war natürlich ermordet worden“, sagte Mutter.
Trotzdem waren Gespenster nun ihre Sache. Aber Vorzeichen, das war etwas, was bewiesen war. Und Hunde und Eulen wußten mehr als Menschen.
Nie schrieen die Eulen im Kirchturm, ohne daß sich in der Gemeinde ein Todesfall ereignet hätte.
„Das wissen ja Küsters19“, sagte Mutter, und nickte.
An den Winternachmittagen ging Mutter mit den Kindern auf Besuch. Alle Kinder plauderten, während sie um die Mutter geschart wie ein Schwarm von Jungvögeln durch die Allee gingen.
Oben am Ende der Allee wohnte der Bürgermeister.
Fein und weiß lag der Hof groß und breit da, mitten auf dem weißen Feld, mit einem grünbemalten Tor verschlossen.
Es waren die Tage, wo sie Bürgermeisters besuchten.
Die Frau des Bürgermeisters ging sofort in die Küche.
Sie sagte ihr Guten Tag mit einer Stimme, die man nicht hörte, reichte einem eine feuchte Hand, die man nicht halten konnte, und ging in die Küche, um für Essen zu sorgen. Man war noch keine zehn Minuten bei Bürgermeisters gewesen, als sich schon der Tisch bog. Es gab immer Schweinebraten und rote Beten zusammen mit Eingemachtem. Die Brotscheiben waren so groß wie eine Landkarte.
Der Bürgermeister war ein dicker Mann, der zum Abendmahl und Markt in Augustenburg im Frack erschien, sonst aber in Hemdsärmeln war. Er sagte nie etwas, sondern lachte immer, so daß sein ganzer Körper erzitterte.
Mutter setzte sich verzweifelt zum Eingemachten
Wenn sie aber von einem Besuch beim Bürgermeister nach Hause kam, brauchte sie immer ein Glas Rotwein, um damit das Fett hinunterzuspülen.
Jahre waren vergangen, und immer noch war es gleich bei Bürgermeisters: daß die Frau nach der Begrüßung in ihre Küche ging, und der Mann, und in ihm begann es, wenn er nur „Mutters“ Gesicht sah, zu glucksen, so daß die kleine Vorstube erbebte.
Aber dann eines Tages, es war schon Dämmerung, schleppte sich etwas wie ein schweres Bündel zuhause in die Wohnstube. Und das Bündel - es bestand aus nichts anderem als Tüchern und einem großen Schal und einem kleinen Schal – kam nicht weiter als bis zum Stuhl beim Bücherschrank, fiel dort hin wie ein schweres Deckbett fällt, und das Bündel weinte und weinte und weinte.
Aus all diesen Kleidern heraus kam das Weinen still und unaufhörlich.
Dieses Bündel war die Frau des Bürgermeisters, ihr Sohn war durch eine verirrte Gewehrkugel gestorben.
Mutter kniete sich hin und versuchte, der Frau näher zu kommen – durch die Schals hindurch, um sie zu trösten.
Aber das Bündel weinte nur und weinte und sagte:
„Ich möchte mit dem Pastor reden.“
„Ja, ja, Madam Hansen, ja, ja, Madam Hansen …“
„Ich möchte mit dem Pastor reden.“
Und das Bündel glitt durch die Stube, leise jammernd, so schwer wie etwas, das nicht lebte, zum Pfarrer.
„Wie sie weinte“, sagte Mutter, „wie sie weinte – hätte man nur die Schals von ihr wegbekommen können.“
Als ob ihr das die Trauer näher gebracht hätte.
… Mutter und der älteste Junge sollten hinauf und den Sohn des Bürgermeisters sehen.
Es war, als ob kein Laut im Hause zu hören wäre. Der Hund bellte nicht, und das Federvieh war eingeschlossen.
Der Bürgermeister empfing uns in der Tür.
Er hatte einen schwarzen Mantel an, und er seufzte. Reden tat er nicht, während Mutter und der Junge still durch die Stuben gingen, wo alle Türen offen standen.
In der großen Wohnstube stand der Sarg.
Es war solch ein gelbes Licht, wie man es hat, wenn Laken vor die Fenster gespannt sind.
Der Bürgermeister nahm das Tuch vom Gesicht des Leichnams.
Leblos lag der Sohn da.
Zuhause in der Gesindestube hatten sie gesagt, bei Anders Niels seien viele schlecht davongekommen:
„Denn er hatte solch einen weiblichen Mund“, hatte der Knecht gesagt:
Was die Mädchen nicht mochten.
Und ein paar Beine, von denen sie ihre Augen nicht wegbrachten …
Aber jetzt lag er leblos da. Es war gleichsam keinerlei Ausdruck in seinem Gesicht – nur Kälte.
Der Bürgermeister ging und murmelte einige Schriftstellen, die er noch von seiner Konfirmation kannte.
Mutter blickte lange in das Gesicht des Leichnams. Dann deckte sie es mit einem Tuch zu. Es lag hoch über der großen und geraden Nase.
Die Frau des Bürgermeisters war nicht drin gewesen. Sie ging auf schwarzen Socken in ihrer Küche.
Als Mutter und der Junge in die vorderste Stube kamen, war der Tisch gedeckt. Er war voll beladen mit Speisen.
Die Frau ging herum und bat zu Tisch.
Die Türen zu der stillen Leichenstube standen offen.
Der Bürgermeister speiste bedächtig. Stück auf Stück. Er mußte in diesen Trauertagen viel essen.
Gesprochen wurde nicht.
Der Junge bekam schwarzen Johannisbeerrum und trank das Glas aus – denn Mutter sah es nicht – so daß ihm ganz schwindlig wurde.
Sie saßen lange zu Tisch. Die Frau des Bürgermeisters hatte sich an die Tür gesetzt. Sie hatte kein Wort gesprochen.
Aber als Mutter gehen wollte und zu der Frau kam und auf Wiedersehen sagen wollte, bemerkte sie, daß die Arme am ganzen Körper zitterte.
Sie blickte auf den Boden, und als sie versuchte zu reden, bekam sie fast kein Wort heraus …
„Denn das war so viel“, sagte sie dauernd … Aber sie wolle beten, ob die gnädige Frau nicht etwas singen wolle … Ob sie etwas bei dem Leichnam singen wolle.
Mutter antwortete nicht.
Sie legte nur ihren Mantel wieder still ab, und sie gingen alle vier hinein – durch die Stube, durch die Zwischenstube, in das gelbe Licht.
Der Bürgermeister brachte ein großes Gesangbuch.
Aber Mutter sang frei und ohne auf den toten Sohn zu blicken:
Wenn ich bedenke recht die Stund,
Wo ich von hier soll fahren,
Meine Seele sich freuet mannigfach,
Wie der Vogel am klaren Tage.
Oh milder Tag,
Wo all mein Streit
Ein seliges Ende nimmt:
In Jesu Schoß
Mit Wonne
Verlaß´ ich mein Elend.20
Die Eltern rührten sich nicht. Mutter sang allein.
Der Junge stand da und blickte sie an. Sie war ganz weiß im Gesicht.
Die einsame Stimme klang so eigentümlich über einen fremden Toten.
Eija, mein Herz, sei frisch und stark
In Christus, deinem Herrn!
Denn der Tod, der Sünde Sold,
Soll dir nun Rettung sein.
Strafe war er einst,
Nun ist er das Tor
Zum Himmelreiche.
Nun ist der Tod
Ein süßer Schlaf,
All Sorge muß nun weichen21.
Es war einen Augenblick still.
Dann legte die Frau die Decke über das Gesicht.
Der Junge hörte die Mutter nicht einmal auf Wiedersehen sagen.
Der Bürgermeister ging mit ihnen über den Hof. Er schloß auf und schloß wieder zu.
Mutter und der Junge traten auf die Straße. Mutter sagte nichts.
„Mutter“, sagte der Junge, „du bist so weiß im Gesicht.“
„Komm jetzt“, sagte Mutter.
Als sie nach Hause kamen, war Mutter schweigsam und fror. Am Abendtisch wurde fast nicht geredet.
„Fritz“, sagte Mutter plötzlich:
„Dieser Mensch hat keine Seele gehabt.“
„Thora!“
„Nein.“
Mutter schwieg kurz.
„Er hat nur Blut gehabt … Und das ist nun kalt geworden.“
Vater antwortete nicht.
Aber Mutter zögerte einen Augenblick:
„Die Menschen müßten immer alt werden, bevor sie sterben müssen“, sagte sie.
„Thora, was sagst du da!“
„Doch, das ist wahr. Denn dann haben die Leiden ihnen immer eine Art Seele gegeben.“
Es war, als wäre Mutter in einem geheimen Aufruhr:
„Ich kann dieses Gesicht nicht vergessen, in dem nichts war – –“
Die ganze Insel traf sich zum Begräbnis.
… Aber kam man am Hof des Bürgermeisters vorbei, lagen die kleinen Kätnerhäuser hinter den Zäunen. Ihre Fensterrahmen waren grün gestrichen, und ihre Türen waren grün, aber sie selbst waren mitten im Schnee weiß.
Mutter nickte jedem Fenster zu, und die Kinder taten dasselbe, und der älteste Junge lief in jedem Schneehaufen, der längs des Weges aufgeschüttet war:
„Wie der Junge geht“, sagte Mutter.
Im letzten Haus wohnte Elsebeth.
Sie war in der Stadt die Älteste. Sie war sicher hundert Jahre alt. Es war so still in der Stube, daß es den Kindern schien, nicht einmal die Katze dürfte schnurren. Oder vielleicht hatte sie das auch vergessen. Denn auch sie war alt und lag am Bett. Aber wenn sie ihre graugelben Augen zu öffnen gedachte, glaubte man, sie wisse vieles.
Früher hatte Else gesponnen – gesponnen, gesponnen.
Aber nun war das Spinnrad weggestellt.
Es stand am Fenster wie eine Uhr, die stehengeblieben ist.
Elsebeth nickte der Mutter zu, als sie kam.
Die Stimme kam von tief unten aus der schweren Brust:
„Ja, hier sitze ich“, sagte sie.
„Sie sitzen ja gut, Elsebeth“, sagte Mutter. Die Katze bewegte sich ein wenig, und Mutter blickte verstohlen nach ihr – denn vor der Katze hatte die Mutter Angst: Sie mochte Fremde nicht, sie wollte Elsebeth ganz für sich alleine haben.
„Ja, man wartet und wartet“, sagte Elsebeth.
„Zuerst lebt man, und dann denkt man zurück, und zuletzt sitzt man nur noch da und wartet.“
„Alte Leute werden klug“, sagte Mutter.
„Ja.“
„Aber es hilft ihnen nicht, Madame, und auch nicht den anderen. Denn Blut bleibt Blut, und es kocht, bis es matt oder kalt wird.
Elsebeth betrachtete den ältesten Jungen – sie hatte so klare Augen, aber sie saßen tief –:
„Er wird auch einmal genügend Blut bekommen“, sagte sie:
„Genügend Blut und Tränen bekommt man zur gleichen Zeit.“
„Was sagt sie?“ fragte der Junge.
Aber Mutter antwortete nicht.
Elsebeth schwieg eine Weile, während die Katze ihre Augen geöffnet hatte.
„Dann kommt die Zeit der mütterlichen Sorge, aber auch die geht vorüber.“
„Was sagt sie?“ fragte der Junge.
„Es gibt Mütter, die sterben, während ihre Kinder noch klein sind“, sagte Mutter.
„Sie haben es am besten“, sagte Elsebeth.
Es war still in der Stube. Auch die Uhr war stehengeblieben. Elsebeth zog sie nicht mehr auf. Die Nachbarsfrau kam zu ihrer Zeit – nach der Sonne – und half Elsebeth beim Aufstehen und brachte Elsebeth ins Bett.
„Aber zuletzt denkt man nur, was das ganze soll.“
„Was meint Elsebeth?“
„Ja, Madam, denn Gott ist zu groß, und er kann auch nicht etwas mit uns zu tun haben.“
„Wir wissen das nicht, Elsebeth“, sagte Mutter.
„Doch, Madam, denn wir sind zu klein, und er kann keine Zeit haben, sich um uns zu kümmern.“
Elsebeth schwieg, und Mutter stand mit ihren Kindern auf.
„Auf Wiedersehen, Elsebeth“, sagte Mutter, „hier stelle ich den Holundersaft22 hin.“
„Auf Wiedersehen“, sagte Elsebeth.
Aber draußen auf der Straße war Mutter schweigsam.
„Was heißt das alles, was sie sagte?“ fragte der Junge.
„Sie redete von dir“, sagte Mutter.
Und sie schwieg wieder.
Aber wenn der älteste Junge alleine draußen war, ging er, wenn er zu Elsebeths Haus gelangte, immer auf die andere Seite der Straße. Es war, als hätte er Angst.
… Ging man die Straße weiter zu Küsters, kam man zu Madam Jespersen.
Ihr Haus lag erhöht, und man mußte eine Treppe hinaufsteigen, die nur ein Geländer hatte. Die Diele war mit Sand bestreut, und es roch nach Jungfräulichkeit und Lavendel.
Madam Jespersen saß auf einem Podest und strickte Deckchen. Dort hatte sie gesessen, seit die Stare in die Stadt gekommen waren. „Die Deckchen“, die sie strickte, lagen leuchtend weiß auf jedem Möbel und auf jedem Stuhl.
Hatten die Kinder sich gesetzt und wollten sie sich wieder erheben, gingen sie alle mit ihrem Deckchen an einen wenig genannten Körperteil geklebt.
„Junge, Junge“, sagte Mutter zu dem Ältesten und legte das Deckchen wieder auf seinen Platz zurück. Alle Stühle waren mit Kannefaß23 von Fräulein Helene bestickt. Fräulein Helene stickte immer Sterne in vielen Farben auf verschiedenem Grund.
Madam Jespersen sprach holsteinisch – denn von dort her stammte sie – und war einmal Kammerjungfer bei den Rantzaus24 gewesen. Niemand wußte, wie es sie hierher verschlagen hatte, genau in diesen Winkel.
Sie trug immer Morin25 und füllte einen ganzen Mahagonistuhl mit breiten Armen aus. Auf dem Kopf thronte eine Mütze, von der die Kinder glaubten, sie habe sie auch im Schlaf auf. An den Handgelenken trug sie Armbänder aus Bernstein.
Sie verließ das Podest nur, wenn sie in die Kirche ging. Dann trug sie ein Moiree-Mäntelchen26 und darüber einen gestrickten Schal.
Fräulein Helene mußte, wenn der Kaffee auf den Tisch sollte, immer viele Muster auf die Seite räumen. Es waren Muster aus grauem Packpapier für ihre nie vollendete Garderobe. Zweimal im Jahr war sie in Flensburg und kehrte zurück, den Kopf voll mit Modellen von Miedern, die sie im folgenden Halbjahr beschäftigten.
Bei Kleidern liebte sie die schottischen Muster.
Was sie einfaßte, waren nur die Mieder. Die Unterröcke blieben so einigermaßen gleich. Nur manchmal waren sie mit Mustern versehen.
Die Kuchen zum Kaffee kamen aus einer Kiste, die unter Madam Jespersens Bett stand. Madam Jespersens Bett war hoch wie ein Berg.
„Ach ja, man muß geduldig sein“, sagte Madam Jespersen und ließ die Hände sinken. Sie hatte sich einmal mit vielen Kammerjungfernringen geschmückt, die nun im Fett ihrer kurzen Finger verschwunden waren.
Jungfer Helene huschte hin und her und schwatzte.
Jungfer Tine streckte nur ein knöchernes Gesicht durch die Tür zu einem guten Tag. Sie mußte in ihrer Nähschule bleiben.
„Sie können noch einen Augenblick dableiben“, sagte Mutter, „lassen sie doch die Jungen nähen.“
Aber Jungfer Tine war schon wieder in einer Stube hinten im Gang, wo sieben Mädchen mit Rattenschwänzen Leinenzeug mit zusammengekniffenen Mündern nähten.
Jungfer Tine war groß wie ein Mannsbild und sehnig wie ein Gaul.
Sie hatte vormittags ABC-Schützen und nachmittags Nähen. Sie bekam pro Kopf eine Mark monatlich von der Nähgruppe.
„Ach, ja“, sagte Madam Jespersen, „diese Stine gönnt sich nie Ruhe. Aber man muß geduldig sein.“
Jungfer Helene legte die Plätzchen mit sechzehn kleinen Handbewegungen für jedes Stück auf eine kleine Porzellanschale.
Sie lief hin und her in die Küche, um Kaffee zu machen, während sie ununterbrochen redete. Jungfer Helene schwatzte ohne Pause das ganze Jahr hindurch, ohne daß noch eine Mutterseele am 31. Dezember wußte, was sie gesagt hatte.
„JA, DIE KLEINE SCHWÄRMT“, sagte Madam Jespersen.
War der Kaffee auf dem Tisch, kam Jungfer Stine eilends und setzte sich neben die Tür auf einen der drei Mahagonistühle mit richtigen Sitzen – die anderen Sitzmöbel waren zerbrechlicher, mit geflochtenen Rücken – denn sie saß zu hart und mußte etwas unter sich haben.
Sie stürzte schnell den Kaffee hinab und war schon wieder draußen.
Von der Kuchenschale waren immer einige Kuchen verschwunden. Sie verteilte sie als Belohnung in der Nähklasse. Sonst lag es Fräuleins Stine ja nicht zu stehlen, aber Kuchen stahl sie in unbewachten Augenblicken. Konnte sie das nicht, kaufte sie Zuckerkringel im Gasthaus.
Es ging zu den Rattenschwänzen. Es war ja immer eine, die mit einem Stück Leinen fertig war.
Wenn Mutter in den Gang kam, um zu gehen, steckte Jungfer Stine ihren Kopf aus dem Klassenzimmer – es schlug einem ziemliche Hitze aus dem kleinen weißgekalkten Loch entgegen – sie mußte Mutter immer küssen, bevor diese ging. Es war der einzige erwachsene Mensch, den sie küßte.
Der älteste Junge trampelte über alle vierzehn Holzschuhe im Flur:
„Wie ungeschickt der Junge doch ist!“ sagte Mutter:
„Er lernt nie, sich zu benehmen.“
Jungfer Stine blieb in der Haustür stehen und nickte, aber Jungfer Helene schob mit zierlicher Hand die Blumen im Fenster der Stube zur Seite und lächelte nur.
„Mutter“, sagte der älteste Junge, als sie auf den Weg hinauskamen, „Jungfer Stine hat Augenbrauen wie Kutscher Lars.“
Jungfer Stine hatte über einem Paar Jungmädchenaugen Augenbrauen wie ein Mannsbild.
Mutter liebte es, ihren ältesten Sprößling reden zu lassen. Er plauderte ganz wie sie selbst, in denselben Sätzen, mit derselben Wortstellung, mit einer altklugen Wichtigkeit, die wie Weisheit wirkte. Und immer lugte sein Kopf, der zu groß für den Körper war, neben Mutters Schürze heraus.
Wenn sie von der Kindergesellschaft nach Hause kamen, wollte Mutter immer einen Bericht über das Fest haben.
Sie setzte sich mitten in der Wohnstube auf ihren Lieblingsstuhl, als setzte sie sich an einen guten Tisch.
„So“, sagte sie, „laßt mich hören.“
Alle Kinder redeten durcheinander.
„Der Junge zuerst!
Der Junge zuerst“, sagte Mutter.
Und der Junge sprang in seiner Samtbluse umher und äffte alle nach, Mädchen und Jungen, in Stimme und Gebärden, so daß Mutter sich vor Lachen in ihrem Stuhl wand.
„Und dann? Und dann?“
Der Junge machte weiter. Er konnte die gesamte Gesellschaft auswendig. Er äffte nach, und er sprang wie eine Kakerlake. Schließlich sagte Mutter:
„Was habt ihr bekommen?“
Und die Kinder schrieen mit vollem Mund durcheinander.
Über das Essen in den Gesellschaften lachte die Mutter am meisten:
„Hierzulande lernen sie es nie zu essen“, sagte sie: „Herr Jesus, was die alles auf den Tisch stellen!“ Auf Kindergesellschaften setzten sie ja nun einmal für alle nur belegte Brote und Mandelpudding auf die Tischtücher.
Vater öffnete schließlich die Tür zu seiner Stube:
„Großer Gott, Thora, du verdirbst ja ganz den Jungen“, sagte er. „Kinder sollen doch nicht schon von der Wiege an kritisieren.“
„Lieber Fritz, ich kann ja den Jungen nicht daran hindern zu schauen.“
Und Vaters Tür schloß sich wieder.
Vaters Tür war fast immer geschlossen, und die Kinder wußten fast nicht, wie es hinter dieser Tür aussah. Denn sie kamen so selten hinein, und drinnen war es dunkel. Das Zimmer war nach Norden gelegen, so daß nie Sonne hereinkam. Die Möbel waren aus dunklem Mahagoni.
Der Vater wanderte im Zimmer meist – hin und her.
„Wer ist da?“ sagte er, wenn jemand hereinkam und fuhr gleichsam zusammen.
„Ich bin es“, antwortete eines der Kinder, das kam, um ein Buch zu holen.
Und Vater wanderte weiter seinem Zimmer, auf und ab.
Er mochte es warm und hatte doch vor Kälte immer weiße Hände.
Am Mittagstisch, wenn eines der Kinder redete, konnte er sich plötzlich aus seinen Gedanken reißen – er saß immer hinter einer Flasche feinen Rotweins mit rotem Lack –:
„Gott weiß, wie die Kinder erzogen werden“, sagte er.
„Lieber Fritz“, antwortete Mutter, „wie soll man auf dem Lande Kinder aufziehen?“
„Wie Kinder“, sagte Vater und verfiel wieder in Gedanken.
Sein Gesicht war immer weiß, und sein Bart begann grau zu werden.
Aber Mutter sagte zu Lehrers Tine:
„Liebe Freundin, Kinder sind Kinder, was sie hier nicht hören, das hören sie in der Gesindestube.“
Das war wirklich wahr. Die fröhlichsten Stunden für die Kinder waren in der Gesindestube. Dort war es so brüllend heiß, daß sie ganz rote Köpfe bekamen, während sie in den Ecken saßen und zuhörten. Dort war beständig eine große Versammlung vom ganzen Dorf, weil niemand darauf aufpaßte, wieviel Bier in die Krüge gefüllt wurde.
Die Hofmagd lief nur hin und her, auf ihren schwarzen Socken, und schenkte ein.
Es war wie in einer Wirtschaft.
Kutscher Lars saß am Tischende und führte den Vorsitz. Die Kätner schmückten die Wände. Maren, die Hofmagd, stand an der Tür und grinste.
Es gab kein Gerede aus dem Dorf, das nicht durch die Gesindestube gegangen wäre.
Mutter öffnete manchesmal die Tür:
„Na, Kinder, gibt's was Neues?“
Und sie setzte sich selbst an den Kachelofen. Dann führte nur Kutscher Lars das Wort, während die Häusler dasaßen und auf ihre Bierkrüge schielten.
Kutscher Lars war hier schon so lange, wie man sich erinnern konnte. Das ganze Gesinde blieb die unendlichen Jahre hindurch im Haus. Mutter beklagte sich dauernd bei Vater über ihr Benehmen.
Der Vater sagte:
„Aber so laß sie doch gehen!“
Mutter drehte hilflos die Augen zur Decke:
„Aber sie wollen doch nicht“, sagte sie.
Und sie blieben.
Das Zimmermädchen hatte es mit Kopfweh. Sie band ihren Kopf in Handtücher, so daß sie einem schwer Verwundeten glich, und ging hinaus und herein, während sie jammerte. Das Mittel gegen ihr Übel war ein unaufhaltsamer Strom von Kaffee, und sie kümmerte sich um nichts.
„Ich finde Hannes Besen überall“, sagte Mutter.
Die Besen waren verlassen.
Hanne selbst sank in der Wohnstube beim Bücherschrank zusammen und jammerte:
„Ich habe Marie gesagt, sie soll Kaffee aufsetzen“, sagte sie.
„Das ist ja gut“, antwortete Mutter.
„Will die gnädige Frau nicht auch eine Tasse?“ jammerte Hanne.
„Ach, danke, wenn gerade eine da ist“, sagte Mutter.
Die Hausjungfer saß am Fenster und stickte. Sie war eine äußerst lange und apathische Person, die dauernd beleidigt sein mußte, als Vorwand, nichts machen zu müssen.
Mutter schaute sie voller Wut an und fragte sie an jedem Wochentag, ob sie nicht mit dem Wagen nach Sonderburg wolle.
„Gott“, sagte sie, „dann bin ich sie solange los.“
Sie schlug in ihrem Schoß die Hände zusammen.
„Alle meine Hausmädchen werden so fein, daß sie nur noch sticken können.“
Das jüngste Kind hatte eine Amme. Diese Amme hörte auf den Namen Rose, und es zeigte sich, daß sie auf der ganzen Insel berüchtigt war. Als sie nicht mehr stillte, ging sie in eine unbestimmbare Stellung über, denn im Hause gab es bereits ein Kindermädchen.
Vater unternahm manches, um sie aus dem Haus zu bekommen. „Lieber Freund“, sagte Mutter: „Kannst du mir sagen, wie ich sie wegbringe?
Sie sitzt ja nur in der Gästekammer und näht. Dort richtet sie sicher keinen Schaden an.“
Und Rose blieb.
Wenn sich das Gespräch überhaupt um die Dienstboten drehte, sagte Mutter:
„Ja, Fritz, wenn du dich darum überhaupt nicht kümmern willst, wirst du schon selbst sehen.“
Der Vater war viel zu müde, um sich der Sache anzunehmen. Ein einziges Mal ausgenommen.
Der älteste Junge kam durch eine Stube und sagte zum Zimmermädchen Hanne: „Machen Sie die Tür zu.“
Er merkte nicht, daß die Tür zum Vater offen stand, der sich sogleich, kreideweiß, in seiner Tür zeigte:
„Wären Sie so freundlich, Hanne, die anderen zu holen“, sagte er.
Das Hausgesinde kam zusammen, während der Junge zitterte und Vater wartete. Als alle zusammen waren, gab Vater seinem ältesten Sprößling eine Ohrfeige, ohne mit den Wimpern zu zucken.
„Wirst du vielleicht“, sagte er, „Hanne um Verzeihung bitten und zu ihr sagen: ‚Hanne, wären Sie so freundlich, die Tür zu schließen.‘“
Der Junge tat dies mit tränenerstickter Stimme, wonach das Gesinde weggeschickt wurde.
Eine gewisse Höflichkeit Untergeordneten gegenüber wurde nach diesem Tag – denn keiner konnte sich daran erinnern, daß Vater je eines der Kinder gezüchtigt hatte – etwas, das ihnen ins Blut überging.
„Es ist im übrigen hart genug, dienen zu müssen“, sagte Vater.
Vielleicht machten die Kinder sich aufgrund des „harten Loses“ in aller Stille verschiedene kritische Gedanken: Denn zuhause war niemand, der regierte, außer denen, die dienten.
Lehrers Tine, die die gesunde Vernunft war, sagte, wenn Mutter klagte:
„Gott, wechsle nichts“, sagte Tine: „es ist doch besser, unter der Fuchtel der Alten zu sein.“
„Kommen Sie!“ sagte Mutter zu ihr, „lassen Sie uns etwas spazieren gehen.“
Sie zogen ein paar Schals an und gingen durch das Türchen in den Garten zu dem zugefrorenen Teich. Am Ufer lag der Schnee zwischen dem halbverdorrten Gras.
Draußen hinter den Pappeln breiteten sich die großen Wiesen aus.
Plötzlich wurde Mutter traurig, und ihre schöne Stimme klang wie eine Klage.
„Wie schön es hier im Sommer war“, sagte sie.
Lange blickte sie betrübt über das Eis und den Schnee auf den Wiesen, sie, die den milden Wind und die Sonne liebte.
Sie starrte auf das Teehäuschen mit den weißen Säulen. An ihrem Geburtstag im Juni waren die Säulen immer mit Kränzen umwunden.
„Ich werde nicht viele Sommer erleben“, sagte sie.
„Aber doch“, sagte Tine.
Aber Mutter starrte weiter von ihrem Teehaus zu den vereisten Wiesen:
„Nein“, sagte sie, und sie begann zu weinen, sie, die das lichte Leben liebte.
– – –
Mutter, du, die ihr Haupt beugte,
Als die Trauer kam,
Und du, die ihr Auge schloß,
Als die Dämmerung hereinbrach
Für dich und für uns alle –
Mutter – du –
Es werden noch Rosen,
Blumen, Rosen
Um die weißen Säulen geschlungen –
Rosen, Blumen,
Mutter –
Für die anderen.
Aber du konntest nicht
Im Winter leben;
Nicht, wenn die Erde
Und nicht, wenn das Herz gestorben war.
Du gingst.
Und doch und doch
Blühen glühende Rosen –
Rosen, Rosen
Blühen jedoch für die anderen.
– – –
Ging man von Jespersens aus ein kleines Stück weiter, bog die Straße auf dem Kirchplatz ab.
Dort lag das Gasthaus und war weiß wie die Kirche, sein Nachbar. Nur war die Gasthaustür grün, während die Kirchentür schwarz war.
Links lag die Schmiede. Sie war so merkwürdig viereckig, mit einer schwarzen Kappe als Dach. Aber drinnen in der Schmiede waren Nacht und Flammen.
Der älteste Junge schlich sonntags oft hinüber zur Schmiede. Dort war es so still und und friedlich, und die Wände waren Wände wie alle anderen, und die Tür war nur eine Tür und die Steine Stein, während der Schmied selbst nur ein blasser und richtiger Mann war, der, froh und stattlich, vor dem Gasthausflügel saß.
Er blickte auf die, die in die Kirche gingen.
Kam aber der Montag, war die Schmiede wieder voller schwarzer Nacht und rotem Feuer. Und nie hätte der Junge es gewagt, dort hinein zu gehen, wo sie sagten, der Schmied bewege sich wie ein großer schwarzer Schatten zwischen den schwarzen Schatten der Blasebälge.
Nach rechts ging es zur Schule. Sie stützte sich gleichsam so freundlich an die Kirche, lehnte sich an sie und was zu ihr gehörte, an.
Die Treppe zur Schule war mit Sand bestreut. Die Tür zum Haus saß lose in ihren Angeln. Im Gang leuchtete alles. Die Wände, der Boden, die Decke leuchteten. Es gab niemanden, der die Schmierseife unter seinen Händen so zum Leuchten brachte wie Küsters Tine.
Rechter Hand lag die Schule. Sie war voll ewigen Summens. Die Kinder saßen in Reihen über dem ABC und dem Katechismus, Jungen und Mädchen je auf ihrer Seite wie Männer und Frauen in der Kirche. Sie schwitzten, und sie mieften über all dem Wissen. Der alte Küster rauchte Pfeife mit starkem Tabak und schwitzte dabei. Er schwitzte immer, und immer hielt er den Kachelofen am Glühen.
Wenn Mutter in den Küstersgang kam, hob sie die Schultürklinke:
„Guten Abend, Küster “, sagte sie:
„Sie haben es warm.“
„Guten Tag, guten Tag“, antwortete der Küster.